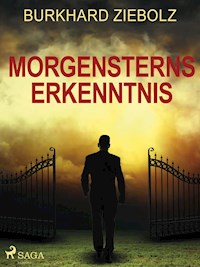Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein fesselnder Krimi, der Vergangenheit und Gegenwart zusammen bringt!Liam Coubert hat sich ein stilles Leben in Mannheim aufgebaut und Zuflucht gefunden, seitdem er 15 Jahre zuvor den Spuren einer Serie grausamer Morde an Frauen gefolgt war und dabei dem Mörder so nah kam, dass er selbst verdächtig wurde. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als eine neue Mordserie beginnt, die demselben Muster wie damals folgt. Erneut beginnt Liam den Spuren zu folgen, die ihn in die Finsternis eines mittelalterlichen Labyrinths unterhalb des Hambacher Schlosses führen. Langsam begreift er, dass ihn mehr mit dem Mörder verbindet als er dachte.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Ziebolz
Im tiefsten Dunkel - Kriminalroman
Saga
Im tiefsten Dunkel – KriminalromanCopyright © 2000, 2019 Burkhard Ziebolz und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726086799
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmontwww.saga-books.comund Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Prolog
Die Wasseroberfläche lag vor ihm wie ein riesiger, schwarzer Spiegel. Von der Tür aus sah Coubert jedes Detail des Bassins. Der Mond schien hell in dieser Nacht, fast so hell wie die Sonne tagsüber.
Keine Zeit für Schlaf, schon gar nicht, wenn ihn so viele Gedanken quälten. Sie begannen als sanftes Säuseln, bissen sich fest, zerrten an losen Stellen, und am Ende fegten sie wie ein Sturm durch jeden Winkel des Gehirns und ließen nichts zurück als Zweifel und Verwirrung.
Durch die Fenster des Wasserturms drängte das kühle Licht herein. Später würde der Mond sich in der Schwärze des Wassers spiegeln. Es war eines der Geheimnisse dieses verwunschenen Orts, dass nichts von dem, was unter der Wasseroberfläche war, sich jemals zu erkennen gab. Sogar an hellen Sommertagen, wenn das Licht spärlich durch die kleinen Fenster sickerte, reflektierte das Wasser lediglich seine Umgebung und enthüllte nichts von dem, was es bedeckte. Wenn es denn überhaupt etwas gab dort unten. Ein Physiker hätte sicherlich eine Erklärung dafür gefunden, aber Coubert, der nicht immer Coubert gewesen war, suchte nicht danach. Er nahm es hin und genoss die Magie, so wie er viele andere Dinge zu genießen gelernt hatte.
Wie oft hatte er nachts hier schon rauchend gestanden und in das Wasser geblickt, das in träger Dunkelheit einen langen Schlaf zu schlafen schien? Fast immer hatte er fast ängstlich auf etwas gewartet, war sich fast sicher gewesen, dass es kommen würde, die Ruhe zu stören. Vielleicht würde sich der klare Spiegel eintrüben, Schlieren werfen und Nebel aufsteigen lassen, aus denen sich dann Bilder von fremden Orten herausschälen. Bilder aus der Vergangenheit. Oder Bilder aus der Zukunft.
Oder das Silber des Wassers würde sich erheben in Säulen, die sich langsam zu menschlichen Körpern formten, rein silbern zwar, aber sonst in jeder Einzelheit wie die Bilder, die er tief in seinem Inneren vergraben hatte und die nun schon so lange tot waren.
Wesen der Vergangenheit. Darauf wartete er, wartete furchtsam, denn die Bilder konnten nichts Gutes bringen, sondern nur altvertraut Schlechtes. Sie konnten ihm nur das bringen, was er sowieso schon sah, jede Nacht, in seinen Träumen, wenn er sich in seinem Bett hin und her warf.
Aber niemals geschah etwas, immer nur war Frieden und Stille. Er stand und rauchte und sah auf die kleine Wasseroberfläche, und wenn ihm dann kalt wurde, zog er den Kragen enger und ging hinunter in sein Zimmer, zu der wenigen Habe, die ihm etwas bedeutete.
Manchmal aber, wenn er sich ganz schwach fühlte und seinen Gespenstern nicht zu trotzen vermochte, fuhr er mit dem winzigen Boot hinaus, von dem aus die Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Mauer gemacht wurden. Es war gerade groß genug für einen Mann. Er setzte sich, machte einen Schlag mit dem Paddel und befand sich sofort mitten auf dem kleinen See. Und seltsam, er war nur wenige Meter von der Treppe entfernt, hinter der seine Gegenwart lag, aber es schienen ihm viele Kilometer, und es schienen ihm viele Jahre, und er wurde ruhig.
Er beugte sich dann vornüber, barg den Kopf mit den widerspenstigen, schwarzen Haaren in den Händen und konnte endlich einmal ohne Schuldgefühl und Scham an das denken, was hinter ihm lag. Er konnte an sie denken, an ihre Jugend und Lebensfreude. Sie hatten wirklich gelebt, im tiefsten Sinne des Wortes, bis ein grausamer Tod sie ereilte. Sie hatten in die Zukunft geschaut, sie hatten Pläne gehabt und eine Zukunft – und sie hatten sicher mit allem gerechnet.
Nur nicht mit einem so bestialischen und unwürdigen Ende.
1. Kapitel
Die Tage vergehen in Gleichförmigkeit und Ruhe, und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, hier oben so isoliert zu sein, wie man es inmitten einer Großstadt sonst nirgends sein kann, umgeben von meinen Büchern und den wenigen Dingen, die mir sonst noch gehören. Du weißt, dass ich Besitz immer als lästigen Ballast empfunden habe, aber einige wenige Dinge, so habe ich festgestellt, brauche ich doch.
Morgen besuche ich eine Auktion in einer kleinen Nachbarstadt.
Eine Reihe interessanter Folianten kommt zur Versteigerung, schon der Katalog liest sich rasend spannend wie ein guter Kriminalroman. Das Auktionshaus ist nicht unbedingt spezialisiert auf Bücher, sie haben alles und nichts, das eröffnet vielleicht die Chance auf einen wirklich guten Fang. Am liebsten sind mir immer die Posten des Katalogs, die nicht genau beschrieben sind. Konvolut von Büchern des neunzehnten Jahrhunderts, aus dem Nachlass einer jungen Dame – das birgt so viele Möglichkeiten, so viele Unwägbarkeiten, so viel Romantik. Warum hatte eine junge Dame so alte Bücher, warum verstarb sie jung? Dinge, die Stoff zum Nachdenken geben. Ein kleines Abenteuer, winzig im Vergleich zu dem, was mich früher umtrieb, aber es bringt ein wenig angenehme, kontrollierte Unruhe in mein Leben.
Ansonsten: alles beim Alten. Meine Aufgaben hier sind wenig anspruchsvoll und lassen mir Zeit für das, was wichtig ist. Ich treibe so viel Sport, wie ich kann. Ich fahre mit dem Fahrrad herum und schaue mir alles an. Ich lese viel, völlig verschiedene Dinge, Religionsgeschichte, Belletristik, Reisebeschreibungen, Philosophie. Nichts, das sich einen besonderen Platz in meiner Aufmerksamkeitsskala erwirbt. Es ist, als suche ich nach irgendetwas, nach etwas, das es wert ist, länger und intensiver beleuchtet zu werden.
Vorhin hatte ich einen meiner Anfälle von Kopfschmerz. Die Medikamente wirken sehr ordentlich, meist bin ich vollkommen schmerzfrei und klar. Nur ab und an ist es wie früher, wenn die Wirklichkeit versinkt in einer Abenddämmerung. Aber es ist nie für lange, schon nach ein paar Minuten bin ich wieder im Diesseits. Der Arzt sagte, dass es anfangs so sein würde. Die neuen Tabletten unterscheiden sich etwas von den alten.
Vor vierzehn Tagen war ich bei einer Auktion. Eine große Auktion mit vielen Posten, aller Art und Herkunft. Es gab Bilder in Öl und Tempera und Federzeichnungen. Es gab Möbel, es gab Schmuck in Hülle und Fülle, Plastiken, sogar ein paar alte Autos, die aussahen wie fabrikneu. Und es gab eine ganze Anzahl Bücher, Klassiker und solche, die einfach nur schön waren, und viele, die nichts weiter darstellten, aber zumindest eine gewisse Originalität hatten. Und im hintersten Winkel des Saales – ein grauer Karton.
Einer der Posten war ein Pappkarton voller Bücher ohne nähere Beschreibung. Die meisten Bücher waren in schlechtem Zustand – so schlecht, dass ihr Äußeres sicherlich ausreichte, bei den bibliophilen Besuchern der Auktion echten Ekel auszulösen. Keiner von denen ließ sich dazu herab, die Kiste auch nur anzufassen. Meist glitt ihr Blick darüber hinweg, als wäre sie nicht da.
Aber ich untersuchte sie gründlich.
Der Zustand war wirklich eine Schande, eine Wüste von schmutzig-brauner Grundfarbe. Einbände hingen nur noch an wenigen Fäden oder waren völlig verschwunden. Seiten fehlten, waren vergilbt, geknickt, zerrissen, angesengt. Es schien nichts als Ramsch zu sein, Überbleibsel alter Auktionen der letzten zwanzig Jahre, der Bodensatz edler Bibliotheken, Dinge, zu schäbig für die Regale der Sammler.
Auf den zweiten Blick jedoch ... Ich schlug die Bücher auf, eins nach dem anderen. Ich fand Geschichte und Geschichten, ein paar Reiseberichte aus dem neunzehnten Jahrhundert, einige technische Werke aus derselben Zeit, Spiegel einer Epoche, die für mich schonimmer zu den spannendsten gezählt hatte. Alles in allem schien mir der Karton ein Engagement wert. Ich ersteigerte ihn für ein Butterbrot, brachte ihn nach Hause. Es waren nicht allein die Inhalte der Bücher, die mich dazu bewogen. Da war noch das Gefühl, dass, wenn ich nicht kaufte, das Ganze möglicherweise in den Papiermüll wandern würde. Ich wollte retten, was anderen nichts wert war, weil sie sich nicht die Zeit nahmen, hinter die Fassade zu schauen.
Es war der späte Abend des gleichen Tages. Ein Klingeln an der Tür zum Turm – nur wenige kennen die verborgene Klingel, sonst würde sie von nächtlichen Herumtreibern sicher andauernd gedrückt werden und mich in meiner Abgeschiedenheit stören.
Hier war jemand, der sie kannte.
Ich ging hinab, öffnete die obere Tür. Vor mir lagen die Treppenstufen, die hinunter zum Brunnen führten. Es war dunkel um das Becken herum, aber die Fontäne schoss hell wie ein Feuerstrahl viele Meter in die Höhe. Später würde sie in verschiedenen Farben angestrahlt werden, eine bonbonhafter als die andere. Ich fand das immer fürchterlich, aber es gefällt den Leuten, und auch an diesem Abend gab es eine große Menge an Zuschauern, die die Grünanlage bevölkerten, auf das Schauspiel warteten oder anderen Zuschauern beim Zuschauen zuschauten.
Im Licht der Parklaternen lag ein Päckchen vor der Tür, in braunes Papier gehüllt. Kein Bote, niemand in der Nähe, der den Anschein erweckte, ein Interesse an dem Päckchen zu haben. Ich hob es auf, zerriss die Verpackung. Ein Buch fiel mir entgegen, scheinbar so alt wie die, die ich vorher gekauft hatte. Und ein Zettel mit einer Handschrift, die gleichzeitig zerfahren und doch energisch wirkte.
Dies gehörte noch in Ihre Kiste. Bitte entschuldigen Sie die späte Lieferung. Mit freundlichem Gruß, Stefan Kringel.
Ich wog das geöffnete Päckchen nachdenklich in der Hand. Kringel war der Auktionator des Abends gewesen, ich erinnerte mich an sein Namensschild auf dem Stehpult. Dass er sich wegendieses Päckchens extra zu mir herbemühte, war seltsam. Und noch seltsamer war, dass er es mir nicht persönlich übergeben hatte.
Dem Aussehen nach passte das Buch tatsächlich zu den anderen. Immer noch in der Tür stehend versuchte ich, das Buch zu öffnen – ohne Erfolg. Die Seiten waren miteinander zu einem festen Block verklebt.
Sie schützen den Inhalt, wie eine Auster die Perle beschützt, schoss es mir durch den Kopf.
Ich trat zurück ins Dunkel des Treppenhauses und schloss die Tür. Ich zog mich zurück, um nachzudenken. Ich würde einen Weg finden, das Buch zu öffnen.
Der Atem kam immer noch leicht, die Schritte ergaben sich wie von selbst. Zehn Kilometer in den Beinen und immer noch keine Anzeichen von Anstrengung. Bernie Trautmann spürte Zufriedenheit.
Sein Weg führte ihn durch den dunkelsten Teil des Waldparks. Er lief fast ausschließlich nachts, seitdem er begonnen hatte, regelmäßig Sport zu treiben. Am Anfang war es reine Scham gewesen, die ihn dazu brachte. Einhundertzehn Kilo bei einer Körpergröße von einem Meter fünfundsechzig führte man nicht unbedingt bei Tageslicht spazieren, wenn jeder es sehen und darüber grinsen konnte. Kein Trainingsanzug war geeignet, hier etwas abzumildern.
Trautmann atmete konzentriert. Ein, aus, ein, aus. Alle drei Schritte einmal. Sein Weg, bis dahin asphaltiert, zweigte ab. Die neue Strecke führte über Waldboden, festgetreten von Hunderten Läufern und Spaziergängern. Trotzdem hatte er das Gefühl, als federe der Boden, als käme er seinen Bewegungen entgegen.
Die hundert Kilo waren schon lange Vergangenheit, aber es gab noch einen Grund für seine nächtliche Sportaktivität:
Sein Beruf ließ ihm tagsüber wenig Zeit. Er war Verkaufskraft im Einzelhandel, Herrenkonfektion – probieren Sie doch mal diesen Anzug, die Farbe ist derzeit sehr angesagt – seine Arbeitszeit war geregelt durch die Öffnungszeiten der Geschäfte: Zehn Uhr morgens bis acht Uhr abends. Bis er zu Hause war, war es – zumindest im Winter – schon lange dunkel. Morgens konnte er nicht laufen, das ließ sein Biorhythmus nicht zu, blieben also nur der Abend und die Nacht. Im Sommer war das wegen des schwül-warmen Klimas in der Stadt sowieso die beste Lösung.
Ein, aus, ein, aus. Trautmann spürte ein leichtes Ziehen im Knie. Hoffentlich blieb es dabei, ein größerer Schaden hätte ihm jetzt gerade noch gefehlt. Jeder wusste, wie schnell das gehen konnte, insbesondere Leute, die so viel Sport trieben, waren sehr gefährdet.
Die Wiese zu seiner Rechten hatte die Größe eines Fußballplatzes. Leichter Dunst waberte über ihr, im Licht des aufgehenden Mondes deutlich zu sehen. Überhaupt, der Mond. Er zeigte ihm immer mehr Details seiner Umwelt, je höher er stieg, trotz der Wolkendecke, die nur teilweise unterbrochen war. Schon konnte er einzelne Äste des Unterholzes identifizieren. In einigen Tagen war Vollmond, die Bäume würden Schatten werfen, so hell war es dann.
Das Ziehen im Knie wurde stärker. Ein, aus, ein, aus. Wie immer, wenn irgendetwas im System nicht stimmte, erhöhte sich automatisch seine Atemfrequenz, ohne dass er schneller gelaufen wäre. Vielleicht war es ja doch der Meniskus, oder es waren die Bänder. In letzter Zeit traten solche und ähnliche Beschwerden immer öfter auf. Die Schweißperlen auf seiner Stirn wurden dicker. Das Laufen war ihm Lebensinhalt geworden, seitdem er innerhalb von zwei Jahren fast dreißig Kilo abgenommen hatte. Nicht auszudenken, wenn er darauf würde verzichten müssen. Der Sport gab ihm alles, was ihm das Leben sonst verwehrte: Bestätigung fand er nur hier, und er konnte sie haben, wann immer er wollte.
Ein, aus, ein, aus. Der Weg wurde wieder dunkler, der Mond schien nur noch schemenhaft durch das dichte Blätterdach über ihm. Ein heller Fleck etwa zweihundert Meter schräg vor ihm im Wald erregte seine Aufmerksamkeit. Er fixierte ihn, konzentrierte sich darauf. Das lenkte ihn von seinem Knieproblem ab. Der Fleck schien abseits des Weges zu sein, zwischen den Bäumen. Er näherte sich mit allmählich schwerer und größer werdenden Schritten. Was war da nur? Der Farbe nach konnte es Papier sein, vielleicht das Stück eines leeren Zementsacks, durch den Wind hierher geweht.
Nur noch hundert Meter Abstand zu dem hellen Fleck, und immer noch hatte er keine Ahnung, was da lag. Über die Anstrengung der Bewegung legten sich andere Gefühle, Neugier zuerst, und dann eine Art unklarer Beklommenheit.
Fünfzig Meter noch. Konturen traten hervor, verdichteten sich. Schemen wurden Gewissheit.
Dann war er heran. Er blickte auf das Bündel zu seinen Füßen. Einen Augenblick war er unfähig, zu verarbeiten, was er da sah. Es war, als sähe er sich selbst und seine Umgebung im Fernsehen. So schützte sich seit jeher der Geist vor Dingen, die ihm Schaden zufügen konnten.
Dann sickerte das Bild glasklar in sein Bewusstsein. Bernie Trautmann machte drei Schritte zur Seite und übergab sich in das dürre Gras, das den Boden zwischen den Bäumen bedeckte.
»Ein Jogger hat sie gefunden.«
Trotz der späten Stunde war es noch warm, schwül und drückend, wie so oft im sommerlichen Rheintal.
Eine Kirchturmuhr schlug leise in der Ferne. Susanne Findeisen lauschte, konnte sich aber nicht richtig konzentrieren. So verpasste sie es, die Anzahl der Glockentöne mitzuzählen bis zum Ende. Sie blickte auf ihre Armbanduhr, ein letztes, teures Geschenk des Mannes, mit dem sie ihr halbes Leben verbracht hatte
Vier Uhr. Dünne Nebelschwaden strichen um die Baumstämme wie formlose Gespenster. Gott allein wusste, warum um diese Zeit Menschen joggen mussten – und dann auch noch hier, im hintersten Winkel des Waldparks. Sicher, der Park war leer wie sonst niemals, man hatte Platz, war unbeobachtet, aber war dies wirklich der Grund? Sie schüttelte in stillem Unverständnis den Kopf, ließ die Zigarettenkippe zu Boden fallen und drückte sie in den weichen Boden. Im gleichen Augenblick aber bückte sie sich wie ein Roboter, nahm die Kippe auf und steckte sie in die Außentasche der leichten, hellen Funktionsjacke. Die Routine jahrlanger Polizeiarbeit – keine zusätzlichen Spuren am Tatort produzieren, die man später wieder mühsam aus dem Beweispuzzle herausrechnen müsste.
Sie selbst hätte nach so einem Dauerlauf, der den gesamten Organismus und alle Drüsenfunktionen in Alarmzustand versetzte, nicht einschlafen können, das war mal klar.
»Laufen Sie auch, Wertheim?«
Ihr Assistent war noch nicht lange beim Morddezernat, und besonders viel passierte glücklicherweise nicht in der Stadt. Wertheims erste Leiche lag eine Woche zurück und hatte sich schnell als kriminalistische Niete entpuppt. Sie war dann doch auf die fatale Ähnlichkeit zweier Flaschen mit extrem unterschiedlichen Inhalten zurückzuführen gewesen. Die meisten Unfälle passierten immer noch im Haushalt.
Dies hier war der erste Einsatz, bei dem der junge Beamte bekommen sollte, was seine Stellenbeschreibung hergab und er sich eigentlich immer als Tagesgeschäft vorgestellte hatte.
Susanne Findeisen zog die Schultern hoch. Sie war Anfang vierzig, blonde, kurz geschnittene Haare, gefärbt, eine energische Nase, etwas zu groß für das schmale, leicht blasse Gesicht, fast einsachtzig groß und schlank – man konnte sie durchaus als attraktiv bezeichnen. Aber viel mehr als diese Äußerlichkeiten schätzten Wertheim und die anderen Kollegen der Dienststelle ihren Intellekt. Immer auf der Höhe eines Gesprächs, immer genau im Bilde, und wenn sie fragte, dann pfeilgenau ins Ziel. Ihr Verstand war schnell wie ein Florett. Manchmal, wenn sie in ihrer knappen, sachlichen Art einen Kommentar abgab, hatte der Zuhörer so ein Gefühl, als funkelte ihr Verstand zwischen den Worten wie ein Brillant zwischen Rheinkieseln.
Aber nicht jetzt, zu dieser nächtlichen Stunde.
»Wenn ich Zeit habe. Manchmal auch abends, aber niemals so spät. Ich kann nicht schlafen, wenn ich zu spät laufe.«
Sie gestattet sich ein leises Lächeln. »Wo ist der Zeuge?«
»Ich hab ihn nach Hause geschickt. Seine Aussage und die Adresse haben wir ja, und ich fand, er sollte duschen gehen.«
Hauptkommissarin Susanne Findeisen wandte sich um. Der Wald war taghell erleuchtet. Zwei großvolumige Strahler überschütteten Bäume und Sträucher verschwenderisch mit gleißendem Licht, ließen die Details plastisch hervortreten, soweit sie nicht von der Nebeldecke verhüllt waren. Zwei der Dienstfahrzeuge hatten es bis nahe an den Tatort geschafft und die ganze Ausrüstung abgeladen.
Einen Augenblick beobachtete sie die kleine Gruppe Männer und Frauen, die sich vorsichtig suchend zwischen den Bäumen bewegte. Die meisten lagen auf den Knien, suchten jeden Quadratzentimeter nach Spuren ab. Alle bewegten sich mehr oder weniger auf Kreisbahnen um das herum, was der Grund ihrer Anwesenheit war, wie Satelliten um einen Planeten.
Eine Zeremonie. Der Tanz um das Idol.
Eine Gruppe von vier Beamten in Uniform stand ein wenig abseits, die Männer unterhielten sich gedämpft und zigarettenrauchend. Einer der Uniformierten hatte die Leiche mit einer grauen Plane bedeckt, nachdem der Fotograf seine Arbeit getan hatte. Er und die anderen Beamten hier am Tatort hatten schon viel erlebt in ihrer Dienstzeit – ausgenommen Wertheim, dem noch der Flaum der Polizeischule hinter den Ohren klebte. So etwas wie dies hier war allerdings für alle neu.
Die Spurensicherung arbeitete schnell und ruhig, eine gut geölte Mechanik, viele Teile mit einem Ziel. Wenn gesprochen wurde, dann nur das Nötigste, sehr leise. Der Nebel schien die Geräusche noch zusätzlich zu dämpfen.
Findeisen blickte nach oben. Der Mond schien in den dicker werdenden Wolken zu ertrinken. Der Wetterbericht hatte für irgendwann am frühen Morgen Regen vorhergesagt; was bis dahin an Spuren nicht gesichert war, würde nur noch von geringem Wert sein.
Äste knackten im Dickicht. Müde wandte sich die leitende Ermittlerin in die Richtung, aus der ein dicker Mann mit rotem Gesicht schwerfällig wie ein Nashorn auf sie zustampfte. Er trug einen grauen, ehemals maßgefertigten Anzug, Relikt aus guten Tagen, der im Laufe der Jahre jede Eleganz eingebüßt hatte, und ein Hemd, das dringend gewaschen werden musste. An den Schuhen klebten loser Waldboden und kleine Blätter.
Sie seufzte. »Berliner. Sie wissen doch, das es verboten ist, den Polizeifunk abzuhören.«
Der Dicke kam schnaufend vor ihr zum Stehen. Er zog ein Taschentuch aus seiner Innentasche und wischte sich damit über den schwitzenden Schädel. Die wenigen, sorgfältig gescheitelten Haare büßten dabei ihre Ordnung völlig ein.
»Bis hierher, aber nicht weiter. Sie wissen ja – der Tatort ist tabu für die Presse.«
Die Hauptkommissarin war froh, dass die Plane über dem toten Mädchen lag.
Leo Berliner blickte sie treuherzig an. Dieser Hundeblick und ein gerütteltes Maß an Furcht- und Respektlosigkeit hatten ihn in seiner Jugend in den Sechzigern zu einem der vielversprechendsten Kriminalreporter der Republik gemacht, wußte die Hauptkommissarin von den älteren Kollegen. Er war bekannt gewesen bei allen großen Tageszeitungen, ein Star mit legendärer Spürnase. Nun aber stand er kurz vor der Rente. Er war ausgebrannt, das alte Feuer war verlodert. Es gab andere, jüngere, die ihn rechts und links überholt hatten und immer noch überholten. Er war zu langsam geworden für das schnelle Rennen um die Neuigkeiten.
»Haben Sie denn gar nichts für mich?«
Findeisens Blick war hart. »Seien Sie froh, dass ich Sie wegen des Polizeifunks nicht festnehme. Wir geben morgen eine Presseerklärung heraus, dann können Sie schreiben.«
»Mein Chef bringt mich um. Falls meine Bandscheibe das nicht schon vorher tut. Haben Sie eine Ahnung, was es mich an Schmerzen und Kraft gekostet hat, um diese Zeit aus dem Bett zu kommen? Nicht einmal für einen Kaffee war Zeit. Bitte, bitte, liebe Frau Hauptkommissarin, ich bitte sie ...«
Er schickte sich an, umständlich vor ihr niederzuknien, und zum zweiten Mal in dieser Nacht huschte ihr ein Lächeln über das kluge Gesicht. Sie hob abwehrend die Hand. »Sie werden sich schmutzig machen. Also schön. Wir haben ein junges Mädchen. Ein Jogger hat sie gefunden. Sie wurde ermordet.«
»Und weiter?«
»Überspannen Sie den Bogen nicht.«
Er blickte immer noch erwartungsvoll. »Verstehen Sie doch. Damit wird man nicht zufrieden sein. Man erwartet mehr von mir ...«
Man erwartet nichts von dir, dachte sie. Lehmann, die neue Kraft beim Mannheimer Morgen, war der Kriminalreporter der Zukunft und machte außerdem noch hervorragende Sportberichte. Eine Doppelbegabung war in den Zeiten knapper Budgets und spärlich besetzter Redaktionen fast schon Voraussetzung für eine einigermaßen ordentliche Laufbahn. Berliner war eigentlich schon draußen, wurde nur mehr geduldet. Ein Fossil war er geworden und hätte doch das Zeug zu einer Legende gehabt.
Die wenigsten Leute wussten, wann es Zeit war aufzuhören, dachte Findeisen mit einem Anflug von Wehmut. Ein paar hatten es geschafft: Der Mittelgewichtler Ottke zum Beispiel, Steffi Graf und James Dean, Letzterer allerdings eher unfreiwillig. Die Wenigsten fanden den richtigen Moment für einen Abgang in Würde. Ein Abgang in Würde. Das war ein Ziel, auf das es sich lohnte, hinzuarbeiten. Bis dahin allerdings gab es noch einiges zu tun.
Die Zahl der Nebelschwaden nahm zu. Vielleicht würde es doch keinen Regen geben. Wo es nebelte, fiel kein Regen.
»Mehr wissen wir noch nicht. Keine Zeugen, keine Identität, keine Hinweise auf den Täter. Die Frau ist verblutet, die genaue Ursache dafür muss die Obduktion ergeben. Sehen Sie, jetzt wissen Sie schon alles, was ich selber weiß und Ihre Kollegen erst heute Nachmittag erfahren werden. Und nun gehen Sie nach Hause und schonen Ihren Rücken.«
Sie sah ihm hinterher, wie er langsam und schnaufend seinen Weg zurückging. Bevor er außer Sichtweite geriet, wandte er sich noch einmal um und winkte ihr zu. Sie reagierte nicht.
Hinter ihr räusperte sich Wertheim. »Wir wären soweit.«
Sie nickte. Die Spurensicherer packten ihre Sachen, gingen im Gänsemarsch den Weg zurück zu den Fahrzeugen; der Vorderste leuchtete mit einer hellen Lampe. Einer der Uniformierten aus der Rauchergruppe sprach in ein Handy. Ein paar Minuten später erschienen zwei dunkel gekleidete Männer auf dem gleichen Weg, auf dem Berliner und die Spurensicherer entschwunden waren. Sie näherten sich der Toten in professionellem Respekt, nahmen sie vorsichtig auf und legten sie in eine Art Plastiksack mit Tragegriffen an den Enden.
Das Letzte, was Susanne Findeisen von der Leiche sah, war ein schwarzer, feuchter Haarschopf, unordentlich über einer schneeweißen, in unmenschlicher Qual verzerrten Stirn.
Dann schloss sich der Reißverschluss wie der Vorhang am Ende eines Theaterstücks.
2. Kapitel
Liam Coubert hatte sich schon immer für Bücher interessiert. Früher waren sie Abenteuer für ihn gewesen, jedes Buch eine neue Welt, eine andere Zeit. Er besuchte Schatzinseln, kämpfte gegen Indianer und erkundete den Orient, oder er flog mit Raumschiffen ins All und zu den Planeten. Später wurden sie ihm Freunde, einige begleiteten ihn über viele Jahre. In trüben Zeiten wurden sie ihm Trost, gestatteten ihm immer wieder kleine Fluchten, an den Tagen, an denen sich das Leben von seiner schwarzen Seite zeigte.
Und es hatte viele dieser Tage gegeben.
Mit der Zeit war so eine kleine Sammlung zusammengekommen. Er war kein typischer Leser, und er war kein typischer Sammler von Büchern. Er bevorzugte kein Genre, es waren auch nicht unbedingt die Erstausgaben oder die alten, in Leder gebundenen Folianten oder die bibliophilen Sonderausgaben, die ihn interessierten. Für Coubert war an einem Buch lediglich wichtig, dass es ihn irgendwie ansprach. Die ausschlaggebenden Reize konnten dabei vollkommen unterschiedlich sein. Er nahm ein Druckwerk in die Hand und wusste, mit diesem würde er eine Beziehung eingehen können für-eine gewisse Zeit oder für immer. Manchmal, wenn ein Klappentext vorhanden war, fand er den nötigen Anreiz dort, aber manchmal war es auch nur ein Element der Aufmachung, des Einbandes, oder es war der Umstand, dass es zu einer Zeit oder an einem Ort geschrieben worden war, die ihm interessant erschienen. Manchmal war es eine altertümliche Type, die sich beim Druck tief in das Papier gekerbt hatte und fast mit den Fingerkuppen zu lesen war. Bisweilen fand er eine merkwürdige, Fragen aufwerfenden Widmung – und schon war es um ihn geschehen. Niemals suchte er nach diesen Dingen, vielmehr hatte er das Gefühl, sie fanden ihn, wenn er in Antiquariaten, auf Flohmärkten oder Auktionen herumging und in dem wühlte, was andere meistens keines Blickes würdigten.
Da stand er nun, mit dem alten Buch in der Hand, dessen Inhalt in einem massiv verklebten Block alten Papiers verborgen war. Er wog es in der Hand. Coubert schätzte das Gewicht auf fast ein Kilo, was schwer war für ein Buch dieser Größe. Der Einband war aus stabilem Pappendeckel von fleckigem Hellbraun und zeigte keinerlei Schrift, keinerlei Hinweis auf Inhalt oder Verfasser. Nur eines war vorhanden und hob dieses Buch für Coubert von allen anderen ab. Auf dem, was er für die Rückseite des Bandes hielt, gab es einen Fingerabdruck, und wenn ihn nicht alle seine Erfahrungen täuschten, war es ein blutiger Finger gewesen, der diesen Abdruck verursacht hatte.
Langsam ging er die lange Treppe hinauf in die Wohnung, in Gedanken verschiedene Möglichkeiten durchspielend, die Seiten voneinander zu lösen. Coubert entschied sich dann für Wasserdampf. Die kleine Küche verfügte über einen Elektroherd. Schnell setzt er Wasser auf und stellt die Platte auf die höchstmögliche Stufe. Nach einiger Zeit bildeten sich am Grund des Topfes kleine Bläschen, die sich ablösten und nach oben stiegen. Es wurden mehr und mehr, und sie wurden größer und größer, und nach einer Viertelstunde stieg Dampf aus dem brodelnden Wasser. Er hielt das Buch hinein, sah zu, wie sich das Papier allmählich dunkler verfärbte. Mehr sah er aber nicht. Die Seiten blieben verklebt.
Er versuchte es noch eine Weile, dann gab er enttäuscht auf. Mittlerweile war es sehr spät geworden, und er beschloss, zu Bett zu gehen. Ein neuer Tag würde ihm vielleicht andere Ideen geben. Oder er konnte jemanden anrufen, der sich besser mit solchen Dingen auskannte.
Gegen Morgen erwachte er aus einem von Träumen zerrissenen, leichten Schlaf. Wie fast jede Nacht hatten ihn die Gespenster der Vergangenheit aufgesucht, seine Seele gegeißelt. Es war lange her, dass er eine Nacht wirklich gut geschlafen hatte. Manchmal, wenn er im Sommer in dem kleinen Park vor dem Turm in der Sonne saß, wurde das Verlangen nach einer Zeit völliger Entspannung fast übermächtig, das Sehnen nach tiefem, traumlosem Schlaf. Auch für sein Leiden wäre das von Vorteil gewesen. Keines der Schlafmittel, die er ausprobiert hatte, hatte ihm helfen können. Psychologische Hilfe konnte er nicht aufsuchen, ohne sich und seine Vergangenheit zu offenbaren – und dies wollte er auf keinen Fall.
Coubert stand auf, ging in die Küchenecke und drückte den Netzschalter der Espressomaschine. Lautlos begann sie ihr Leben, ein Kontrolllicht leuchtete auf, nach einer Minute ein zweites. Er drückte den Knopf an der Maschine, und lärmend startete der Automat den Spülvorgang. Sein Blick schweifte durch die Küche, die vom sanften Licht der Morgensonne erhellt war. Sie war schlicht und funktionell eingerichtet, der Kaffeeautomat war der einzige Luxus, den er sich hier gegönnt hatte.
Coubert blickte aus dem Fenster.
Die Stadt zu seinen Füßen erwachte gerade zum Leben, mit zögerlichen Bewegungen erprobte sie ihre Kraft. Die Morgenstunden von sechs bis acht Uhr waren ihm am liebsten. Im Sommer war es noch nicht zu heiß, und es war noch keinerlei Hektik zu spüren.
Er ließ Kaffee in einen einfachen Becher aus weißer Keramik laufen, gab Milch aus dem Kühlschrank hinzu. Dann fiel sein Blick auf das Buch, das er nach den vergeblichen Versuchen mit dem Wasserdampf neben dem Herd hatte liegen lassen. Irgendetwas daran war verändert. Er trat näher.
Der Papierblock war lockerer geworden. Als er ihn in die Hand nahm, sah er, dass sich die Seiten leicht voneinander trennen ließen.
Das Buch gab sein Innerstes frei.
Vorsichtig löste Coubert die erste Seite, sorgsam darauf achtend, dass keine Partikel der darunter liegenden Seite kleben blieben. Es gelang sehr gut. Das Buch erwachte unter seinen Händen zum Leben.
Was dort gedruckt stand, war alt klingendes Französisch, aber er hatte keine Schwierigkeiten damit. Die Zeit in der Legion hatte ihn vieles gelehrt, und einiges davon verursachte keinen Ekel in ihm.
Er las es, einmal, zweimal, und dann noch mal, um völlig sicher zu sein.
Ein Kürzel, das er zwar nicht kannte, dessen Sinn sich ihm aber im Zusammenhang erschloss. Namen, die ihm bekannt waren, aus dem berühmtesten Werk von Alexandre Dumas: Der Graf von Monte Christo. Die Hauptfigur, Edmond Dantes. Dann ein Hinweis auf die Nebenhandlung, Dantes’ Zeit vor der Rache, auf die er so lange zuarbeitete. Ein Stück Historie, die Ereignisse im Janina zur Zeit der Türkenherrschaft, Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Noch ein Hinweis auf Geschichte, auf das Schicksal des Herrschers von Janina, Ali Pascha und seiner Familie. Dann wechselte der Ort, von den Resten eines riesigen Schatzes war die Rede, der irgendwo hingebracht worden war, in deutsche Lande, an einen Ort in dem Mittelgebirge, das als Pfalz bekannt war und nicht weit von Mannheim entfernt lag.
Coubert ließ das Buch sinken. Entweder hatte jemand vor sehr langer Zeit seiner Fantasie freien Lauf gelassen, oder er hatte hier etwas sehr Interessantes gefunden.
Immer weiter öffnete sich der Band, immer mehr Seiten wurden in Freiheit entlassen. Schließlich waren alle sauber voneinander getrennt. Er war am Ende angekommen. Als sich die letzte Seite umblättern ließ, sah er es: eine kleinformatige Fotografie. Offenbar war sie erst vor Kurzem hineingebracht worden. Zumindest sahen die Tesafilmstreifen neu aus, die sie in ihrer Position in der Mitte des Buchdeckels hielten. Der hintere Einband hatte sich deutlich leichter vom Rest gelöst als die anderen Blätter, auch das ein Hinweis darauf, dass an dem Buch manipuliert worden war. Er sah sich das Foto an, führte es nahe an sein Gesicht. Das Bild einer Frau und eines Mannes.
Kalter Schweiß brach Liam Coubert aus. Das Bild flackerte vor seinen Augen, und ihm war, als würde der Boden unter ihm Wellen schlagen und ihn abwerfen wie ein störrischer Gaul.
Vor vielen Jahren, Anfang der Neunziger, war ich für drei Wochen auf Urlaub in einem gottverlassenen Nest im Piemont. Vallumida ist ein kleines Weindorf ohne größere Bedeutung in der Szene der Vinophilen, und heute würde ich sicher den Weg dorthin nicht mehr finden. Damals wollte ich ausspannen, mich von ein paar herben Schlägen erholen, die mit einem Mädchen zu tun hatten, mit einem großen Versprechen, mit Plänen und mit vernichteten Hoffnungen.
Drei Wochen. Das Hotel war gut und ziemlich klein, es gab nur wenige andere Gäste dort, darunter ein deutsches Paar. Wir kannten uns vom Sehen, morgens beim Frühstück, manchmal abends im Restaurant. Keiner hatte Interesse am anderen, wir wollten nur unsere Ruhe. Ein wirklicher Kontakt kam nicht zustande. Dennoch begegneten wir uns zwangsläufig immer wieder.
Die beiden waren nur zum Frühstück im Hotel, danach verschwanden sie gleich mit dem Auto, waren den ganzen Tag unterwegs und kamen erst spät wieder. Viele von denen, die das Piemont bereisen, tun das. Sie sind auf den Weingütern unterwegs und verkosten die letzten Jahrgänge. Diese beiden allerdings waren anders. Sie hatten bei ihrer Rückkehr immer etwas Gehetztes im Blick, in den Bewegungen, sogar in der Sprache. Es war, als hätten sie sich bei einer sportlichen Aktivität verausgabt, und nun lief ihr Kreislauf immer noch auf Hochtouren und ließ sie nicht zur Ruhe kommen.
Bei ihr, einer schlanken Frau Mitte dreißig, mit langem, schwarzem Haar, wirkte das ganz seltsam auf mich. Immer dieses Wegschauen und dem anderen nicht in die Augen sehen können, ruckartige, unsichere Bewegungen, aufgeregtes, leises Reden – irgendwie machte mich das auch an. Sie war hübsch auf eine leicht kränkliche Weise, blass, mit schmalem Gesicht. Die Hüften waren breit und passten nicht recht zum Rest des Körpers. Dennoch, sie hatte eindeutig etwas erotisch Anziehendes. Der Mann war mittelgroß, schlank und wirkte sehr sportlich. Ich hörte, wie die Bedienung die beiden mit Signore und Signora Calvin ansprach. Sie waren aber sicherlich keine Italiener, wenngleich sie ganz gut – besonders die Frau – die Sprache konnten. Waren sie aber allein, sprachen sie deutsch.
Wenn sie überhaupt sprachen.
Zu der Zeit, als wir dort waren, erlebte das Piemont ein paar der übelsten Morde, die es dort jemals gegeben hatte. Morde, wie sie bestialischer nicht hätten sein können. Junge Frauen verschwanden und wurden wiedergefunden, zu Tode gefoltert auf besonders sadistische Art. Ich las es in den Zeitungen, mein Italienisch reichte dafür gerade aus.
Es waren zwei Mädchen, die im Abstand von wenigen Tagen gefunden wurden. Der Mörder hatte die Leichen so platziert – genauer gesagt, sie hatten sich selber platziert, aber er hatte es zugelassen –, dass man sie finden musste. Wahrscheinlich wollte er, dass man sein Werk bewunderte. Zumindest behaupteten die Psychologen das, die in den Artikeln die Taten des wahnsinnigen Mörders kommentierten.
Die Frauen waren jung und schlank, und sie hatten lange, dunkle Haare. Auf den Bildern sahen sie aus wie jüngere Schwestern der Frau, die ich jeden Tag beim Frühstück mit ihrem Partner sah. Die Polizei vermutete, dass es mehrere Täter waren, die die Morde gemeinschaftlich begingen. Sadisten, Perverse, fehlgeleitete Sektierer vielleicht. Wie immer gab es Hinweise aus der Bevölkerung, brandheiße Spuren, über die nichts verraten werden durfte, aber keine konkreteren Informationen. Man wollte den Tätern nicht zeigen, wie weit die Ermittlungen schon gediehen waren.
Dieses Paar in meinem Hotel, es ging mir nicht aus dem Kopf. Irgendetwas stimmte nicht mit den Leuten. Sie redeten kaum, wenn man sie sah, weder mit anderen noch untereinander, außer, wenn sie von ihren Streifzügen zurückkamen. Redeten sie mit Fremden, zum Beispiel mit dem Personal des Hotels, dann waren sie freundlich, auf eine sehr bemühte, fast schon verkrampfte Art. Sie schienen nur darauf zu warten, dass das Gegenüber etwas sagte, dem sie zustimmen konnten.
Zustimmung schafft Akzeptanz.
Zwei junge Frauen im Alter von zwanzig bis dreißig Jahren. Die eine Hausfrau und Mutter zweier Kinder, die andere eine Kosmetik-Verkäuferin. Ihr Leiden hatte lange gedauert, ich konnte mir vorstellen, was in ihnen vorgegangen war, wie sich Panik und Hoffnung abgewechselt hatten und immer wieder von Schmerzen ausgelöscht wurden wie Kreideschrift auf einer Schultafel.
Man macht sich diese Gedanken, wenn man viel Zeit hat.
Als ich den Fall zu verfolgen begann, war gerade die zweite Tote gefunden worden. Die Leiche wurde in einem Waldstück entdeckt, etwa siebzig Kilometer von unserem Hotel entfernt. Keine Stunde Fahrt mit dem Auto. Über die Ähnlichkeit der Ermordeten mit meiner schönen Mitbewohnerin muss sich wohl die Verbindung hergestellt haben, jedenfalls, mir fiel auf, dass an keinem der beiden Mordtage – sollten meine Informationen über den Tathergang aus der Zeitung stimmen – das Paar zum Abendessen im Hotel gewesen war.
Du wirst sagen, dass das nichts zu bedeuten hatte. Ich wäre heute geneigt, dir Recht zu geben. Aber damals – du weißt, wie es ist, wenn man Urlaub hat nach einer langen Zeit der Anspannung. Man fällt in ein Loch, Zeit im Überfluss ist etwas Ungewöhnliches, mit dem man erst wieder umzugehen lernen muss.
Teils war es Langeweile, teils Neugier, teils nur ein Spiel. Ich begann, die beiden systematisch zu beobachten. Beim Abendessen suchte ich mir einen Platz in der Nähe ihres Tisches. Die Hoffnung, sie belauschen zu können, erfüllte sich nicht, denn sie waren meist schweigsam. Sie aßen wenig und sehr schnell, und dann verschwanden sie sofort auf ihr Zimmer. Beim Frühstück war es ähnlich, nur dass sie sich sofort danach in ihren Campingbus setzten und fortfuhren. Meist kamen sie am späten Nachmittag wieder zurück. Nur an den Mordtagen waren sie erst so spät ins Hotel genommen, dass ich es nicht mehr gesehen hatte. In jedem Fall war es erst nach elf Uhr gewesen.
Bis auf das schon Gesagte gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass mit ihnen etwas nicht stimmte. Du wirst sagen, dass dies nicht besonders viel war, aber damals reichte es mir aus. Die Tatsache, dass sie vor und nach dem Essen die Köpfe zu einem kurzen Gebet – jedenfalls hielt ich es dafür – senkten, ließ Rückschlüsse auf Religiosität zu. Zwar stand ich allen Kirchen und ihren Organen immer sehr kritisch gegenüber, ein Verdachtsmoment war dies aber sicher nicht.
Natürlich blieb mein Interesse den beiden nicht verborgen. Mein Eifer muss wie eine Flagge vor mir hergeweht haben. Nach ein paar Tagen gewann ich den Eindruck, dass sie meine Gegenwart als störend empfanden und darauf reagierten. Sie schienen es bewusst so einzurichten, dass wir uns nicht einmal zu den Mahlzeiten sahen, sie änderten ihre Essenszeiten fast jeden Tag, und meist waren sie schon fort, wenn ich zum Frühstück kam. Sie entzogen sich. Und je weniger ich sie sah, umso mehr blühte meine Fantasie.
Die Zeitungen kamen mit immer grausameren Details der Mordfälle. Man beschrieb das Offensichtliche, das Muster der Fälle, die Ähnlichkeit der Opfer untereinander. Aber ich war, so meinte ich, der Einzige, der den Schlüssel zur Lösung in der Hand hielt. Denn ich hatte noch einen Zusammenhang erkannt: In den Zeitungen ging es damals noch um einen anderen Fall. Eine ganz andere Geschichte, weniger spektakulär, aber für mich ganz klar mit den Morden verwandt.
Jemand schlug Engeln und Heiligen die Hände ab.
Ich bin Gabriel. Früher war ich jemand anderes, jemand ohne Bedeutung. Ich lebte ein Leben in Sicherheit, Bescheidenheit und Mittelmaß. Ich träumte von einer Frau, einem Kind, einer Familie. Von einem anderen Job, besser als der alte, von einem Reihenhaus, einem neuen Auto. Ich hatte Freunde, mit denen ich am Wochenende ins Kino ging, wanderte und mich manchmal betrankt. Ich hatte Urlaub, den ich an der See oder in den Bergen verbrachte. Ich hatte ein Sparbuch und ein paar Aktien. Ich hatte Träume, von Karriere und von noch mehr Wohlstand. Ich wusste, ich würde das kriegen, und bis dahin hatte ich alles, was ich immer gewollt hatte.
Nur kein richtiges Leben.
Der Entschluss zu werden, was ich bin und immer war, war nicht mal schwer. Es war wie damals als Kind, wenn ich einen Hang hinunterlief. Der erste Schritt kostet Überwindung, alle anderen gehen wie von selbst.
Es trieb mich vorher schon um, in meinen Träumen, später in meinen wachen Gedanken. Ich wollte Dinge tun, unbeschreibliche Dinge, aber ich konnte es nicht, denn der andere stand mir im Wege. Der andere verhinderte, dass ich der werden konnte, der ich immer schon war, er verhinderte es mit seiner kleinbürgerlichen Moral, mit seiner kindlichen Religion, mit seinem naiven Verständnis von Gut und Böse und von dem, was die Welt zusammenhält.
So trug ich es ein Jahr oder zwei mit mir herum. Ich war eine Raupe, hässlich und unbeholfen.
Was die Welt zusammenhält. Darüber dachte ich nach, wenn ich Zeit hatte, und eines Tages wusste ich es, ich konnte die Kraft identifizieren, die unsere Systeme antreibt, im Osten wie im Westen und wahrscheinlich über die engen Grenzen unseres Planeten hinweg. Es war eine Gewitternacht im Sommer, heiß und drückend wie ein Backofen, als mich Gottes Erkenntnis traf wie ein Pfeil ins Herz – schmerzhaft, aber am Ende stand die Befreiung. Ich trat über in eine Welt der Kühle, der Beherrschung. Ich bewegte mich auf einmal schneller, nahm die Bewegungen anderer um mich herum wie in Zeitlupe wahr. In dieser Nacht wurde ich Gabriel.
War es wirklich mein Wille? Ich denke, er war es nicht allein. Ich glaube, dass es Gottes ausdrücklicher Wunsch war, den er in seiner unendlichen Güte so in meinen Kopf einpflanzte, dass er mir wie mein eigener erschien.
Ich saß aufrecht im Bett, starrte in die Dunkelheit vor dem Schlafzimmerfenster, die unregelmäßig vom Zickzack der Blitze erleuchtet wurde. Ich war schweißnass, und meine Lippen bewegten sich lautlos.
Ich bin Gabriel. Ich bin Gabriel. Ich bin Gabriel. Vollstrecker Gottes. Ich tat, was er mir eingab, ich war SEIN Werkzeug. Und ich wusste, solange er mit mir war, konnte ich alles tun, was ich wollte. Und Gott würde immer mit mir sein.
Was die Welt zusammenhält, das ist die Angst. Ich überwand sie in dieser Nacht, aus der Raupe wurde ein Schmetterling, elegant, kraftvoll, allem überlegen. Ich stand außerhalb aller Systeme, sah mich zum Himmel aufsteigen, hell glühend wie Lava im Licht der aufgehenden Sonne.
Ich war Gabriel.
Neben mir bewegte sich eine Frau in den Kissen. Es war die Frau des anderen, der mir im Weg stand. Ich spürte ihre Wärme, roch sie, hörte ihren Atem, der regelmäßig wie das Ticken einer Uhr die Nacht einteilte. Im Licht des nächsten Blitzes sah ich ihre blonden, feinen Haare, strubbelig zerzaust, die feinporige, rosige Haut, die der andere so gern gestreichelt, die roten, halbgeöffneten Lippen, die er so gern geküsst hatte.
Ich tötete die Frau und das Kind noch vor dem ersten Hahnenschrei. Ich schnitt ihnen die Kehlen durch und sah ihr Leben rot in den Kissen des Nachtlagers versickern. Kurz bevor das Kind starb, öffnete es die Augen, die mich eisblau ansahen. Kein Laut, kein schmerzverzerrtes Gesicht, nur dieser Blick, der erlosch wie eine Kerze im Wind.
Ich spürte nichts, nur ein Brennen im Hals. Ich tauchte meinen Finger in ihr Blut und schrieb damit Gott auf die glatte, in leichtem Erstaunen gerunzelte Stirn.
Gabriel wurde geboren in dieser Nacht aus dem Blut der Frau.
Dann zog ich mich an und verließ das Haus. Ich nahm nur ein paar Kleider mit und etwas Bargeld. Mehr brauchte ich nicht, nur ein bisschen Geld für die ersten Stunden. Ich wusste, dass es mir von nun an an nichts mehr mangeln würde. Der Herr würde für mich sorgen. Ich sollte seine Arbeit tun, also würde er für mich sorgen. Ich war sein Bote, und ich war unbesiegbar.
Ich ging durch die Straßen der Stadt, mit neuen Sinnen. Ich sah und hörte Dinge, die niemand sonst sehen und hören konnte. Die Menschen lagen vor mir wie offene Bücher, in denen ich Zukunft und Vergangenheit las: Du stirbst morgen, du in einem Jahr. Deine Frau ist krank, und deine betrügt dich. Du schlägst dein Kind, du schändest es.
Die ganze Schlechtigkeit der Welt. Sie würde meine neue Aufgabe sein. Ich würde vernichten, was sich SEINER Ordnung entgegenstellte, was sie missbrauchte, was sie auf perverse Art für andere Zwecke nutzte.
Ich lebte eine Weile auf den Straßen, ohne mich zu verbergen. Anfangs studierte ich manchmal eine Zeitung am Kiosk, sah das Gesicht der Frau und mein eigenes, aber das interessierte mich nicht. Ich hatte mich schon sehr verändert, niemand erkannte mich. Bald würde ich gehen, hinaus in die Welt. Und ich würde nicht allein sein.
Ich beobachtete. Und bald sah ich, dass es einen Typus Mensch gab, der Keim war für das Dunkle, der es anzog, der andere damit infizierte. Es war ein besonderer Typus Frau.
Einige Monate später begann ich mein Werk. Die ersten wurden gerichtet, wie es ihnen bestimmt war. Über viele Jahre tat ich, was ich tun musste, und ich glaubte, es sei gut. Ich verfeinerte meine Arbeit immer mehr, ich fand den richtigen Weg.
Dann aber, nach einiger Zeit, keimte etwas in mir, eine Unzufriedenheit. ER nahm das Opfer an in seiner grenzenlosen Güte, aber es blieb eine kleine, eine winzig kleine Unsicherheit. Waren sie wirklich die, die es treffen sollte? Konnte es sein, dass ich mich irrte? Ich haderte mit mir, wälzte mich im Schlaf, stöhnte unter der Last der Verantwortung. Es musste etwas geben, das mir half, das Urteil zu fällen. Ich betete um Erlösung, um ein Zeichen. Und ich wurde erhört, ER schickte mir, was ich brauchte.
Ich fand den Ort. Die Stätte würde mir zukünftig Zuflucht sein in Zeiten der Not, denn niemand kannte sie und niemand konnte sie finden außer mir. Und, was noch viel wichtiger war – sie würde die Stätte des Gerichts werden, die Probe, die über Schuld und Unschuld entschied.
Wertheim beeilte sich. Nach dem ungewohnten Einsatz in der letzten Nacht mit den für ihn noch neuen Ermittlungstätigkeiten hatte er den Morgen verschlafen wie der Bär den Winter. Aus der Theorie wohl wissend, wie wichtig die ersten Stunden nach Entdeckung einer Tat sind, war ihm sein Zuspätkommen nun doppelt peinlich.
Er hastete den Korridor entlang. Sein Büro lag neben dem der Findeisen. Vielleicht hatte sie seine Abwesenheit noch nicht bemerkt. Wertheim konnte sich denken, dass sie am Morgen eine Menge Dinge zu tun gehabt hatte. Einer der wichtigeren Termine war sicher ein Gespräch mit dem Polizeipräsidenten gewesen, in dem sie ihn über den neuen Mordfall unterrichtet hatte.
Doktor Manfred Strasser war seit fünf Jahren Kopf der Mannheimer Polizei. Er hatte nach dem Studium der Kriminologie eine Bilderbuchkarriere hingelegt, was einerseits seinen Fähigkeiten, sich im rechten Augenblick in Szene zu setzen, andererseits einem unglaublichen Glück bei der Aufdeckung von Kapitalverbrechen in seinem Einflussbereich zu verdanken war. Nicht, dass er selber jemals etwas dazu beigetragen hatte – tatsächlich war er völlig unkreativ, ein guter Verwalter ohne die Spürnase, die ein Ermittler braucht. Aber er hatte alle Ergebnisse so effektiv unter die Leute gebracht, dass sie ihm zugeschrieben wurden, ohne dass er selber etwas dazu hätte tun müssen. Mittlerweile hatte er sich sogar auf Bundesebene einen Namen gemacht, der richtige Mann am richtigen Ort, und nicht wenige Leute im Justizministerium trauten ihm durchaus eine Karriere in der Politik zu.
Bei allem Dusel und dem daraus resultierenden Erfolg der letzten Jahre hatte er aber nicht vergessen, wer ihm dies alles beschert hatte. Seine Leute waren ihm wichtig, wobei ihm selber nicht ganz klar war, ob aus reeller Loyalität oder weil sie ein wichtiges Werkzeug zum Erreichen seiner Ziele waren; möglicherweise war beides der Fall. Wie auch immer, das Resultat war, dass er sich vor sie stellte, wann immer es nötig war. Und er tat, was er konnte, um sie mit Schulungen und moderner Ausrüstung noch besser und effektiver zu machen.
Dieselben Leute, die ihn schon in der Landespolitik sahen, betrachteten genau dies als seine größte Schwäche. »Seine Truppe ist seine Achillesferse«, hieß es in diesen Kreisen, »eines Tages wird einer seiner Leute Mist bauen, und er wird darüber stolpern und sich den Hals brechen.«
Susanne Findeisen saß im Augenblick von Wertheims Eintreffen bei Strasser und erstattete Bericht. Der graumelierte Enddreißiger hörte aufmerksam zu, nahm jedes Wort konzentriert auf, wälzte es schon im Kopf, wog seinen Wert ab und gab ihm eine mediengerechte Form.
»Die Spurensicherung hat nichts?«
»Nicht viel. Sie starb nicht dort, wo ihr die tödlichen Verletzungen beigebracht worden waren. Tatsächlich muss sie noch eine längere Strecke aus eigener Kraft gelaufen sein.«
»Wie weit kann man ... unter solchen Umständen denn laufen?« Strasser zog die gebräunte Stirn in kritische Falten. Er wirkte erholt; sein letzter Urlaub lag nur eine Woche zurück – der Versuch einer Versöhnungsreise auf die Malediven mit seiner zweiten Frau.
Susanne Findeisen wippte in dem Freischwinger vor dem Schreibtisch ihres Chefs. »Fast dreihundert Meter. Wir fanden ihre Hände an einem Waldweg, etwa dreihundert Meter vom Fundort des Körpers.«
Strasser stand auf, entnahm dem Humidor im Regal hinter seinem Stuhl eine Havanna und wog sie nachdenklich zwischen den Fingern. In seinem Büro durfte geraucht werden. »Das ist furchtbar. Ich darf?« Reine Formsache, aber er hielt die Zigarre kurz hoch, wartete Findeisens Nicken ab und entzündete sie dann ohne allzu viel Zeremoniell.
»Wir fanden sehr viel Blut am eigentlichen Tatort. Ein paar Reifenspuren. Zwei Zigarettenkippen, von denen ich aber nicht glaube, dass sie vom Täter – oder von den Tätern – stammen. Sie sahen schon sehr alt aus. Des Weiteren fanden sich im Gebüsch ein benutztes Präservativ und reichlich Kleenex und Toilettenpapier. Die Stelle ist nicht weit von der Straße entfernt.«
Strasser nickte nachdenklich. Bei allem Horror – die Details würden für Aufsehen sorgen, sollten sie bekannt werden der Fall hatte die Art Brisanz, die die Öffentlichkeit mobilisierte. Was nicht unbedingt von Vorteil sein musste.
»Wir schließen daraus, dass die Tat ziemlich schnell vonstatten ging. Der Täter musste damit rechnen, jederzeit gestört werden zu können. Hohes Risiko – wäre hinter ihm jemand in den Weg gefahren, hätte er ihm die Ausfahrt versperrt. Der Waldweg ist eine Sackgasse.«
»Vielleicht wusste er das nicht.« Der Polizeipräsident blies eine Rauchwolke von sich.
»Das kann natürlich sein. Das Mädchen war übrigens nackt.«
»Vergewaltigung?«
»Das wissen wir noch nicht. Ihre Kleider sind verschwunden, der Täter muss sie mitgenommen haben.«
»Gut, vielen Dank zunächst. Für heute Nachmittag werde ich eine Pressekonferenz einberufen. Halten sie sich bitte gegen drei Uhr zur Verfügung.«
Findeisen schloss einen Moment die Augen. Strasser ließ wirklich keine Chance aus, die Arbeit der Truppe und natürlich sich selbst in Szene zu setzen. Sie war da eher zurückhaltend. In Anbetracht der Tatsache jedoch, dass sie in der Nacht schon ein paar Informationen an Berliner gegeben hatte, war die Pressekonferenz aber vielleicht keine schlechte Lösung. »Ist gut. Wir zeigen ein Bild, vielleicht kennt sie jemand. Bis drei Uhr müssten auch die Ergebnisse der Gerichtsmedizin vorliegen.«
Strasser nickte sein abschließendes, verabschiedendes Nicken, Signal dafür, dass andere, wichtigere Aufgaben auf ihn warteten.
Hauptkommissarin Findeisen verließ das elegante Büro, das mit alten englischen Möbeln den unaufdringlichen Charme eines Londoner Clubs des neunzehnten Jahrhunderts verströmte. Strasser, der sich gerne mit schönen Dingen umgab, hatte es vorschriftswidrig, aber geschmackvoll aus dem Privatbesitz seiner Familie ausgestattet.