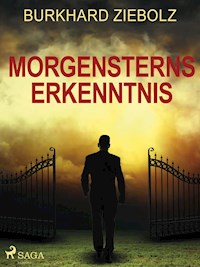Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein packender Krimi, der einen zum Weiterlesen antreibt!Wilhelm Ringelnatz geht zuerst von reiner Routine aus, als er den Diebstahl einer jahrhundertealten Schrift aufklären soll, doch ganz im Gegenteil. Bald findet er heraus, dass jeder, der das verschwundene Werk gelesen hatte, kurz darauf verstorben ist. Ob die Tode mit dem Buch zusammen hängen? Die Spuren führen ihn zu Salomon Mergentheimer, ein jüdischer Bibliothekar, welcher vor dem Zweiten Weltkrieg in Wolfenbüttel gearbeitet hatte. In einem Wettrennen mit der Zeit versucht Ringelnatz die Puzzleteile zusammen zu setzen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Ziebolz
Orpheus Stufen - Kriminalroman
Saga
Orpheus Stufen - KriminalromanCopyright © 1998, 2019 Burkhard Ziebolz und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726086775
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Ereignisse und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Historische Angaben, die nicht direkt mir der Geschichte in Verbindung stehen, sind sachlich richtig. Die Abmessungen und die Ausdehnung der Braunschweiger Kanalisation wurden den Anforderungen des Romans angepaßt – die Stadtväter werden mir die Eigenmächtigkeit verzeihen.
Mein Dank gilt dem Braunschweiger Landesmuseum und der Jüdischen Gemeinde Braunschweig für ihre freundliche Hilfe. Weiterer Dank gebührt Jürgen, der mir bei den Recherchen zur Kanalisation in Braunschweig geholfen hat, und Sabine, Peter, Christiane und Michael für Lektorat und Diskussionsbereitschaft.
Teil I: Lose Endenoder Die Quellen
Das erste ist das Gefühl völliger Ruhe und ein sanftes Dahingleiten, in milder, angenehmer Luft. Dann öffnet sich das Bild, wie eine Bühne, vor der ein Vorhang weggezogen wird.
Der Zug fährt lautlos durch eine Landschaft von sattem, dunklem Grün. Er bewegt sich vorwärts in völligem Einklang mit seiner Umgebung, nichts stört die Harmonie des Bildes. Seine Form, seine Farbe, seine Geschwindigkeit – alles wurde für diesen einen Moment gemacht, für diese eine Fanrt; ist sic zu Ende, wird auch er nicht mehr existieren. Keine Kraft kann die eiserne Maschine aufhalten, und ihr Ziel liegt hinter dem Horizont, dort, wo eine dünne Linie hellgrauer Berge die Grenze des Gesichtsfeldes markiert.
Er blickt von oben darauf herab. Die Lokomotive und die Wagen sind klein wie Spielzeug. Er fragt sich: Wie komme ich hier herauf? Fliege ich? Fliege ich selbst, aus eigenem Antrieb? Er weiß es nicht. Auch seine Identität bleibt ihm verschlossen, ebenso wie die Beschaffenheit seiner unmittelbaren Umgebung. Nur eines weiß er genau:
Er ist hier, um dem Zug zuzusehen, der sich tief unter ihm unbeirrbar in das Grün der Landschaft frißt.
Je länger er hinabschaut, um so klarer wird ihm, daß der Zug für ihn eine Bedeutung hat, mehr ist als bloßes Objekt der Beobachtung. Eine lange verschüttete Erinnerung brodelt, wird heiß und schlägt Blasen. Vergebens versucht sie aufzusteigen. Sie hat noch zu wenig Kraft.
Aber eine vage Ahnung ist da, eine Ahnung von etwas, das vor langer Zeit geschehen ist und zu dem er den Schlüssel hat.
Und diese Ahnung ist unangenehm.
1.
Ein enger Ring aus Stahl, schrecklich eng, der sich wie ein Alp um die Brust zieht und einem die Luft abdrückt.
Er kennt das Gefühl schon von anderen Situationen. Er hat es manchmal gehabt, wenn er etwas gegenüberstand, das großes Leid erzeugte, ohne eine Spur von Sinn erkennen zu lassen. Zum Beispiel damals, als sein Kumpel Max mit seinem Motorrad von einem betrunkenen Autofahrer an eine Hauswand gedrückt wurde. Und dann die andere Sache. Die, um deretwillen er heute beinahe zu spät zur Beerdigung seines Großvaters gekommen wäre.
Felix, den blonden Scheitel wie immer ein wenig zerrauft, schaut sich um. Die Gesichter der etwa dreißig schwarz gekleideten Personen sind dem Pfarrer zugewandt. Die meisten der Blicke machen an der hochaufgerichteten Gestalt nicht halt, sondern setzen sich fort in die Unendlichkeit, und Felix könnte schwören, daß die Gedanken ihrer Besitzer sich momentan nicht mit dem Andenken des Dahingeschiedenen beschäftigen.
Der Pfarrer hat sich redlich und mühsam wie ein gutes Schiff bei schwerer See durch die Ansprache gekämpft und kommt langsam zum Ende; eine letzte Salve von Allgemeinplätzen noch, dann ist das rettende Ufer erreicht. Was soll der Mann auch sagen? Er kannte den Verstorbenen nicht. Heinrich Ringel hat Zeit seines Lebens wenig zu tun gehabt mit der Kirche und ihren Angestellten.
Der Geistliche gibt den Trägern ein Zeichen, die leicht gelangweilt im Hintergrund warten, die steifen Hüte regelmäßig in den Händen drehend. Taue straffen sich, Bretter werden unter dem Sarg weggezogen, und dann verschwindet er, Heinrich Ringel, wie er vor fast achtzig Jahren gekommen ist: Zentimeter um Zentimeter, Lichtjahr um Lichtjahr. Bis zu diesem Augenblick war er für Felix körperlich noch irgendwie präsent, aber jetzt entfernt er sich endgültig, vollständig und für immer.
Felix schluckt. Ihm ist zum Heulen zumute, aber als er es versucht, verspürt er nur einen schmerzhaften, trockenen Krampf in der Halsgegend und er weiß, daß er es nicht mehr kann; das Weinen ist eine der Fähigkeiten, die er eingetauscht hat gegen ein paar andere, nützlichere. Dafür zieht sich der Ring um seine Brust weiter zusammen, er kann kaum noch atmen.
Schnelle Ablenkung muß her.
Er wendet Blick und Gedanken wieder beobachtend der Trauergemeinde zu.
Sein Stiefvater. Er kannte den Dahingeschiedenen kaum, hat nur selten Zeit und Gelegenheit für ein Gespräch mit ihm gesucht. Sie hatten nichts gemeinsam, weder Gegenwart noch Vergangenheit, und Zukunft schon gar nicht. Entsprechend niedrig darf bei ihm wohl der Grad von Bestürzung und Trauer eingeschätzt werden, den Pfarrer Kielmann in der Trauerrede soeben in natürlichem Zusammenhang mit den nächsten Verwandten und Freunden erwähnt hat.
Seine Mutter, an ihr hängt sein Blick länger. Die schöne, zerbrechliche Barbara Luckmann, geborene Ringel. Ihr blasses Gesicht ist noch blasser geworden in der letzten Zeit, der Kontrast zu den dunklen Haaren noch stärker. Trauert sie? Sie hatte kein besonders gutes Verhältnis zu ihrem Vater, hat ihm seine Vergangenheit angelastet und manchmal auch offen zum Vorwurf gemacht. Und trotzdem weiß Felix, daß sie ihn vermissen wird. Sie weint nicht, aber das hat sie nie getan, nicht einmal damals, als sie ihren ersten Mann, seinen Vater, verlor.
Der Rest der ihm bekannten Anwesenden kommt als Trauerkandidaten nicht in Frage. Sein Cousin Tobias spielt mit den Bügeln seiner teuren Sonnenbrille herum, in Gedanken wahrscheinlich beim Geschlechtsverkehr mit einer seiner zahlreichen Eroberungen. Tante Monika, Schwester seiner Mutter und fast genauso schön, fixiert den obersten Knopf am Hemdkragen des Priesters, die Haare sorgfältig frisiert und den Mund mit den vollen roten Lippen leicht geöffnet, was sie ausgesprochen sexy aussehen läßt. Felix könnte wetten, daß auch ihre Gedanken sich nicht um Tod und Vergänglichkeit drehen.
Der Sarg ist verschwunden, verschlungen von der Erde. Die ersten Trauergäste treten vor, bilden eine Schlange, um ihm mit einer Handvoll Erde die letzte Ehre zu erweisen. Felix kennt viele der Leute nicht und kann mit ihren Gesten der Anteilnahme nichts anfangen. Sie treten auf ihn und seine Eltern zu, um ihnen mit vielsagend verschleierter Miene die Hände zu schütteln; nicht zu fest, das könnte pietätlos wirken. Ein sanfter Händedruck dem Stiefvater, ein mitfühlender Blick in die Augen der Mutter, dann ein aufmunternder Klaps auf seine, Felix’, Schulter. Und ein leises, aber dennoch deutlich hörbares »Na? Wohl froh, wieder draußen zu sein?« von Onkel Walter, der sich schon immer durch seine Taktlosigkeit ausgezeichnet hat. Aber Felix hat kein Problem damit. Er kennt seine Familie und hat Zeit genug gehabt, sich an derlei Peinlichkeiten zu gewöhnen.
Ein alter Mann am Ende der Schlange fällt ihm auf, dem toten Großvater in Aussehen und Haltung sehr ähnlich. Er nähert sich schnell und je näher er kommt, um so größer scheint die Ähnlichkeit zu werden. Mit kurzen, straffen Schritten tritt er hochaufgerichtet an das Loch, das wie eine offene Wunde im torfigen Boden des Friedhofs klafft. Kurz und straff ist die Bewegung, mit der er seine Portion Erde hinunter in die Grube schleudert – eher eine Geste der Abwehr als des Abschiedes –, und kurz und straff senkt er den Kopf in einer Art ruckartigen, grüßenden Nickens; dann tritt er zurück, kurz und straff. Er ist groß und hager, wie es der Alte war, mit weißen, zurückgekämmten Haaren und einer gewaltigen Hakennase, die ihm das Aussehen eines traurigen Papageien gibt. Aber er wirkt alles andere als komisch, und seine Haltung flößt Felix unwillkürlich Respekt ein. Wahrscheinlich ein alter Kamerad, aus Tagen, an die sich sein Großvater ebenso gern wie heimlich erinnert hat und über die er niemals sprach.
Die ältliche dicke Frau, die als nächste kommt, kennt er auch nicht. Sie trägt ihren wogenden Busen wie ein schweres Bündel vor sich her, die knollige Nase tief in ein Papiertaschentuch von zweifelhafter Färbung gedrückt. Vielleicht die Putzfrau. Nein – hat nicht der Alte so etwas wie eine Haushälterin gehabt, die letzten zwei Jahre? Das hat er ihm mal geschrieben. Sein »Faktotum«, hat er sie in dem Brief genannt. Haushälterin, das könnte passen, Physiognomie und Haltung entsprechen Felix’ Vorstellung.
Keine Zeit mehr für müßige, passive Betrachtung. Seine Tante kommt, und er muß nun seine Aufmerksamkeit zwischen der Dicken und ihr teilen. Sie umarmt ihn und gibt ihm einen Kuß auf die Wange; ihre Lippen sind kühl.
»Tut mir leid für dich. Du mochtest ihn, nicht wahr?«
»Ja, Tante Monika.«
Ihre Augenbrauen wandern leicht nach oben. Ihr Ton ist ernst, kritisch, fast vorwurfsvoll.
»Trotz seiner Vergangenheit.«
»Ja, Tante Monika.«
Er weiß, was sie denkt: Gleich und gleich gesellt sich; aber sagen tut sie es nicht. Gleichzeitig ist er nicht sicher, wie fest ihre moralische Standfestigkeit wirklich ist und ob sie sich auf alle Bereiche ihres Lebens erstreckt. Er hat früher ein paar Geschichten über sie gehört, die nicht dazu passen.
Jedenfalls wird ihre Stimme nun ein paar Grad rauchiger.
»Du bist ein richtiger Mann geworden.«
»Ja.«
Diesmal verschluckt er das »Tante Monika« und findet, daß er schon wieder ganz gut zurechtkommt in der freien Welt.
Ein letzter Händedruck, dann ist sie fort, wie ein schwül warmer Gegenwind, der plötzlich ausbleibt, wenn man in die Abdeckung eines Gebäudes gerät. Er sieht ihr nach, wie sie an Onkel Walters Arm mit schwingenden Hüften das Feld verläßt. Immer noch gute Beine und ein guter Hintern.
Er hat den Alten wirklich gern gehabt, und was früher War, war ihm egal. Er war ein Kind, was interessierte ihn die Vergangenheit seines Opas, oder gar die einer ganzen Nation? Aber er merkte schon damals: Irgend etwas ist da, das der alte Mann mit sich herumträgt wie einen unsichtbaren Kropf. Die Blicke der Leute, leise, halb ausgesprochene Sätze, vielsagende Gesten mit den Händen – und nie wurde ausgesprochen, was man meinte, und nie wurde ganz klar, worin der Makel bestand.
Aber Felix war ein Kind, und er liebte seinen Großvater. Der war groß und stark und wußte immer, was zu tun war, wenn der kleine Junge mit seinen kleinen Nöten und Ängsten zu ihm kam. Er wußte es oft besser als dessen Eltern.
Der Alte hat ihm gegenüber nie von der dunklen Zeit gesprochen, obwohl sie das vertrauteste Verhältnis hatten, das man sich nur vorstellen kann. Und Felix hat nie gefragt, nicht einmal, als er schon älter und neugierig war. Er ahnte irgendwann, worum es ging, aber es blieb dennoch der weiße Fleck auf der Karte ihrer Partnerschaft, den keiner betrat und nie betreten würde, um den anderen nicht in Verlegenheit zu bringen.
Er wußte jedoch, was dem Mann die Erinnerungen bedeuteten. Mehr als einmal hat er ihn bei der Lektüre stockfleckiger Bücher oder bei der Durchsicht von altem, braunem Fotomaterial ertappt; alles verschwand blitzschnell in einer Schublade, wenn er merkte, daß er ihm zusah, und ein Scherz lenkte ab und verwischte die Gedankenspuren.
Und jetzt? Will er es überhaupt noch wissen? Nichts, was der Mann, der jetzt anderthalb Meter unter ihm liegt, je getan hat, kann wirklich nur schlecht gewesen sei, davon ist er überzeugt. Einen Augenblick bereut er schon, daß er sich nicht alles von ihm selbst hat erzählen lassen, als dies noch möglich war.
Die Zeremonie ist zu Ende, die Anwesenden wenden sich dem Ausgang des Friedhofs zu, teils mit gebührender Langsamkeit, teils in einer Eile, die fast an Flucht erinnert. Felix’ Vater reicht dem Pfarrer die Hand, dankt für die zu Herzen gehenden Worte. Dieser nimmt das Lob routiniert entgegen, in Gedanken schon weit weg bei der Hochzeitsfeier am Nachmittag und der abendlichen Sitzung des Pfarrgemeinderates.
Ein letzter Blick Felix’, der als einziger noch an seinem Platz steht, auf die Grube. Ein Arbeiter in grünem Overall – sagt man noch Totengräber? – beginnt, sie zuzuschaufeln. Braune Lawinen rollen hinab, kleine Erdklumpen überholen große, große Erdklumpen überholen kleine, und alle sammeln sich am tiefsten Punkt des Loches, um mit dumpfem Klopfen auf den Holzdeckel zu prallen. In den ruhigen, gemessenen Bewegungen des Mannes liegt etwas Feierliches, das seiner Tätigkeit eine neue, höhere Bedeutung gibt. Fast scheint sie die logische Fortsetzung der Trauerfeier zu sein, und einen Moment bedauert es Felix, daß nur er allein noch beobachtet, was hier geschieht, und nur er Zeuge wird eines weiteren Rituals. Dann aber bemerkt er die Einzelheiten, die Zigarette im Mundwinkel des Mannes, die schlampige Rasur und die angeschmutzten Hosenbeine, und er entscheidet, daß hier doch nichts anderes stattfindet als das Schließen eines Grabes.
Ein paar Minuten später sitzen sie im neuen lackglänzenden Auto seines Adoptivvaters. Felix auf dem Beifahrersitz, seine Mutter hinten; eine unwillkürliche Sitzordnung, ohne Überlegung oder Absprache so wie früher eingenommen, trotz der langen Zeit, die er fort war. Es ist sehr still im Wagen. Er lehnt sich in den bequemen Ledersitz.
Irgendwo muß man anfangen.
»Schöner Wagen. Hast du ihn schon lange?«
Erich Luckmann widmet seine Aufmerksamkeit dem stark fließenden Straßenverkehr an der Einmündung der Straße.
»Ein paar Monate. Ein neues Modell mit mehr Leistung bei niedrigerem Verbrauch. Gab es den schon, als du ...?«
»Ich glaube nicht. Ich hätte es gewußt.«
Felix’ Grinsen kommt nicht ganz ungezwungen.
Seine Mutter legt ihm von hinten die Hand auf die Schulter, leicht wie ein Schmetterling.
»Wir sind froh, daß du wieder bei uns bist.«
Sie will noch mehr sagen, aber wie immer in Augenblicken emotionaler Bewegung fehlen ihr die Worte; ein Mangel, der ihn seine ganze Kindheit hindurch begleitet hat. Er drückt sanft ihre Hand, und sie zieht sie zufrieden wieder zurück.
»Ich freue mich auch. Schade ist nur . . .«
»Was?«
»Schade ist, daß ich zu spät gekommen bin. Ich hätte den Alten gern noch mal gesehen. Lebend, meine ich.«
»Die Kommission hat sich sehr spät entschieden. Später, als es eigentlich geplant war. Dein Großvater hat genauso gespannt darauf gewartet wie du.«
Felix blickt gedankenverloren auf die Straße vor der langen Motorhaube, die Unterlippe etwas vorgeschoben. Er hätte ihn wirklich gern noch einmal gesehen, und noch lieber wäre er bei ihm gewesen, als es passierte. Der Alte hatte sich in den letzten Jahren auf ihn verlassen, in vielen Dingen. Eines Tages hatte er ihn beiseite genommen und gesagt: »Wenn es mal soweit ist, will ich, daß du bei mir bist. Ich will nicht allein sein, wenn ich gehe.« Felix, auf der Schwelle zwischen Kind und Erwachsenem, hatte die Bedeutung des Augenblickes nur unscharf erfaßt, aber es hatte gereicht, um einen dicken Kloß in seiner Kehle entstehen zu lassen. Der ganze Sinn dieses Wunsches war ihm erst viel später aufgegangen. Es war nicht die Angst vor dem Sterben – die hatte der Alte nie gehabt –, es war einfach der größte Beweis von Vertrauen und Zuneigung gewesen.
Und jetzt hat er das Gefühl, ein Versprechen nicht gehalten zu haben.
»Wie ist er gestorben? Er war doch niemals krank.«
Ein kurzer Seitenblick seines Vaters.
»Gehirnschlag. Es ist wohl ganz plötzlich passiert, kurz nach dem Abendessen.«
Gehirnschlag? Was ist das?
»War jemand bei ihm?«
»Nein. Die Haushälterin war schon fort; sie wohnt in der Nachbarschaft und kam nur zur Arbeit ins Haus. Am Morgen hat sie ihn dann gefunden. Ganz friedlich lag er auf dem Sofa, so als wäre er eingeschlafen.«
Die Stimme seiner Mutter klingt dünn und ohne Überzeugungskraft vom Rücksitz.
»Ein schöner Tod. Schnell und ohne Leiden, von einem Moment auf den anderen.«
Sie fahren schweigend das letzte Stück.
Nach einer halben Stunde biegen sie auf das Grundstück ein; die Auffahrt ist mit dickem, weißem Kies bestreut. Es hat sich einiges geändert, schon auf den ersten Blick. Früher gab es hier nur zwei Spuren aus Zementsteinen, mit spärlichem Gras dazwischen und links und rechts daneben. Zwischen den alten Apfelbäumen kommt das Haus in Sicht, und auch hier gibt es Neuerungen: Die Fassade ist renoviert, hellgelb gestrichen, mit Weiß an den Ecken und um die Fenster, und das Dach ist neu.
»Ihr habt mir gar nicht erzählt, was ihr alles gemacht habt.«
Der Wagen hält, Kies knirscht unter den Reifen. Auch die Stimme seines Vater ist verändert. Felix meint, sie wäre tiefer als früher, Ausdruck einer Selbstsicherheit, die er vor ein paar Jahren in diesem Ausmaß noch nicht besessen hatte.
»Das war überfällig, du weißt ja, wie es vorher aussah. Und als wir angefangen haben, da wollten wir es dann gleich gründlich machen. Du solltest mal den Garten sehen. Der Pool ist auch wieder in Ordnung.« Felix’ Augen werden immer größer. Das Anwesen, ein Haus aus den dreißiger Jahren, war früher ein Ärgernis für die noble Nachbarschaft, unordentlich, baufällig, eine Art ständiges Provisorium, das regelmäßig durch neue Provisorien ergänzt und teilweise ersetzt wurde. Nun macht es den Eindruck dauerhafter Stabilität.
»Das muß doch reichlich gekostet haben. Gehen die Geschäfte so gut?«
Er sieht seine Mutter an, bemerkt ein leichtes Flattern der Augenlider. Sein Vater antwortet breit lächelnd.
»Ich kann nicht klagen. Einige dicke Dinger im Osten – Thüringen und Brandenburg –, und hier tut sich auch langsam wieder was. Alles in allem ist die Entwicklung zufriedenstellend, und wir können zuversichtlich in die Zukunft blicken.«
Das klingt nun wie aus dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes bei der Aktionärsversammlung. Felix erinnert sich, wie schlecht der Laden früher lief, immer am unteren Limit, die Nase gerade so über dem Wasser und in ständiger Gefahr unterzugehen. Architekten gibt es viele, und nur wenige können so gut von dem leben, was sie gelernt haben, wie es Erich Luckmann offenbar kann.
Wieder betrachtet er das Gesicht seiner Mutter und zum ersten Mal erkennt er die harten Linien, die sich um den Mund gebildet haben, die Ringe unter den Augen, sorgfältig mit den Mitteln der Kosmetik abgemildert, und die tiefen Furchen auf der Stirn. Sie ist älter geworden in der Zeit seiner Abwesenheit, viel älter, als es hätte sein dürfen. Bei ihren Besuchen ist ihm das nie aufgefallen; aber da hat die Freude immer alles andere ausgelöscht, und wirkliche Ruhe hatte man auch nicht miteinander.
Er umfaßt ihre Schultern.
»Du siehst müde aus, Mutti. Laß uns reingehen.«
Die Tür öffnet sich, und seltsam erleichtert bemerkt er, daß im Inneren alles unverändert geblieben ist. Die Möbel stehen noch so, wie er sie in Erinnerung hat, die Lage der Teppiche hat sich nicht verändert, und sogar die Tapete ist noch dieselbe.
Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, ist er wieder frei; alte, rostige Ketten fallen klirrend von ihm ab, und er spürt die eiserne Klammer von vorhin auf dem Friedhof nicht mehr. Ihm ist, als wären die letzten zwei Jahre ausgelöscht und er stünde wieder an dem Punkt, an dem er damals aufgehört hat, wirklich zu leben.
2.
Die Höhe der Regale flößt Respekt ein; und die unüberschaubare Menge an Gedankengut, die auf ihnen lagert, ebenfalls. Achthunderttausend Bände, und dreitausend Handschriften in den Tresoren.
Wilhelm Ringelnatz hat keine tiefere Beziehung zu Büchern. In den sechzig Jahren seines Lebens hat er nur eine Handvoll gelesen, meist Kriminalromane, und die nicht aus Interesse, sondern eigentlich nur, um sich über die darin beschriebenen Ermittlungsmethoden und das aufregende Leben der Detektive zu amüsieren. Aber was ihm hier entgegenschaut, ist beinahe das gesamte Wissenspektrum der Menschheit des Mittelalters, gesammelt über Jahrhunderte, konzentriert auf einem Fleck und konserviert für die Zukunft. Dieses Bewußtsein nötigt ihm Respekt ab.
Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel ist bekannt in der bibliophilen Welt. Die in ihr lagernden Schätze der frühen Buchdruckerkunst und die Sammlung von Werken, die noch früher entstanden sind, faszinieren die Wissenschaft seit vielen Jahren.
Er war schon einmal hier, in einem anderen Fall, hatte das alte Gebäude aber nicht so prunkvoll in Erinnerung. Die hohe Halle in ihrer barocken Pracht, die sich wie ein zweiter Himmel über ihm wölbt, ist ein würdiger Rahmen für die Zeugnisse der Vergangenheit, und man kann hier nicht anders, als leise und andächtig zu sein.
Doktor Ernest Bilfinger, der Leiter der Bibliothek, strahlt bei allem, was er sagt und tut, eine bestimmte Art von Zufriedenheit und Stolz aus. Die kleinen, wässrigblauen Augen blitzen aus dem feist-rosigen Gesicht, so als wollte er sagen: »Hier sind wir, ein wertvoller Baustein im Weltwissen, anerkannt in allen Kulturen.« Auch jetzt blitzen sie, obwohl er in die Niederungen krimineller Verirrungen hinabsteigen muß.
»Wir sind natürlich froh, daß es keines unserer wirklich wichtigen Stücke betrifft. Stellen Sie sich vor, der ›Kopernikus‹, oder gar das ›Evangeliar‹ . . .«
Er schlägt in aufkommender Panik die Hand vor den Mund, so als müßte er sich am Schreien hindern. Ringelnatz lockert die Krawatte; er steht dem anderen in Leibesfülle in nichts nach, und ihm ist im Moment nicht ganz wohl. Das »Evangeliar«, so wertvoll es auch ist, ist ihm egal, denn es ist nicht bei der Insura, seinem Arbeitgeber, versichert. Wilhelm Ringelnatz ist das, was der Volksmund einen Versicherungdetektiv nennt.
Er zückt einen kleinen, weißen Block, auf dem gut sichtbar das Logo seiner Gesellschaft prangt: Hermes, Gott der Kaufleute und konsequenterweise auch der Diebe, stilisiert über dem Firmennamen schwebend.
»Das freut uns auch. Um welchen Band handelt es sich noch mal genau?«
Bilfinger senkt die Stimme noch weiter, so als könnte eine erhöhte Lautstärke die Aufmerksamkeit weiterer krimineller Elemente erregen.
»Das Buch heißt ›Traktätlein von dem Kometen, der im November Anno 1638 gesehen worden ist‹.«
Fragend blickt ihn der andere an.
»Was ist der Inhalt des Buches?«
»Wie Sie sich denken können, schildert es das Auftauchen eines Kometen im Jahre 1638. Der Autor hat versucht, sich wissenschaftlich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, was in den damaligen Zeiten des Aberglaubens an sich schon ein erstaunlicher Ansatz war.«
»Ist das Buch wertvoll?«
Bilfinger verdreht pikiert die Augen. Er ist mittelgroß und sehr dick. Die Reste dessen, was einmal ein mittelblonder Haarschopf war, liegt, sorgfältig nach vorn gebürstet und mit Frisiercreme an die Haut geklebt, quer über der Schädeldecke.
»Naja, irgendwie schon. Bei einer Versteigerung würde es ein paar tausend Mark bringen, aber ich glaube nicht an Gewinnsucht als Motiv.«
»Warum nicht? Meist ist Gewinnsucht das Motiv von Diebstählen.«
Der Direktor blickt jetzt mit verschwörerischem Ausdruck um sich. Der Detektiv zollt der Wandlungsfähigkeit im Mienenspiel des Mannes eine gewisse Bewunderung. Keine Sekunde scheint zu vergehen, ohne daß sich dessen Gesichtsausdruck ändert.
»Jemand, der ein Buch entwendet, muß sich mit antiquarischem Material auskennen. Er muß wissen, was er wo verkaufen kann. Richtig?«
Ringelnatz zuckt die Schultern.
»Wahrscheinlich.«
»Ganz bestimmt.«
Überschlaue Typen hat Ringelnatz noch nie ausstehen können. Aber vielleicht ist die aufkommende Aversion auch auf seinen momentan angegriffenen Gesundheitszustand zurückzuführen. Schön beim Aufstehen am Morgen war ihm übel, und er fühlte sich müde und schwach wie schon die ganzen letzten Wochen.
Die Untersuchung vor ein paar Tagen geht ihm durch den Sinn. Er ist nicht unbedingt beunruhigt, aber doch ein wenig gespannt auf die Ergebnisse. In seinem bisherigen Leben ist er selten krank gewesen, und niemals ernsthaft, aber irgendwann, so denkt er, fängt der Körper halt an, nicht mehr zu funktionieren. Der Arzt hat ihm die Diagnose für nächsten Mittwoch versprochen.
»Was könnte sonst das Motiv gewesen sein?«
»Keine Ahnung. Eine Art ideeller Wert oder der Inhalt des Buches vielleicht. Könnte ich mir denken.«
Was meint er damit? Den Inhalt hätte man ja lesen können, ohne das Buch zu stehlen, und was ist ein ideeller Wert? Der Detektiv schaut ihn forschend an, beschließt aber, systematisch vorzugehen und erstmal das Nächstliegende zu klären.
»Wo hat der Band gestanden?«
Bilfinger wendet sich um, weist in Richtung auf eine Treppe, die nach unten führt, und setzt sich auch gleich in Bewegung.
»Dort unten. Kommen Sie.«
Raumgreifend stürmt er voran, so schnell ihn die kurzen Beine tragen; Ringelnatz, kurzatmig und wieder stärker transpirierend, vermag kaum zu folgen. Der Bibliotheksdirektor scheint besser in Form zu sein, als es seine aufgeschwemmte Erscheinung glauben läßt.
Ein paar Stufen nach unten, das Licht wird gedämpfter. Auch hier sind die Wände voll bis unter die Decke mit weißen oder bräunlichen Bücherrücken. Die Titel sind handschriftlich und immer noch gut lesbar auf jeden einzelnen aufgeschrieben, in eigentümlich spitzer, genauer Schrift, von einer Hand, die schon lange Staub ist.
Bilfinger tritt an ein Regal rechts neben dem Eingang und weist auf eine Lücke zwischen den Bänden.
»Hier war es.«
Ringelnatz sieht sich um.
»Und daß das Buch irgendwo anders hingekommen ist? Ausgeliehen? Oder in eine andere Abteilung, ein anderes Regal, aus Versehen?«
Er weist unbestimmt in den Raum um sie herum.
Schlagartig vereist die Miene des kleinen dicken Direktors, und seine Stimme hat nun jede Spur von Freundlichkeit und Sympathie verloren. Das Dreifachkinn zittert in schwachem Tremolo. Schwer zu sagen, ob es Aufregung ist oder Bindegewebsschwäche, in jedem Fall ist der Mann über die Maßen aufgebracht.
»So etwas gibt es hier nicht. Es gibt keine Versehen in diesem Haus, alles folgt bestimmten, festgelegten Abläufen. Regeln, Herr Ringelnatz, Regeln und Plänen. Jedes Werk hat seinen Platz, der genau festgelegt ist. Dort, und nur dort, kann es sein. Wenn es nicht dort ist, ist es gestohlen. Was nicht ist, wo es sein soll, existiert nicht. Jedenfalls nicht in diesem Haus.«
Ein klarer Standpunkt. Ringelnatz beschließt, nicht weiter darauf einzugehen, um den Mann nicht noch mehr aufzuregen, und setzt mit ruhiger Stimme fort.
»Wer hat den Verlust als erster bemerkt?«
»Das war Herr Zwanziger, einer unserer Bibliothekare.«
»Ist er für diesen Teil der Bibliothek zuständig?«
Huscht ein leichtes Unbehagen über die Miene Bilfingers?
»Nein, eigentlich nicht. Es war mehr ein Zufall.«
Es gibt also doch Zufälle in diesem Haus der Regeln. Der Detektiv setzt sein impertinentestes Lächeln auf, unterbricht den anderen aber nicht.
»Herr Zwanziger suchte eigentlich ein anderes Buch, das in der Nähe des gestohlenen steht. Irgend etwas fiel ihm am Rücken des ›Traktätleins‹ auf. Er zog es aus der Reihe und fand im Inneren eine Attrappe. Weiße Seiten.«
»Das war gestern nachmittag?«
»Richtig. So gegen vier. Wir haben sofort die Polizei gerufen, die die Attrappe dann mit ins Labor genommen hat. Von der Polizei hätten Sie übrigens alles, was ich Ihnen eben erzählt habe, auch erfahren können.«
Das heißt: »Diese Unterhaltung geht mir auf die Nerven und kostet mich Zeit, die ich nicht habe. Und wenn ich sie hätte, würde ich sie nicht mit dir verbringen.« Und es heißt: »Die Polizei wird es schon richten. Die brauchen keinen alten, abgehalfterten Plattfuß wie dich, um ihre Arbeit zu machen.« Ringelnatz spürt die Ablehnung, die in der letzten Minute in seinem Gesprächspartner entstanden ist, verzieht aber keine Miene.
Trotzdem beschließt er, es kurz zu machen.
»Sie haben zu Protokoll gegeben, daß der letzte, der das Buch ausgeliehen hat, der Dieb sein muß. Wie geht das Ausleihen denn vonstatten?«
Der Direktor macht jetzt den Eindruck wirklicher Genervtheit, nahe daran, die Geduld zu verlieren.
»Unsere Räume mit den Büchern sind zwar zugänglich, aber die Bücher dürfen ohne Aufsicht nicht berührt werden. Die Möglichkeit, daß ein Schaden entsteht, ist zu groß. Wenn sich jemand für ein bestimmtes Werk interessiert, dann meldet er sich beim Bibliothekar vom Dienst, ab acht Uhr morgens. Er erhält Einsicht in unsere Kataloge und sucht sich anhand derer das Buch oder die Bücher aus, die ihn interessieren. Manche kommen auch schon am Tag vorher, stöbern in den Regalreihen und treffen auf diese Weise ihre Auswahl. Der Bibliothekar sucht das Buch heraus, das dauert etwa eine dreiviertel Stunde. Er übergibt dem Interessenten das Buch, und der setzt sich damit in den Lesesaal, unten rechts vom Eingang. Bei besonders wertvollen Folianten erhält er dünne Handschuhe, um den direkten Kontakt zwischen Papier und Haut zu verhindern. Schweiß, Aminosäuren, Fett – Sie verstehen. Hat er fertig gelesen, gibt er das Buch zurück und geht. Für die Handschriften gilt dieses simple Procedere natürlich nicht. Sie werden nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zur Ansicht freigegeben, unter Aufsicht und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken.«
»Und bei der Gelegenheit soll das Buch vertauscht worden sein?«
»Ja. Wissen Sie«, nun sinkt die Lautstärke des anderen auf ein Maß, das bei Verschwörungen oder Gesprächen über besonders unangenehme Geschlechtskrankheiten angebracht ist, »wissen Sie, am fraglichen Tag hatte Herr Wenders Dienst. Ein guter Mann, langjähriger Mitarbeiter mit hervorragendem Fachwissen, aber sehr kurzsichtig. Jetzt hat er ja eine neue Brille.«
»Und dieser Herr Wenders . . .«
» . . . schwört natürlich, keine Attrappe entgegengenommen zu haben, und wir können ihm das Gegenteil kaum beweisen. Aber – sagen Sie Wenders nichts von meiner Meinung zu dieser Geschichte. Wenn es so war, wie ich vermute, macht er sich sicherlich selber schon genug Vorwürfe. Das Buch entpuppte sich übrigens als Einband eines Kontobuches aus dem vorigen Jahrhundert; so was kann man auf Flohmärkten billig kaufen. Der Täter hatte sich sogar die Mühe gemacht, ein kleines papierenes Etikett auf den Rücken zu kleben, wie sie alle unsere Bücher tragen, mit einer entsprechenden Beschriftung.«
Der Detektiv lehnt sich mit wackligen Knien gegen ein kleines Stehpult. Ganz plötzlich steigt Übelkeit in seiner Kehle auf, und ihm wird heiß, trotz der konstant zwanzig Grad bei exakt sechzig Prozent Luftfeuchte, die in den Bibliotheksräumen herrschen. Er muß schnell raus hier, an die frische Luft.
Nur noch ein paar letzte Fragen.
»Der Dieb muß um die schlechten Augen ihres Angestellten gewußt haben«, würgt er hervor.
Bilfingers Antwort klingt abweisend.
»Haben Sie Wenders zufällig gesehen? Er sitzt da vorne an der Auskunft. Seine Brillengläser sind dick wie Panzerglas, für jeden erkennbar.«
Ringelnatz erinnert sich. Der Mann hat einen ängstlichen, verschüchterten Eindruck auf ihn gemacht, wie ein in die Enge getriebenes Kaninchen. Sein Augen hatten durch die vergrößernde Wirkung der Brille so ausgesehen, als wären sie in maßlosem Schrecken weit aufgerissen.
Weiß Gott, welche Szene ihm sein Chef wegen des Diebstahls schon gemacht hat. Auch wenn Bilfinger jetzt den Eindruck macht, besorgt um seinen Mitarbeiter zu sein, stuft Ringelnatz ihn in die Kategorie »cholerisch und rechthaberisch« ein.
»Hat der potentielle Dieb sich nur dieses eine Buch vorlegen lassen oder waren es mehrere?«
»Nur das eine.«
»Konnte Herr Wenders den Mann beschreiben?«
Der Direktor schnaubt abfällig duch die Nase.
»Er nicht, aber ich. Ich habe ihn zufällig gesehen, als ich durch die Halle ging, und sein Aussehen fiel mir auf, weil es so untypisch für den Kreis unserer sonstigen Besucher war. Er war klein, kräftig, mit kurzen dunklen Haaren und trug eine schwarze Lederjacke und hohe Stiefel zum Schnüren.«
Sie sind auf dem Weg zum Ausgang, stellt der Detektiv in diesem Moment mit leichter Überraschung fest. Sein Gastgeber führt ihn allmählich, aber zielstrebig hinaus, während er immer weiter spricht.
»Springerstiefel heißen die Dinger, glaube ich. Ganz sauber und blank poliert, wie unsere damals, beim Barras. Und so eine Tätowierung auf der Hand, wie eine germanische Rune.«
Dann stehen sie auch schon vor der Tür, und nach kurzer Verabschiedung stellt Ringelnatz fest, daß er selten so elegant und beiläufig vor die Tür gesetzt worden ist wie gerade eben. Er geht zögernd ein paar Schritte, die Gedanken noch mit dem Gehörten beschäftigt, dann setzt er sich auf eine der Bänke vor dem Bibliotheksgebäude. Das helle Sonnenlicht wird an dieser Stelle vom Grün des Blätterdachs gemildert und gibt ihm eine Färbung, die Kühle auf der Haut erzeugt. Er fühlt sich besser jetzt, das Unwohlsein sinkt auf ein erträgliches Maß herab: Immer noch vorhanden, aber unterhalb der Grenze, die permanent störend wirkt.
In seinem Alter muß man damit rechnen, daß der Körper bisweilen nicht mehr so mitspielt wie früher.
Der feiste Bilfinger hat wahrscheinlich recht, was den Ablauf des Diebstahls anbelangt; vielleicht hat er auch recht in bezug auf das Motiv. Der Inhalt des Buches: Ein Komet fällt auf die Erde. Was kann daran so interessant sein, das Risiko eines Diebstahls einzugehen? Er muß mit jemandem reden, der es gelesen hat und der ihm mehr sagen kann als nur einen Satz.
Die Beschreibung des Diebes paßt natürlich auf die Hälfte aller jungen Neonazis in der Stadt. Eigentlich sollte die Polizei keine Schwierigkeiten haben, ihn zu identifizieren; die meisten dieser Typen sind aktenkundig. Aber Ringelnatz fällt es schwer, die rechte Szene mit Büchern im allgemeinen und diesem Buch im besonderen in Einklang zu bringen. Möglicherweise ist es ein Vorurteil, aber für ihn passen braune Gesinnung und Kultur nicht zusammen. Vielleicht wollte der Dieb ja auch nur aussehen wie ein Rechter und trug die Sachen als Tarnung.
Vielleicht doch ein Auftragsdiebstahl?
Achttausend Mark Versicherungswert, davon bleiben dem Dieb tausendfünfhundert, wenn er Glück und einen netten Hehler hat. Kein Profi macht dafür einen Finger krumm, und Amateure haben nicht den Mumm, so etwas durchzuziehen, falls sie überhaupt auf die Idee kämen.
Er schließt müde die Augen. Auch eine Errungenschaft der letzten Wochen: ständige Müdigkeit. Wann hat er zuletzt Urlaub gehabt? So richtig vor acht Jahren, damals, das letzte Mal mit Agnes. Alles, was später kam, war keine Entspannung mehr, sondern nur eine Flucht. Flucht aus dem Job, vor den Kollegen, aus dem Alltag.
Aus den Umständen.
Langsam kommt er von der Bank hoch, stemmt seine fast hundert Kilo mit Mühe in die Höhe. Er tritt aus dem Schatten der Bäume, die Hitze trifft ihn wie ein Schlag mit einer Wolldecke. Und er denkt, wie schon oft in der letzten Zeit: Du wirst aufhören nach diesem Fall. Die Idee, vor ein paar Wochen noch ganz vage, ist immer konkreter geworden, und jetzt steht es beinahe fest. Ringelnatz hat etwas Geld auf der Seite, nicht viel, aber es wird reichen, um die Zeit bis zur Rente in angenehmem Vorruhestand zu verbringen.
Er atmet auf, als hätte der Gedanke eine Befreiung gebracht. Ein Fall noch. Nächste Woche spricht er mit Millstatt. Sein Chef wird froh sein, daß er geht, aber er wird soviel Anstand haben, es ihn nicht spüren zu lassen. Vierzig Jahre Herumlaufen und Fragen stellen, das muß reichen; vierzig Jahre Unwillen, Reserviertheit und Ablehnung bei seinen Gesprächspartnern. Daran hat er sich niemals gewöhnen können, trotz der zahlreichen kleinen Erfolge, die er über die Zeit in seinem Job hatte und die ihm die Anerkennung seiner damaligen Vorgesetzten eingebracht haben.
Erfolge, die jetzt nichts mehr zählen.
Willi Ringelnatz gehört zum alten Eisen, für seine Vorgesetzten, seine Kollegen, aber auch für Freunde und Bekannte.
Und für sich selbst.
3.
Der kurze, zischende Laut, als er den Vorhang beiseite zieht, zerschneidet die Luft wie eine Schwertklinge. Licht erhellt den Raum.
Felix steht im Flur des großväterlichen Hauses. »Sieh es dir mal an«, hat sein Vater gesagt. »Der Alte wollte es so. Er hat es zufällig noch mal erwähnt, ein paar Tage vor seinem Tod. Wenn mir mal was passiert, gib Felix meinen Hausschlüssel. Er soll in meinem Arbeitszimmer nachschauen.«
Eine Vermächtnis? Wenn es eine Belohnung beinhaltet, so hat er nicht das Gefühl, sie verdient zu haben. Er war nicht da, als sein Großvater starb, trotz seiner Bitte; das wirft er sich vor. Dann aber greift die Logik und beruhigt ihn: Du wärst auch nicht hier gewesen, wenn es möglich gewesen wäre. Du wärst nicht hier gewesen, weil es zu plötzlich kam und du hättest es nicht vorhersehen können.
Er sieht sich um: Es hat sich wenig geändert. Die Möbel, die Heinrich Ringel durch die letzten vierzig Jahre seines Lebens begleitet haben, sind immer noch wie neu, sorgfältig poliert und ohne ein Stäubchen. Felix weiß, daß die Sachen eine Menge wert sind, ausgesucht schöne, antike Stücke; aber das bedeutet ihm nichts.
Kein Laut ist zu hören, und in ihm breitet sich eine vage Beklemmung aus, wie Ringe im Wasser nach einem Steinwurf. Alles hier atmet noch die Gegenwart des Alten, jedes Stück der Inneneinrichtung weist auf ihn hin. In diesem Augenblick und an diesem Ort ist der Geist Heinrich Ringels noch so gegenwärtig und lebendig wie ehemals, und sein Enkel weiß, daß es eine ganze Weile dauern wird, bis ihm dieses Haus wirklich unbewohnt erscheint.
Das Haus ist nach dem Krieg gebaut, in den Sechzigern. Sein Großvater hat auch in einer Zeit, in der Geld knapp war, auf Qualität geachtet. Die Bauweise ist solider als die der anderen Gebäude in der Straße, und die Einrichtung ist auf Ewigkeiten ausgelegt: Stein- oder Parkettböden, Kacheln und Holzvertäfelungen, wo immer es möglich war. Bestimmt hat der Bau damals eine Menge Neid erzeugt und – als Balsam für die mißgünstigen Seelen – die Gerüchte über seine Vergangenheit weiter geschürt. Felix kann sich genau vorstellen, wie der Alte damals darauf reagiert hat.
Mit Gleichgültigkeit.
Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen ist eine der hervorstechendsten Eigenschaften des alten Ringel gewesen. Er hat sie alle ignoriert und zeigte ganz selten Interesse an fremden Personen. Seine Familie, ein paar Freunde, sie waren wichtig, alle anderen schienen ihm völlig gleichgültig zu sein. Anfangs wußte Felix nicht einmal, ob das nicht auch für einige Mitglieder der Familie galt.
Einmal, Felix mochte zehn Jahre alt gewesen sein, war er ein paar Tage bei seinem Opa zu Besuch gewesen. Die Eltern waren übers Wochenende fortgefahren und wußten ihn bei dem Alten in zuverlässigen Händen. Am Morgen kam ein junger Aushilfsbriefträger. Felix, sehr vorlaut für sein Alter, fragte ihn, wo der alte Postbote, den er von früheren Besuchen her kannte, sei. Er erfuhr, daß der Mann schwerkrank im Hospital lag.
Als er dies seinem Großvater erzählte, bekam er zur Antwort: »Aber wieso denn, ich habe ihm doch vorhin ein Einschreiben unterschrieben.« Er hatte offensichtlich nicht einmal wahrgenommen, daß der Briefträger diesmal ein viel jüngerer war als sonst.
Das war die Art Gleichgültigkeit, die Felix meinte. Ringel sah die Leute seiner Umgebung selektiv; einen Teil nahm er als Personen war, als Charaktere, die meisten aber nur als Gegenstände oder Funktionen.
Er wußte lange nicht, was er darüber denken sollte. Der alte Mann lehnte die wenigen freundlichen Angebote für zwischenmenschliche Kontakte ab, auf barsche, unfreundliche Art und so, daß dem anderen ein für alle Mal die Lust verging, es nochmals zu versuchen. Gegenüber der Familie und den Freunden war er umgänglich, in unterschiedlicher Abstufung. Am oberen Ende der nach unten offenen Umgänglichkeitsskala rangierte Felix und – mit ein wenig Abstand – seine Mutter. Die Schlußlichter waren seiner Schätzung nach Tante Monika und ihr Mann.
Felix’ Charakter unterschied sich von dem des Alten, deshalb verstand er erst spät, warum sich dieser so verhielt. Wie alles in dessen Leben hatte es mit seiner Vergangenheit zu tun und war nichts als ein Schutzmechanismus. Heinrich Ringel war eine Schildkröte, die sich bei Annäherung von etwas Ungewohntem in den Panzer zurückzieht, um den weichen, verletzlichen Körper vor Verletzung durch den potentiellen Feind in Sicherheit zu bringen.
Eine alte, vorsichtige Schildkröte.
Die dicke Holztür zum Arbeitszimmer ist nur angelehnt, Felix drückt sie auf. Er tritt ins Halbdunkel, ahnt die gediegene Inneneinrichtung mehr, als daß er sie sieht. Er würde hier jedes Detail mit verbundenen Augen erkennen. Dann haben sich die Augen an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt.
Das riesige Bücherregal. Felix hebt die Hand, ein Finger gleitet über die Rücken der alten Wälzer: deutsche Klassiker, zeitgeschichtliche Werke, dazu Schriften von Größen des Dritten Reiches. Als Kind hat er auch manchmal hier gestanden, mit fast der gleichen Neugierde, fast dem gleichen schlechten Gewissen und dem Gefühl, in verbotenes Gebiet einzudringen. Nie hat er eines der Bücher herausgezogen oder gar gewagt, eines aufzuschlagen. Es war keine Angst, es war nur das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun, vergleichbar mit dem Verstoß gegen eines der Zehn Gebote, nur viel konkreter.
Felix schüttelt den Kopf. Er ist jetzt älter, gereifter, und das Gefühl, eben noch ganz nah, verschwindet wie verwehender Rauch.
Ratlos sieht er sich um. Er ist hier, um etwas zu finden, und weiß nicht, was es ist. Der Raum bietet tausendundeine Möglichkeit zum Versteck; allein die Durchsuchung der Bücher würde Stunden dauern. Unschlüssig steht er da, die Hände in den Taschen.
Durch die Latten der Fensterläden dringen feine Streifen goldenen Lichtes und malen ein Muster von geometrischer Strenge in das Zimmer; in den Sonnenstrahlen tanzen Millionen kleinster Staubpartikel und bilden eine Galaxis in ständiger Bewegung. Er folgt den hellen Linien mit dem Blick, über Wände und Boden, zum Schreibtisch, der gerade in diesem Augenblick durch den Schatten des Fensterrahmens in zwei exakte Hälften geteilt wird. Wie magnetisiert macht er einen Schritt darauf zu.
Im Schatten des Rahmens liegt ein Stapel geöffneter Briefumschläge. Er nimmt ihn in die Hand. Es sind ältere Briefe, teilweise abgegriffen und verfärbt, offenbar Schriftwechsel mit Freunden, dazu zwei Briefe seiner Großmutter, die sie ihrem Mann vor langer Zeit aus der Schweiz geschrieben hat.
Verbotenes Terrain.
Er legt den Stapel zurück und beugt sich vor, über den Schreibtisch. Sein Hand gleitet suchend unter der Kante der Arbeitsplatte an der Wandseite hin und her. Wo war es nur?
Vor Jahren hat sein Großvater ihm das Geheimnis des massiven Sekretärs offenbart: Das Geheimfach ist hinter der Schublade in der Mitte des Tisches, läßt sich aber nur herausziehen, wenn vorher ein Hebel umgelegt wird. Der Hebel ist irgendwo an der Vorderseite des Schreibtisches. Felix hat ihn zwar damals nicht sehen können, aber er erinnert sich noch gut, wo der Alte gesucht hat.
Die Oberfläche des Holzes fühlt sich warm und glatt an, keine Spur von einem Hebel. Er tastet weiter, spürt schmerzhaft die Kante des Schreibtisches an seiner Hüfte, da, wo sich sein Körper aufstützt. Irgendwo hier muß das Ding sein. Dann stößt sein Zeigefinger an einen kleinen Vorsprung.
Felix drückt mit zwei Fingern darauf und spürt, wie der Vorsprung leicht nachgibt. Irgendwo im Inneren des Möbels rastet, mit deutlich hörbarem metallischen Klicken, ein Riegel ein. Anscheinend hatte sich sein Großvater damals nicht klar ausgedrückt: Es ist eher eine Art Knopf als ein Hebel.
Er richtet sich auf, zieht die Schublade vollständig heraus. Sie enthält Papier, Stifte, Briefmarken und andere Dinge, die in einen Schreibtisch gehören. Er stellt sie schnell auf die Arbeitsplatte und kniet sich hin. Am hinteren Ende der Schienen, die die Schublade gehalten haben, befindet sich noch eine zweite, viel kürzer als die erste und aus rohen, unlackierten Brettern; er zieht auch diese heraus. Der Inhalt wird sichtbar.
Der Umschlag des Briefes ist, im Gegensatz zu denen auf dem Tisch, neu und er ist zugeklebt. Die Adresse besteht aus einem einzigen Wort.
Felix.
4.
Geht es euch gut, meine Lieben? Habt Ihr genug Wasser?«
Das Pfeifen des Wasserkessels zerschneidet den halblaut gesprochenen Monolog des Mannes wie ein Sägeblatt, und gleichzeitig die Rede des Nachrichtensprechers aus dem Fernsehgerät im Hintergrund.
Ringelnatz erhebt sich schwerfällig aus den Tiefen des alten Sofas. Seine Füße tasten suchend nach den ausgetretenen Pantoffeln, die Agnes immer so gehaßt hat. Es sind zwar nicht mehr dieselben wie damals, aber er hat sich wieder ähnliche gekauft, als die alten nicht mehr zu gebrauchen waren. Das ist ein Jahr nach ihrem Auszug gewesen.
Fast acht Jahre ist es her. Seine Frau hat ihn von einem Tag auf den anderen verlassen, ohne Vorwarnung. Sie haben sich über die Jahre auseinandergelebt, das stimmte, und sein Beruf ist ihm immer wichtiger gewesen als sie, das stimmte auch. Trotzdem hat ihn die Trennung schwerer getroffen, als er geglaubt hat. Nicht sofort, in der ersten Zeit war er überwiegend mit der Pflege seiner gekränkten Eitelkeit und dem daraus entstandenen Zorn auf Agnes beschäftigt. Aber dann, nach ein paar Wochen, da trat das Selbstmitleid zurück und er begann, die Einsamkeit zu spüren.
Er geht hinüber, in die Küche der kleinen Wohnung, die er allein mit seinen zwei Sittichen bewohnt. Das Wasser brodelt hörbar im Inneren des Kessels, wie Lava in einem Vulkan kurz vor der Eruption. Ringelnatz nimmt die Pfeife ab, das Geräusch verstummt. Dann gießt er das kochende Wasser in die vorbereitete Tasse mit dem Teebeutel.