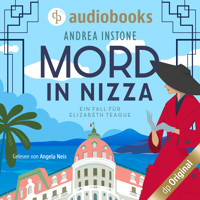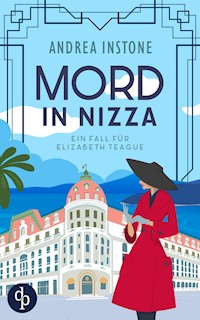Mrs. Arthur Tengye
Abschied ohne Worte
Bonn, September 1845
Als ich die Arscotts kennenlernte, ahnte ich nicht, wie diese Begegnung mein Leben verändern würde. Wie viele ihrer englischen Landsleute bereisten sie das Rheintal, das mit seinen Burgen und dem milden Klima ein beliebtes Ziel war, nachdem wenige Wochen zuvor Königin Victoria dieselbe Reise in die Heimat ihres Ehemannes unternommen hatte.
Wir trafen vor der Statue Beethovens zusammen. Iseuld spielte mit ihren Kindern Fangen, was ihre Mitreisenden empörte. Ich aber freute mich, wie die beiden Kleinen lachten, und beneidete sie sogar, denn ein solch ausgelassenes Miteinander kannte ich von meiner Familie nicht.
Vielleicht sollte ich dort beginnen: bei meiner Familie. Papa und ich lebten bei meinem Bruder Carl und seiner Gattin Bertha, ständig bemüht, ihnen nicht zur Last zu fallen. Deshalb hatte ich es übernommen, ihren verwöhnten Kindern Englisch, Französisch und Klavierspiel beizubringen. Weshalb Bertha die Gouvernante entlassen hatte; wenn sie auch nur einen Taler einsparen konnte, dann sagte sie nicht Nein. Als Schwägerin oder gar Schwester hatte sie mich eh nie betrachtet und so fiel es ihr leicht, in mir nichts weiter als eine Angestellte zu sehen. Eine, die nicht mehr kostete als einen Platz am Tisch und ein abgelegtes Kleid dann und wann.
Dafür erwartete sie viel: Luise und Alexander sollten manierlich schreiben, plaudern, musizieren und singen, niemandem außer mir auf die Nerven fallen und vor Gästen Eindruck machen. Beide waren hübsch, eitel und ließen sich gerne vorführen; sie spielten die Bescheidenen und taten so, als hingen sie an mir. Und ich tat so gut mit, dass mein Bruder nicht begriff, wie es wirklich um seine glückliche Familie stand.
Carl war es ein echtes Bedürfnis, Papa und mir zu helfen. Er betrachtete mich als seine Schwester, ohne Wenn und Aber, obwohl Bertha versucht hatte, mich als ferne Verwandte hinzustellen. Der Altersunterschied zwischen uns und dann noch meine Mutter – wie könne er da von Schwester sprechen? Überhaupt, meine Mutter! Was der alte Füssenich sich nur gedacht habe! Doch wie sie sich auch bemühte, in diesem Punkt ließ Carl sich nicht reinreden: Es habe sein Vater, wie jeder andere Mann, das Recht, seinem Herzen zu folgen, und er als sein Sohn habe die heilige Pflicht, sich um ihn und die Schwester zu kümmern. Oder wolle Bertha etwa die Frau eines Sünders sein?
Das wollte Bertha nicht, das hätte sich im Kreis ihrer vornehmen Freundinnen nicht gut gemacht. Vor ihnen sprach sie von mir als ihrer lieben Schwester, ohne deren Hilfe sie nicht leben könne. Dennoch wollte sie mich zu gerne loswerden und gelegentlich nahm sie mich zur Seite, um mir irgendeinen Mann schmackhaft zu machen. Sie ließ mich spüren, wie mein Vater und ich eine Belastung darstellten. Täglich klagte sie, dass sie nicht Herrin ihres Hauses sei und ständig Rücksicht auf einen Kranken nehmen müsse. Ebenso oft erklärte sie mir, wie schlecht es um die Finanzen der Füssenichs stünde: »Meine liebe Anna, Rücklagen haben wir keine und träfe uns ein Unglück, so wüssten wir kaum noch unser Essen zu bezahlen. Wenn du dich nur ein wenig freundlicher geben wolltest, dann würde der Herr Kommerzienrat Weber dir einen Antrag machen.«
Mit Kommerzienrat Weber kam sie mir seit Wochen ständig. Weit über fünfzig war der und drei Ehefrauen hatte er bereits unter die Erde gebracht. Allgemein ging man davon aus, dass sie es dort besser hatten. Er war ein Schwätzer und Vielfraß und verstand von nichts etwas außer vom Handel. Und als einen Handel sah er auch die Ehe an. In seinem Haus standen ein ungenutztes Klavier und ein leeres Bett – weshalb nicht eine vierte Frau nehmen und sich an Klavier wie Bett wieder erfreuen? Und warum nicht die Schwester vom Carl Füssenich? Schadete nicht, einem Bankier die Last abzunehmen, das konnte sich mal als nützlich erweisen. Und als Tochter vom alten Füssenich würde ich seine kulturbeflissenen Freunde am Klavier beeindrucken können.
Ja, bestimmt hatte Kommerzienrat Weber eine solche Rechnung aufgestellt und Bertha darauf hingewiesen, dass ich ein gutes Geschäft machen würde. Dass ich mit meinem hellen Haar, der fehlenden Mitgift und meinem Alter weder der herrschenden Mode noch dem Geschmack der meisten Herren entsprach, das erwähnte Bertha dauernd. »Meine liebe Anna, Kommerzienrat Weber ist ein reizender Herr in den besten Jahren und sehr verständnisvoll. Er wird dich gut versorgen und sogar deinen lieben Papa aufnehmen. Wie glücklich wir alle dann wären.«
Ich wäre glücklicher, wenn Papa mir erlaubt hätte, anderswo als Gouvernante zu arbeiten. Doch davon wollte er nichts hören. »Familie, Anna«, sagte er dann immer und zeigte mir auf, wie Carl dastünde, wenn ich mich so weit unter Stand begeben würde. Und selbst für seine eigensüchtige Schwiegertochter hatte Papa Verständnis; jede Frau wolle doch ihr Heim für sich und ihre Familie haben. »Und unter ihrer Anleitung sind deine Aussichten auf einen Ehemann höher als anderswo. Nimm mir diese Hoffnung nicht, mein Kind, ich möchte dich glücklich sehen. So glücklich, wie ich mit deiner Mama war.«
Manches Mal ging seine Rede im Husten unter, der ihn heftiger schüttelte mit jedem Monat. Heute denke ich, mein Vater wusste, wie wenig Zeit ihm blieb, ich aber träumte weiterhin von seiner Genesung. Um seinetwillen hielt ich durch.
An diesem Nachmittag Mitte September war Bertha mit den Kindern zu einer Feier geladen und so unternahm ich einen Spaziergang durch die Stadt. Es war ein sonnig warmer Tag und ohne festes Ziel ließ ich mich treiben. Ich hing meinem Lieblingstraum nach: Wenn Papa wieder gesund wäre, wollte ich mit ihm einen Musikalienhandel eröffnen. Sein Name galt etwas und vielleicht würden uns seine früheren Auftraggeber mit einem Kredit auf die Beine helfen. Wie viel die Musiker Bonns zuwege brachten, hatten sie mit dem Denkmal für unseren guten Beethoven bewiesen – da würden sie auch etwas für Papa tun können, der ihnen viele Jahre treu zur Hand gegangen war. Immer hieß es, es gäbe keinen besseren Notenstecher im gesamten Rheinland und keinen, der mehr Liebe zur Musik habe als Georg Friedrich Füssenich.
In diese Träumerei drangen Iseulds Lachen und das fröhliche Glucksen ihrer Kinder. Und die Stimme Caradocs, der sie amüsiert anfeuerte. Erst als ihre Reisegesellschaft sich um den älteren Herrn versammelte, der ihnen die Schönheiten meiner Stadt erklärte, unterbrachen die Arscotts ihr Spiel. Ich trat näher heran; es war lange her, dass ich Englisch hatte sprechen hören. Als aber dieser wichtigtuerische Mann mit Jahreszahlen und Geschichten um sich warf, die falscher kaum sein könnten, da musste ich sehr an mich halten.
Vermutlich las Iseuld an meiner Miene ab, was ich dachte. Sie zwinkerte mir zu und sprach mich an, als würden wir uns seit Kindertagen kennen. »Mr. Goodwill gibt wohl argen Unsinn von sich? Ich vermute das schon seit Tagen, aber ich habe nicht das Herz, ihn darauf anzusprechen.«
Es erstaunte mich, wie freimütig sie mit einer Fremden sprach, und schwieg überrascht.
»Oh, entschuldigen Sie, ich wollte mich nicht aufdrängen.«
»Aber nein.« Rasch hielt ich sie zurück. »Und Sie haben recht; Ihr Mr. Goodwill weiß nicht, wovon er spricht. Was verzeihlich wäre, wäre er dabei amüsant.«
»Amüsant? Himmel, nein. Jede Anekdote trägt er so ernst vor, dass es schmerzt. Aber sehen Sie, wie meine Mitreisenden an seinen Lippen hängen. Als verkünde er das Evangelium.« Sie beugte sich vertraulich an mein Ohr. »Wir reisen mit Dummköpfen.«
»Nicht dümmer, als es die meisten Menschen sind«, flüsterte ich zurück.
Leise lachte sie. »Nun, so ist es eben, wenn man sich einer Gruppe anschließt, weil man glaubt, es mache das Reisen einfacher. Aber denken Sie bitte nicht, ich wäre boshaft. Ich bin nur enttäuscht.«
»Nicht zu sehr, hoffe ich? Es täte mir leid, nähmen Sie keine freundliche Erinnerung an meine Stadt mit.«
»Wenn Sie uns Bonn zeigen, dann wird das nicht geschehen.« Sie wartete meine Antwort nicht ab, sondern winkte ihren Mann heran und erklärte, sie würden nun mit mir die Stadt besichtigen.
Er schien daran gewöhnt zu sein, die Wünsche seiner Frau zu erfüllen. Lächelnd verbeugte er sich. »Ich nehme an, Sie wissen nicht einmal, mit wem Sie es zu tun haben. Wenn ich uns vorstellen darf: Caradoc Arscott aus London. Meine Gattin hört auf den Namen Iseuld. Manchmal zumindest.«
Caradoc war charmant und wie Iseuld frei von Förmlichkeit; er war mir auf Anhieb sympathisch. Ganz, wie es sich gehörte, knickste ich und stellte mich vor. »Anna Füssenich.«
»Ach herrje«, rief Iseuld aus, »Fussänisch? Sie können nicht erwarten, dass wir diesen Namen aussprechen. Lassen Sie mich Anna sagen, ja?«
Ich stimmte zu, denn längst kam es mir so vor, als wären wir langjährige Vertraute. Iseuld schien mir kaum älter als ich zu sein und als auch noch ihr Töchterchen, ein Mädchen von vier Jahren etwa, nach meiner Hand griff, schmolz ich dahin.
»Das ist Jenefer. Sie hat ein gutes Gespür für Menschen.«
Ich bückte mich zu Jenefer, dankte für ihre Aufmerksamkeit und fragte nach dem Namen ihres Bruders. Mit wichtiger Miene zog sie den Jungen heran und stellte ihn als ihren Zwillingsbruder Petrok vor. Beide waren sie so zart und dunkelhaarig wie ihre Mutter, doch der Namen wegen und weil Caradoc groß, breit und rothaarig war, hielt ich die Arscotts für Schotten. Doch ich irrte mich Aus Cornwall stammten sie und sowohl in Caradocs wie auch in Iseulds Familie pflegte man die alten Namen der Gegend. Das schien mir eine tiefe Verbundenheit zu zeigen – zu den Ahnen, zur Vergangenheit, zur Heimat.
Wir spazierten gute drei Stunden durch die Straßen und Gassen Bonns. Ins Münster führte ich die Arscotts und zur Universität; ich zeigte ihnen, wo Beethoven geboren worden war und wo der englische Prinzgemahl Albert gewohnt hatte. Dabei unterhielten wir uns mit einer vertrauten Leichtigkeit, die man selbst unter Freundinnen nur selten findet. Bald sprach ich von Bertha und wie mir nicht viel anderes bliebe, als einen von ihr gewählten Mann zum Gatten zu nehmen.
Ein Vorhaben, das sowohl Iseuld wie auch Caradoc unklug erschien. Natürlich müsse eine junge Frau darauf achten, wie ihr zukünftiger Mann aufgestellt sei; es überdauere kaum eine Liebe Jahrzehnte der Armut. Aber eine Ehe nur aus finanziellen Gründen zu schließen, sei ebenso dumm. Um glücklich zu werden, bedürfe es des guten Charakters beider Parteien, der gegenseitigen Zuneigung und der Sicherheit, eine Familie versorgen zu können. Wo eine dieser Voraussetzungen fehle, so erklärte Caradoc, wäre eine Dame besser beraten, eine Stelle als Gouvernante anzunehmen. Eine solche Stelle ließe sich bei meinen Kenntnissen und meiner liebenswürdigen Wesensart leicht finden.
»Es kann in Deutschland so anders nicht sein als bei uns. Wir alle wollen unsere Kinder in den besten Händen wissen und jemand wie Sie, Miss Anna, wäre für jede Familie ein höchst willkommenes Mitglied.«
Ich dankte für das Kompliment, das mir aufrichtig wohltat. Als es Zeit für mich war, nach Hause zu eilen, verabredeten wir uns erneut für den nächsten Tag. Die Arscotts wollten eine Kutsche mieten und nach Brühl hinausfahren und unbedingt müsse ich mitkommen. Ich wollte nichts versprechen, da ich Berthas Pläne nicht kannte, aber als Iseuld mich daran erinnerte, dass ich eben nicht die Gouvernante sei, sondern die Schwägerin, sagte ich zu.
Daheim angelangt empfing mich Bertha mit Vorwürfen. Wo ich so lange gesteckt habe, wollte sie wissen. Was mir denn einfiele, über Stunden alleine unterwegs zu sein, und ob ich den guten Ruf der Füssenichs mit Füßen treten wolle. Das brachte mich zum Kichern und ich erwiderte, das läge in meiner Natur, sonst hieße ich ja Händenich. Was Bertha noch böser machte. Gerne hätte sie mich auf mein Zimmer gesandt, aber Carl verbat sich die Schimpferei; seine Schwester sei kein Kind mehr und als anständiges Fräulein bekannt, dürfe sie einmal einen Spaziergang unternehmen, ohne dass sein Ruf darunter leide.
Bertha gab Ruhe. Und bemerkte wie nebenbei, ich solle morgen Nachmittag ihr grünes Kleid tragen und Marie bitten, meine Haare zu locken. »Vielleicht legst du ein wenig von dem Balsam auf, dass du frisch und nett aussiehst.«
Der Balsam. Schminke war es, die Bertha in Paris bestellte und so geschickt auflegte, dass sie oftmals für jünger gehalten wurde, als sie war. Ich fand das albern. Bertha war dreißig Jahre alt und bereits Mutter zweier großer Kinder – was wollte sie da aussehen wie ein junges Mädchen? Ich kicherte wieder, bis mir aufging, weshalb sie wollte, dass ich frisch und nett aussehe und ihr grünes Kleid trage: Kommerzienrat Weber würde mit uns Tee trinken und mich danach zu einem Konzert ausführen.
»Aber liebe Bertha, ich würde niemals Carls Ruf schädigen wollen! Ich kann unmöglich mit einem Herrn in der Öffentlichkeit erscheinen. Was denkst du dir nur?«
»Es spricht nichts dagegen, mit deinem Verlobten ein Konzert bei Freunden zu besuchen. Carl hat seinem Antrag bereits zugestimmt.«
Mein Verlobter? Und Carl hatte zugestimmt? Entsetzt drehte ich mich zu ihm und verlangte zu erfahren, wie er dazu käme. »Ich habe wohl auch ein Wörtchen mitzureden in dieser Angelegenheit, meinst du nicht?«
Ehrlich erschrocken schaute mein Bruder mich an und fragend blickte er zu Bertha, die mit den Schultern zuckte und ihre Suppe löffelte. Carl räusperte sich. »Nun, liebe Anna, Kommerzienrat Weber versicherte mir, er habe dein Herz errungen. Du willst ihn doch nicht der Lüge bezichtigen?«
»Mein Herz? Natürlich lügt er! Hast du ihn dir einmal angesehen? Hast du ihm zugehört? Wirklich zugehört? Wie kannst du nur glauben, ich könnte mich in so jemanden verlieben?«
»Aber Anna, er ist ein Geschäftsmann von bestem Ruf. Gelogen hat er keinesfalls und so musst du dir vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, mit seinen Gefühlen gespielt zu haben.«
»Bitte?« Das war doch nicht mein Bruder, der da sprach! Ich wandte mich an Bertha. »Was hast du dem Weber gesagt?«
»Welch eine Sprache du führst. Der Weber, ich bitte dich. Ich habe immer gesagt, wir lassen dir zu viel durchgehen.«
»Was hast du ihm gesagt?«
»Nichts. Was sollte ich ihm gesagt haben? Erinnere dich bitte, wie es wirklich war.«
Ich wusste nicht, wovon sie sprach.
»Bei Rüttermanns. Der Kommerzienrat war dein Tischherr und du hast seinen Komplimenten so viel Aufmerksamkeit entgegengebracht, dass er sich ermutigt fühlen durfte.«
»Aber ich war nur höflich!«
»Nun, er sagte mir, und er sagte es auch Carl, dass er dir gestanden hat, wie viel er für dich empfindet und dass du ihm …«
»Empfindet? Er sagte, ich sei eine ausgezeichnete Pianistin und er bewundere meinen gesunden Appetit!«
Wieder zuckte Bertha mit den Schultern, doch mein Bruder tupfte sich den Mund ab, legte die Serviette beiseite und schickte die Kinder und seine Frau aus dem Raum. Dann bat er, ich möge nicht brüllen, das sei vulgär. »Anna, du kannst nicht sagen, ich hätte nicht immer das größte Verständnis für dich gehabt, nicht wahr? Und du kannst auch nicht sagen, ich hätte dich jemals dazu gedrängt, dich zu verheiraten. Ich weiß, wie sehr du an Papa hängst und wie er nur für dich noch lebt. Nein, bitte, unterbrich mich nicht. Ich weiß auch, du neigst gelegentlich dazu, mit mehr Temperament zu antworten, als es einer jungen Frau geziemt, und ich habe das nie beklagt. Aber wenn es jetzt dazu führt, dass du einen guten Mann der Lüge bezichtigst, nachdem du deinen weiblichen Charme an ihm erprobt und deine Eitelkeit an seinen Schmeicheleien gestillt hast, dann muss ich dir sagen, es geht zu weit.«
»Meine Eitelkeit? Ich …«
»Nein! Du hörst mir zu. Kommerzienrat Weber hat mich heute Nachmittag in der Bank aufgesucht und um deine Hand angehalten. Und ich war nicht allzu überrascht, denn er hat uns in der letzten Zeit öfter aufgesucht als sonst. Dass er nicht um meinetwillen kommt oder um Luises Klimperei zu lauschen, muss dir ebenso klar gewesen sein wie mir. Ich habe dich mehr als einmal im Gespräch mit ihm gesehen und deine Miene, Anna, war stets von Liebenswürdigkeit und Entgegenkommen. Jeder Mann hätte geglaubt, du nehmest seine Komplimente gerne entgegen. Wenn ich jemals Ermutigung gesehen habe, dann bei dir.«
»Dann weißt du nicht, wie Ermutigung aussieht. Oder du bist blind!«
»Anna!«
»Auf keinen Fall heirate ich Weber!«
»Ich habe ihm mein Wort gegeben!«
»Dann heirate du ihn!«
»So also zeigst du deine Dankbarkeit?«
»Dir bin ich dankbar, wirklich, aber Bertha …«
»Ruhe jetzt! Gegen meine Gattin kein Wort! Nicht jede Frau hätte dich aufgenommen, wie sie es tat.«
»Da magst du wohl recht haben!«
Carl blickte mich an, böser, als ich ihn jemals gesehen hatte. Dann holte er tief Luft. »Ich möchte nicht mit dir streiten und ich billige dir zu, aufgeregt zu sein, da dein Handeln dich in diese Lage gebracht hat. Aus dir spricht die verständliche Bangigkeit einer jungen Frau vor der Ehe. Aber ich versichere dir, der Kommerzienrat ist ein anständiger Mann, der selbst in Herrenzirkeln nie auch nur ein unziemliches Wort über eine Frau fallen lässt. Du kannst dich ihm völlig anvertrauen.«
»Damit er mich auch ins Grab bringt? Das willst du für mich?« Ich stand auf und setzte mich neben meinen Bruder. »Liebster Carl, ich versichere dir aufrichtig, ich habe ihm niemals Hoffnung gemacht, sondern im Gegenteil sogar erklärt, dass ich nicht an die Ehe denke.«
»Anna, er hat dich gefragt, ob es einen Mann gibt, an den du denkst. Und du hast das verneint. Was hast du denn geglaubt, worauf er mit dieser Frage abzielt?«
»Er stellt mir immerzu unverschämte Fragen, wie sollte ich da …«
Carl nahm meine Hände, seufzte. »Höre mich an: Unser Vater ist ein alter Mann, der sehr krank ist und mir oft gesagt hat, wie sehr er sich wünscht, deine Zukunft gesichert zu sehen. Selbstverständlich werde ich auch für dich sorgen, solltest du niemals heiraten, aber es muss dir klar sein, dass es nicht ausreichen kann, um dir ein sorgenfreies Leben zu garantieren.«
»Aber das erwarte ich nicht. Und Papa und ich – schau, wenn du uns hilfst, ein Geschäft …«
»Was ist das nur immer für eine Idee mit der Musikalienhandlung? Anna, mach die Augen auf: Vater ist deshalb zu mir gezogen, weil er nicht erleben wollte, wie du an seiner Pflege zugrunde gehst und als alte Jungfer zurückbleibst. Nichts wünscht er sich so sehr, als dich in guten Verhältnissen zu wissen, und niemand könnte besser dafür sorgen als Bertha und ich. Vergiss einmal, dass ich dein Bruder bin, sieh in mir etwas wie deinen zweiten Vater – einen, der tatkräftig ist und sich auskennt in der guten Gesellschaft und deshalb tun kann, was dein Papa nicht mehr erledigen kann.«
»Papa wünscht sich mein Glück, nicht …«
»Anna, wie kann dein Glück darin bestehen, Bertha zu brüskieren, die dich so sehr liebt? Wie kannst du Glück darin finden, meinen Rat zurückzuweisen und deinen kranken Vater mit seiner Sorge um dich zu quälen?«
Carl hatte recht, Papa wünschte sich all das. Aber niemals würde er wollen, ich heirate den falschen Mann. Das sagte ich Carl und bat ihn, mir zu helfen. »Ich bin ja bereit, zu heiraten, wirklich, ich werde mich nicht sträuben, wenn du mir einen bringst, der zu mir passt. Aber ich kann Weber nicht heiraten. Bitte, hilf mir. Bitte.«
»Anna, ich habe ihm mein Wort gegeben. Ich kann es nicht zurücknehmen. Wie stünde ich da, wenn der Kommerzienrat mich als Lügner hinstellt? Das kann ich mir nicht leisten, das …«
»Aber wenn er mich wirklich liebt, so wird er über diese Geschichte schweigen. Carl, bitte, ich …«
Ich weiß nicht, ob ich meinen Bruder überzeugt hatte, denn meine Schwägerin trat ins Zimmer. Sie lächelte und zog mich mit sich hinauf in den zweiten Stock, wo Papa in seinem Krankenzimmer lag. Zu ihm brachte sie mich, denn nichts Eiligeres hatte sie zu tun gehabt, als zu ihm zu gehen und ihm von meiner Verlobung zu erzählen.
Papa empfing mich mit einem Lächeln, das ich lange nicht von ihm gesehen hatte. Da waren weder Sorge noch Trauer in seinem Blick, ja, er hatte sich sogar aufgerichtet und streckte beide Arme nach mir aus. »Mein liebes, liebes Kind, wie froh ich bin, wie unendlich froh und glücklich. Und deine Mama wird wohl von oben auf dich hinabblicken und dir den Segen des Himmels senden.«
Ich weinte. Vor Freude, Papa so zu sehen. Und vor Trauer über mein Schicksal. Ich brachte es nicht über mich, ihm zu sagen, Bertha habe sich geirrt. Ich sprach nicht davon, wie widerlich mir der Mann war, den er als meinen Retter pries. Stattdessen legte ich mich in Papas Arme und behauptete, so glücklich zu sein wie er. Als Carl dazukam, war keine Rede mehr davon, mir aus dieser Lage herauszuhelfen.
An die Arscotts und unsere Verabredung dachte ich nicht mehr. Ich saß bis spät in die Nacht bei Papa und hörte zu, wie er von Mama sprach, von ihrem Kennenlernen und den glücklichen Jahren, die sie gemeinsam verbringen durften. Er sprach auch von Carls Mutter, der er kaum weniger herzlich zugetan gewesen war und nach deren Tod er nicht gehofft hatte, noch einmal die Liebe zu finden. Ich weiß nicht, ob er mir damit sagen wollte, es könne auch für mich ein zweites Glück geben, wenn der Kommerzienrat nicht mehr lebe; ich würde das gerne glauben, denn Papa musste doch gespürt haben, wie ich wirklich fühlte. Aber er betonte immer wieder, welch eine Last ihm von der Seele genommen sei.
Irgendwann, weit nach Mitternacht, als Papa mehr hustete als sprach, ging ich zu Bett und schnell schlief ich ein. Ich weinte nicht, ich wütete nicht – ich nahm hin, was geschehen würde, das war mir Papas Glück wert. Ich schlief traumlos und tief. Bis Carl mich weckte. Die Sonne schien bereits in mein Zimmer und ärgerlich fragte ich ihn, weshalb man mich so lange habe schlafen lassen.
»Vater hat darum gebeten, dich nicht zu stören. Deine ersten Träume als glückliche Braut sind heilig.«
Was hatte Papa damit zu tun, ob man mich zum Frühstück holte oder nicht? Ich suchte in Carls Gesicht nach der Antwort, doch da nahm er mich schon in die Arme, küsste meine Stirn und bat, ich möge mir rasch etwas überziehen; es bliebe nicht mehr allzu viel Zeit.
Ich hielt mich nicht damit auf, nach meinem Morgenmantel zu greifen. Aus dem Bett hinaus, durch den Flur hindurch und schon stand ich in Papas Schlafzimmer. Da lag mein Vater und war so weiß wie die Kissen, seine Augen lagen in schwarzen Höhlen und sein Atem ging stoßweise. Dennoch versuchte er, sich aufzurichten, als er mich sah, wurde daran jedoch von unserem Hausarzt gehindert.
»Ruhig, alter Freund, dein Mädchen ist ja da.«
Papa wisperte etwas, was kaum zu verstehen war. Nur das Wort Braut war klar und deutlich. Weinend stürzte ich zu ihm, nahm ihn in die Arme, wollte nicht wahrhaben, was geschah. Und hatte nur wenige Augenblicke, mich von ihm zu verabschieden. Mit einem Lächeln starb er, glücklich im Glauben, es werde sein geliebtes Kind Trost in den Armen eines guten Mannes finden.
Gegen elf Uhr hatte ich keine Tränen mehr; leer und taub war ich. Ich ging auf mein Zimmer, unsicher, was ich mit mir anfangen sollte. Ich legte mich hin, verkroch mich unter der Bettdecke. Und fuhr auf, als wenig später Bertha eintrat und mich aufforderte, aufzustehen und mich zurechtzumachen. »Die Nachbarn sind gekommen, dir ihr Beileid auszusprechen. Beeile dich.«
Ich bat sie, statt meiner die Bekundungen entgegenzunehmen; ich konnte und wollte das nicht durchstehen. Das gefiel Bertha nicht, aber dennoch übernahm sie meine Aufgabe und verließ mich. Ich war ihr dankbar, glaubte, sie nehme Rücksicht auf mich. Das Essen ließ sie mir aufs Zimmer servieren, Tee auch und sogar ein wenig Konfekt. Und dann schickte sie Marie zu mir. Um mich schön zu machen für den Besuch des Herrn Kommerzienrats.
Ich rannte zu ihr, fragte, was das solle.
»Beruhige dich bitte. Natürlich werdet ihr euch heute nicht verloben. Nicht offiziell. Aber ich habe ihn von unserem Unglücksfall in Kenntnis gesetzt und selbstverständlich will er sich in dieser schweren Zeit um dich kümmern. Wenn du deine Karten geschickt ausspielst, mag es sein, er zahlt die Kosten für die Beerdigung.«
Ich verstand sie nicht. Wie konnte sie an einem solchen Tag an so etwas denken? Wie konnte überhaupt irgendwer an irgendetwas denken? Ich konnte keinen einzigen Gedanken fassen, ich war überwältigt von Trauer.
»Aber Anna, fasse dich doch bitte. Dein Vater war bald siebzig und lange schon krank. Du musst gewusst haben, wie es um ihn steht. Jetzt ist es Zeit, nach vorne zu schauen und den letzten Wunsch deines lieben Papas zu erfüllen.«
Papas letzter Wunsch konnte doch nicht gewesen sein, ich solle ihn in wenigen Stunden schon vergessen und einen widerwärtigen Mann heiraten? Ich sah Bertha an und sah nichts als eine eitle und gemeine Frau, der ich völlig gleichgültig war. Ich musste fort von hier, jetzt gleich.
Ich nickte und sagte, ich wolle einmal noch zu Papa, dann wolle ich mich auf den Nachmittag vorbereiten. Und Bertha glaubte mir! Wie konnte sie nur glauben, ich wolle ihrem Rat folgen an solch einem Tag? Und wie konnte sie seit Jahren schon eine solche Kaltschnäuzigkeit vor meinem Bruder verbergen?
Ich stieg hinauf und verabschiedete mich zum letzten Mal von meinem Vater. Was mir leicht wurde, als ich spürte, dass nichts mehr von ihm hier war außer seines kalten Körpers. Alles, was ihn ausgemacht hatte, lebte fort in meinen Erinnerungen und jenen der Menschen, die mit ihm zu tun gehabt hatten. Rasch packte ich meine wenigen Habseligkeiten und einige Erinnerungsstücke und schlüpfte ungesehen aus dem Haus.
Nach vorn sehen
Bonn, 18. September 1845
Vom Hause meines Bruders bis zum Hotel Zum Goldenen Stern war es nicht weit. Ich trat ein und fragte nach den Arscotts, hoffend, sie wären ohne mich nicht nach Brühl gefahren. Doch weshalb sollten sie auf eine ihnen kaum bekannte Frau warten? Wie konnte ich mir von ihnen Hilfe erwarten, wenn nicht einmal mein Bruder mir beistand? Und wie war ich überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet heute Carls Haus zu verlassen? Was würden die Leute über mich sagen? Schon wollte ich zurück und tun, was sich gehörte: trauern und heiraten. Und mich lebendig begraben lassen.
Aber als der Portier mir mitteilte, es seien die Engländer erst vor zwei Stunden aufgebrochen, da erwachte in mir neue Zuversicht. Sie hatten also ausgeharrt, bis sie sicher waren, ich käme nicht mehr. Ich bat darum, in der Hotelhalle warten zu dürfen, was der gute Mann mit einigem Misstrauen aufnahm. Eine junge Frau mit einer ausgebeulten Reisetasche, die Haare kaum frisiert, aufgeregt, nervös und fiebrig – so eine gefiel ihm nicht. Er fragte, in welcher Angelegenheit ich seine Gäste zu sprechen wünsche. Was konnte ich anderes sagen, als dass ich die bestellte Gouvernante sei?
Das nun schien ihm zu meinem Auftreten zu passen und mitfühlend erkundigte er sich, was mein rechtzeitiges Erscheinen verhindert habe. Also log ich ein weiteres Mal und erklärte, es habe Schwierigkeiten mit der Eisenbahn gegeben. Was er mir ohne Weiteres glaubte. Seit einem guten Jahr fuhren Bahnen zwischen Köln und Bonn und in der Bevölkerung hielten sich die Freude über den Fortschritt und die Kritik an Lärm, Dreck und Verspätungen die Waage. Der Portier nahm mir die Tasche ab und führte mich in den Speisesaal, wobei er mir erklärte, weshalb die Eisenbahn eine gute Sache für das Hotelwesen sei. Dann fragte er, ob ich nicht etwas essen wolle; ich mache ihm ganz den Eindruck, als brauche ich eine Stärkung.
Ich hatte nur vier Taler, zwölf Groschen und einige Pfennige bei mir. Durchaus ausreichend, um eine Familie durch zehn Tage zu bringen, aber bei Weitem nicht genug, wenn die Arscotts keine Gouvernante einstellen wollten und ich auf eigenen Füßen stehen müsste. Doch der Portier flüsterte mir zu, es werde mein Mahl natürlich meinen Arbeitgebern auf die Rechnung gesetzt. »Glauben Sie mir, Fräulein, die können sich das leisten.«
Ich aß langsam und konzentriert; ich wollte nicht in Tränen ausbrechen. Wie ich da saß, dachte ich pausenlos an Papa und ob er mir wohl verzeihen würde, wenn er wüsste, was ich tat und dass ich sein Begräbnis Bertha überließ. War ich eine schlechte Tochter? Würde er sich im Himmel grämen? Wirklich, diese Gedanken quälten mich. Eigensüchtig schimpfte ich mich, pflichtvergessen und verdorben. Nichts wünschte ich mir sehnlicher als irgendein Zeichen, das mir sagte, ich tat das Richtige. Ich war nie abergläubisch gewesen, aber in meiner Trauer suchte ich verzweifelt nach Halt, von wo auch immer er kommen mochte.
Mitten in diese Grübeleien trat ein älterer Herr, der mir auf die Schulter tippte und fragte, ob ich nicht die Tochter vom lieben Füssenich sei. Im ersten Moment befürchtete ich, man würde bereits nach mir suchen, doch er setzte sich, bestellte einen Mokka und schien wenig geneigt, mich zurück zu meinem Bruder zu schleifen. »Ich täusche mich nicht«, sagte er im singenden Bönnsch, »Sie sind die Anna, ja? Sie sind Ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Das war auch eine feine Frau. Traurig das, sehr traurig. Aber sagen Sie, wie geht es meinem lieben Freund Georg? Was macht die Lunge?«
Mit meiner Contenance war es aus. Bitterlich weinte ich, was den armen Mann erschreckte. Ein Taschentuch reichte er mir und hektisch winkte er nach dem Kellner, den er um ein Glas Schnaps bat.
»Mein bestes Fräulein Füssenich, was ist Ihnen denn nur? Sagen Sie nicht, Ihr werter Herr Papa … Ich sehe es Ihrem Gesicht an. Wann ist es denn geschehen?«
»Heute Morgen«, wisperte ich.
»Ach herrje, wie schrecklich! Mein liebes Fräulein Füssenich, was kann ich sagen? Was kann ich tun?«
Dann schien ihm klar zu werden, wie ungewöhnlich es war, mich in einem Hotelspeiseraum zu finden, obwohl ich doch daheim hätte sein müssen. Sein Blick fiel auf meine Reisetasche. Bevor ich ihm eine Lüge auftischen konnte, legte er seine Hände auf meine. Echtes Mitleid lag in seiner Miene und mit warmen Worten versicherte er, wie er mit mir fühle.
»Sehen Sie es doch bitte mal so, Fräulein Füssenich: Sie gehen Ihren Weg jetzt alleine, aber Ihr guter Vater hat mit seiner Liebe dafür gesorgt, dass Sie stets in den rechten Pfad einbiegen.«
Damit erhob er sich und versprach, am Abend bei uns vorbeizukommen, um seinem Freund Georg den letzten Gruß zu entbieten. Wie ein Engel kam er mir vor und was sonst war sein Erscheinen als das von mir gewünschte Zeichen?
Ab da saß ich wie auf glühenden Kohlen. Was, wenn die Arscotts erst spät in der Nacht zurückkehrten? Dann würden Carl und Bertha von diesem netten Mann erfahren, wo ich war, und danach würde Carl mir nie wieder vertrauen. Und wer sagte mir denn, dass die Arscotts mir helfen würden, selbst wenn sie früh genug zurückkehrten?
Mittlerweile war es drei Uhr nachmittags und Kommerzienrat Weber würde nun wohl hören, dass ich leider unpässlich sei. Bertha würde die Wahrheit nicht sagen, bis es unumgänglich war.
Ich saß im behaglichen Lesezimmer und versuchte, mich abzulenken. Ich las die ersten Seiten eines Romans über einen König namens Artus und erinnerte mich dunkel, dass Papa mir Geschichten über diesen edelsten aller Ritter erzählt hatte. Doch das Gerede von Ehre und Heldenmut konnte mich nicht fesseln und so griff ich nach einem anderen Buch. Um eine junge Frau ging es, die von der Natur nicht zur Heldin ausersehen war und dennoch dazu wurde. Das zumindest versprach die Autorin. Und wirklich ließ Miss Morland ihr Dorf hinter sich und reiste nach Bath, wo sie eine Freundin und einen Verehrer fand. Die Autorin spottete voller Humor über die Ernsthaftigkeit, mit der wir an Schauermärchen glauben wollten.
Ich konnte diese Faszination für das Düstere nicht nachvollziehen. Vielleicht, weil meine Umstände jenen dieser Heldin ähnelten: Die einsame Waise, die nur an ihre Ehre denkende Familie, das Fehlen liebender Freunde und die Notwendigkeit, ein Auskommen zu finden – ja, aus mir ließe sich eine solche Heldin schaffen, mir konnte man leicht ein unheilvolles Schicksal andichten. Und vielleicht hatte mein Unglück schon begonnen? Ich schüttelte mich und las weiter, entschlossen, von jetzt an mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen.
Dann sprang die Tür auf. Iseuld lief auf mich zu, hakte mich unter und fragte, weshalb ich nicht mit ihnen nach Brühl gefahren sei; ob die böse Bertha sich mir in den Weg gestellt habe.
Wieder weinte ich und Iseuld erwies sich als wahre Freundin. Obwohl ich kein Wort herausbrachte, nahm sie mich in die Arme, streichelte meinen Rücken und äußerte schließlich die Vermutung, es sei meinen Vater etwas zugestoßen.
»So, wie du uns seine Krankheit geschildert hast, befürchtete ich, dass er nicht mehr zu viel Zeit auf Erden hat.«
Ich nickte nur und klammerte mich an ihr fest.
»Denke immer daran, wie gut sein Leben war mit einer liebenden Tochter wie dir. Ich bin überzeugt, er ist glücklich gestorben und ist nun schon mit deiner Mutter im Himmel vereint.«
Gegen meinen Willen lachte ich, denn ich stellte mir vor, wie dort oben nicht nur meine Mama, sondern ebenso Carls Mutter auf Papa wartete. Ich schämte mich fürchterlich meiner Albernheit, doch Iseuld meinte, es sei sehr gut, dass ich so froh an das ewige Leben meines Vaters denken könne; das würde ihm bestimmt gefallen. Ihre Worte trösteten mich und schon für diesen Trost hatte das bange Warten sich gelohnt. Nun aber traute ich mich nicht, ihr zu sagen, weshalb ich wirklich gekommen war.
Doch wieder überraschte Iseuld mich. »Sage mir, als Caradoc gestern davon sprach, es wäre besser als Gouvernante zu arbeiten, als den falschen Mann zu heiraten – hat dich das darauf gebracht, es mit diesem Beruf versuchen zu wollen?«
War ich so leicht zu durchschauen? Es war mir entsetzlich peinlich; bestimmt glaubte Iseuld, ich wolle sie ausnutzen. Ich wollte sagen, ich erwarte nichts von ihr, da unterbrach sie mich.
»Ich habe mit Caradoc geschimpft, weil er dich fast gefragt hätte, ob du mit uns kommen willst. Als ob man durch die Lande fahren und anständige Damen fragen kann, ob sie für uns arbeiten wollen! Aber ich werde ihm wohl Abbitte leisten müssen.« Sie seufzte. »Damit wird er mich noch tagelang aufziehen. Grässlich.«
Sie führte mich hinauf in ihre Suite, wo sie Caradoc mitteilte, er habe recht gehabt und Miss Anna überzeugt; nun solle er gefälligst ein anständiges Angebot machen und ein Zimmer für mich buchen. Da musste ich eingreifen. War es mir schon peinlich gewesen, Iseuld zu sagen, weshalb ich gekommen war, so war es mir nun noch viel unangenehmer, als ich gestehen musste, ich müsse schnellstens aus Bonn weg, da ich ansonsten die vierte Frau des Kommerzienrats werden müsse. Ich bot an, alleine vorauszufahren, wenn sie mich unter diesen Umständen noch einstellen wollten. Es war etwas völlig anderes, eine Waise zu beschäftigen oder aber die Schwester eines Mannes mit sich zu nehmen, die als Verlobte eines einflussreichen Herrn gelten konnte – würde Carl sich an die Polizei wenden, so könnte die von einer Entführung sprechen! Ich war mir sehr bewusst, in welche Lage ich die Arscotts brachte, die mir nichts schuldeten und mich gerade einmal einen Nachmittag kannten. Ich ging davon aus, sie würden ihr Angebot zurückziehen.
Aber Iseuld schaute mich schweigend an, zog dann die Klingelschnur und packte ihre Bürsten, Kämme und Parfüms in ein Kästchen. Caradoc strich sich übers Kinn, nickte und eilte aus dem Zimmer. Ich ging ihm nach, doch Iseuld hielt mich an der Tür zurück.
»Was denkst du denn? Dass er deinen Bruder holt? Er bestellt einen Wagen und meldet uns in der Reisegruppe ab. Wie wäre es, wenn du nach nebenan gehst und den Kindern sagst, dass wir abreisen? Und dass du mit uns kommst? Sie werden sich freuen und Jenefer wird dich bis London nicht in Ruhe lassen, bis du alle Märchen wenigstens zehn Mal erzählt hast.«
Wir saßen eine Stunde später in der Kutsche und fuhren am Rhein entlang hinauf nach Köln. Dort stiegen wir gegen zehn Uhr abends in die Eisenbahn, die uns nach Ostende brachte, wo wir um sechs Uhr morgens eintrafen. Für die Kinder war es eine aufregende Fahrt; Petrok sah in mir eine Prinzessin, für deren Rettung er sorgen müsse. Jenefer hingegen schien mehr von den Gesprächen zu verstehen, die ihre Eltern mit mir führten, denn irgendwann im Laufe der Nacht nahm sie ihren Vater an der Hand und ließ ihn feierlich schwören, er werde sie niemals an einen bösen Mann verheiraten. Das versprach er und Iseuld fügte hinzu, es hätten die Tengyes immer schon aus Liebe geheiratet und sie sähe nicht ein, weshalb Jenefer es anders halten solle, nur weil sie Arscott heiße. Mir zwinkerte sie zu und flüsterte, es möge wohl sein, dass manche Ahnin die Liebe erst entdeckt habe, nachdem sie sich von Einfluss und Reichtum des Bewerbers überzeugt hatte. »Aber wir Tengyes sind ein eigenes Völkchen. Was wir tun, das tun wir ganz.«
Caradoc seufzte leise. »Deine Brüder beweisen das immer wieder.«
»Das hat nichts mit dem zu tun, was ich unserer Tochter rate.« Iseulds Entgegnung klang in meinen Ohren recht scharf, doch als ich zu ihr hinsah, schmunzelte sie und meinte, sie wolle ein Stündchen schlafen und empfehle uns, es ihr gleichzutun.
Um sieben Uhr erreichten wir Ostende, wo wir in einer Brasserie frühstückten. Zwei Stunden später bestiegen wir das Dampfschiff. Iseuld fühlte sich an Bord nicht wohl und auch die Kinder litten unter Schwindel und Übelkeit. Meine Hilfe lehnte sie ab, sie wollte sich mit den Kindern zurückziehen und niemanden außer Caradoc bei sich haben in ihrem Elend. So stand ich am frühen Vormittag an Deck und sah zu, wie sich die belgische Küste entfernte. Natürlich zog auch ich die üblichen Vergleiche aller Reisenden: Es schien das hinter mir bleibende Festland mein altes Leben zu sein, das mich friedlich ziehen ließ. Alles war gut, alles war richtig.
Als dann die Felsen von Dover in Sicht kamen, leuchtend weiß unter einem blauen Himmel, da glaubte ich, die englische Insel präsentierte sich nur mir zum Willkommen ohne das übliche schlechte Wetter. Ich hatte oft von grauenvollen Kanalüberquerungen gelesen, die sogar die Mannschaft krank machten, und von enttäuschten Reisenden gehört, sie hätten die berühmten Felsen vor lauter Nebel nicht sehen können. Wie hätte ich da ahnen können, was mich erwartete, bei einem solchen Empfang?
In Dover bestand Caradoc darauf, zu Mittag zu essen, bevor wir eine Kutsche nach London mieteten; noch hätten wir Ferien und sollten sie genießen. Mein schlechtes Gewissen plagte mich. Meinetwegen hatten sie ihre Reise abgebrochen und ich fragte mich, wie ich das jemals wieder gutmachen sollte. Ich fragte es auch Iseuld, doch sie meinte, ich solle endlich aufhören mich zu sorgen.
»Bist du nicht unter Freunden, Anna? Und werde ich dir meine Kinder nicht noch oft genug aufbürden? Da stellt sich die Frage, wer wem etwas schuldig sein wird.«
Immerhin war es meine Aufgabe, mich um Jenefer und Petrok zu kümmern, und so erinnerte ich sie daran, dass ich ihre Angestellte sei und ihr herzliches Entgegenkommen niemals ausnutzen wolle.
»Du glaubst, wir hätten all das für jede Angestellte getan? Es ist mir wichtig, dass unser Personal ein gutes Leben führt. Ja, ich behaupte, Caradoc und ich sind eine angenehme Herrschaft, die anständig zahlt und nichts fordert, was über das hinausgeht, was recht und billig ist. Aber unser Personal ist nicht mit uns befreundet. Die Gespräche, die wir führten, liebe Anna, was du von uns weißt und wir von dir, dein Instinkt, der dich in der Not zu uns führte – das alles muss dir doch zeigen, was ich in dir sehe. Eine Freundin, wie ich sie mir immer gewünscht habe.«
Man darf nicht vergessen, mein geliebter Papa war gerade einmal einen Tag von mir gegangen, und so war es wohl verständlich, dass ich bei Iseulds Rede erneut in Tränen ausbrach. Was mich allerdings nicht daran hinderte, zwei Dinge zu bemerken: Es konnte doch nicht sein, dass ausgerechnet Iseuld Arscott mit all ihrer natürlichen Herzlichkeit und ihrem Humor keine Freundin hatte, die diesen Namen auch verdiente. Und wie konnte es mir außerdem nicht früher aufgefallen sein, dass zwar die Arscotts alles von mir wussten, ich von ihnen jedoch wenig? Ich kannte ihre Namen und ihren Wohnort, ansonsten hatte ich nur eine vage Ahnung, wovon sie lebten und welche Ansichten sie von der Welt hatten. Und jetzt war ich hier. In ihrer Welt. Mir kamen Zweifel, ob ich eine kluge Entscheidung gefällt hatte.
Diese Zweifel aber verflogen, als wir gemeinsam zu Tisch saßen. Caradoc hatte nicht weit vom Hafen entfernt ein Inn gefunden und lachend bestellte er für mich eine Mahlzeit, die er als typisch englisch bezeichnete.
»Miss Anna, daran werden Sie sich gewöhnen müssen, wenn wir in London sind. Unsere Köchin besteht darauf, so zu kochen, wie sie es gelernt hat. Aber solange wir unsere Tochter noch nicht an böse Männer verheiraten müssen, können wir im Sommer nach St. Tudy reisen. Da werden Sie verwöhnt mit Pasties, Scones und Saffron Buns, dann trinken Sie Mead und Apfelpunsch und Sie werden Ihre Finger nicht lassen können von Yarg und Clotted Cream.«
Bis ins Kleinste schilderte Caradoc, was es mit diesen Köstlichkeiten auf sich hatte und wie sehr mir nicht nur alles schmecken, sondern wie ich Leute und Landschaft Cornwalls lieben würde.
»Vielleicht möchte Anna während der Saison lieber in London bleiben? Ihre Chancen, sich vorteilhaft zu verheiraten, sind in London höher als in St. Tudy.« Iseuld schaute mich an, prüfend, neugierig und ernst.
»Nein, wirklich, daran denke ich nicht. Wenn mir ein Ehemann bestimmt ist, dann wird er mich schon finden.«
Da schmunzelte Iseuld. Sie scherzte, was für ein elendes Geschäft die Verheiraterei sei und wie sie diejenigen Damen nicht beneide, die Jahr für Jahr zu entscheiden hätten, welche Debütantin ein Erfolg sein werde und welche gnadenlos durchfiel. Iseuld ließ ihrem Spott freien Lauf und ich lachte herzlich mit, bis sie sich auf die Lippen biss und sich für ihre Respektlosigkeit entschuldigte.
Damals glaubte ich, Papas Verlust in genau diesem Moment endgültig zu begreifen und meine Trauer ebenso wie meine bitteren Erfahrungen hinter mir gelassen zu haben, als ich englischen Boden betrat. Für eine neue Frau hielt ich mich. Heute weiß ich es besser. Alles, was ich in den nächsten Monaten sah und hörte, war getrübt von meiner tiefen Trauer, die ich nicht wahrhaben wollte. Ich will nicht sagen, ich hätte nichts von dem verstanden, was um mich herum geschah. Es war eher so, als hätte ich eine Dimension hinzugewonnen. Ich erhielt Zugang zu einer Welt, von der ich vorher nichts geahnt hatte. Vielleicht wäre alles anders gekommen, hätte ich meine Gefühle zugelassen, anstatt sie zu verleugnen.
Dort aber, in diesem Gasthof, wusste ich das nicht. Zu gerne wollte ich mich ablenken lassen von Iseulds Anekdoten. Iseuld drückte meine Hand und fuhr fort, sich über die Damen lustig zu machen, die den Debütantinnen für gutes Geld Einladungen zu den wichtigen Bällen verschafften. Sie malte uns aus, wie diese bedeutenden Frauen im Frühjahr gemeinsam planten, welche der neuen Schönheiten mit der Hand eines Lords belohnt werden sollte und welche sich mit einem Baronet zufriedengeben müsste.
»Ganz sicher sind ihnen die Gefühle ihrer Schachfiguren gleichgültig. Vielleicht würfeln sie sogar?«
Caradoc amüsierte sich zwar prächtig, dennoch mahnte er seine Frau, sich rechtzeitig mit diesen Personen gutzustellen, wenn sie nicht wolle, dass Jenefer wie minderwertige Ware präsentiert würde.
»Sieh, mein Lieber, ich will, dass Jenefer weder wie minderwertige noch wie überhaupt eine Ware feilgeboten wird. Und ebenso wenig möchte ich erleben, dass in Petrok nicht mehr gesehen wird als eine gute Versorgung für eine eitle Miss ohne Verstand.«
»Wenn beide nach dir kommen, wird das nicht geschehen.« Caradoc wandte sich mir zu und fragte, ob ich wissen wolle, wie er diese wunderbare Frau habe gewinnen können.
Das wollte ich selbstverständlich. Schon, um mir die noch immer nagenden Zweifel an meiner Entscheidung zu nehmen.
»Machen Sie sich auf einen schockierenden Bericht gefasst. Nicht ich war es, der den Anfang machte. Es war wahrhaftig Iseuld, die mir vor sechs Jahren und fünf Monaten erklärte, sie gedenke, meine Gemahlin zu werden und ob ich damit einverstanden sei. Wie finden Sie das?«
Mir erschien das gewagt, aber das wollte ich nicht zugeben. Also antwortete ich, es sei im Grunde ohne Bedeutung, wer das Thema Heirat ins Spiel bringe, wenn man sich einig sei.
Caradoc lachte. »Glauben Sie mir, Miss Anna, ich hatte nicht die Gelegenheit, mir über meine Gefühle klar zu werden. Oder überhaupt welche zu entwickeln. Es war unser erster Tanz – ein Walzer übrigens – und Iseuld fragte mich nach nicht einmal zehn Schritten. Sie können sich vorstellen, wie überrascht ich war.«