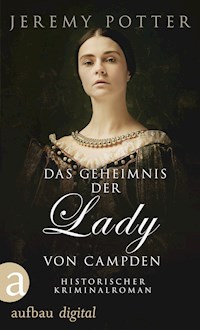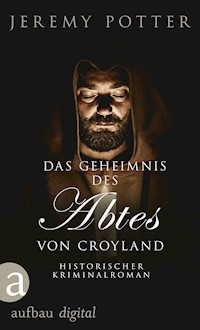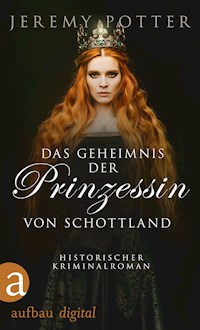
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thronraub, Morde & Intrigen
- Sprache: Deutsch
England im 11. Jahrhundert. Der Normanne Wilhelm der Eroberer hat über die Angelsachsen gesiegt und sich zum König von England krönen lassen. Die schottische Prinzessin Edith hat kaum die sicheren Mauern des Klosters Romsey erreicht, wo sie in den nächsten Jahren, vor allem Bösen der Außenwelt beschützt, eine ihr gemäße Erziehung genießen soll, da stehen schon die vier Söhne des Normannenkönigs vor den Toren, um die junge Schönheit als mögliche Heiratskandidatin in Augenschein zu nehmen. Als eine der letzten Nachfahren des angelsächsischen Königshauses hat Edith begründeten Anspruch auf den englischen Thron. In der darauffolgenden Nacht wird einer der Prinzen ermordet. Und gerade zu ihm, dem jungen Richard, hatte sie sich am meisten hingezogen gefühlt. Edith vermutet Brudermord. Sie ahnt, dass sie sich für einen der Königssöhne entscheiden muss und da sie keinen Mörder heiraten will, muss sie das Verbrechen auf eigene Faust aufklären …
Ein fesselnder Krimi vor opulenter Kulisse, basierend auf wahren Begebenheiten und realen historischen Persönlichkeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Jeremy Potter
Jeremy Potter (1922-1997) war Autor zahlreicher Bücher zu verschiedenen Themen der englischen Geschichte sowie Kriminalromanen mit historischem Hintergrund. Zudem war er 18 Jahre lang Vorsitzender der Richard III Society. Privat war er mit der Schriftstellerin Anne Melville verheiratet.
Informationen zum Buch
England im 11. Jahrhundert. Der Normanne Wilhelm der Eroberer hat über die Angelsachsen gesiegt und sich zum König von England krönen lassen.
Edith, eine schottische Prinzessin und gleichzeitig Spross des angelsächsischen Königshauses, lebt in einem Kloster. Eines Abends tauchen die vier Söhne des Eroberers dort auf, um sie, die als die Rose von Ramsey in die Geschichte einging, als mögliche Heiratskandidatin in Augenschein zu nehmen. In der Nacht wird einer von ihnen umgebracht. Edith vermutet, dass es Brudermord war. Sie ahnt, dass sie sich für einen der Königssöhne entscheiden muss. Da sie keinen Mörder heiraten will, versucht sie auf eigene Faust, das Verbrechen aufzuklären.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jeremy Potter
Das Geheimnis der Prinzessin von Schottland
Historischer Kriminalroman
Aus dem Englischen von Johannes Sabinski
Inhaltsübersicht
Über Jeremy Potter
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Impressum
Kapitel 1
Am Tor der Abtei tauschten die Männer ihres Vaters sie gegen eine Empfangsbescheinigung aus. Sei sie eine Prinzessin oder eine Ware, fragte sie schluchzend, als sie sich ohne einen Blick zurück heimwärts wandten. Allein Fergus, ihr Anführer, kümmerte sich um sie. Er bückte sich und küsste respektvoll ihre Stirn, bevor er davoneilte, um die anderen einzuholen. Im Tränenglanz seiner Augen spiegelten sich ihre eigenen Tränen wieder.
Edith stand verlassen da: hochgewachsen, gut entwickelt für ihr Alter, doch kaum mehr als ein Kind. Sie war vor fast fünfzehn Jahren geboren und auf den feuchtkalten Höhen der Festung ihres Vaters bei Stirling mit Strenge erzogen worden. Dies war ihre erste Begegnung mit dem Land der königlichen Vorfahren ihrer Mutter – des großen Alfred und seines Sohnes Edward, Edgar des Friedensstifters und Ethelred der Glücklosen, den stolzen Mitgliedern der vornehmsten Dynastie Europas.
Die Eskorte, die man für ihre lange Reise nach dem Süden abgestellt hatte, war ein schmeichelhafter Ausdruck des Wertes, der ihrer königlichen Jungfräulichkeit beigemessen wurde. Selbst Edith erschrak über die Grausamkeit ihrer Begleiter. Dies waren die treuen und wilden Männer, die König Malcolms Erbschaft Macbeth, dem Usurpatoren, wieder entrissen hatten. Weh und Leid harrten eines jeglichen normannischen Störenfrieds, sollte er versuchen, den Durchzug der Tochter ihres Herren aufzuhalten. Vernünftigerweise hatte keiner den Versuch unternommen.
Schottland wurde als ärmliches und wildes Land verachtet. Doch England, von dem ihre Mutter so aufregende Geschichten zu erzählen wusste, schien kaum anders zu sein. Womit konnte es sich brüsten? Wälder, Marschen und Moore. Moore, Marschen und Wälder. Wo verbargen sich die Reichtümer, von denen sie so viel gehört hatte? Wo war die Tapferkeit im Volk? Die Leute, die sie sah, lebten kaum besser als die wilden Tiere und flohen beim Nahen ihres Trupps in den Schutz des nächsten Dickichts.
Unter ihren angelsächsischen Königen waren die Engländer ein großes Volk gewesen. Nun waren sie gedemütigt. Es betrübte Edith, zu spät geboren zu sein, um die letzten glorreichen Tage noch mitzuerleben. Zwanzig Jahre waren seit der Schmach der Eroberung vergangen, seit jenem schwarzen Tag, da König Harold in der Schlacht fiel. Er war der letzte Engländer gewesen, der dieses Namens würdig war, denn mit ihm war der Stolz der Nation untergegangen. So hatte Fergus sie verächtlich eingeladen, sich auf ihrem Ritt nach Süden selbst davon zu überzeugen, dass die Engländer jetzt allesamt nicht mehr als Leibeigene waren und ihre einstige Größe eine heimliche Erinnerung darstellte.
Die Unannehmlichkeiten der Reise hatte sie mit Tagträumen gemildert: Tagträume davon, Königin dieses gebückten Volkes zu werden. Wie stolz sie es anführen würde, das Haupt hoch erhoben, es anführen würde dem Bastard von Eroberer zum Trotz, so wie Königin Boadicea den Römern getrotzt hatte und König Alfred den dänischen Piraten und Plünderern! Beim Anblick der verkohlten und verlassenen Überreste von Dörfern am Wegesrand ballte sie ihre Faust um die Zügel. Sie richtete schneidende Fragen an Fergus, und er erzählte ihr, was er über das Schicksal Englands seit König Harolds Tod wusste: wie Städte dem Eindringling feige und ohne Widerstand ihre Tore geöffnet hatten, wie alte Rechte rücksichtslos beschnitten, Ländereien beschlagnahmt, Gesetze und selbst die Sprache abgeschafft wurden.
Einige hatten den Mut aufgebracht, sich zur Wehr zu setzen. Wenige vielleicht, aber immerhin. Was war mit denen geschehen, fragte sie.
Sie seien tot, wenn sie Glück gehabt hatten, hatte Fergus erwidert. Hatten sie keines gehabt, so waren Gefangenschaft und Verstümmelung ihr Los. Man hatte Augen ausgestochen, Füße abgehackt. So war die normannische Gerechtigkeit. Niemand war verschont geblieben, kein Winkel des Reichs vor Verwüstung bewahrt worden.
Ediths eigener Vater, der sich zunächst außerhalb des eisernen Zugriffs der Normannen gewähnt hatte – selbst er war gezwungen worden, sich der Würdelosigkeit des Vasallentums zu unterwerfen. Wenigstens, so tröstete sie sich, hatte mit ihm einer hier den Kampf noch nicht aufgegeben. Am Tag ihrer Abreise aus Sterling hatte er einen Einfall nach Northumbria geplant, um die neue Burg am Tyne zu zerstören. Allein ihre Reise hatte ihn davon abgehalten. Sobald ihre Begleiter zurückkehrten, würde er losschlagen – und zwar hart.
Wenn die Schotten kämpfen konnten, warum nicht die Engländer? fragte sich Edith. Es musste daran liegen, dass ihnen ein Anführer fehlte. Wenn ihr Onkel, der Athelinger, der rechtmäßige sächsische Erbe, es vorzog, sich in Ungarn herumzudrücken, warum gab er dann nicht seinen Anspruch auf und übertrug ihn auf einen der Seinen? So weit ihre Erinnerung reichte, hatte sich Edith danach gesehnt, ein Junge zu sein. Ihre Brüder mochten sich mit Schottland begnügen, doch was hätte sie nicht alles an deren Stelle getan? England und Schottland vereint wären unbesiegbar, und die eisenbewehrten, steinherzigen Normannen wären ins Meer zurückgeworfen.
Der Traum überdauerte die Reise nicht. Als Mädchen hatte sie nur eine Möglichkeit, ein Mittel, ihren Ehrgeiz zu befriedigen: die Heirat. Bitten an ihre Eltern, sie dieser Möglichkeit nicht zu berauben, indem man sie in ein Kloster steckte, blieben unerhört. Sie sagten, dass sie sie liebten, aber sie beachteten ihre Einwände nicht. Jeder Schritt nach England hinein hatte sich dem Drängen ihres Herzens entgegengestellt. Wäre nicht Fergus’ zügelnde Hand gewesen, sie hätte kehrtgemacht, noch bevor die Grenze überquert war.
Dies, nicht minder als das plötzliche Verlassensein, war der Grund für ihre Tränen am Tor zur Abtei. Es nutzte nichts, dass die Äbtissin alle Förmlichkeit missachtete in ihrem Bemühen, sie willkommen zu heißen. Edith wurde umarmt und gestreichelt und im selben Atemzug gebeten, zu erzählen, wie es ihrer Mutter, ihrem Vater, den Brüdern ginge, welche Neuigkeiten sie aus Schottland mitbrächte und welche Übel und Abenteuer ihr auf dem Weg widerfahren seien. Die Erkundigungen fielen behutsam aus, denn die Abtei sollte ihre zweite Heimat werden. Die Äbtissin war ihre Tante Christina, die Schwester der Königin von Schottland und Edgar des Athelingers, der König von England hätte sein sollen.
Die Wohnräume der Äbtissin waren reich ausgestattet, wie es ihrem Rang zukam. Ihre Dienerinnen zogen Edith die staubigen, von der Reise schmutzigen Kleider aus. Man brachte ihr Wasser zum Waschen.
»Deine Mutter hat mir oft von deiner Schönheit geschrieben, Kind«, sagte die Äbtissin und hielt ihre Hände bewundernd in die Höhe, »doch nie hätte ich mir solchen Liebreiz vorgestellt. Dein Haar ist so golden wie des Herrgotts Glorie und deine Augen sind so blau wie der Himmel über uns! Es wundert mich, dass sie sich von dir zu trennen vermochte.«
Edith weinte noch immer, leise jetzt, doch es war, als wollte sie nie damit aufhören. Die Komplimente brachten ihr keinen Trost. Als sie gewaschen und abgetrocknet war und sie versuchten, ihr die Nonnentracht anzuziehen, riss sie sich den Schleier vom Kopf, warf ihn auf den Boden und trampelte darauf herum. Eine der Dienerinnen bückte sich, um ihn aufzuheben, doch Edith trat ihn ihr aus der Hand. Entsetzt klatschte die Äbtissin in die Hände und schickte die Dienerinnen hinaus.
»Heb deinen Schleier auf«, befahl sie Edith, sobald sie allein waren. »Dass du nach einer solchen Reise leicht reizbar bist ist normal, aber hier ist Gehorsam geboten. Als du mir die Hand gabst und durch das Tor tratest, bist du ein Kind des Klosters geworden.«
»Dann lasst mich wieder gehen.«
Die Äbtissin widersprach ihr. »Wohin solltest du gehen, Mädchen? Die Männer deines Vaters sind schon auf dem Weg. Falls du sie einholen solltest, sie würden dich nicht mit zurücknehmen.«
»Ich werde keine Nonne. Niemals!«
»Du wirst Novizin sein, bis du dein Gelübde abgelegt hast. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, denkst du anders.«
»Ich möchte heiraten.« Edith platzte unter ihren Tränen mit den Worten heraus. Sie klangen wie ein schamhaftes Geständnis.
»Das wirst du auch.« Die Äbtissin sprach besänftigend. »Du bist eine künftige Braut Christi. Stellt dich das nicht zufrieden? Es ist der Wunsch deines Vaters und auch der deiner Mutter. Und die Liebe wie der Respekt, die du ihnen schuldest, verlangen deine Einwilligung. Bedenke doch, welche Freude es für deine Eltern sein wird, ihre liebste Tochter in die Arme unseres Erlösers zu geben. Selbst der normannische König hat das getan.«
»Ich wurde hierhergeschickt, um Bildung zu erwerben und weil Schottland nicht als sicher für mich angesehen wird«, entgegnete Edith bestimmt und trocknete schließlich ihre Tränen. Dass ihr Vater es dem normannischen König gleichtat war kein Trost.
»Das auch«, nickte die Äbtissin. »Aber du musst dir jeden Gedanken an Heirat aus dem Kopf schlagen. Zum einen bist du zu jung. Zum anderen, wen solltest du heiraten? Steht dein Herz etwa nach einem Normannen?«
»Lieber würde ich sterben.«
»Sehr schön. Also entweder lebst du hier unter dem Schutz des Schleiers, oder für dich wird ein Gatte ausgewählt, und du findest dich bald in den Armen eines normannischen Emporkömmlings wieder. Wie begierig sie darauf sind, ihr niederes Heidenblut mit unserem Königtum zu mischen! Glaube nicht, der König hätte dich nach England kommen lassen, um einen Mann aus unserem eigenen Volk zu heiraten. Dafür stehst du dem Thron zu nahe.«
Edith ließ den Kopf hängen; ihr fehlten die Worte.
»Weshalb sonst, glaubst du, bin ich hier«, fuhr ihre Tante fort, »und führe ein Leben in Keuschheit – und bin damit zufrieden? Denk an Christus, und sage mir, wie du ihn siehst.«
»Schön. Groß und schön. Mit Augen voller Mitgefühl, wie die meiner Mutter und Eure eigenen.« Edith fügte die letzten drei Worte aus Dankbarkeit hinzu. Die Augen ihrer Tante berührten sie nicht so wie die ihrer Mutter, doch sie strahlten trotzdem Liebe aus, als die Äbtissin aufrecht vor ihr stand in der Blüte ihrer Schönheit, eine würdige Braut für jeden Mann.
»Stell ihn dir in Gedanken vor, und auch du wirst zufrieden sein. Wie du habe ich geschworen, als sie mich hierherbrachten, dass ich niemals den Schleier tragen würde. Ich wurde in Ungarn geboren und wusste wenig über England. Aber bald habe ich eingesehen, dass eine Zuflucht vor der Welt ein Segen Gottes ist. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass von allen Segnungen Gottes die Jungfräulichkeit die kostbarste ist. Sie erhebt uns über die übrige Menschheit. Unsere Hochzeit ist himmlisch und für die Ewigkeit. Vergiss niemals, mein Kind, dass Jungfrauen den Engeln gleich sind im Angesicht Gottes.«
»Mutter ist keine Jungfrau, und man sagt, sie sei den Heiligen gleich.«
Edith bereute die Worte, kaum dass sie ihr über die Lippen gekommen waren. Christina war diejenige der beiden Schwestern, die um Christi willen der Welt entsagt hatte. Doch diejenige, die für die Frömmigkeit und Reinheit ihres Lebens gerühmt wurde, war Margaret, die Königin und Mutter von sechs Kindern.
»Deine liebe, liebe Mutter!« rief die Äbtissin aus. Ihr Lächeln verriet keine Spur von Eifersucht. »Sie war auch mir eine Mutter, als wir beide noch Kinder waren. Erzähl mir von ihr.«
Während ihrer Unterhaltung über Familienangelegenheiten war die Äbtissin damit beschäftigt, Edith beim Anlegen und Richten ihres Schleiers zu helfen, als sei die Auseinandersetzung nun beigelegt. Edith fügte sich, doch als sie schließlich in die unwillkommene Tracht gekleidet war, murmelte sie, dass sie ihr Fleisch für zu schwach für die ewige Jungfräulichkeit hielte.
»In deinem Alter!« wandte ihre Tante ein. »Was kannst du vom Fleische wissen, Kind?«
»Seid ehrlich, Tante«, beharrte Edith. »Habt Ihr nicht das gleiche gefühlt?«
Ja, das habe ich«, gestand die Äbtissin errötend. »Glückseligkeit ist nicht zu erlangen ohne züchtige Hingabe. Wenn es leicht wäre, worin läge dann unser Verdienst?« Einen Augenblick lang verschwand die heitere Ruhe aus ihrem Gesicht.
»Wenn ich eingekerkert werden muss, so wäre ich eine Belastung für Euch«, entgegnete Edith. »Womöglich würdet Ihr es vorziehen, dass ich mich woandershin begebe?«
»Woandershin? Wo deine Mutter dich meiner Obhut anvertraut hat? Was für eine Idee! Wohin sonst solltest du gehen, Kind?«
»Nach Wilton, falls meine Namensvetterin mich aufnimmt.«
Es war eine Antwort, die Edith sich gut überlegt hatte. Die königliche Stiftung in Wilton genoss einen Ehrenplatz unter den Nonnenklostern in England. Dort lebte die Königin, nach der sie ihren Namen erhalten hatte, die Witwe des frommen Königs Edward, Schwester des tapferen Königs Harold, die bedeutendste und am meisten verehrte Überlebende aus den Tagen der sächsischen Herrschaft. In Wilton lag sie Stunde um Stunde, morgens wie abends auf den Knien, so wurde berichtet, und flehte den Tag herbei, da Gott sich entscheiden würde, England vom normannischen Joch zu befreien. Sie war es, die Edith in der ganzen weiten Welt am dringendsten zu treffen wünschte, um aus ihrem Mund zu hören, wie man sich als Königin von England fühlte, und vor allem, was die Gemahlin eines Herrschers für die Wohlfahrt ihres eigenen Volkes tun konnte.
Diesmal fühlte sich die Äbtissin herausgefordert und war unfähig, ihre Eifersucht zurückzuhalten. Dass Edith Wilton erwähnte hatte ihren Stolz verletzt.
»Ist Romsey denn keine königliche Gründung? Sind wir hier etwa ein Deut schlechter? Du enttäuschst mich, Edith. Wie kannst du nur die Schwester deiner eigenen Mutter beleidigen, indem du dieses Haus um eines anderen willen verschmähst? Was würden die Leute sagen?«
Edith verspürte Reue. »Ich hatte gehofft, dass sie in Wilton nicht darauf bestehen würden, dass ich den Schleier nehme«, entschuldigte sie sich.
»Romsey, Wilton, Shaftesbury – die Regeln sind in jedem Haus dieselben. Du bist überspannt, deshalb stellst du es dir anders vor. Aber da es dich so beunruhigt, lass mich dir folgendes versichern. Obwohl du als Mitglied unserer Gemeinschaft den Schleier tragen wirst, sogar tragen musst, werde ich dir kein Gelübde abverlangen, solange du nicht reif dafür bist. Dich dazu zu drängen und zu zwingen wäre eine Verfehlung vor Gott und vor Sankt Benedikt. Also! Macht dich das froh, und wirst du nun weniger erpicht darauf sein, nach Wilton davonzulaufen?«
Edith knickste zum Dank, entschlossen, ihre Tante an das Versprechen zu binden. Der Tag, an dem sie bereit wäre, ihr Gelübde abzulegen, würde niemals kommen.
»Dann lass uns nicht mehr davon reden«, fuhr ihre Tante zügig fort. »Du wirst hierbleiben, und ich werde uneingeschränkten Gehorsam erwarten und einfordern. Es wird nicht lange dauern, und du hast erkannt, dass das fromme Dasein das beste auf Erden ist. Hier in Romsey genießen wir den Vorzug völliger Abgeschiedenheit. Hier kannst du wahrhaft Frieden im Herrn finden, während in Wilton …«
Sie brach ab, doch Ediths Neugier war geweckt. »Ja, Tante?«
»Wilton wird verdächtigt, ein Widerstandsnest zu sein. Man weiß, dass der König Spione selbst in der Klostergemeinschaft hat. Aber du darfst deinen Kopf nicht mit Politik belasten. Unsere Ansichten sind hier nicht minder entschieden, doch wir sind vorsichtig.«
»Gibt es hier keine Spione?« Edith spähte über die Schulter, aber ihre Tante lächelte und schüttelte den Kopf.
Während sie sich unterhielten, waren sie hinaus in den Kreuzgang getreten, und die Worte der Äbtissin schienen durch einen Mann Lügen gestraft zu werden, den Edith hinter ihnen im Schatten des Eingangs zum Ordenshaus entdeckte. Sie hatte sein Eintreffen nicht bemerkt und fragte sich, wieviel von ihrem Gespräch er mitangehört haben mochte.
Ihre Tante jedoch zeigte keine Spur von Überraschung oder Missfallen. Sie begrüßte ihn freundlich. »Das ist Pater Edmund, mein Kaplan«, sagte sie. »Er ist auch mein Beichtvater und wird der deine sein.«
Der Priester war jung und stämmig gebaut. Ein Angelsachse, wie Edith erleichtert bemerkte. Doch sie misstraute seinem schmeichlerischen Gebaren und dreisten Lächeln.
»Willkommen in Romsey, Lady Edith.« Er verneigte sich sogar und küsste ihre Hand. »Gott erweist unserem Hause die Gnade der Anwesenheit einer Prinzessin – einer weiteren Prinzessin – königlichen Geblüts – das ist in der Tat eine Ehre. Das gnädige Fräulein werden uns Inspiration und Zierde sein. Der gütige Herrgott hat uns über unsere Verdienste hinaus begünstigt.«
Die Äbtissin setzte diesen Höflichkeiten mit einem Stirnrunzeln ein Ende und fragte nach seinem Grund, sie aufzusuchen.
»Ich kam, die gnädige Frau von Berichten über eine Jagdgesellschaft unweit von hier in Kenntnis zu setzen«, erwiderte er. »Sie nähert sich dem Dorf vom Wald her und wird Winchester vor Einbruch der Nacht nicht mehr erreichen können.«
»Suchen sie um unsere Gastfreundschaft nach?« fragte die Äbtissin. »Wie viele Male habe ich deutlich gemacht, dass ich in diesen Mauern Männer weder bewirten kann noch will? Es sind Normannen, vermute ich.«
»Es sind Höflinge. Welcher Art, ist nicht bekannt.«
Edith war sich bewusst, dass nach den Gesetzen niemand ohne die Erlaubnis des Königs jagen durfte. Wie oft mochte so eine Erlaubnis einem Sachsen gewährt werden?
»Normannen!« rief die Äbtissin. »Verriegelt das Tor und lasst niemandem herein. Eilt, Pater! Edith, komm mit mir! Ich werde dich in meine Gästekammer führen, wo du deine erste Nacht verbringen kannst. Du wirst müde sein nach der Reise und brauchst dich uns nicht im Refektorium anzuschließen, es sei denn, du bist hungrig. Morgen wird genügend Zeit sein, die Schwestern zu treffen, aber Gott wartet auf dich in der Kirche. Du wirst dich sicher nicht schlafen legen wollen, ohne zuvor deinem Herrn und Schöpfer im Gebet dafür zu danken, dass er dich unbeschadet in den Schutz Seines Heiligtums geleitet hat.«
Doch noch bevor Edith die kurze Strecke von der Gästekammer zur Kirche zurücklegen konnte, wurde der Friede des Herrn gestört. Heiseres Gebrüll, das rauhe Schmettern von Jagdhörnern und frevlerische Schläge gegen das Tor der Abtei entweihten sein Heiligtum. Abgeschiedenheit? Schutz? Edith entschied, das es für sie kein Versteck geben würde. Sie wandte der Kirche den Rücken zu und ihr Gesicht den Eindringlingen entgegen.
Kapitel 2
Neugier hatte ihre Frömmigkeit fast kampflos bezwungen, und Edith folgte unaufgefordert ihrer Tante, die zum Tor geeilt war. Gott war geduldig und hatte gewiss Verständnis dafür.
Die Gebäude der Abtei scharten sich um eine kleine Steinkirche und waren von einem hohen Palisadenzaun umgeben. Dieser Zaun und das Risiko, den Zorn Gottes auf sich zu ziehen, waren ihr einziger Schutz vor den Gefahren, die jenseits davon lagen. Edith lugte durch einen Spalt zwischen den Pfählen und zog aufgeregt den Atem ein. Der ungebärdige Reitertrupp bestand aus Fremden, soviel war sicher. Sie brauchte nicht zu hören, was gesagt wurde, um zu wissen, dass sie Einlass begehrten. Pater Edmund war hinausgegangen, um zu verhandeln, und dass er offenkundig die Fremden bat, friedlich abziehen, war ebenso offenkundig nutzlos.
Sein verzweifelter Blick zurück wurde schnell beantwortet. Die Äbtissin stieg auf eine Plattform innerhalb des Zauns und hob ihre Hände, um Ruhe zu gebieten. Ihr Erscheinen wurde nicht mit angemessener Achtung begrüßt, sondern mit ungestümem Hurra.
»Wisset«, rief sie ihnen zu – und Edith erschauerte über die Befehlsgewalt in ihrer Stimme: »Wisset, dass ich, Christina, durch die Gnade des Herrn Äbtissin von Romsey, Macht habe über Leben und Tod auf meinem Gebiet, auf dem Ihr jetzt steht. Die Hoheit darüber von alters her, meinen Vorgängern durch Edgar den Guten verliehen, einst König dieses Reiches, wurde jüngst von König William selbst bestätigt. Davon legt die Leiche eines Gattenmörders Zeugnis ab, die Ihr von meinem Galgen auf jenem Hügel dort drüben neben der Landstraße konntet hängen sehen. Dieser Schurke wurde von mir verurteilt, sich für sein Verbrechen vor dem Richterstuhl des Allmächtigen zu verantworten. Lass ihn Euch eine Warnung sein. Nun sprecht, sprecht ohne Umschweife. Wer ist es, der derart gröblich die Andacht einer geheiligten Schwesternschaft Gottes stört?«
Sie stand hoch oben und allein, aufrecht und unerschrocken. Ein Windhauch blies ihren Schleier zur Seite, legte ihr Gesicht frei und einen Schimmer goldener Locken gleich jener Ediths. Die Fremden waren bezwungen. Ob durch die Worte oder den Anblick ungeahnter Schönheit, konnte Edith nicht sagen. Sie flüsterten untereinander, bis ein Sprecher vortrat.
»Mein Name ist Fulke«, gab er bekannt. Er war groß, dunkelhäutig und sprach Englisch wie ein Fremder. »Meine Herren suchen Unterkünfte für die Nacht.«
»Wir haben hier keine«, entgegnete die Äbtissin. »Ihr wäret am besten nach Winchester weitergeritten.«
»Das war unsere Absicht, aber die Jagd erwies sich als zu lang.« Er beriet sich mit einem seiner Begleiter und erkundigte sich dann: »Ist Gastfreundschaft nicht eine Regel Eures Ordens, Euch streng anbefohlen durch euren Stifter?«
»Soweit es unsere Mittel erlauben«, gestand die Äbtissin ein. »Aber Eurer sind viele, und die Abtei hat keine Unterkünfte für Männer. Was Speise angeht, so würdet Ihr unsere armselige Küche unangemessen für solchen Appetit wie den Eurigen finden.«
»Speise ist ein Mangel, den wir beheben können. Wir bringen unsere eigene mit.« Der Sprecher zeigte auf zwei Männer, die eine Stange über ihren Schultern trugen, an der an den zusammengebundenen Füßen ein erlegtes Reh hing.
»Ihr habt das Rotwild des Königs geschossen.« Die Worte der Äbtissin klagten sie an. Das Rotwild wurde derart umhegt, dass selbst die Klauen ihrer eigenen Hunde verstümmelt werden mussten.
»Mit seiner Zustimmung.« Der Mann namens Fulke trat näher und sprach leiser, so dass Edith nicht länger mithören konnte.
Zu ihrer Überraschung endete die Unterredung mit dem Befehl der Äbtissin, das Tor zu öffnen. Während der Sprecher der Fremden, von Pater Edmund geführt, die übrigen ins Dorf geleitete, stiegen vier der Jäger von ihren Pferden ab und wurden eingelassen.
Verwundert beobachtete sie die vier Männer. Mit ihrem kurzen Haar und seltsamen Kleidern waren sie gewiss keine Engländer. Ihre Haltung und die Anzahl ihrer Begleiter wiesen sie als Männer von Rang aus. Als sie sich der Äbtissin näherten, schienen sie von ihr zu erwarten, dass sie ihnen die Ehre erweisen würde, aber Tante Christina, das war klar, würde nichts dergleichen tun. Geistlicher und weltlicher Herrscher, Souverän in ihrem Bereich, blieb sie gebieterisch aufrecht stehen und streckte ihnen ihre rechte Hand entgegen, bis sie sich notgedrungen niederbeugten und ihren Ring küssten.
Edith hatte sich derart in Mutmaßungen verloren, dass die Männer ihrer gewahr wurden, bevor sie sich zurückziehen konnte. Konnten das Normannen sein? rätselte sie. Der Anführer war ein dunkelgesichtiger, breitschultriger Mann von gedrungenem Wuchs. Der zweite – bei seinem bloßen Anblick stockte Edith das Herz. Er war schön, groß und schön, das Ebenbild Christi, und als seine Augen sich in ihre Richtung wandten, sah sie, dass sie denen ihrer Mutter ähnelten. Sie stand da wie versteinert und verzaubert, bis ihre Tante ihr mit gerunzelter Stirn und entschiedener Stimme befahl, auf ihre Kammer zu gehen.
»Sicherlich«, sagte das Ebenbild Christi, »ist dieses Mädchen zu jung, um eine der Nonnen der gnädigen Frau zu sein?« Er sprach französisch, und Edith empfand es als Segen, dass der Lehrer ihres Bruders sie in dieser Sprache unterrichtet hatte.
»Sie ist meine Nichte.« Auch die Äbtissin sprach französisch.
»Dann hoffe ich, dass wir die Freude und Ehre ihrer Gesellschaft haben, während wir essen.«
»Ihr müsst sie entschuldigen. Sie ist erst in diesen Stunden bei uns eingetroffen, und die Reise hat sie ermüdet.«
»Ist sie dann nicht genügend hungrig, um von unserem Wildbret zu kosten? Reisen macht Appetit, nicht wahr? Es ist zu früh zum Zubettgehen. Kann ihr nicht wenigstens erlaubt werden, ihre eigene Entscheidung zu treffen?«
Wenn auch an die Äbtissin gerichtet, waren die Worte für Edith bestimmt. Während sie sich verzweifelt den Kopf auf der Suche nach den treffenden französischen Wendungen zerbrach, antwortete ihre Tante.
»Da es Euer Wunsch ist, darf meine Nichte sich selbst entscheiden. Allerdings habe ich keinen Zweifel, dass ihre Entscheidung mit der meinen übereinstimmen wird.«
Zu verwirrt, um den Kopf zu heben, spürte Edith dennoch, dass seine Augen auf ihr ruhten. Sie waren forschend und durchdringend. Auf einmal dankbar für den Schutz des verhassten Schleiers, stammelte sie, wenn es der Wunsch des Edelmannes sei und die gnädige Frau Äbtissin es nicht vollkommen verbieten würde, dann würde sie für kurze Zeit am Abendessen teilnehmen. Ohne dem Fremden oder der Äbtissin ins Gesicht zu blicken, zog sie sich mit einem hastigen Knicks zurück und suchte eilends Zuflucht in der Kirche. Je fester sie dort die Augen im Gebet schloss, desto deutlicher erschien ihr die Vision des Gesichts, das sie gerade gesehen hatte.
»Lieber Gott«, fragte sie aufrichtig, »was ist es, das du von mir erwartest?«
Das Glockenläuten zur Vesper war die einzige Erwiderung, worauf sie fort in ihre Kammer eilte, um ein Zusammentreffen mit den Schwestern zu vermeiden.
Zum Abendessen wurde in den privaten Speisesaal ihrer Tante gerufen, wenige Schritte von der Kammer entfernt, in der Edith die Nacht verbringen sollte. Die Gemächer der Äbtissin lagen in Nähe des Tores, und den so widerwillig bewirteten Gästen war es nicht gestattet, tiefer in die Anlage vorzudringen. Als Edith eintrat, erläuterte die Äbtissin, dass die Anwesenheit von Männern im Refektorium nicht erlaubt sei. Die einzigen Ausnahmen waren die Abteikaplane, vom Bischof ernannt, und der Bischof selbst, wenn er zu Besuch kam.
Edith spürte die Nervosität in ihrer Stimme. Ein scharfer Seitenblick ließ sie vermuten, sie werde für ihre Anwesenheit gerügt werden. Statt dessen hieß ihre Tante sie nach einer Pause willkommen, allerdings ohne Zeremoniell.
»Setz dich, Kind. Da ist ein Platz für dich neben Pater Edmund. Unsere Gäste haben mir erklärt, sie seien Edelleute aus Frankreich, Besucher am Hof von Winchester. Dies ist Lord Robert und dies Lord Richard. Lord William ist hier, und dort ist Lord Henry.«
Also war er kein Normanne! Ihre Knie wurden weich vor freudiger Erleichterung, während sie nacheinander vor jedem knickste und noch immer nicht wagte, Lord Richard in die Augen zu blicken. Sie fragte sich, ob ihre Tante ihre Identität zu verbergen versuchte, indem sie sie nicht ihrem Rang entsprechend vorstellte. Warum sollte Lord Richard nicht erfahren, dass sie eine Prinzessin war? Richard, flüsterte sie unhörbar. Es war ein schöner Name.
Als sie zu essen anfingen, musterte sie insgeheim die anderen. Lord Robert saß zur Rechten ihrer Tante und führte die Unterhaltung an.
»Ihr habt uns noch nicht den Namen Eurer Nichte verraten.« Unerwartet hatte er von seinem Teller aufgeblickt und sie dabei erwischt, ihn anzustarren.
»Er lautet Edith. Von unseren sächsischen Namen einer der reizendsten.«
»Äußerst treffend.« Er benahm sich wie ein leutseliger Aufschneider und beugte sich über den Tisch, um einen Toast auf ihre Schönheit auszubringen. »Lady Edith, sagt Ihr?«
Die Äbtissin hielt inne, einen Bissen auf halbem Wege zum Mund. »Ihr seid mit meiner Verwandschaft vertraut?«
»Es gab Berichte, dass die Tochter des Königs von Schottland in Romsey zu finden sei.« Er lächelte, als hätte er ein Geheimnis gelüftet.
Edith warf einen verstohlenen Blick auf Lord Richard, wandte sich jedoch hastig wieder ihrem Essen zu, als sie sah, dass er sie anschaute. In der Tat wurde sie von allen angeschaut, und sie hatte nichts zu sagen, schon gar nicht auf französisch.
»Ist der König von England in Winchester?« fragte sie, wobei sie sorgfältig die Worte aussprach.
»Der König ist in der Normandie. Er muss einige Angelegenheiten mit dem König von Frankreich regeln.« Es war Lord Robert, der ihre Frage beantwortete. »Während seiner Abwesenheit«, fügte er hinzu, »hält die Königin in Winchester Hof.«
Weitere Fragen lagen Edith auf der Zunge, wurden jedoch von der Vorsehung unterdrückt. Waren diese Lords Vasallen des Königs von Frankreich, welchen Zweck hatte dann ihr Besuch in England, dessen Herrscher zugleich der rebellische Herzog der Normandie war? Sie roch die Nähe von Intrige und bedeutenden Ereignissen.
»Ihr scheint neugierig auf uns zu sein«, sagte Lord Henry, der auf der anderen Seite saß. Er war der jüngste der vier, nur wenig älter als sie selbst, dunkel und ernsthafter als die anderen, mit einer Nase, die viel länger war als nötig. »Wirken wir derart seltsam?« fragte er.
Gute Manieren erforderten eine Verneinung, aber sie sah keinen Grund, ihn mit einer Unwahrheit zufriedenzustellen.
»Wir sind Brüder«, fuhr er fort. »Überrascht Euch das, wo wir so ungleich ausgefallen sind? Damit wir Euch Edith nennen können, ohne Anstoß zu erregen, müsst Ihr uns auch einfach bei unseren Vornamen anreden. Robert ist der älteste und hält sich deshalb für wichtig, wie Ihr sehen könnt. Er rechnet damit, das Erbe unseres Vaters anzutreten. Richard kommt als nächster. Er ist fromm und wird Erzbischof. William aber ist nicht im mindesten fromm. Vor William müsst Ihr Euch in acht nehmen.« Zum Scherz flüsterte er die letzten Worte.
»Ist Richard denn Priester?« fragte sie überrascht.
»Noch nicht«, erwiderte Henry ernsthaft. »Er wartet auf eine Vakanz unter den Erzbistümern. Wir beten alle zu Gott für einen zeitigen Tod.«
Edith wusste nicht, was sie davon halten sollte. »Und Ihr?« erkundigte sie sich. »Von Euch habt Ihr nichts gesagt. Auf welche Vakanz wartet Ihr?«
»Ich bin der vierte Sohn«, sagte er mit melancholischer Stimme. »Gibt es ein schlimmeres Geschick? Jemand ohne Bedeutung, ohne Aussichten oder Bestrebungen.« Sein Blick wurde unstet. Ob das ein Zwinkern war oder nicht, dessen war sie sich nicht sicher.
»Henry ist ein Lügner«, unterbrach William laut. »Am besten glaubt man ihm kein einziges Wort. Nur darin hat er recht, dass er sich als jemand ohne Bedeutung bezeichnet.«
Williams Erscheinung und Benehmen ängstigten Edith. Er war kräftig und rotgesichtig, direkt und irritierend in Aussehen und Rede. Die drei älteren Brüder spülten alle das Fleisch mit Weinmengen hinunter, die einem Dutzend Männer aus Schottland zur Ehre gereicht hätten. Das machte sie ungestüm, und William am meisten. Obwohl ein Stotterer, brüllte er die anderen an wie ein Bulle. In seiner Erregung purzelten die Wörter übereinander und blieben manchmal mitten im Satz stecken wie ein Wasserfall, der auf einen Damm prallt. Doch Robert und Richard zollten ihm kaum Beachtung.
Zu beiden Seiten der Äbtissin plaziert, konkurrierten sie mit Schmeicheleien, ja Koketterien, und Edith war schockiert festzustellen, dass Tante Christina ihr Benehmen nicht mit der Strenge ahndete, die es verdiente. Der Schleier war ihr aus dem Gesicht geglitten, und eine goldene Haarsträhne schlich sich über ihre Stirn, doch sie schien sich dessen nicht bewusst. Ihre Tante lachen und Wein trinken zu sehen gab Edith Anlass, sich zu fragen, ob sie tatsächlich der Welt abgeschworen hatte. Äbtissinen waren über Tadel erhaben; dennoch wurde Edith gewahr, dass Pater Edmund verhohlenes Missfallen zeigte und Henry eine Belustigung, die alles andere als diskret war.
»Der Wein ist aus Gloucestershire«, verkündete die Äbtissin, »und Wein aus Gloucester ist Englands bester.«
Die beiden älteren Brüder fuhren fort, ihm kräftig zuzusprechen, und stritten bald offen miteinander. Während Richard die Ereignisse des Jagdtages beschrieb, warf Robert Berichtigungen und Bosheiten ein. Schnell bei der Sache, schürte William den Zank und attackierte Richard lauthals mit Flüchen, bis Edith hätte aufschreien mögen.
»Was müsst Ihr von uns denken?« flüsterte ihr Henry ins Ohr. »Brüder, die auf heiligem Boden krakeelen. Wieviel besser wäre es, würden wir dem Beispiel der meisten Brüder folgen und einander aus der Ferne lieben.« Sein Französisch war präzise und so klar gesprochen, dass sie es sicher verstehen konnte.
»Was macht ihr also zusammen?« flüsterte sie zurück. »Und hier in England? Kommt ihr aus familiären Gründen oder als Gesandte?«
»So scharfsinnig, und Ihr könnt es nicht erraten?« Er neckte sie.
»Wie sollte ich es wissen, wo ich doch selbst erst heute aus einem anderen Land eingetroffen bin?« Sie sprach ungehalten, denn es missfiel ihr, als Dummerchen angesehen zu werden.
Er lachte. »Als nächstes werdet Ihr sagen, dass Ihr die Absicht unseres Besuchs in Romsey nicht kennt.«
»Absicht? Sagtet Ihr nicht, Ihr hättet Euch bei der Jagd verspätet und wärt von der vorgerückten Stunde überrascht worden?«
»Und Ihr habt uns geglaubt?«
»Man hat mich gelehrt, die Ehre von Edelleuten verpflichte sie, die Wahrheit zu sagen.«
»Aber nicht, wenn es die Schicklichkeit einer Dienerin Gottes wie Eurer gütigen Tante verletzen könnte. Denkt lieber mehr an die Neigung statt an die Ehre. Gehen Edelleute nicht gern den Berichten nach, dass sie an einem gewissen Ort durch den Anblick der schönsten Prinzessin Europas belohnt würden?«
»Ihr seid meinetwegen gekommen?« Seine Stimme war die eines Verschwörers geworden, und sie rückte erschrocken ab, eine Hand unwillkürlich auf den Mund gelegt.
»Erzählt es nicht Eurer Tante«, bat er, »sonst wirft sie uns hinaus.«
»Was werden da für Geheimnisse ausgetauscht?« stellte sie Robert auf einmal zur Rede. Sein Ton war besitzergreifend, als wollte er Henry warnen, sich nicht in Dinge einzumischen, die nur ihn etwas angingen.
»Ich sprach vom Unglück, der jüngste Sohn zu sein«, erwiderte Henry. »Das ist doch wohl kein Geheimnis.«
»Vorlaut wie immer«, tadelte ihn Robert. »Trink deinen Wein aus und werde ein Mann, bevor du anfängst, über das Erbrecht zu jammern. Du ja musst erst einmal ein Schwert im Ernst führen lernen.«
»Wenn es soweit ist, dann an meines Vaters Seite.«
Zu Ediths Überraschung erzürnten diese Worte Robert derart, dass er aufsprang, um den Tisch herum eilte und Henry mit seiner Faust ins Gesicht schlug. Henry fiel zu Boden. Die Äbtissin schrie. William lachte schallend. Richard erhob sich wie ein Held, der die Schwachen verteidigt, und befahl Robert barsch, Henry in Frieden zu lassen.
»Mit welchem Recht maßt du dir an, mir Befehle zu erteilen?« Robert suchte Streit. Er ließ von Henry ab, der sich wieder aufrappelte, und kehrte zurück, um Richard zum Schweigen zu bringen.
Während beide einander trotzig anbrüllten, nahm William Henrys Platz ein und bemühte sich, Edith zu beruhigen. Es sei, sagte er, eine Gewohnheit unter Brüdern, sich derart zu amüsieren.
»Ich habe vier davon«, meinte Edith zu ihm, »und mein Vater würde es ihnen nicht gestatten, sich untereinander in dieser Weise zu benehmen.«
»Unser Vater wird alt«, entgegnete William, »und sein Arm hat seine Kraft verloren. Er hat viele Besitzungen – und Robert glaubt, sie alle sollten nach Geburtsrecht ihm zufallen. Es gab Zank, und – wie Ihr vielleicht aus Henrys unzeitigem Spaß geschlossen habt – Robert hat gar die Waffen gegen seinen eigenen Vater erhoben. Richard ist loyal geblieben – und glaubt daher, er werde der Erbe sein.«
»Und was ist mit Euch? Was glaubt Ihr?«
»Ich glaube an das Teilen – an eine gerechte Aufteilung. Was gäbe es sonst für den dritten Sohn zu hoffen? Es sei denn …« Er hielt inne, und der Satz schien totgeboren. Doch dann kamen die Worte hervorgesprudelt: »Es sei denn, einer seiner älteren Brüder wird enterbt und der andere würde ein Geistlicher.« Er berührte ihren Unterarm mit einer schüchtern ausgestreckten Hand, die der Pfote eines großen, nach Zuwendung dürstenden Hundes glich.
Edith fühlte sich bedrängt und rückte ab, genau wie von Henry. »Welcher von euch ist verheiratet?« erkundigte sie sich aus sicherer Entfernung und bemühte sich, ihn nicht merken zu lassen, wie sich ihr Blick bange Richard zuwandte, der mit blassen Lippen dem tobenden Robert die Stirn bot.
»Keiner«, erklärte ihr William. »Erscheint Euch das seltsam? Unserer Mutter zufolge ist der Mann ein Trottel, der früh schon heiratet. Je wichtiger er wird, desto größer seine Aussicht auf eine gute Partie. Unser Vater sehnt sich nach Enkeln aus der männlichen Linie, aber sie sagt, dass man uns Zeit lassen muss – um zu prüfen, was der Markt zu bieten hat.« Sein direkter Blick war abschätzend, und sie verbarg sich hinter den Schutz ihres Schleiers. Die beiden älteren Brüder waren nunmehr in einer unbrüderlichen Umarmung verkeilt, schoben sich hin und her und grunzten bei dem Versuch, den anderen zu Boden zu werfen. Richards Rückgrat schien in Gefahr zu brechen, während er Zoll für Zoll nach hinten gebogen wurde, bis Edith dieses Mal einen Schrei nicht mehr unterdrücken konnte.
»Seid um Richard nicht beunruhigt«, sagte William. »Bei all seinem frommen Anschein ist er der schlimmste aus unserer Sippe. Ihr könnt mir glauben – ich bitte Euch, keine freundlichen Blicke in diese Richtung zu werfen.«
»Das ist keine Art, von einem Bruder zu reden«, antwortete sie ihm kühn, »und ich schaue, wohin es mir gefällt, auch ohne Eure Erlaubnis. Wenn Ihr mir einen Dienst erweisen wollt, dann trennt sie, bevor einer von beiden verletzt wird.«
Ihre Worte kamen zu spät. Die Kontrahenten hatten einander zum Straucheln gebracht. Wie gefällte Ochsen schlugen sie gemeinsam auf dem Boden auf. Der kleinere der beiden, Robert, ging nach unten wie ein geübter Ringer und war schnell wieder auf den Beinen. Richard lag totenstill, als wollte er sich nie wieder erheben.
Die Äbtissin saß da mit geöffnetem Mund und vor Bestürzung wie betäubt. Pater Edmunds Augen waren geschlossen, seine Lippen bewegten sich in lautlosem Gebet. Robert zeigte sich davon unberührt. Er setzte einen Fuß auf die Brust seines Bruders und hob die ausgestreckten Hände in einer Geste des Triumphs über den Kopf.
Einen Augenblick lang stand er siegreich da, im nächsten war er wieder geworfen. Denn Richards Bewegungslosigkeit erwies sich als Täuschung. Ohne Warnung packte er Roberts Fußknöchel und schleuderte ihn mit einer kurzen Drehung krachend gegen den Tisch, wo er die Kanne mit Wein umwarf, so dass der Rebensaft wie Blut verrann und herabtröpfelte. Ein böses Omen, das Ediths Blut erstarren ließ.
Diesmal war es Robert, der sich nicht erhob. Statt Richard verspätet zur Hilfe zu eilen, strafte William ihn im Vorbeigehen mit einem kräftigen Hieb zwischen die Rippen.
»Hinterhältiges Biest«, brüllte er, als Richard sich krümmte. »Es sind schon Männer für weniger erschlagen worden.« Robert behandelte er kaum minder grob und schüttete ihm den Rest Wein ins Gesicht, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Dann zog er ihn hoch und klatschte ihm erbarmungslos auf die Wangen.
Wiederbelebt und schimpfend rief Robert nach mehr Wein. Mit hochroten Wangen hob die Äbtissin die Hand, um das zu unterbinden, doch William ignorierte sie und machte unter Drohungen einer Dienerin Beine.
»Dies ist der beschämendste Tag in der Geschichte Romseys«, stöhnte Pater Edmund, an Edith gewandt. »Eure Tante ist von Angst und Entsetzen überwältigt. Um Eurer eigenen Sicherheit willen müsst Ihr Euch jetzt verabschieden. Sie werden die ganze Nacht noch raufen und zechen.«
Gehorsam erhob sich Edith und bat ihre Tante um Erlaubnis, sich zurückzuziehen. Sie versuchte nicht zu zittern, und sagte den ungebärdigen Brüdern einem nach dem anderen Adieu. Eine frische Kanne Wein war gebracht worden, und sie ließen sich in vorübergehend wiederhergestellter Freundschaft zu einem weiteren Trinkgelage nieder. »Morgen früh werde ich an die Seite der Schwestern treten«, teilte sie ihnen mit, »und werde Euch nicht wiedersehen. Ich wünsche Euch alles Gute.«