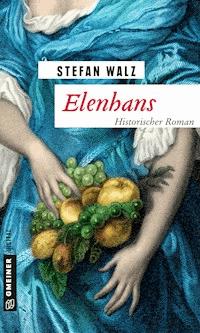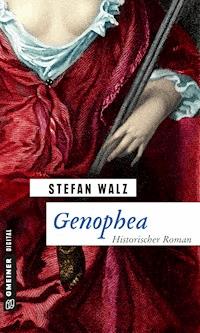Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
1628. Die Waisen Niklas und Sophie wachsen behütet im Kloster Wittichen auf. Sie ahnen nicht, dass ein altes Geheimnis hinter den dicken Mauern des Klosters schlummert. Doch die Gerüchteküche bringt den Orden bald in Verruf. Ein von den Prälaten inszeniertes Wunder soll helfen, Pilger anzulocken. Die Neugier der Kinder ist geweckt und je tiefer sie eintauchen, umso mehr müssen sie erkennen, dass sie selbst Teil der Verschwörung sind. Auf der Suche nach ihrer wahren Identität werden dunkle Mächte entfesselt, in deren Sumpf die Kinder zu ersticken drohen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Walz
Das Geheimnis der Silberkinder
Historischer Roman
Impressum
Gedicht »Ihr Mauern haltet mich gefangen«: Carola Abele
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schirmer_Das_Geroldsauer_Tal_bei_Baden-Baden_1855.jpg
ISBN 978-3-8392-5282-6
Vorspann
»Der Junge Brandstifter wurde um 11 Uhr vor dem Franziskanertor aufs Feuer gelegt. Er war ungefähr 15 Jahre alt und ertrug die allerdings harte Todesstrafen mit eher verstocktem als tapferen Sinn. Als bei bereits gerösteten Beinen die Flammen noch nicht die oberen Körperteile erfasst hatten, gab er nur ganz geringe Zeichen von Unwillen von sich. Nur die Klagelaute ›oh weh, oh weh‹ hörte man, ohne alle Scheltworte. Fast nur diese einzige Äußerung war von ihm zu hören, sonst erlitt er seine Qual wie ein Stummer gut …«
Tagebucheintrag des Abt Georg
Prolog
In einer Zeit, in der Aberglaube im Volk noch tief verwurzelt war, fürchtete man den Silberberg und die Geräusche, die aus dem aufgelassenen Stollen drangen. Dort, so hieß es nämlich, würde der Teufel umgehen, der besonders gern reine und unschuldige Seelen verspeiste.
Darum mieden die Menschen diesen Ort. Die alten Hütten zerfielen und überwucherten bald. Inzwischen hatte die Natur, nach langen Jahren des Raubbaus, sich dieses Stück Land zurückgeholt. Keiner kam mehr her. Doch immer dann, wenn der Sturmwind über die Hügel fauchte und an den morschen Bohlen rüttelte, erwachte die Geisterstadt zum Leben. Äste und Sträucher erhoben sich wie Phantome, und aus dem Mundloch sang wie eh und je das Klagelied der Bergleute. Und wer genau hinhörte, der konnte sogar ihre Hammerschläge widerhallen hören …
Tief unter etlichen Ruten dicken Gesteins huschte ein vages Licht. Es drang weit in den Berg hinein. Für einen Moment traten die Abdrücke der Mühsal hervor. Es waren Zigtausend Meißelspuren, die mit purer Muskelkraft, Eisen und Schlägeln in den Fels gerammt worden waren.
Das Menschenkind keuchte.
Unergründliche Nacht schnitt ihm den Rückweg ab. Nein, der Schein seines Kienspans, den es verbissen in seinem Mund festhielt, während es unentwegt vorwärtsstürmte, als wäre eine Armee Erdgeister ihm auf den Fersen, konnte gegen die Finsternis kaum etwas ausrichten. Lediglich ein, zwei Schritte betrug die Sicht. Dafür erschien das rußgeschwärzte Antlitz des Buben umso deutlicher. Seine kindlichen Augen waren geweitet und von Angst schwer gezeichnet.
Eigentlich war es eine menschenfeindliche Welt, in die er sich verirrt hatte. Doch es musste sein. Die Neugier, das Geheimnis zu lüften, trieb ihn an. Das Atmen der feuchtklammen Luft fiel schwer. Kein Wunder, dass er fror, barfüßig, wie er war, und nur mit einem einfachen Zwilchhemd bekleidet. Er hustete. Fast wäre ihm der Kienspan aus dem Mund gefallen. Auf dem feuchten Stollengrund wäre er sofort erloschen. Natürlich hatten sie ihn vor den Gefahren gewarnt. Er kannte die Legende und wusste über die Berggeister, oder was auch immer es war, das mit Vorliebe kleine Kinder auffraß, Bescheid.
Ohne einen wachen Verstand und sehende Augen war man hier unten verloren. Der Abbruch, der manchmal aus den bis zu 100 Fuß hohen Schächten ins Rollen kam, hätte ihn einfach zerquetscht. Auch traten plötzlich Abgründe zutage, mit denen er nicht gerechnet hatte. Eine einzige Unachtsamkeit, ein falscher Tritt – und die lechzende Tiefe hätte ihn verschlungen!
Immer wieder rauschte Wasser beim Durchwaten der Pfützen: »Plitsch, platsch!« Der Bub keuchte. Endlich hatte er die Gabelung erreicht, wo der verschüttete Südschacht abzweigte, um den sich die Erzählungen rankten. Was sich wohl dahinter verbarg? Sagenhafte Schätze, Edelsteine, Gold und Silber vielleicht? Oder gar der Teufel selbst? Allein war der Junge nicht imstande, den Schutt wegzuräumen. Dazu benötigte es schon eines gestandenen Mannes. Zögernd ging er weiter und zwängte sich in den engen Gang hinein, den sie den »Alten Mann« nannten. Der letzte Abbau von anno dazumal stand heute knietief unter Wasser. Hier glitzerte der Erzgang wieder. Zeitweise war die Lebensader der Mine wie abgeschnitten gewesen. Der Junge kroch über Geröllhaufen hinweg, dem Leuchten entgegen. Denn am Sohlenende bündelte sich das Licht des Kienspans in einem einzigen strahlenden Punkt. Es war wie der Stern inmitten eines düsteren Firmaments. Tausend silberne Wassertropfen glitzerten mit den Bergkristallen um die Wette. Es war schon ein beeindruckender Glanz, so tief unter Tage, von finsterer Nacht umgeben.
Beherzt nahm der Junge das Bergeisen und schlug einen faustgroßen Brocken aus dem Fels. Seine Augen funkelten nicht minder, denn nach dem Gewicht des Steins zu urteilen, hielt er wenigstens zwölf Lot gediegenes Silber in der Hand. Er hatte es geschafft! Die Angst war besiegt! Ohne fremde Hilfe war es ihm gelungen, bis zum Südschacht vorzudringen – und so ganz nebenbei hatte er die alte Erzader wiederentdeckt.
Kapitel 1
In der Abgeschiedenheit des Schwarzwalds, in einem von schillernden Bächen durchflossenen wildromantischen Tal, legte das alte Kloster noch immer steingewordenes Zeugnis seiner frommen Gründerin ab. Luitgard von Wittichen hatte zu Lebzeiten unzählige Wunder bewirkt, und selbst in der Gegenwart hofften Pilger im Garten ihres längst vergangenen Daseins, Trost und Linderung zu erfahren.
Man schrieb das Jahr 1628.
Luitgards Erbe war längst verblasst, und die Schatten irdischer Fehlbarkeit senkten sich über den Konvent.
Doch trotz der um sich greifenden Dunkelheit gab es auch Lichtblicke. Die beiden Waisen, die in der Obhut der Klarissen heranwuchsen, versprühten Leben. Dass sie ganz besondere Kinder waren, erkannte man daran, mit welcher Hingabe sich die Dienerinnen Gottes um sie kümmerten. Damals, als sie am Silberberg noch schürften, regierte der Puls der Bergleute im Tal der grünen Weiden1. Inzwischen waren die und damit das geschäftige Treiben aber weggezogen. Seit die Spanier riesige Mengen des Edelmetalls aus den Minen Mexikos und Perus bargen, lohnte sich der Abbau im Schwarzwald nicht mehr. Für das Kloster war das ein Segen, denn in der Abgeschiedenheit kamen die Schwestern dem Schöpfer wieder ein Stück näher.
Ganz anders erging es den Kindern. Sie empfanden das tägliche Einerlei erdrückend. So gab sich das Mädchen, Sophie, mit den blonden glatten Haaren, gerne ihren Tagträumen hin. Glaubte man den Nonnen, erblickte sie vor etwa 13 Jahren das Licht der Welt. Ihre schwangere Mutter sei eine Wallfahrerin gewesen, die sich an Luitgards Grab Seelenheil versprach. Ob sie es bekam? Jedenfalls nahm sie der Herr gleich zu sich, nachdem Sophie geboren wurde.
Soweit die Geschichte. Heute begann das Postulat. Sophie sollte sich an ein Leben für Gott in Keuschheit, Armut und Gehorsam gewöhnen. Sie trug eine armselige schafwollene Tunika, die an der Brust geschnürt wurde. An kalten Tagen warf sie ein braunes Skapulier über. Schleier und Brusttuch lehnte sie trotzig, wie sie war, ab. Doch so einsam, ganz ohne eigene Familie, hielt das irdische Sein nur die strenge Klausur für sie bereit. Besonders, wenn die Tage kürzer wurden, brütete das Mädchen in der Klosterbibliothek über den »guten katholischen Büchern, Postillen und Heiligenlegenden«. Ihre Mentorin, Johanna von Hornstein, die Verwalterin der klostereigenen Flößerei, wachte akribisch genau darüber. Sophie ließ die Seiten gelangweilt durch die Finger fliegen. Es half alles nichts. Sie gähnte, und die großen, wachen Augen wurden immer dunkler. Wie ermüdend das Schriftgut doch war. Sie walkte die schön geschwungenen Lippen aufeinander und summte die ewig gleiche Melodie, die wie ein Gespenst durch ihre Gedanken spukte. Gott hatte Sophie eine engelsgleiche Stimme geschenkt. Sie liebte den Gesang und manchmal dichtete sie selbst einen Text hinzu wie diesmal:
»Lies mein Kind, so höre das Wort
was von den Weisen g’schrieben dort.
Mond und Stern, sie halten Wacht
wenn erleuchtet die Aug’ du zug’macht«2
Die Konzentration auf das Wesentliche fiel ihr schwer. Denn sie schweifte allzu gerne ab und steckte ihre Nase viel lieber in das verbotene Buch über die englische Prinzessin. Sie hatte es einst in einer verstaubten Ecke entdeckt. Jetzt kramte sie es hervor. Wie herrlich es doch wäre, ein ähnlich sorgenfreies Leben in Luxus zu führen?
Vorsichtig blickte sie über die Schulter zurück. Jeden Augenblick musste sie damit rechnen, dass Schwester Johanna ohne jegliche Vorankündigung hereinstürmte. Doch die Luft war rein, und Sophie versank in der spannenden Lektüre. Das schulterlange Haar schmiegte sich liebevoll an die Wangen und kitzelte das schmale Kinn des Mädchens. Elisabeth Stuart3 musste eine außergewöhnliche Schönheit sein, mit der hochtoupierten Frisur, von goldenen Spangen bekrönt, und dem hellen Teint. Charme und Edelmut hatten ihr die Beinamen »Pearl of Britain« und »Queen of Hearts« eingebracht. Doch das Schicksal hatte der Dame übel mitgespielt, nachdem ihr Gatte Friedrich von der Pfalz vom Kaiser geächtet worden war. Sie musste ins Exil in die Niederlande fliehen. Die Kurwürde hatten sie an Maximilian von Bayern und die Königskrone an Ferdinand von Österreich verloren. Dass Elisabeth eine Protestantin war, eine Ungläubige also, störte Sophie nicht. Sie faszinierte alleine die Biografie, in der sie eine Parallele zu ihrem eigenen Schicksal erkennen wollte, und da war die Religion einerlei.
Langsam setzte sich die Dämmerung gegen das diesige Tageslicht durch. Müde linste Sophie aus dem Fenster und war mit den Gedanken bei Niklas und seinen Streichen. Ein wohlwollendes Lächeln zuckte über ihr Gesicht. Niklas war so etwas wie ein Bruder für sie. Ein quirliger Junge, der zuweilen mit einer fast unbändigen Wildheit ausgestattet war, die nur durch seine angeschlagene Gesundheit ausgebremst werden konnte. Auch er war elternlos und träumte von besseren Zeiten, die für ihn aus Abenteuern in der großen weiten Welt bestanden. Über seine Herkunft wurde viel spekuliert. Die Klarissen gaben vor, er sei als Säugling eines Nachts unter dem Klosterportal abgelegt worden. Das lag nun elf Jahre zurück.
Mit den Fingerspitzen kämmte Sophie die widerspenstigen Strähnen hinters Ohr zurück, aber das war gar nicht so einfach. Die Haare, so trocken wie Weizenbüschel, hingen kerzengerade herab, egal was sie unternahm. Mit einem lauten Knall klappte sie das Prinzessinnenbuch zu. Wie für die Stuart, so neigte sich auch für sie im Wittichener Tal das unbeschwerte Leben seinem Ende entgegen. Sophie war kein Kind mehr und sah die Welt zunehmend mit den Augen einer Frau. Sie stellte Fragen, die ihr früher niemals in den Sinn gekommen wären. Auch politisch rumorte es allerorts. Der große Krieg, der auch die Königstochter ins Unglück gerissen hatte, tobte schon seit 14 Jahren. Noch wüteten die Kämpfe fern der Heimat, und doch bekam man die Not langsam zu spüren. Der Befehl Graf Wratislaus I., Herr des Klosters, alles Vieh den Wolfacher Metzgern zur Verfügung zu stellen, um das durchziehende Soldatenvolk zu versorgen, hatte jüngst für großen Unmut gesorgt. Zum Glück besaß das begüterte Kloster noch genügend andere Einkünfte, deren Eintreibung jedoch immer schwieriger wurde.
Sophie seufzte, denn sie wusste: Zeiten wie diese waren für Träume nicht gemacht!
*
Draußen hatte das Nieseln, das sie schon den ganzen Tag über bedrückte, nicht nachgelassen. Der graue Schleier hatte die goldenen Farben des Herbstes völlig aufgesogen. Er ließ keine Sonnenstrahlen durch. Immer mehr verschmolz das Grün des Waldes mit dem alten Gemäuer zu einem tristen Gemälde ohne Hoffnung.
Niklas trat aus dem Stollen.
Stolz verwahrte er den ergatterten Schatz in seiner Umhängetasche und begab sich auf den Heimweg. Der Gedanke an eine reich gedeckte Tafel verdrängte die Sorge, dass noch etwas schief gehen und man von seinem Ausflug Wind bekommen könnte. Dabei ließen die dreckigen Kleider nur die eine Schlussfolgerung zu, und die Wahrheit stand ihm sozusagen am Leib geschrieben. Pfeifend überquerte er den Vorplatz beim Silberberg, der von Abraumhalden und verfallenen Hütten gesäumt war. Vor vielen Jahren hatten die Bergleute alles stehen und liegen gelassen. Gelegentlich fand man noch Schwerspat im Geröll, der jedoch einen so geringen Gehalt aufwies, dass es nicht lohnte, ihn aufzubrechen. Am Wüstenbach wusch er sich sorgfältig Hände und Gesicht. Der Gedanke an den verschütteten Gang und die Frage, was sich wohl dahinter verbarg, kreiste in seinem Kopf und ließ ihn nicht mehr los. Noch genoss er die Freiheit, das geheimnisvolle Rauschen der Tannen und das fröhliche Plätschern des Baches, das sich jedoch allmählich zu einer kummervollen Symphonie wandelte, je weiter er sich Luitgards Haus näherte. Schon kam die moosüberwachsene Ringmauer in Sicht. Zweifellos hatte die uralte Umfriedung, genauso wie das geistige Leben, schon bessere Tage erlebt. Überall bröckelte der Putz, und der nackte Stein lag blank. Die ersten Gebäude, die Umrisse des Waschhauses und die dahintergelegenen Stallungen fügten sich rasch zusammen. Dann brach die wuchtige Abtei durch. Dort, im sogenannten »Langen Bau«, befanden sich die Wohnungen der Wirtschafterinnen, das Gasthaus und auch ihre eigenen Zimmer – enge schmucklose Zellen, nicht viel gemütlicher als der Karzer, die Arrestzelle im dritten Stock, wohin man ihn wegen seines Ungehorsams hoffentlich nicht bringen würde.
Das schmucklose kastenförmige Gebäude fügte sich passend in die hügelige Landschaft ein und schottete das Tal und damit die Menschen, die hier lebten, von der anderen Seite der Welt ab. Am Kräutergarten zur Linken erhob sich der Bergrücken, hinter dem sein alter Freund Rochus in der Waldsiedlung lebte. Von rechts grüßte, auf leichter Anhöhe, die Klosterkirche und schließlich erschien hinter dem »Frau Mutter Bau« der geheiligte Bezirk mit der Klausur und dem Refektorium. Drumherum gab es nichts außer Wald, so weit das Auge reichte. Vor diesem trostlosen Hintergrund bedrückte Niklas besonders die Stille. Ihm war, als flüstere ihm jemand zu, dass dieser Ort Wächter eines finsteren Geheimnisses sei. Denn keiner durfte sich ungestört umsehen, niemand konnte das Areal verlassen, ohne dass man es bemerkte.
Doch Niklas hatte Glück. Unbehelligt schaffte er es in den »Langen Bau«. Dort traf er im Speisesaal Schwester Renate. Die resolute Münchnerin war die Aufseherin des Spitals. Mit Argusaugen überwachte sie die Essensausgabe, musste sie doch genau hinsehen, welcher Pfründner einer besonderen Stärkung bedurfte und wer nicht. Schon von Weitem grinste Niklas wie ein Schelm und zeigte die breiten, leicht vorstehenden Schneidezähne. Wer konnte ihm da noch widerstehen? Die herzensgute Renate jedenfalls nicht! Sie verzieh ihm sogar die schmutzigen Gewänder, schließlich war es kein ungewohntes Bild, sondern Alltag. Nachsichtig verrubbelte sie seinen verwegenen Blondschopf und schickte ihn sogleich auf den freien Platz neben Sophie.
Erleichtert schlug der Bub das Kreuz und dankte dem Himmel.
Während die geweihten Nonnen im Refektorium speisten, war das Gasthaus im »Langen Bau« für die Laien und Pilger bestimmt. Auch der Klosterschaffner Weber und dessen Sohn Konrad saßen dort zu Tisch. Pater Johannes, ein Schwarzer Franziskaner, der Beichtvater im Kloster, las wie immer aus der Bibel, damit, wie er sagte, »neben dem Leib, auch die Seele gespeist wird«.
Sophie empfing den Herumtreiber mit einem vorwurfsvollen Augenaufschlag und löffelte dann ungestört das Essen. So unschuldig, wie er dreinschaute, so faustdick hatte er es hinter den Ohren. Sie ahnte bereits, wo er gewesen war. Zum Dank dafür bekam er auch noch das Essen serviert, während andere dafür anstehen mussten. Renate wusste genau, dass der Bub zum Mittagessen gefehlt hatte, und legte einen Extraschöpfer nach.
Niklas aber zog eine enttäuschte Miene und guckte naserümpfend vom Teller auf. Nur gebrannte Mehlsuppe mit Brot?
Sophie grinste mit vollem Mund. Sie hatte am Mittag noch Semmelknödel mit Eiern und Speck gehabt. Hm, wie lecker das war! Sie stieß ihn mit dem Ellenbogen an. »Wo warst du?«, raunte sie, nachdem sie geschluckt hatte. »Hoffentlich nicht da, wo ich denke?« Prüfend blickte sie in die Runde. Alle ließen es sich schmecken, und zum Glück war das Essgeräusch noch lauter als ihre Stimme. Denn bei den Mahlzeiten galt absolutes Sprechverbot, und wer sich nicht daran hielt, riskierte eine schwere Bestrafung. »Du weißt, dass dort …«, begann sie, doch Niklas fiel ihr ins Wort und zog genervt die Brauen hoch: »… der Teufel wohnt, der gerne kleine Kinder verspeist? Ich weiß, ich weiß«, wiederholte er gebetsmühlenartig die bekannte Warnung. »Das ist dummes Gewäsch. Und ich habe ihn übrigens nicht getroffen, den Kerl mit dem Bocksfuß!« Er zeigte Sophie den Vogel, und als ihn der mahnende Blick des Vorlesers traf, riss er ein breites Unschuldslächeln.
Die Augen Sophies folgten Niklas’ verstohlenem Wink unter den Tisch, wo der Bub etwas aus der Umhängetasche kramte, das in ein Taschentuch eingewickelt war. Umständlich schlug er das Päckchen auf, und ein matter Silberstein kam zum Vorschein.
Sophie blinzelte angstvoll zu Pater Johannes hinüber, der im Sprechgesang fortfuhr.
Niklas’ blaue Augen funkelten hell. Auch er vergaß bei aller Aufregung das Schweigegebot: »Der Rochus und ich haben die Schleuse wieder in Gang gesetzt. Würde das Wasserrad nicht so hartnäckig blockieren, würde auch das Pochwerk wie zu besten Silbergräberzeiten hämmern. Dort könnten wir den Schwerspat brechen, den es im Berg immer noch zuhauf gibt!«
»Du bist verrückt!« Sie verpasste ihm eine Kopfnuss, die nicht ganz ernst gemeint war, und sah ihn mitleidig an. »Wenn sie erfahren, dass du in der Grube warst, sperren sie dich ein.« Um ihrer Sorge Nachdruck zu verleihen und ihn zu ermahnen, die Trophäe besser wegzuräumen, stieß sie ihn mit dem Knie an.
»Das ist noch lange nicht alles«, plapperte Niklas unbeirrt weiter und strahlte dabei wie ein Honigkuchenpferd. »Ich habe den verschütteten Gang wiederentdeckt. Bald werden wir reiche Leute sein und das Kloster verlassen.« Er nickte ohne Unterlass und heischte nach Bewunderung.
Doch Sophie war alles andere als begeistert. Dass er sich so leichtfertig in Gefahr begab, machte sie rasend. »Da hast du das Höllentor entdeckt, du Narr! Willst du den Teufel aufwecken und in seinem Ofen braten wie ein Hähnchen? Bei allen Heiligen, Niklas, du gehst zu weit!«
Auf einmal wurde es totenstill. Sophie, die langsam begriff, was geschehen war, verschloss sich angstvoll den vorlauten Mund. Die Speisenden blickten allesamt fassungslos auf sie. Das Mädchengesicht nahm die Farbe einer roten Rübe an. Sophie fürchtete besonders den stechenden Blick des Schwarzen Franziskaners, der Giftpfeile in ihre Richtung schoss. Energisch legte er die Bibel zur Seite und schritt zur Tat. Niklas schaffte es gerade noch, den Silberklumpen einzuwickeln, bevor der große hagere Ordensbruder sich vor dem Tisch aufbaute. Ohne ein Wort packte er Sophie am Arm, die spürte, wie das Blut daraus entwich, da ihre rechte Hand bereits pelzig wurde. Vor Schmerzen und Angst kniff sie die Augen zu und ließ sich vom Stuhl zerren. Der Sprühnebel von Johannes’ Speichel kitzelte ihre Haut, während er sie anherrschte: »Du fluchst, während ich aus dem Heiligen Buch vorlese?«
Sophie zitterte wie Espenlaub.
Sie ahnte bereits, welche Strafe ihr blühte.
*
In der Nacht streckte der Tod seine schwarzen Flügel über dem Kloster aus und rief eine Seele zu sich in die Finsternis. Sophie spürte die bösen Mächte, die da wirkten, und durchlebte Höllenqualen. Der Boden, auf dem sie hockte, war mit Binsen bestreut und dennoch bitterkalt. Fröstelnd zog sie die Beine eng an den Leib. Eingesperrt hinter ellendicken Wänden, hielten die alten Ängste sie fest im Bann. Es war ein Déjà-vu – wie eine Rückkehr an einen unbekannten Ort, in eine nicht gekannte Zeit. Es riss sie aus dem Jetzt, und es fiel ihr schwer, halbwegs rationale Gedanken zu fassen. Nein, eine solche Nacht wie die zurückliegende wünschte sie keinem, nicht einmal Pater Johannes, der sie gestern in den Karzer gesperrt hatte.
Der Dämon überfiel sie vor allem bei Dunkelheit und hatte sie die ganze Zeit gepeinigt. Zum Glück verjagte ihn jetzt das helle Tageslicht, das die Zelle flutete und sie erlöste. Langsam wurden die eingeritzten Buchstaben wieder deutlich, die in den vergangenen Jahrzehnten von den Malefikantinnen in den Putz gezeichnet worden waren.
Errette uns, oh Herr, von der Hure der Montfort.
Erspar uns den Bastard des Getauften im Namen des
Glücks – Caritas.
Sühne den Brudermord, oh Grafenkind.
Besonders die Zeilen, die sich der Reihe nach auf den Wänden verteilten, brannten sich in ihren Gehirnwindungen ein. Mit etwas Fantasie musste man die Teile nur zu einem Ganzen zusammenfügen, und man erhielt ein wundervolles Gedicht:
Ihr Mauern haltet mich gefangen,
gleich der Sucht nach deinem Schein,
Herz reist Meilen in Gedanken,
ausweglos ist nun mein kaltes Sein.
Dunkelheit umgibt mich strafend,
Teufel, Gott, wem ist’s sein Spiel?
Bin erkaltet und verlassen,
mein Herz, wenn ich dich nur einst behielt.
Dazwischen, kreuz und quer, lateinische Silben, mit denen sie allerdings nur wenig anzufangen wusste. »Omnia vincit amor.« Was das wohl alles bedeutete? Liebe, oh du innig wahre Liebe! Die Verse jedenfalls klangen nach einem Herzensgedicht. Was es doch für ein schönes Gefühl sein musste, geliebt zu sein? Unweigerlich kam Sophie die Kurfürstin von der Pfalz in den Sinn. Auch sie war einst Königin gewesen, die schöne Engländerin, doch keusch war sie nie. Sie hatte ihrem Gatten knapp ein Dutzend Kinder geschenkt.
»Pst«, flüsterte es plötzlich. Für Sophies Ohren klang es wie ein unheimliches Fauchen. Und wieder überfiel sie diese unsägliche Beklemmung wie schon die ganze Nacht über. Auf einmal verschwammen die eingeritzten Worte, und auch das anmutige Bild der englischen Königin und mit ihr die Kinderschar zerplatzte. Sie hätte wohl einen freundlichen Unterton heraushören können, wäre der Schall im langen Schlauch des Flurs nicht derart übersteigert verstärkt worden. Die Stimme hatte kein Erbarmen und ließ sich auch nicht von dem Schluchzen beirren.
»Lass mich in Ruhe«, scheuchte Sophie den Dämon fort.
Dieser antwortete umgehend: »Spinnst du jetzt?«
Das klang nun gar nicht gespenstisch, sondern verletzt und erstaunt.
Langsam kam Sophie zu sich. Sie blinzelte und sah die tanzenden Staubpartikel im Licht schwimmen. Es war außergewöhnlich hell geworden. Jemand hatte das Schiebefenster des Sprechgitters aufgerissen. Der geschwätzige Mund, der sich auf und zu bewegte, war ihr wohlbekannt.
Mit einem Satz sprang sie auf und ging ihm wortlos entgegen.
»Mensch, warum antwortest du denn nicht? Geht es dir nicht gut?«, fragte die Stimme besorgt, von der sie längst wusste, dass sie Niklas gehörte. Ein hölzernes Knirschen lenkte sie ab, und Sophie vergaß, erneut zu antworten. Ihr Blick fiel auf die Klappe neben dem Sprechgitter, die sich nun langsam öffnete. Es war die Durchreiche, über die man Nachrichten austauschen konnte oder das Essen bekam.
Die Kurbel konnte von beiden Seiten betrieben werden.
Sophie wartete gespannt.
»Ich dachte mir, du hast bestimmt einen Bärenhunger«, war Niklas um Gutwetter bemüht, schließlich war er an Sophies Situation nicht ganz unschuldig. Jetzt erkannte er ihren Schatten hinterm Sprechgitter und atmete erleichtert aus. »Na endlich, ich dachte schon …«, er brach ab und verscheuchte die schlimmen Gedanken. »Ach egal. Einen schönen Gruß von Renate soll ich dir bestellen. Sie hat dir Würste und frisches Brot geben lassen. Außerdem habe ich Kerzen besorgt …«
Sophie fiel wie eine hungrige Wölfin über die Leckereien her. Niklas hörte sie schmatzen und strahlte verwegen. »Ich weiß doch, wie sehr du dich fürchtest. Deshalb die Kerzen«, erklärte er und unterdrückte ein Kichern. »Wenn du wüsstest, woher ich die habe!«
»Woher denn?«, fragte Sophie schmatzend und nahm die vertraute Nähe und das Gefühl, dass jemand an sie dachte, in sich auf.
»Mann, der Pfaffe wird schön dumm aus der Wäsche gucken, wenn er den Verlust in seiner Kirche bemerkt. Ich hab sämtliche Leuchter leer geplündert.« Und wieder prustete er vor Schadenfreude in die vorgehaltene Hand, wenn er sich das dämliche Gesicht von Pater Johannes vorstellte, der hoffentlich einem räuberischen Pilger die Schuld geben würde.
»Niklas, du bist ein Schatz. Aber die Hochwürdige Mutter wird dir dafür sicher den Hintern versohlen, ich meine, sie werden es herausfinden, denn sie kennen dich Lumpen!«
Niklas’ Heiterkeit kam ins Bröckeln, und er machte aus seinen Gefühlen keine Mördergrube mehr. »Sie wird nie davon erfahren, fürchte ich«, erklärte er traurig. »Es steht alles andere als gut mit ihr. Die gerufenen Ärzte sind ratlos. Sophie, ich fürchte, die Nonnen haben im Moment ganz andere Sorgen, als sich um unsere Dummheiten zu kümmern.«
Die Nachricht verdarb Sophie den Appetit. Sie legte den Wurstzipfel auf den Tellerrand zurück, schürzte die Lippen und tippte mit dem Zeigefinger darauf. Dass die Äbtissin plötzlich sterben würde, war einfach ungerecht! Sie war wie eine liebe Mutter, denn alleine auf ihrem ruhigen Schoß durfte sie ihre Verlorenheit ausweinen. Wieder suchten die salzigen Tropfen ihren Weg und schlängelten sich an Sophies Nasenflügel entlang. Doch wie so oft lehnte sich das Mädchen gegen die aufwallenden Gefühle auf und bündelte sie in Trotz. Sie schniefte und wischte das Gesicht mit dem Hemdsärmel energisch trocken. »Lieber Gott, lass mich für sie büßen!«, schrie sie ihren Schmerz heraus. »Die Meisterin darf nicht sterben!«
*
Eine neue Nacht senkte sich über das Tal. Man hörte den Klosterbach glucksen und irgendwo im Wald einen Uhu rufen. Zur Mette erfüllte der Ruf, »Herr öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde«, das Areal. Doch es war nicht wie sonst, denn es klang wie ein Klagen. Niklas bekam kein Auge zu. Er kauerte auf seiner Pritsche, im zweiten Stock des »Langen Baus«, und fühlte, dass nun die Todesstunde gekommen war. Es riss eine tiefe Wunde in sein Herz. Der Umstand, dass Sophie mithilfe seiner Kerzen einen halbwegs geruhsamen Schlaf verlebte, vermochte den Schmerz etwas zu lindern. Doch die innere Unruhe forderte ihn geradezu heraus, den Machenschaften dieser Nacht auf den Grund zu gehen.
Ja, Niklas kannte die Wunder, die am Grab der Seligen angeblich geschehen waren. Aber warum vermochte Luitgards Kraft, die nach ihrem Tod noch immer allgegenwärtig war, die kranke Meisterin nicht zu heilen, wenn sie angeblich so viele andere genesen ließ? Die Fantasien überforderten bald seinen kindlichen Verstand, denn es verirrten sich so manch dumme Ideen darin. Bald war ein solcher Wirrwarr an Intrigen gesponnen, dass es ihn geradewegs aus dem Bett katapultierte. Er beschloss, einen klaren Gedanken zu fassen. Das gelang ihm am allerbesten in Gegenwart von Pferden. Sie waren für ihn Inbegriff der Freiheit, von Bewegung und Ruhe zugleich, und das bedeutete mehr als sämtliche Reliquien oder Heiligenbilder dieser Welt.
Inzwischen war das Totenoffizium zu Ehren der Äbtissin im Gange, und die Annahme von ihrem Tod wurde nun zur traurigen Gewissheit. Die gesungenen Choräle und die Monotonie der wiederkehrenden Paternoster4, 50 an der Zahl, wie Niklas sie zählte, trieben ihn geradezu hinaus. Er schlüpfte in seine Weste und schwang sich die steinerne Wendeltreppe hinab. Die Schnarchlaute, die aus Pater Johannes’ Zelle drangen, begleiteten ihn. Obwohl der Boden bei jedem Schritt knarrte, musste er den Franziskaner wohl nicht fürchten.
Drunten im Hof umgab ihn stockfinstere Nacht. Doch zum Glück war der Weg bis zu den Winterstuben mit Fackeln ausgeleuchtet. Auf einmal hörte Niklas Hufe klappern. Er verließ den Weg und fand unter dem Dachfirst des Refektoriums ein geeignetes Versteck. Sein Herzschlag galoppierte schier davon, als er die Gestalt ausmachte, die ein Pferd zur unteren Klosterpforte führte. So dicht es ging, schob er sich gegen die Hauswand, um nicht vom Schein der Laterne eingefangen zu werden. Bange hielt er Ausschau nach möglichen Erklärungen. Doch da selbst die Schaffnerei gegenüber düster war, konnte es auch nicht Martin Weber sein, der zu später Stunde über den Hof streifte. Aber wer dann? Nur einem ausgewählten Personenkreis stand es nämlich frei, das Kloster zu verlassen. Dazu gehörten der genannte gräfliche Verwalter, der Beichtvater, der augenscheinlich schlief, und schließlich die Äbtissin. Doch diese lag tot in ihrem Bett!
Die Straße von Schenkenzell grub sich tief unter dem Abteigebäude hindurch und mündete vor dem verschlossenen Portal. Da das Bodenniveau dort leicht abgesenkt war, musste der Fahrweg durch eine Böschungsmauer gestützt werden. Der Reiter verschwand in ihrem Schatten. Bald hörte Niklas die Pforte knarren, und es erschien eine weitere Silhouette. Sie trug eine Laterne und hastete die Auffahrt herauf. Niklas konnte ein dunkelbraunes Nonnenhabit ausmachen. Wer die Unbekannte war, konnte er nicht erkennen, denn die Kapuze des Skapuliers war weit ins Gesicht gezogen und verdunkelte ihr Antlitz. Nun hetzte die Nonne zum »Frau Mutter Bau« und tappte unbedacht in eine Pfütze. Niklas hörte Matsch spritzen. Er blieb aber in seinem Versteck und hielt den Atem an. Denn auch die Ordensfrau war hellhörig geworden und sah sich um. Es war eine groß gewachsene, schlanke Person. Glücklicherweise schien sie niemanden bemerkt zu haben und verschwand schließlich nichtsahnend in der Wohnung der verstorbenen Äbtissin.
Kurz darauf erklang das Gloria Patri: »Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist …«
Für Niklas war die Luft rein. Quer raste er das letzte Stück über den Hof zum Stall hinüber. Komisch! Das Gatter war angelehnt, die Pferde unruhig, was bei dem nächtlichen Radau eigentlich kein Wunder war. Sie scharrten mit den Hufen. Niklas kannte jedes einzelne Tier. Sofort stach ihm der fremde Rappe ins Auge. Mutig ging er auf ihn zu und streichelte den samtigen Hals. Das edle Ross war verschwitzt und musste erst vor Kurzem hier untergestellt worden sein. Niklas sah sich das Brandzeichen genauer an und ertastete mit den Fingerspitzen so etwas wie einen Krummstab.
Er konnte es nicht glauben: Es war das Wappen Alpirsbachs!
Schaudernd zog er die Hand zurück. Das ehemalige Benediktinerkloster gehörte seit der Reformation dem Herzog von Württemberg. Was, um alles in der Welt, wollte ein Lutheraner in der klösterlichen Gemeinschaft von Nonnen? Womöglich hatte dieser Ketzer die Meisterin auf dem Gewissen. Der Tod der Äbtissin war ein schändlicher Mord und das Pferd der Beweis dafür, dessen war er sich sicher. Hals über Kopf stürzte Niklas in die Nacht. Das Gatter ließ er offen stehen. Nicht im Geringsten dachte er mehr daran, ertappt zu werden. Es gab auch keine Anzeichen. Die Eingangstür zur Abtei fand er angelehnt vor, so wie er sie vorhin verlassen hatte. Im sicheren Glauben, sein nächtlicher Streifzug wäre unbemerkt geblieben, schwang er sich am Handlauf der Treppe in den zweiten Stock empor. Dort hatten die knarrenden Dielen Pater Johannes aufgeweckt. Er hatte die ganze Zeit auf ihn gewartet. Mit flackernder Kerze kam er ihm auf dem Flur entgegen. Seine Schritte waren kaum zu hören. Niklas kapitulierte und senkte den Kopf. Ihm schien es, als würde der Schwarze Franziskaner wie ein Geist über dem Boden schweben.
»Dumm, wie du bist«, schnaubte der Mönch, »hast du genau eine Kerze übrig gelassen, die nun genügt hat, dich auf deinem neuerlichen Raubzug zu ertappen!« Er packte das Kind an beiden Schultern, schob es über den Flur und stieß es schließlich durch die geöffnete Kammertür. Dort fand sich der Bub auf dem kahlen Fußboden vor seinem eigenen Bett wieder.
Die Tür krachte ins Schloss.
Der Riegel knarrte und es wurde mucksmäuschenstill.
1 Tal der »gruone Widechen« (etwa: grünes Weidegebüsch). Mittelalterlicher Name von Wittichen.
2 Vollständiges Wiegenlied siehe Anhang
3 Elisabeth Stuart (* 1596, † 1662): Prinzessin von England und Schottland. Durch Heirat mit Friedrich V. (dem Winterkönig) von 1613 bis 1623 Kurfürstin von der Pfalz. 1619 bis 1620 Königin von Böhmen
4 Vaterunser
Kapitel 2
In derselben Nacht, nur wenige Meilen von Wittichen entfernt …
Reiter streiften durch die Täler des Schwarzwalds. Sie kamen aus der Stadt Villingen und waren das Geleit des Guardians Ludwig Amusis. Wegen der eingebrochenen Dunkelheit und zweier ziemlich angetrunkener Führer, den Benediktinermönchen Rudolf und Jakobus, waren sie mit den Nerven ziemlich am Ende. Die eng gewundenen Wege und die unübersichtlichen territorialen Zugehörigkeiten taten ein Übriges. Sie bekamen es mit der Angst zu tun.
Hier waren sie völlig auf sich allein gestellt. Nichts außer Bäumen und den schmalen Pfad vor Augen, der sich irgendwo in den Tiefen des Waldes verlor. Ihre Reise drohte, zum Spießrutenlauf zu werden. Es passte genau in das Bild, dass jetzt der Himmel seine Schleusen öffnete und Regen niederströmte. Ob sie ihr Ziel noch vor der Sperrstunde erreichen würden?
Ginge es nach Bruder Rudolf, wohl kaum! Keiner verstand, wie er noch die Ruhe bewahren konnte. Das Misstrauen über ihn wuchs, und langsam platzte dem hohen Würdenträger der Kragen. Schließlich gab es Angelegenheiten von äußerster Wichtigkeit zu erledigen, die keinen Aufschub duldeten. Mit dem Hirtenstab schlug er gegen die Kabinenrückwand, um den Kutscher zu einer schnelleren Fahrt anzuhalten. Und siehe da, die Pferde schlugen eine schnellere Gangart an. Bald hatte die Karosse die beiden Benediktiner, die gemütlich vorausritten, eingeholt. Amusis schob den Vorhang zurück und streckte den Kopf durch das schmale Fenster. »So haltet ein!«, rief er hinaus.
Ungerührt führte Rudolf das Zwiegespräch mit Jakobus fort: »Morgen«, schwärmte er und blinzelte in den verregneten Nachthimmel, »sobald der Spuk hier vorbei ist, werde ich meine verdiente Kur antreten. Die Quellen des Sauerbrunnens werden mich genesen lassen und meine Seele befrieden. Während unsereins sich bei diesem Sauwetter ohne Dach herumplagen muss, faulenzt dieser fette Franziskaner in seinem vornehmen Gefährt. Pah!«
Jakobus, ein etwas dicklicher Mönch mit Baritonstimme und Knubbelnase, schluckte. Er spürte den wütenden Blick des Guardians und getraute sich kaum hinüberzuschauen. Störrisch sah er geradeaus. Rudolf träumte unbeirrt dem Urlaub entgegen, den ihm Abt Georg nach langem Betteln endlich gewährt hatte. Dass der Regen dem Guardian ins Gesicht peitschte, schien Rudolf zu gefallen, zeigte es doch, dass sie alle Gottes gleiche Kinder waren.
»Anhalten, sage ich!«, brüllte Amusis und schickte ein paar verbotene Flüche nach. Er japste und spuckte die eingeatmeten Regentropfen angewidert aus. Als wäre es die sofortige Strafe des Himmels, durchfuhr die Kutsche in diesem Moment ein Schlagloch, und das ehrwürdige Haupt des Franziskaners knallte gegen den Türrahmen.
»Was für eine Katastrophe dieser Beinbruch doch war«, sinnierte Rudolf über die missglückte Pilgerfahrt im letzten Jahr nach. »Im Kloster Einsiedeln wollte ich das Gelübde an der Heiligen Jungfrau erfüllen, und wir kamen gerade mal aus Villingen hinaus. In der Herberge ›Zum Fischer‹ ist es dann passiert – und an allem war diese verdammte Treppe schuld!«
Die Erinnerung trieb Jakobus die Zornesröte ins Gesicht. Noch heute könnte er Rudolf für das Malheur erwürgen. Denn wieder einmal hatte dieser es sich nicht nehmen lassen, die Schlafräume der jungen Mägde aufzusuchen, um durchs Fenster zu spicken – in Vorfreude auf wer weiß was nicht alles! In seiner Gier war er wohl gestolpert und das gesamte Trippel von oben nach unten hinab gerumpelt. Eigentlich hätte er dafür den Groll des Abts auf sich ziehen müssen. Doch anstatt der Stockhiebe und dem fälligen Bußarrest bescherte es Rudolf die erwähnte Erholung in Rippoldsau. Eine unglaubliche Ungerechtigkeit, wie Jakobus fand.
Das Getöse des Wagens raubte Rudolf endgültig die Lust, im Morgen zu schwelgen. Hochmütig wandte er sich dem Guardian zu. »Eure Exzellenz, Ihr werdet Euch einen Schnupfen holen. Ihr solltet Euren Kopf besser einziehen. Das Dach schützt vor Niederschlag, über den wir zwar nicht hadern wollen, aber der Herr hätte doch warten dürfen, bis wir einfache Leute das gewünschte Ziel erreicht haben. Amen.«
So viel Unverschämtheit auf einen Haufen war dem Guardian selten untergekommen und es verschlug ihm die Sprache. Rudolf grinste selbstzufrieden in sich hinein. Er wusste, dass Amusis, der erst zu Monatsbeginn das Amt des hiesigen Provinzials angetreten hatte, auf seine Hilfe angewiesen war. Beinahe hätte das Schweigen respektlose Auswüchse angenommen, wäre nicht Pater Jakobus gewesen, der seinem Bruder uneigennützig aus der Klemme half. »Seht hin, Euer Gnaden!«, rief er und deutete auf die Baumwipfel, hinter denen sich helle Lichter zeigten. »Die Nachtfeuer der Burg ›Hohen Landesehr‹, die über die Stadt Schiltach thront, weist uns den Weg. Dort findet ihr, Hochwürdigster Herr, gewiss ein gemütliches Bett. Morgen Früh werden wir dann das Kloster Wittichen erreichen, sodass Euch noch genügend Zeit für die wichtige Arbeit bleibt.«
Amusis nickte verschnupft. Doch die nahende Stadt ließ in sein strapaziertes Gemüt allmählich die ersehnte Behaglichkeit einkehren. Beruhigt sackte er auf die Polsterbank zurück und zog den Vorhang zu.
*
Sofort nach ihrer Ankunft im Gasthaus »Zur Sonne« zog sich der Guardian auf seine Stube zurück. Sie hörten ihn noch lange niesen und husten. Die beiden Benediktiner indes dachten noch lange nicht ans Schlafengehen. Wieso denn auch? Schließlich flossen in der Trinkstube im Untergeschoss Bier und Wein in reichen Strömen.
Inzwischen war die Sperrstunde längst überschritten.
Es war keine Überraschung, dass die Mönche in der württembergischen Stadt schnell zur Attraktion avancierten. Früher war der Besuch bei den Nachbarn durchaus gängige Praxis gewesen, nicht aber in diesen Zeiten wachsender Spannungen. Der Tonfall zwischen Fürstenbergern und Württembergern war rauer geworden. Kein Wunder, schlugen sich doch die katholischen und reformierten Fürsten auf den Schlachtfeldern des Nordens gegenseitig die Köpfe ein.
An und für sich war Jakobus ein ruhiger Zeitgenosse. Doch sobald ihm der Weingeist einmal zu Kopf gestiegen war, gediehen die Geselligkeit und mit Fortschreiten des Abends auch die Rauflust. Schnell waren sie von Neugierigen umringt, und man feierte besonders Jakobus für sein loses Mundwerk und die unchristlichen Trinksprüche, die er zum Besten gab. Dennoch knisterte die Stimmung merklich. Es gab Männer, die nur darauf warteten, dass den Mönchen ein Fehler unterlief. Rudolf schien ein gutes Gespür dafür zu haben und entsagte still und heimlich dem Gelage. Er hielt Ausschau nach einem schummrigen Plätzchen, das er an einem der hinteren Bänke auch fand. Sein lauernder Augenaufschlag machte kein Geheimnis daraus, wonach ihm der Sinn stand. Besonders in der Fremde konnte er seinen Leidenschaften, die neben dem Trunk auch der holden Weiblichkeit galten, ungestört frönen.
Der Reiz des Verbotenen war beileibe nicht einseitig geprägt. So wusste der hagere Mönch den Frauenzimmern durchaus zu gefallen. Spielend gingen ihm die Komplimente von den Lippen. Er neckte mit anzüglichen Gesten, kitzelte an Körperstellen, wohin alleine schon einen Gedanken zu verschwenden, ein Tabubruch gewesen wäre. Der fülligen Schankmagd schien der Ordensmann mit dem Charisma eines Schwerenöters durchaus eine Sünde wert zu sein. Schon bald rekelte sie sich kichernd auf seinem Schoß.
»Nun, Herr Mönch, erzähl Er uns, wie es sich neuerdings mit den Sakramenten in Eurer Kirche verhält. Wie ich sehe, seid Ihr Reformen nicht abgeneigt«, meldet sich der Vogt von Schiltach zu Wort und deutete zu den Turteltäubchen hinüber. Für den treffenden Einwurf heimste er das hämische Gelächter seiner Leute ein.
Jakobus begann der Angstschweiß auf die Stirn zu treten.
»Jetzt tu doch nicht so, Mönchlein, als ob du es nicht auch schon getan hättest!«, brummte Jakobus’ Tischnachbar und schlug ihm brüderlich auf die Schulter. Der beleibte Mönch mochte es aber gar nicht, wenn man ihn so rüde anpackte und noch viel weniger, wenn man ihm Untugenden unterstellte. Wie der Blitz wallte der Zorn in ihm auf, und der gutmütige Jakobus schnaubte plötzlich wie ein wütiges Wildschwein. Natürlich war das zölibatäre Leben eine Bürde und er hatte des Öfteren einen inneren Kampf auszufechten, um den Versuchungen, die ihnen der Satan bot, zu widerstehen. Im Grunde war er ja auch bloß ein schwacher Mann.
Auf der Ofenbank neben ihm saß ein bärtiger Fremder. Scheinbar ungerührt blickte er auf das silberne Amulett in seiner Hand und versank dabei in innige Gedankenwelten. Nach einer Weile der Einkehr küsste er den Anhänger und band die Kette wieder um. Da er offensichtlich sehr hungrig war, schnallte er das Messer vom Gürtel und schnitt vom Brotlaib auf dem Tisch eine Scheibe ab. Er brach einen Bissen heraus und schob ihn in den Mund.
Jakobus sollte inzwischen Rede und Antwort stehen, dazu forderte ihn der Vogt von Schiltach unmissverständlich auf: »Du fettes Pelztier, so sprich endlich! Wie verhält es sich neuerdings mit den Sakramenten bei euch Papisten? Was ist euch heilig? Oder seid ihr euch einfach zu fein, mit einem guten Württemberger zu reden?«
Jakobus hätte dem vorlauten Kerl am liebsten die Visage zerbeult, doch er besann sich, schlug das Kreuz über dem Herzen und sprach ein stilles Gebet. Der Mann neben ihm wuchtete derweil, dem Wink des Vogts folgend, einen Schießkolben auf den Tisch. Der Benediktiner wurde kreidebleich und verlor jeglichen Glauben an die Wirkung des göttlichen Anrufs. Er griff nach seinem Bierkrug und nahm hastige Schlucke.
Indes ließ der Fremde Obacht walten. Doch da er nichts überstürzen wollte, steckte er das Brotmesser in aller Gemütsruhe weg. Schließlich erhob er sich seufzend und trat breitbeinig mit abgespreizten Armen hinter den Vogt. Die ausdrucksstarken blauen Augen nahmen jeden Einzelnen der Gesellschaft ins Visier. Erst nachdem er den Bissen verschlungen hatte, erhob er das Wort: »Alles!«, schleuderte er in die Runde und gewann die Aufmerksamkeit im Nu. Aufmunternd nickte er dem zitternden Mönch zu, doch da dem die Antwort nicht einfallen wollte, redete er einfach weiter: »Alles, was den protestantischen Christen auch heilig ist!« Er spürte die Feindseligkeit in den Blicken und rückte sein Rapier zurecht. Keinen ließ er aus den Augen, während er an den Fingern aufzählte: »Taufe, Firmung, Buße, Krankensalbung und die Ehe.« Dabei zwinkerte er zu Rudolf hinüber. »Oder habe ich etwas vergessen, verehrter Pater?«
Der Angesprochene verstand den Wink sofort, löste sich aus der Umarmung, auch wenn es ihm schwerfiel, und trottete herbei. Doch angesichts der geladenen Waffe wollte auch ihm das fehlende Sakrament nicht über die Lippen kommen. Verstockt blieb er stehen.
»Die Heilige Messe, nicht wahr, Rudolf?«, kam ihm die forsche Stimme der Magd zu Hilfe. Demonstrativ stellte sie sich an seine Seite und stemmte die Hände in die Hüften.
Rudolf nickte erleichtert.
»Da habt Ihr die Antwort«, erwiderte der Fremde. »Damit lasst die Diener Gottes gefälligst in Frieden.«
Stutzig geworden überkreuzte der Vogt die Arme vor der Brust. Offensichtlich erkannte er den bärtigen Mann und bleckte die Zähne. »Aha, seid gegrüßt, Schwabenhans! Wie ich annehme, gab es mit den frommen Schwestern mal wieder Geschäftliches zu bereden – bis in die Nachtstunden hinein. Dabei wundert es mich schon, was die Nonnen mit einem Ungläubigen zu bereden haben, noch dazu zu solch unchristlichen Zeiten. Oder sollten die Gerüchte etwa stimmen?« Er lachte spöttisch.
Das hatte gesessen. Der Fremde spannte jeden einzelnen Muskel an. »Was weißt du schon, Vogt?« Blitzschnell tat er einen Ausfallschritt, zückte die Stichwaffe, und die Klinge sauste in einem atemberaubenden Tempo über den Tisch, wo sie zielsicher in den Karabinerring einfädelte und die Pistole durch die Luft wirbelte.
Die Leute staunten nicht schlecht und sprangen gleichzeitig von den Bänken auf. Schließlich landete das Schießeisen in Rudolfs Händen. Er schien durchaus kundig im Umgang mit der Waffe zu sein, entspannte den Hahn, umfasste den Lauf und hielt damit einen wirksamen Knüppel in der Hand. Das war die Gelegenheit für Jakobus. Er stemmte beide Beine gegen die Tischplatte und stieß die Tafel mit einem lauten Knall um. Krüge gingen zu Bruch und Stühle flogen umher. Mittendrin die beiden Ordensleute, eifrig um sich schlagend. Sie wurden tatkräftig von der Schankmagd und dem Bärtigen unterstützt. Doch lange währte der Schlaghändel nicht, und die alarmierten Büttel setzten der Konfusion ein jähes Ende.
Dem Schwabenhans gelang rechtzeitig die Flucht.
Nicht so den beiden Benediktinern …
*
Eine gewisse um sich greifende Unruhe war bis in den dritten Stock hinauf spürbar. Draußen im Flur war es bedenklich still geworden. Sophie horchte am Sprechgitter. Anfangs hatte das Plappermaul ihres Gegenübers einfach nicht stillstehen wollen. Ob er nun schlief? Sie dachte an die letzten Stunden zurück. Niklas teilte mit ihr jetzt dasselbe Schicksal. Es war ja auch nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das passieren würde. Heute Morgen, in aller Herrgottsfrühe, war der Pater plötzlich erschienen und hatte den Knaben in die gegenüberliegende Arrestzelle geworfen. Da Niklas des Öfteren gehustet hatte, machte sich Sophie langsam Sorgen. »Alles gut bei dir, Niki?«, wisperte sie.
»Ja«, murrte er beleidigt.
Ob es ihn nervte, weil sie seinen Kosenamen verwendete? Er mochte das nicht besonders, das wusste sie. Doch wegen des Mitleids, das sie empfand, hatte sie das außer Acht gelassen. Abermals ließ sie Niklas’ Erzählungen Revue passieren, die so unglaublich klangen, dass sie wahr sein mussten. »Bist du dir wirklich sicher, dass es eine Klosterfrau war, die den geheimnisvollen Reiter hinausließ?« Da keine Antwort kam, half sie sich selbst auf die Sprünge und murmelte gedankenverloren vor sich hin. »Das würde dann bedeuten, dass es ein Mordkomplott war …«
Sie hörte Schritte. »Still jetzt«, mahnte sie im Flüsterton. Was der Pfarrer bloß wieder wollte? Vorsichtshalber blies Sophie ihre Kerze aus und verwedelte den Rauch. Irgendwer klimperte mit Schlüsseln. Sie vernahm hastige Atemgeräusche. Dem Anschein nach suchte jemand nach dem passenden Türöffner. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis endlich die Verriegelung aufsprang und das Gitter aufgestoßen wurde.
In der Tür erschien Renate. Ihr Brustkorb pumpte wie ein Blasebalg. Sie warf Sophie ein Paar Hosen zu und meinte knurrig: »Hier, zieh das an.«
Daraufhin ließ sie auch Niklas frei.
Das rundliche Gesicht der Nonne zeigte tiefe Sorgenfalten. Die Kinder wussten, immer wenn sie so dreinschaute, dann war ihr Geduldsfaden am Reißen. Da sie sich nicht regten, sondern nur Löcher in die Luft starrten, machte Renate ihnen Beine. »Na los, ihr Faulpelze. Nichts wie zum Waschhaus. Johanna hat das Badewasser eingelassen und frische Kleider bereitgelegt.«
»Was ist denn nur los, Renate?«, wollte Sophie wissen.
»Nicht so viel fragen – folgen!«
Natürlich nahm Sophie das Angebot, freizukommen, gerne an und spazierte ohne weitere Widerworte aus ihrem Gefängnis. Niklas zögerte noch. Er beäugte die Nonne skeptisch. Ihm fielen die schmutzigen Schuhe und die Spritzer am Skapulier als Erstem auf. Mit dem Kinn gab er Sophie ein Zeichen, doch sie begriff nicht.