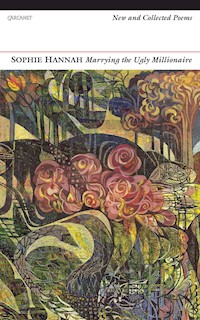10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Ein Mordfall ohne Opfer? Ein Fall für Hercule Poirot! Wer ist Barnabas Pandy und wurde er wirklich ermordet? Diese Frage stellt sich der berühmte Privatdetektiv Hercule Poirot, nachdem er Besuch von einer ihm vollkommen unbekannten und ebenso aufgebrachten Dame erhalten hat. Sie hat ihm einen Brief unter die Nase gehalten, in dem Poirot sie des Mordes an besagtem Herrn Pandy bezichtigt. Und es soll nicht bei dieser einen mysteriösen Begegnung bleiben. Wenig später wird Poirot von einem ihm ebenfalls unbekannten Herrn mit dem gleichen Brief aufgesucht. Wie viele dieser Briefe sind noch im Umlauf? Wer hat sie geschrieben und mit welcher Absicht? Und kann Poirot diesen Fall aufklären, ohne weitere Menschen in Gefahr zu bringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sophie Hannah
Das Geheimnis der vier Briefe
Ein neuer Fall für Hercule Poirot
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Atlantik
Für Faith Tilleray,
die mehr als ihr Bestes gegeben
und mir unglaublich viel
beigebracht hat
Das erste Viertel
1Poirot wird beschuldigt
Hercule Poirot lächelte in sich hinein, als sein Chauffeur das Automobil mit erfreulicher Akkuratesse zum Stehen brachte. Als Liebhaber von Ordnung und Präzision wusste Poirot solch eine perfekte Ausrichtung nach der Eingangstür von Whitehaven Mansions, wo er seine Wohnung hatte, zu schätzen. Man hätte vom Mittelpunkt des Fahrzeugs zur Berührungslinie der zwei Türflügel eine Senkrechte ziehen können.
Der Lunch, von dem er gerade zurückkehrte, war très bon divertissement gewesen: vorzügliches Essen und eine ebensolche Tischgesellschaft. Poirot stieg aus, bedachte seinen Chauffeur mit einem herzlichen Dank und war eben im Begriff, das Gebäude zu betreten, als er das eigentümliche Gefühl verspürte, etwas hinter ihm (so beschrieb er sich die Empfindung selbst) bedürfe seiner Aufmerksamkeit.
Als er sich umwandte, rechnete er dennoch nicht damit, etwas Ungewöhnliches wahrzunehmen. Für Februar war es zwar ein milder Tag, aber vielleicht hatte ja eine leichte Brise die Luft um ihn in Bewegung versetzt.
Bald jedoch erkannte Poirot, dass die Unruhe nicht vom Wetter verursacht worden war, wenngleich die gutgekleidete Frau, die mit hohem Tempo herannahte, trotz ihres modischen hellblauen Mantels und Hutes in der Tat einer Naturgewalt ähnelte. »Sie ist ein orkanischer Wirbelwind«, murmelte Poirot bei sich.
Der Hut missfiel ihm. In der Stadt hatte er Frauen schon ähnliche tragen sehen: minimalistisch, schmucklos, den Kopf wie Badekappen umschließend. Ein Hut sollte eine Krempe oder irgendeine andere Verzierung besitzen, fand Poirot. Zumindest sollte er etwas mehr leisten, als lediglich den Kopf zu bedecken. Zweifellos würde er sich an diese modernen Hüte bald gewöhnen – und kaum wäre es ihm gelungen, würde die Mode wechseln, wie sie das immer tat.
Die Lippen der Blaugekleideten zuckten und schürzten sich, ohne dass etwas zu hören gewesen wäre. Es schien, als probte die Frau, was sie sagen würde, wenn sie Poirot endlich erreicht hätte. Denn dass er ihr Ziel war, stand außer Zweifel. Sie sah fest entschlossen aus, ihm so bald als möglich etwas Unerfreuliches anzutun. Er wich einen Schritt zurück, während sie wie eine Stampede (er hätte es nicht anders bezeichnen können) auf ihn zumarschierte – eine Stampede, die aus nichts und niemandem außer ihr selbst bestand.
Sie hatte dunkelbraunes, glänzendes Haar. Als sie direkt vor ihm abrupt haltmachte, erkannte Poirot, dass sie nicht so jung war, wie sie von weitem ausgesehen hatte. Nein, diese Frau hatte die Fünfzig schon hinter sich. Eine Dame mittleren Alters, die die Kunst beherrschte, die Fältchen in ihrem Gesicht zu verbergen. Ihre Augen waren von einem erstaunlichen, weder hellen noch dunklen Blau.
»Sie sind Hercule Poirot, richtig?«, sagte sie im lautestmöglichen Flüsterton. Poirot begriff, dass sie Zorn zum Ausdruck zu bringen wünschte, ohne von Dritten gehört zu werden, obwohl niemand in der Nähe war.
»Oui, Madame. Der bin ich.«
»Wie können Sie es wagen! Wie können Sie es wagen, mir einen solchen Brief zu schreiben!«
»Verzeihen Sie, Madame, aber ich glaube nicht, dass wir uns kennen.«
»Spielen Sie mir nicht den Unschuldigen! Ich bin Sylvia Reagan. Wie Sie sehr wohl wissen.«
»Jetzt weiß ich es, weil Sie es mir gesagt haben. Noch vor einem Moment wusste ich es nicht. Sie erwähnten einen Brief …«
»Wollen Sie mich zwingen, Ihre Verleumdungen an einem öffentlichen Ort zu wiederholen? Also schön, wie Sie wollen. Heute Morgen erhielt ich einen Brief – einen äußerst widerwärtigen und anstößigen Brief, unterschrieben von Ihnen.« Sie durchstieß die Luft mit einem Zeigefinger, der Poirot, wäre er ihm nicht mit einem Ausfallhopser ausgewichen, mitten in die Brust getroffen hätte.
»Non, Madame …«, begann er zu beteuern, doch sein Versuch zu leugnen wurde im Nu hinweggefegt.
»In diesem Spottbild eines Briefes beschuldigen Sie mich des Mordes. Des Mordes! Mich! Sylvia Reagan! Sie behaupten, meine Schuld beweisen zu können, und empfehlen mir, mich sofort zur Polizei zu begeben und meine Tat zu gestehen. Wie können Sie es wagen! Sie können mir überhaupt nichts nachweisen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich unschuldig bin. Ich habe niemanden ermordet! Ich bin der am wenigsten zu Gewalt neigende Mensch, dem ich jemals begegnet bin. Und von einem Barnabas Pandy habe ich noch nie etwas gehört!«
»Einem Barnabas …«
»Dass Sie ausgerechnet mich beschuldigen, ist ungeheuerlich! Schlicht ungeheuerlich. Ich hätte gute Lust, mich damit an meinen Rechtsanwalt zu wenden, wäre es mir nicht zuwider, dass er erfährt, wie schändlich ich verleumdet worden bin. Vielleicht sollte ich wirklich zur Polizei gehen. Die Schmach, die ich erlitten habe! Die Beleidigung! Eine Frau in meiner gesellschaftlichen Stellung!«
Sylvia Reagan schimpfte eine Zeit lang so weiter. Ihr entrüstetes Flüstern war von vielerlei Gezisch und Gespritze durchsetzt. Sie erinnerte Poirot an die lauten, tosenden Wasserfälle, die er auf seinen Reisen gesehen hatte: eindrucksvoll zu betrachten, aber bedrohlich, vor allem aufgrund ihrer Unerschöpflichkeit. Der Strom riss niemals ab.
Sobald er sich Gehör verschaffen konnte, sagte er: »Madame, gestatten Sie mir, Ihnen zu versichern, dass ich keinen solchen Brief geschrieben habe. Falls Sie einen erhalten haben, wurde er nicht von mir gesandt. Auch ich habe von Barnabas Pandy noch nie etwas gehört. Das ist der Name des Mannes, dessen Ermordung der Verfasser des Briefes, wer auch immer er sei, Ihnen zur Last legt?«
»Der Verfasser sind Sie, und reizen Sie mich nicht noch weiter, indem Sie das bestreiten! Eustace hat Sie dazu angestiftet, habe ich recht? Sie wissen beide, dass ich niemanden ermordet habe, dass ich so unbescholten bin, wie ein Mensch nur sein kann! Sie und Eustace haben einen Plan ausgeheckt, um mich zum Wahnsinn zu treiben! Das wäre so typisch für ihn, und anschließend wird er natürlich behaupten, es sei alles nur ein Scherz gewesen!«
»Ich weiß von keinem Eustace, Madame.« Poirot gab sich weiterhin alle Mühe, obwohl es offensichtlich war, dass nichts, was er sagte, den geringsten Eindruck auf Sylvia Reagan machte.
»Er hält sich ja für so gescheit – für den gescheitesten Mann in ganz England! –, mit diesem widerlichen süffisanten Grinsen, das er ständig zur Schau trägt. Wie viel hat er Ihnen gezahlt? Ich weiß, dass es seine Idee gewesen sein muss! Und Sie erledigen die Schmutzarbeit für ihn. Sie, der berühmte Hercule Poirot, dem unsere zuverlässige und tüchtige Polizei so sehr vertraut. Sie sind ein Schwindler! Wie konnten Sie nur? Eine Frau meines untadeligen Charakters verleumden! Eustace würde alles tun, um mich zu vernichten. Alles! Was auch immer er Ihnen über mich erzählt haben mag – es ist eine Lüge!«
Wenn sie die Bereitschaft gezeigt hätte, ihm zuzuhören, hätte Poirot ihr erklären können, dass er schwerlich mit einem Mann kooperieren würde, der sich für den gescheitesten Mann in ganz England hielt, solange er, Hercule Poirot, sein Domizil in London hatte.
»Bitte zeigen Sie mir den Brief, den Sie erhalten haben, Madame.«
»Sie glauben doch wohl nicht etwa, ich hätte ihn behalten? Es machte mich krank, ihn auch nur in der Hand zu halten! Ich habe ihn in ein Dutzend Fetzen zerrissen und ins Feuer geworfen. Am liebsten würde ich mit Eustace genauso verfahren! Ein Jammer, dass derlei Taten gegen das Gesetz verstoßen. Ich kann dazu nur sagen, dass derjenige, der dieses bestimmte Gesetz erlassen hat, Eustace unmöglich gekannt haben kann. Wenn Sie mich jemals wieder so verleumden, gehe ich direkt zu Scotland Yard – und zwar nicht um irgendetwas zu gestehen, denn ich bin gänzlich unschuldig, sondern um Sie anzuzeigen, Monsieur Poirot!«
Ehe Poirot eine angemessene Entgegnung formulieren konnte, hatte Sylvia Reagan kehrtgemacht und war davonmarschiert.
Er rief sie nicht zurück. Er blieb noch ein paar Sekunden lang stehen und schüttelte langsam den Kopf. Während er die Stufen zum Hauseingang hinaufstieg, brummelte er in sich hinein: »Wenn sie der am wenigsten zu Gewalt neigende Mensch ist, möchte ich dem am meisten dazu Geneigten nicht begegnen!«
In seiner geräumigen und gut ausgestatteten Wohnung erwartete ihn sein Kammerdiener George. Sein eher steifes Lächeln verwandelte sich, als er Poirots Miene sah, in einen Ausdruck der Betroffenheit.
»Ist Ihnen nicht wohl, Sir?«
»Non. Mir ist wirr, George. Sagen Sie mir, als jemand, der viel weiß über die höheren Kreise der englischen Gesellschaft … kennen Sie eine Sylvia Reagan?«
»Nur vom Hörensagen, Sir. Sie ist die Witwe des verstorbenen Clarence Reagan. Hervorragende Verbindungen. Meines Wissens sitzt sie im Vorstand verschiedener wohltätiger Organisationen.«
»Und was ist mit Barnabas Pandy?«
George schüttelte den Kopf. »Dieser Name ist mir nicht geläufig. Mein Spezialgebiet ist die Londoner Gesellschaft, Sir. Wenn Mr Pandy andernorts lebt …«
»Ich weiß nicht, wo er lebt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt lebt und nicht vielmehr ermordet worden ist. Vraiment, ich könnte über Barnabas Pandy nicht weniger wissen, als ich derzeit weiß – das wäre eine Sache der Unmöglichkeit! Aber versuchen Sie nicht, Georges, das Sylvia Reagan zu erklären, die sich nämlich in den Kopf gesetzt hat, dass ich au contraire alles über ihn weiß! Sie glaubt, ich habe ihr einen Brief geschrieben, in dem ich sie seiner Ermordung bezichtige, einen Brief, den ich hiermit bestreite, geschrieben zu haben. Ich habe den Brief nicht geschrieben. Ich habe Mrs Sylvia Reagan keinerlei Mitteilung gleich welcher Art gemacht.«
Poirot zog Hut und Mantel mit weniger Behutsamkeit aus als gewöhnlich und übergab beides George. »Es ist nicht angenehm, einer Sache beschuldigt zu werden, die man nicht getan hat. Man müsste imstande sein, Unwahrheiten von sich abzuschütteln, aber irgendwie klammern sie sich an das Denken und verursachen eine Art Phantomschuld – wie ein Gespenst im Kopf oder im Gewissen! Irgendjemand ist sicher, dass man eine schreckliche Tat begangen hat, und dann beginnt man, sich so zu fühlen, als wenn es wahr wäre, obwohl man weiß, dass dem nicht so ist. Allmählich begreife ich, Georges, wie Menschen sich irgendwelcher Verbrechen für schuldig bekennen können, die sie gar nicht begangen haben.«
George setzte eine zweifelnde Miene auf, was er häufig tat. Die englische Diskretion, hatte Poirot oft beobachtet, nahm eine äußere Erscheinung an, die an Zweifel erinnerte. Viele der höflichsten Engländerinnen und Engländer, die er über die Jahre kennengelernt hatte, sahen so aus, als hätte man ihnen befohlen, jeder seiner Äußerungen zu misstrauen.
»Darf ich Ihnen einen Drink servieren, Sir? Einen sirop de menthe, wenn ich mir einen Vorschlag gestatten darf?«
»Oui. Das ist eine hervorragende Idee.«
»Ich sollte außerdem erwähnen, Sir, dass ein Besucher darauf wartet, von Ihnen empfangen zu werden. Soll ich Ihren Drink sofort servieren und den Herrn bitten, sich noch ein wenig zu gedulden?«
»Ein Besucher?«
»Ja, Sir.«
»Wie ist sein Name? Vielleicht Eustace?«
»Nein, Sir. Es ist ein Mr John McCrodden.«
»Ah! Das ist eine Erleichterung. Kein Eustace. Ich kann mich also in der Hoffnung wiegen, dass der Albtraum um Madame Reagan und ihren Eustace sich verzogen hat und Hercule Poirot nicht wieder heimsuchen wird! Hat Monsieur McCrodden sein Anliegen genannt?«
»Nein, Sir. Ich sollte Sie allerdings warnen, er wirkte … ungehalten.«
Poirot ließ es zu, dass ein kleiner Seufzer seinen Lippen entwich. Nach dem mehr denn befriedigenden Lunch schien sich der Nachmittag eher enttäuschend zu gestalten. Immerhin war es unwahrscheinlich, dass John McCrodden sich als so enervierend wie Sylvia Reagan erweisen würde.
»Ich werde das Vergnügen des sirop de menthe verschieben und zuerst Monsieur McCrodden empfangen«, sagte Poirot zu George. »Er klingt mir vertraut, der Name.«
»Denken Sie möglicherweise an Rechtsanwalt Stanley McCrodden, Sir?«
»Mai oui, bien sûr! Stanley Strang, des Henkers hilfreicher Freund – wenngleich Sie, Georges, zu höflich sind, um ihn bei seinem so treffenden sobriquet zu nennen. Der Galgen – nicht Rast noch Ruhe gönnt ihm Stanley Strang!«
»Er war maßgeblich daran beteiligt, dass etliche Verbrecher ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden, Sir«, pflichtete George ihm gewohnt taktvoll bei.
»Vielleicht ist John McCrodden ja mit ihm verwandt«, sagte Poirot. »Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit, es mir bequem zu machen, und dann mögen Sie ihn hereinführen.«
Der Aufgabe, John McCrodden hereinzuführen, wurde George indes durch McCroddens Entschlossenheit enthoben, führerlos und unangemeldet hereinzumarschieren. Er schob sich an dem Kammerdiener vorbei und platzierte sich in der Mitte des Teppichs, wo er innehielt und erstarrte, als hätte er die Anweisung, eine Statue zu spielen.
»Bitte, Monsieur, so nehmen Sie doch Platz«, sagte Poirot mit einem Lächeln.
»Nein, danke«, sagte McCrodden. Sein Ton drückte verächtliche Distanz aus.
Er mochte um die vierzig sein, schätzte Poirot. Sein Gesicht besaß jene Art von Schönheit, die einem außer in Kunstwerken nur selten begegnete. Seine Züge hätte ein Meistergraveur ziseliert haben können. Es fiel Poirot schwer, das Gesicht mit der Kleidung in Einklang zu bringen, die schäbig und stellenweise mit Erde beschmutzt war. Hatte Mr McCrodden die Angewohnheit, auf Parkbänken zu nächtigen? Hatte er überhaupt Zugang zu den üblichen häuslichen Annehmlichkeiten? Poirot fragte sich, ob McCrodden bestrebt war, alle Vorzüge, mit denen die Natur ihn bedacht hatte – die großen grünen Augen und das goldblonde Haar –, dadurch zu tilgen, dass er sich ansonsten um eine möglichst abstoßende Erscheinung bemühte.
McCrodden blickte wütend auf Poirot herab. »Ich habe Ihren Brief erhalten«, sagte er. »Er traf heute Morgen ein.«
»Zu meinem Leidwesen muss ich Ihnen widersprechen, Monsieur. Ich habe Ihnen keinen Brief geschickt.«
Stille trat ein und zog sich unbehaglich in die Länge. Poirot wünschte keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, befürchtete aber zu wissen, in welche Richtung das Gespräch sich weiterentwickeln würde. Aber es konnte nicht sein! Wie wäre das möglich? Nur in Träumen hatte er dieses Gefühl schon erlebt: die unheilvolle Gewissheit, dass man in einer Situation gefangen ist, die keinerlei Sinn ergibt noch, was man auch tun mag, jemals ergeben wird.
»Was stand darin, in diesem Brief, den Sie erhalten haben?«, fragte er.
»Sie sollten es doch wohl wissen, da Sie ihn geschrieben haben!«, sagte John McCrodden. »Sie beschuldigten mich, einen Mann namens Barnabas Pandy ermordet zu haben!«
2Untragbare Provokation
»Ich muss gestehen, ich war ziemlich enttäuscht«, fuhr McCrodden fort. »Der berühmte Hercule Poirot lässt sich zu einem Werkzeug für derlei Frivolitäten machen!«
Poirot wartete ein paar Augenblicke ab, bevor er etwas darauf erwiderte. War es vielleicht seine Wortwahl gewesen, die sich als ungeeignet erwiesen hatte, Sylvia Reagan zum Zuhören zu bewegen? Dann würde er sich bei John McCrodden um größere Klarheit und Überzeugungskraft bemühen. »Monsieur, s’il vous plaît. Ich glaube Ihnen, dass jemand Ihnen einen Brief geschickt hat und dass Sie darin des Mordes beschuldigt wurden. Des Mordes an Barnabas Pandy. Diesen Teil Ihrer Geschichte stelle ich nicht in Abrede. Jedoch …«
»Das könnten Sie auch nicht!«, sagte McCrodden.
»Monsieur, bitte, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, dass ich nicht der Verfasser des Briefes bin, den Sie erhalten haben. Für Hercule Poirot hat Mord nichts Frivoles an sich. Ich würde …«
»Ach, einen Mord hat es bestimmt gar nicht gegeben!«, unterbrach ihn McCrodden erneut, jetzt mit einem bitteren Lachen. »Oder falls doch, hat die Polizei den Verantwortlichen mit Sicherheit schon festgenommen. Das ist wieder nur so ein kindisches Spielchen meines Vaters.« Dann zog er die Brauen zusammen, als wäre ihm ein beunruhigender Gedanke gekommen. »Es sei denn, der alte Domschrat ist ein noch größerer Sadist, als ich dachte, und würde wirklich meinen Hals in einem tatsächlich unaufgeklärten Mordfall aufs Spiel setzen. Möglich wäre es wohl. Bei seiner rücksichtslosen Entschlossenheit …« McCrodden verstummte, dann murmelte er: »Ja. Es ist möglich. Daran hätte ich denken müssen.«
»Ihr Vater ist der Rechtsanwalt Stanley McCrodden?«, fragte Poirot.
»Das wissen Sie doch.« John McCrodden hatte sich bereits für enttäuscht erklärt, und genau so klang er jetzt auch: als ob Poirot mit jedem Wort, das er sprach, nur noch tiefer in seiner Achtung sänke.
»Ich kenne Ihren Vater nur vom Hörensagen. Persönlich bin ich ihm noch nie begegnet, habe auch noch nie mit ihm gesprochen.«
»Sie müssen natürlich die Komödie weiterspielen«, sagte John McCrodden. »Er hat Ihnen zweifellos eine ansehnliche Summe gezahlt, damit Sie seinen Namen heraushalten.« Er blickte sich im Zimmer um, in dem er stand, und schien es zum ersten Mal bewusst wahrzunehmen. Dann nickte er, als bestätigte er sich selbst irgendetwas, und sagte: »Die Reichen, die, die Geld am wenigsten nötig haben – wie Sie, wie mein Vater –, scheuen vor nichts zurück, um noch mehr davon in die Finger zu bekommen. Deswegen habe ich ihm auch von jeher misstraut. Ich tat recht daran. Sobald man sich an Geld gewöhnt hat, verdirbt es den Charakter, und Sie, Monsieur Poirot, sind der lebende Beweis dafür.«
Poirot konnte sich nicht entsinnen, wann zuletzt jemand etwas so Unerfreuliches, so Unfaires oder so persönlich Verletzendes zu ihm gesagt hatte. Er entgegnete leise: »Ich habe mein ganzes Leben dem Kampf für das Gute und der Verteidigung der Unschuldigen und – ja! – der zu Unrecht Beschuldigten geweiht. Diese Gruppe schließt Sie ein, Monsieur. Und heute schließt sie auch Hercule Poirot ein. Auch ich werde zu Unrecht beschuldigt. Ich bin ebenso wenig schuldig, den Brief, den Sie erhalten haben, verfasst und versendet zu haben, wie Sie eines Mordes. Auch mir ist kein Barnabas Pandy bekannt. Kein toter Barnabas Pandy und auch kein lebender Barnabas Pandy! Doch hier – ah! Hier enden die Ähnlichkeiten zwischen uns beiden auch schon, denn wenn Sie beteuern, Sie seien unschuldig, höre ich Ihnen zu. Ich denke bei mir: Dieser Mann könnte die Wahrheit sagen. Wohingegen wenn ich …«
»Verschonen Sie mich mit Ihren hochtrabenden Floskeln!«, fiel ihm McCrodden wieder ins Wort. »Wenn Sie sich einbilden, ich würde funkelnder Rhetorik weniger misstrauen, als ich Geld, Ansehen oder sonst einem der Dinge misstraue, die mein Vater wertschätzt, so irren Sie sich gewaltig. Und da Stanley Strang zweifellos von Ihnen erwarten wird, dass Sie ihm meine Reaktion auf seine schmutzige kleine Intrige referieren, sagen Sie ihm bitte Folgendes: Ich spiele nicht mit! Ich habe noch nie etwas von einem Barnabas Pandy gehört, ich habe niemanden ermordet, also habe ich auch nichts zu befürchten. Ich habe genügend Zutrauen zum Gesetz dieses Landes, um mir sicher zu sein, dass man mich nicht wegen eines Verbrechens hängen wird, das ich nicht begangen habe.«
»Glauben Sie denn, es ist das, was Ihr Vater will?«
»Ich weiß es nicht. Schon möglich. Ich war von jeher der Überzeugung, dass Vater, sollten ihm jemals die Schuldigen ausgehen, die er an den Galgen bringen kann, seine Aufmerksamkeit den Unschuldigen zuwenden und behaupten würde, sie seien schuldig – und zwar vor Gericht ebenso wie vor sich selbst. Hauptsache, er kann seinen Durst nach dem Blut seiner Mitmenschen stillen!«
»Das ist eine bemerkenswerte Anschuldigung, Monsieur, und nicht die erste, die Sie seit Ihrem Erscheinen erhoben haben.« McCroddens knappe, nüchterne Sprechweise ließ Poirot frösteln. Sie verlieh seinen Worten einen Anschein von Objektivität, als ob er lediglich die reinen, unbestreitbaren Fakten referierte.
Der Stanley Strang, von dem Poirot im Laufe der Jahre so viel gehört hatte, war nicht der Mann, den sein Sohn jetzt beschrieb. Er war ein glühender Verfechter der Todesstrafe – ein bisschen zu glühend für Poirots Geschmack, da es oft Umstände gab, die es zu berücksichtigen galt –, aber Poirot vermutete doch, dass McCrodden senior bei der Vorstellung, ein Unschuldiger könnte gehängt werden, ebenso entsetzt, wie er selbst gewesen wäre. Und wenn der fragliche Angeklagte sogar sein eigener Sohn war …
»Monsieur, ich bin noch nie, in all meinen Jahren nicht, einem Vater begegnet, der bestrebt gewesen wäre, seinen Sohn für einen Mord, den er nicht begangen hat, an den Galgen zu bringen.«
»Sind Sie doch!«, gab John McCrodden sofort zurück. »Trotz Ihrer anderslautenden Beteuerungen weiß ich, dass Sie meinem Vater begegnet sein müssen, oder zumindest haben Sie mit ihm gesprochen, und Sie beide haben sich verschworen, mich zu beschuldigen. Schön, Sie können meinem teuren Papa ausrichten, dass ich ihn nicht mehr hasse. Jetzt, da ich sehe, wie tief er bereit ist zu sinken, tut er mir leid. Er ist nicht besser als ein Mörder. Ebenso wenig wie Sie, Monsieur Poirot. Und das Gleiche gilt für jeden, der es für richtig hält, Übeltäter vermittels eines Strangs vom Leben zum Tode zu befördern, wie unser brutales Rechtssystem es vorsieht.«
»Ist das Ihre Überzeugung, Monsieur?«
»Mein Leben lang bin ich für Vater ein Quell der Scham und Enttäuschung gewesen: indem ich mich weigerte, mich zu fügen, das zu tun, was er verlangt, zu denken, was er denkt, den Beruf seiner Wahl zu ergreifen. Er wollte, dass ich Jurist werde. Er hat mir nie verziehen, dass ich nicht er sein wollte.«
»Dürfte ich fragen, was Sie von Beruf sind?«
»Beruf?« McCrodden schnaubte. »Ich arbeite für meinen Lebensunterhalt. Nichts Besonderes. Nichts Großartiges, was etwa beinhaltete, mit dem Leben anderer Leute zu spielen. Ich habe in einem Bergwerk gearbeitet, auf Bauernhöfen, in Fabriken. Ich habe Flitter für Damen gemacht und verkauft. Verkaufen kann ich gut. Momentan habe ich einen Marktstand. Dank ihm habe ich ein Dach über dem Kopf, aber nichts von alldem ist gut genug für meinen Vater. Und da er Stanley McCrodden ist, wird er sich nicht geschlagen geben. Niemals.«
»Was meinen Sie damit?«
»Ich hatte gehofft, er hätte mich aufgegeben. Jetzt ist mir klar, dass er das niemals tun wird. Er weiß, dass ein des Mordes Beschuldigter sich verteidigen muss. Tatsächlich ist es ziemlich clever von ihm: Er versucht, mich zu provozieren, und malt sich, wie ich vermute, genüsslich aus, dass ich darauf bestehen würde, mich in meinem Mordprozess im Old Bailey selbst zu verteidigen. Und dazu müsste ich mich wohl oder übel in die Juristerei vertiefen, nicht wahr?«
Ganz offensichtlich war Stanley McCrodden für John McCrodden das, was Eustace für Sylvia Reagan war.
»Sie können ihm von mir ausrichten, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Ich werde nie der Mensch sein, den mein Vater in mir sehen will. Und ich würde es vorziehen, wenn er weitere Versuche unterließe, mit mir in Verbindung zu treten – sei es direkt oder indem er Sie oder sonst eine seiner Schranzen als Postillion verwendet!«
Poirot erhob sich aus seinem Sessel. »Bitte warten Sie hier einen Augenblick«, sagte er. Er verließ das Zimmer und achtete darauf, dass die Tür hinter ihm weit offen blieb.
Als Poirot zurückkam, wurde er von seinem Kammerdiener begleitet. Er lächelte John McCrodden zu und sagte: »Georges kennen Sie ja bereits. Wie ich hoffe, konnten Sie hören, wie ich ihm erklärte, dass für eine kurze Weile seine Anwesenheit vonnöten sei. Ich habe eigens die Stimme erhoben, damit Sie alles hören konnten, was ich zu ihm sagte.«
»Ja, ich habe es gehört«, sagte McCrodden mit gelangweilter Stimme.
»Wenn ich sonst noch etwas zu Georges gesagt hätte, so hätten Sie das ebenfalls gehört. Das habe ich nicht. Somit wird das, was er Ihnen gleich sagen wird, Sie, wie ich hoffe, davon überzeugen, dass ich nicht Ihr Feind bin. Bitte, Georges – sprechen Sie!«
George machte ein verdutztes Gesicht. Er war es nicht gewohnt, so unbestimmte Anweisungen zu erhalten. »Worüber, Sir?«
Poirot wandte sich zu John McCrodden. »Sie sehen? Er weiß es nicht. Ich habe ihn nicht darauf vorbereitet. Georges, als ich heute vom Lunch zurückkehrte, erzählte ich Ihnen etwas, was mir gerade widerfahren war, richtig?«
»So ist es, Sir.«
»Bitte wiederholen Sie, was ich Ihnen erzählte.«
»Sehr wohl, Sir. Sie wurden von einer Dame angesprochen, die sich als Mrs Sylvia Reagan vorstellte. Mrs Reagan war der irrigen Auffassung, Sie hätten ihr einen Brief geschrieben, in dem Sie sie des Mordes bezichtigten.«
»Merci, Georges. Und sagen Sie mir, wer war das angebliche Opfer dieses Mordes?«
»Ein Mr Barnabas Pandy, Sir.«
»Und was sagte ich Ihnen sonst noch?«
»Dass Sie mit einem Mann dieses Namens nicht bekannt seien, Sir. Falls es einen solchen Gentleman gebe, wüssten Sie nicht, ob er lebendig oder tot sei oder ob er ermordet worden sei. Als Sie versuchten, dies Mrs Reagan klarzumachen, weigerte sie sich zuzuhören.«
Poirot wandte sich triumphierend zu John McCrodden. »Monsieur, vielleicht wünscht Ihr Vater also, dass auch Sylvia Reagan sich im Old Bailey selbst verteidigt? Oder sind Sie endlich bereit einzuräumen, dass Sie Hercule Poirot falsch beurteilt und auf höchst unfaire Weise angefeindet haben? Übrigens könnte es für Sie von Interesse sein, dass Madame Reagan mich gleichfalls beschuldigte, mich mit einem ihrer Widersacher gegen sie verschworen zu haben – einem Mann namens Eustace.«
»Ich behaupte nach wie vor, dass hinter alldem mein Vater steckt«, sagte John McCrodden nach einer kurzen Pause. Er klang entschieden weniger sicher als zuvor. »Er genießt nichts so sehr wie die Auseinandersetzung mit einem anspruchsvollen Rätsel. Offenbar soll ich jetzt auch noch herausfinden, warum Mrs Reagan den gleichen Brief wie ich erhalten hat.«
»Wenn man eine vorherrschende Sorge hat – Ihre Befasstheit mit Ihrem Vater oder Sylvia Reagans Besessensein von diesem Eustace –, färbt dies auf die Art und Weise ab, wie man die Welt wahrnimmt«, sagte Poirot mit einem Seufzer. »Ich vermute, Sie haben den Brief nicht bei sich?«
»Nein. Ich habe ihn zerrissen und die Fetzen meinem Vater zugesandt, mit ein paar Begleitzeilen, in denen ich ihm gesagt habe, was ich von ihm halte, und jetzt sage ich es Ihnen, Monsieur Poirot. Ich lasse mir das nicht bieten. Nicht einmal der große Hercule Poirot kann Unschuldige des Mordes bezichtigen und erwarten, damit ungestraft davonzukommen!«
Es war eine beträchtliche Erleichterung, als John McCrodden endlich den Raum verließ. Poirot trat ans Fenster und beobachtete, wie sein Besucher sich vom Gebäude entfernte.
»Wäre jetzt Ihr sirop de menthe genehm, Sir?«, fragte George.
»Mon ami, jetzt wäre mir ein ganzer Ozean von sirop de menthe genehm!« Als er erkannte, dass er möglicherweise eine gewisse Verwirrung verursacht hatte, stellte er klar: »Ein Glas, bitte, Georges. Nur eins.«
Poirot kehrte tief beunruhigt zu seinem Sessel zurück. Was konnte man noch für die Gerechtigkeit oder den Frieden in der Welt hoffen, wenn drei Menschen, die eigentlich einen Interessenbund hätten schließen können – drei zu Unrecht Beschuldigte: Sylvia Reagan, John McCrodden und Hercule Poirot –, es nicht fertigbrachten, sich zusammenzusetzen und ein ruhiges, vernünftiges Gespräch zu führen, durch das sie gemeinsam hätten ergründen können, was genau geschehen war? Stattdessen hatte es Wutausbrüche gegeben, die fast fanatische Weigerung, einen anderen Standpunkt als den eigenen einzunehmen, und eine unablässige Flut von Verbalinjurien. Nicht vonseiten Hercule Poirots allerdings; er hatte sich selbst angesichts einer untragbaren Provokation untadelig verhalten.
Als George ihm seinen sirop brachte, fragte er: »Sagen Sie – ist sonst noch jemand da, der mich sprechen möchte?«
»Nein, Sir.«
»Niemand hat angerufen und um einen Termin gebeten?«
»Nein, Sir. Erwarten Sie jemanden?«
»Oui. Ich erwarte einen wütenden Unbekannten, vielleicht sogar mehrere davon.«
»Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Sir.«
Just in dem Augenblick klingelte das Telefon. Poirot nickte und gestattete sich ein kleines Lächeln. Wenn eine Situation keine weiteren Freuden bot, dachte er, konnte man sich ebenso gut darüber freuen, recht gehabt zu haben. »Das ist er schon, Georges – oder sie. Die dritte Person. Die dritte von wer weiß wie vielen – drei, vier, fünf? Jede Zahl wäre möglich.«
»Jede Zahl wovon, Sir?«
»Von Menschen, die einen Brief erhalten haben, der sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigt – und betrügerischerweise unterschrieben ist mit dem Namen Hercule Poirots!«
3Die dritte Person
Um drei Uhr des folgenden Tages erhielt Poirot den Besuch einer Miss Annabel Treadway. Während er darauf wartete, dass George sie hereinführte, merkte er, dass er sich auf die bevorstehende Begegnung freute. Menschen andersgearteten Temperaments hätte es vielleicht bald gelangweilt, von einer Folge von wildfremden, in ihrer Entschlossenheit, auf nichts, was man ihnen sagte, zu hören, vereinten Personen, ein um das andere Mal mit derselben Beschuldigung konfrontiert zu werden; nicht so Poirot. Dieses – dritte – Mal, gelobte er sich, würde es ihm gelingen, seine Argumentation zum Abschluss zu bringen. Er würde Miss Annabel Treadway davon überzeugen, dass er die Wahrheit sagte. Vielleicht würde man dann etwas vorankommen und sich interessanteren Fragen zuwenden können.
Dem Rätsel, wie die meisten Leute, selbst intelligente Exemplare, so unlogisch und stur sein konnten, war Poirot bereits in der vergangenen Nacht, während er wach lag, hinlänglich nachgegangen; jetzt drängte es ihn, seine Aufmerksamkeit Barnabas Pandy selbst zuzuwenden. Vorausgesetzt natürlich, Barnabas Pandy besaß überhaupt etwas wie Selbstheit. Es war schließlich möglich, dass er gar nicht existierte, nie existiert hatte und nichts mehr war als ein Hirngespinst des Verfassers dieser Briefe.
Die Tür öffnete sich, und George ließ eine magere Frau von durchschnittlicher Größe eintreten, mit hellem Haar, dunklen Augen und ebensolcher Kleidung. Poirot erschrak über seine eigene Reaktion auf ihren Anblick. Er hatte das Gefühl, den Kopf neigen und »Mein Beileid, Mademoiselle« sagen zu müssen. Da er aber keinen Grund zu der Annahme sah, dass sie einen Verlust erlitten hatte, unterdrückte er diesen Impuls. Ein Brief, der sie des Mordes beschuldigte, mochte bei ihr Ärger oder Besorgnis auslösen, doch er konnte schwerlich als eine Tragödie gewertet werden; traurig, sagte sich Poirot, würde er einen nicht machen.
Doch ebenso unbestreitbar, wie John McCrodden Poirots Zimmer mit kalter Verachtung erfüllt hatte, brachte Annabel Treadway Kummer mit sich. Herzeleid, dachte Poirot. Er spürte es so intensiv, als wäre es sein eigenes.
»Danke, Georges«, sagte er. »Bitte, nehmen Sie Platz, Mademoiselle.«
Sie eilte zum nächsten Stuhl und nahm darauf eine Sitzposition ein, die unmöglich bequem sein konnte. Poirot stellte fest, dass ihr auffälligstes physiognomisches Merkmal eine tiefe senkrechte Falte war, die zwischen ihren Augenbrauen entsprang: eine deutliche Furche, die ihre Stirn in zwei exakte Hälften zu teilen schien. Poirot beschloss, nicht wieder hinzusehen, damit sie es nicht am Ende bemerkte.
»Danke, dass Sie mir gestattet haben, heute zu Ihnen zu kommen«, sagte sie leise. »Ich hatte damit gerechnet, dass Sie ablehnen würden.« Während sie sprach, sah sie Poirot fünf- oder sechsmal an, um jedes Mal rasch wieder wegzuschauen, als wollte sie nicht von ihm dabei ertappt werden, wie sie ihn beobachtete.
»Woher kommen Sie, Mademoiselle?«
»Ach, der Name würde Ihnen sicher nichts sagen. Er sagt niemandem was. Ein Nest auf dem Land.«
»Warum hatten Sie damit gerechnet, dass ich Sie nicht empfangen würde?«
»Die meisten Menschen würden nichts unversucht lassen, um zu verhindern, dass jemand, den sie für einen Mörder halten, ihr Heim betritt«, sagte sie. »Monsieur Poirot, was ich Ihnen sagen wollte, ist … Na ja, vielleicht glauben Sie mir nicht, aber ich bin unschuldig. Ich könnte keine Menschenseele töten. Niemals! Sie können nicht wissen …« Sie brach atemlos ab.
»Bitte fahren Sie fort«, sagte Poirot freundlich. »Was kann ich nicht wissen?«
»Ich habe noch nie irgendjemandem Schmerz oder Schaden zugefügt, und ich wäre dazu auch gar nicht fähig. Ich habe Leben gerettet!«
»Mademoiselle …«
Annabel Treadway hatte ein Taschentuch hervorgeholt und betupfte sich jetzt damit die Augen. »Bitte verzeihen Sie, wenn ich prahlerisch geklungen haben sollte. Es war nicht meine Absicht, mir besondere Herzensgüte oder besondere Leistungen zuzuschreiben, aber es stimmt, dass ich ein Menschenleben gerettet habe. Vor vielen Jahren.«
»Ein Menschenleben? Ich hatte Sie so verstanden, dass es mehrere waren.«
»Ich meinte damit nur, dass ich, wenn ich wieder die Gelegenheit dazu hätte, jedes Leben retten würde, das ich nur retten kann – selbst wenn ich dazu mein eigenes in Gefahr bringen müsste.« Ihre Stimme zitterte.
»Liegt es daran, dass Sie besonders heldenmütig sind, oder daran, dass Sie glauben, andere Menschen seien wichtiger als Sie selbst?«, fragte Poirot.
»Ich … ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Für jeden von uns sollten andere Menschen grundsätzlich vorgehen. Ich behaupte nicht, selbstloser als die Mehrheit zu sein, und ich bin alles andere als tapfer. Tatsächlich bin ich ein schrecklicher Feigling. Hierherzukommen, um Sie zu sprechen, hat meinen ganzen Mut erfordert. Meine Schwester Lenore – sie ist die Mutige. Sie sind bestimmt auch mutig, Monsieur Poirot. Würden Sie nicht jedes Leben retten, das Sie retten können, jedes einzelne?«
Poirot runzelte die Stirn. Das war eine eigenartige Frage. Das ganze Gespräch war bislang ungewöhnlich gewesen – selbst für das, was Poirot im Geiste »das neue Zeitalter des Barnabas Pandy« getauft hatte.
»Ich habe viel über Ihre Arbeit gehört, und ich bewundere Sie sehr«, sagte Annabel Treadway. »Deswegen hat mich Ihr Brief ja auch so verletzt. Monsieur Poirot, Sie gehen völlig fehl in Ihrem Verdacht. Sie sagen, Sie hätten Beweise gegen mich, aber ich begreife nicht, wie das möglich sein könnte. Ich habe kein Verbrechen begangen.«
»Und ich habe Ihnen keinen Brief geschickt«, entgegnete Poirot. »Ich habe Sie nicht beschuldigt – und beschuldige Sie auch jetzt nicht –, Barnabas Pandy ermordet zu haben.«
Annabel Treadway blinzelte Poirot erstaunt an. »Aber … ich verstehe nicht.«
»Der Brief, den Sie erhalten haben, wurde nicht vom wahren Hercule Poirot geschrieben. Auch ich bin unschuldig! Ein Schwindler hat diese Anschuldigungen verschickt, jedes Mal mit meinem Namen unterzeichnet.«
»Jedes … jedes Mal? Wollen Sie damit sagen …?«
»Oui. Sie sind die dritte Person in zwei Tagen, die mir genau das sagt: dass ich ihr geschrieben und sie beschuldigt hätte, Barnabas Pandy ermordet zu haben. Gestern waren es Madame Sylvia Reagan und Monsieur John McCrodden. Heute sind Sie es.« Poirot beobachtete sie aufmerksam, um festzustellen, ob die Namen ihrer Mitangeklagten irgendeine Reaktion bei ihr auslösten. Soweit er erkennen konnte, war das nicht der Fall.
»Dann haben Sie also nicht …« Ihre Lippen bewegten sich, nachdem sie verstummt war, noch eine Zeit lang weiter. Endlich sagte sie: »Sie halten mich also nicht für eine Mörderin?«
»Das ist korrekt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich keinen Grund zu der Annahme, Sie hätten wen auch immer ermordet. Wohlgemerkt, wenn Sie die einzige Person wären, die zu mir gekommen wäre und von diesem Anklagebrief erzählt hätte, könnte ich mich schon fragen …« Dann aber beschloss Poirot, keinen weiteren Einblick in seine Gedankengänge zu gewähren, lächelte und sagte: »Es ist ein grausamer Streich, den dieser Gauner, wer auch immer er sei, uns beiden gespielt hat, Mademoiselle. Die Namen Sylvia Reagan und John McCrodden sind Ihnen nicht bekannt?«
»Ich höre beide zum ersten Mal«, sagte Annabel Treadway. »Und Streiche sollten lustig sein. Dieser ist nicht lustig. Er ist entsetzlich. Wer würde nur so etwas machen? Ich selbst bin nicht wichtig, aber so etwas einem Mann Ihres Rufes anzutun, ist empörend, Monsieur Poirot.«
»Mir sind Sie sogar sehr wichtig«, versicherte er ihr. »Einzig Sie, von den drei Personen, die diesen Brief erhalten haben, haben mir zugehört. Einzig Sie glauben Hercule Poirot, wenn er sagt, dass er einen solchen Anklagebrief weder geschrieben noch verschickt hat. Sie geben mir nicht das Gefühl, dass ich allmählich den Verstand verliere, so wie es die zwei anderen getan haben. Dafür bin ich Ihnen zutiefst dankbar.«
Noch immer lastete eine beklemmende Trauerstimmung auf dem Zimmer. Wenn es Poirot nur gelänge, ein Lächeln auf Annabel Treadways Gesicht zu zaubern … Ah, doch das war eine gefährliche Denkrichtung! Gestattete man jemandem, die eigenen Emotionen zu beeinflussen, litt die Urteilskraft darunter – immer! Nachdem er sich ins Gedächtnis gerufen hatte, dass Miss Treadway, auch wenn sie hilflos und verloren wirkte, durchaus einen Mann namens Barnabas Pandy ermordet haben konnte, fuhr Poirot weniger überschwänglich fort: »Madame Reagan und Monsieur McCrodden, sie schenkten Poirot keinen Glauben. Sie hörten nicht zu.«
»Sie haben Sie doch wohl nicht der Lüge bezichtigt?«
»Bedauerlicherweise doch.«
»Aber Sie sind doch Hercule Poirot!«
»Eine unbestreitbare Tatsache«, pflichtete Poirot ihr bei. »Darf ich fragen – haben Sie den Brief mitgebracht?«
»Nein. Ich habe ihn leider sofort vernichtet. Ich … ich konnte seine bloße Existenz nicht ertragen.«
»Dommage. Ich hätte ihn mir gern angesehen. Eh bien, Mademoiselle, wenden wir uns dem nächsten Schritt in unserer Ermittlung zu. Wer könnte auf diese bestimmte Weise Unheil anrichten wollen – zu Ihrem, zu meinem und zu Madame Reagans und Monsieur McCroddens Schaden? Vier Personen, die diesen Barnabas Pandy nicht kennen, falls er überhaupt existiert, was, soweit wir wissen …«
»Ach!«, entfuhr es Annabel Treadway.
»Was ist mit Ihnen?«, fragte Poirot. »Sagen Sie es mir. Haben Sie keine Angst!«
Sie sah zu Tode erschrocken aus. »Es ist nicht wahr«, flüsterte sie.
»Was ist nicht wahr?«
»Er existiert sehr wohl.«
»Monsieur Pandy? Barnabas Pandy?«
»Ja. Na ja, er hat existiert. Er ist nämlich tot. Aber nicht ermordet worden! Er schlief ein, und … ich dachte … es war nicht meine Absicht, Sie zu täuschen, Monsieur Poirot. Ich hätte es gleich klipp und klar sagen sollen … Ich dachte einfach …« Ihre Blicke flogen hierhin und dorthin durchs Zimmer. In diesem Moment, spürte Poirot, herrschte in ihrem Geist ein gewaltiges Durcheinander.
»Sie haben mich nicht getäuscht«, beruhigte er sie. »Madame Reagan und Monsieur McCrodden behaupteten Stein und Bein, niemanden dieses Namens zu kennen, und ich kenne ihn ebenso wenig. Ich zog den vorschnellen Schluss, das Gleiche träfe auch auf Sie zu. Jetzt erzählen Sie mir bitte alles, was Sie über Monsieur Pandy wissen. Er ist tot, sagen Sie?«
»Ja. Er starb im Dezember letzten Jahres. Vor drei Monaten.«
»Und Sie sagen, es war kein Mord – was bedeutet, Sie wissen, wie er ums Leben kam?«
»Natürlich. Ich war ja da. Wir lebten zusammen, im selben Haus.«
»Sie … Sie lebten zusammen?« Das hatte Poirot nicht erwartet.
»Ja, seit meinem achten Lebensjahr«, sagte sie. »Barnabas Pandy war mein Großvater.«
»Er war für mich eher ein Vater als ein Großvater«, erklärte Annabel Treadway Poirot, sobald er es geschafft hatte, sie zu überzeugen, dass er ihr wirklich nicht vorwarf, ihn in die Irre geführt zu haben. »Meine Eltern starben, als ich sieben war, und Grandy – so nannte ich ihn – nahm uns auf, Lenore und mich. Auch Lenore ist mir wie ein Elternteil gewesen – in gewisser Hinsicht. Ich weiß nicht, was ich ohne sie täte. Grandy war furchtbar alt. Natürlich ist es traurig, wenn sie uns verlassen, aber alte Leute sterben nun einmal, nicht? Natürlich erst, wenn ihre Zeit gekommen ist.«
Die Diskrepanz zwischen ihrem sachlichen Ton und der Traurigkeit, die sie ausstrahlte, veranlasste Poirot zu dem Schluss, dass es auf jeden Fall nicht der Tod ihres Großvaters war, der sie so betrübte.
Dann änderte sich ihr Verhalten. Etwas blitzte in ihren Augen auf, und sie sagte heftig: »Die Leute nehmen es sich viel weniger zu Herzen, wenn alte Leute sterben, und das ist fürchterlich unfair! ›Er hatte ein ausgefülltes Leben‹, sagen sie dann, als ob es dadurch erträglicher wäre, während wenn ein Kind stirbt, jeder weiß, dass das eine schreckliche Tragödie ist. Ich glaube, dass jeder Tod eine Tragödie ist! Finden Sie das nicht auch unfair, Monsieur Poirot?«
Das Wort »Tragödie« schien in der Luft widerzuhallen. Hätte man Poirot aufgetragen, ein Wort auszuwählen, das die Frau vor ihm am treffendsten definierte, hätte er sich für genau dieses entschieden. Es war fast eine Erleichterung, es laut ausgesprochen zu hören.
Als er ihre Frage nicht sofort beantwortete, errötete Annabel Treadway und sagte: »Als ich von alten Leuten sprach und davon, dass niemand sich ihren Tod so zu Herzen nehmen würde wie … also, ich meinte damit nicht … ich habe da von wirklich sehr alten Leuten gesprochen. Grandy war vierundneunzig, was mit Sicherheit viel älter ist als … Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu nahe getreten.«
So, sinnierte Poirot, schafften es manche Erklärungen, mehr zu beunruhigen als die ursprüngliche Bemerkung, die sie eigentlich entschärfen sollten. Nicht ganz aufrichtig, erklärte er Annabel Treadway, er sei nicht beleidigt. »Wie vernichteten Sie übrigens den Brief?«, fragte er sie.
Sie richtete den Blick auf ihre Knie.
»Sie würden es vorziehen, es mir nicht zu sagen?«
»Wenn man des Mordes beschuldigt wird – nicht von Ihnen, aber von irgendjemandem doch mit Sicherheit –, zögert man ein wenig, überhaupt etwas preiszugeben.«
»Das verstehe ich. Trotzdem würde ich gern wissen, was Sie damit gemacht haben.«
Sie zog die Brauen zusammen. Alors!, dachte Poirot, als sich die Falte über ihrer Nasenwurzel vertiefte. Das Rätsel zumindest war damit gelöst. Sie hatte die Angewohnheit, die Augenbrauen zusammenzuziehen, und zwar schon seit vielen Jahren. Die Furche auf ihrer Stirn war der Beweis.
»Sie halten mich bestimmt für eine abergläubische Gans, wenn ich es Ihnen verrate«, sagte sie und hob dabei das Taschentuch bis unter ihre Nase. Sie weinte zwar noch nicht, rechnete aber vielleicht damit, dass es bald passieren würde. »Ich habe einen Federhalter genommen und jedes Wort dick durchgestrichen, sodass man überhaupt nichts mehr lesen konnte. Auch Ihren Namen, Monsieur Poirot. Jedes einzelne Wort! Dann habe ich das Blatt zerrissen und die Schnipsel verbrannt.«
»Drei jeweils vollgültige Methoden der Tilgung.« Poirot lächelte. »Ich bin beeindruckt. Madame Reagan und Monsieur McCrodden waren nicht so gründlich wie Sie, Mademoiselle. Da wäre noch etwas anderes, was ich Sie fragen möchte. Mein Eindruck täuscht mich doch nicht, dass Sie unglücklich sind und sich möglicherweise fürchten?«
»Zu befürchten habe ich nichts«, antwortete sie sofort. »Ich sagte Ihnen doch, ich bin unschuldig. Ach, wenn’s nur Lenore oder Ivy wären, die mich beschuldigten, dann wüsste ich schon, wie ich sie überzeugen könnte. Ich würde einfach sagen: ›Ich schwöre es beim Leben von Hoppy‹, und dann wüssten sie, dass ich die Wahrheit sage. Natürlich wissen sie schon so, dass ich Grandy nicht getötet habe.«
»Wer ist Hoppy?«, fragte Poirot.
»Hopscotch. Mein Hund. Er ist mein allerliebster Liebling. Ich würde nie bei seinem Leben schwören und dann lügen. Sie würden ihn lieben, Monsieur Poirot. Es ist unmöglich, ihn nicht zu lieben.« Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft lächelte Annabel Treadway, und die dicke Schicht Traurigkeit, die die Atmosphäre im Zimmer beschwerte, lichtete sich ein wenig. »Jetzt muss ich zu ihm zurück. Sie werden es verrückt von mir finden, aber er fehlt mir entsetzlich. Und ich habe keine Angst – ehrlich. Wenn derjenige, der den Brief geschrieben hat, nicht bereit war, seinen Namen darunterzusetzen, dann ist es keine ernst zu nehmende Anschuldigung, oder? Es war ein alberner Streich, mehr steckt nicht dahinter, und ich bin sehr froh, dass ich Sie aufsuchen durfte und die Sache richtigstellen konnte. Jetzt muss ich gehen.«
»Bitte, Mademoiselle, brechen Sie noch nicht auf! Ich würde Ihnen gern weitere Fragen stellen.«
»Aber ich muss zu Hoppy zurück«, beharrte Annabel Treadway und stand auch schon auf. »Er braucht … und keiner von ihnen kann … Wenn ich nicht da bin, ist er … Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, wer auch immer diese Briefe geschickt hat, wird Ihnen keine weiteren Unannehmlichkeiten bereiten. Danke, dass Sie mich empfangen haben. Guten Tag, Monsieur Poirot.«
»Guten Tag, Mademoiselle«, sagte Poirot in die Leere eines Zimmers, das mit einem Mal nichts außer ihm und einem nachklingenden Gefühl von Hoffnungslosigkeit enthielt.
4Der ausgeschlossene Vierte?
Der nächste Vormittag fühlte sich für Hercule Poirot sonderbar an. Es schlug zehn, und noch immer hatte kein Unbekannter angerufen. Keine Menschenseele war in Whitehaven Mansions vorstellig geworden, um ihn zu beschuldigen, sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigt zu haben. Er wartete noch bis zwanzig vor zwölf (man konnte nie wissen, wann ein schadhafter Wecker einen Beschuldigten verschlafen ließ) und brach dann zu Pleasant’s Coffee House auf, ans andere Ende der Stadt.
Die inoffizielle Geschäftsführung des Pleasant’s hatte eine junge Kellnerin namens Euphemia Spring inne. Jedermann nannte sie nur Fee. Poirot mochte sie maßlos. Sie sagte die überraschendsten Dinge. Ihr fliegendes Haar trotzte der Schwerkraft, indem es sich weigerte, glatt an ihrem Kopf anzuliegen; ihr Verstand allerdings hatte nichts Flatterhaftes oder Verfusseltes an sich, sondern war im Gegenteil stets bei der Sache. Sie kochte den besten Kaffee in ganz London, und anschließend tat sie ihr Bestes, um Gäste davon abzubringen, welchen zu trinken. Tee, wie sie gern verkündete, sei ein weit edleres Getränk und der Gesundheit zuträglich, wohingegen Kaffee angeblich zu schlaflosen Nächten und zu jedweder Art von Verderben führte.
Ungeachtet von Fees Warnungen und Beschwörungen fuhr Poirot fort, ihren ausgezeichneten Kaffee zu trinken, und hatte festgestellt, dass sie zu vielerlei Themen (mit Ausnahme des eben erwähnten) viel Kluges anzumerken hatte. Eines ihrer Spezialgebiete war Poirots Freund und gelegentlicher Helfer Inspector Edward Catchpool – was auch der Grund für Poirots heutiges Hiersein war.
Das Coffee House füllte sich langsam. An der Innenseite der Fenster rann Feuchtigkeit herab. Als Poirot hereinkam, bediente Fee gerade einen Herrn, aber sie winkte ihm mit der Linken zu: eine beredte Geste, die ihm bedeutete, wo genau er sich hinsetzen und auf sie warten sollte.
Poirot setzte sich. Er rückte das Besteck, das vor ihm lag, wie er es immer tat, gerade und bemühte sich, die Teekannenkollektion, die die deckenhohen Wandregale füllte, nicht anzusehen. Er empfand ihren Anblick als unerträglich: allesamt verschieden und allem Anschein nach planlos ausgerichtet. Das entbehrte jeder Logik. Jemand zu sein, dem Teekannen immerhin so viel bedeuteten, dass er sie in solchen Mengen sammelte, und dennoch die Notwendigkeit nicht einzusehen, die Tüllen alle in dieselbe Richtung zu drehen … Poirot hatte Fee seit langem im Verdacht, sich einzig und allein zu dem Zweck, ihm Seelenqualen zu bereiten, um eine möglichst undurchdachte Anordnung zu bemühen. Einmal, als die Teekannen noch auf eine konventionellere Manier aufgereiht standen, hatte er angemerkt, dass eine nicht korrekt ausgerichtet sei. Seitdem war, sooft er ins Pleasant’s kam, keinerlei System mehr zu erkennen gewesen. Auf Kritik sprach Fee nicht gut an.
Sie erschien von der Seite und knallte einen Teller zwischen Gabel und Messer auf den Tisch. Darauf lag ein Stück Kuchen, das Poirot nicht bestellt hatte. »Ich brauch gleich Ihre Hilfe«, sagte sie, bevor er sie wegen Catchpool fragen konnte, »aber zuerst wird aufgegessen.«
Es war ihr berühmter Kirchenfensterkuchen, so genannt, weil jedes einzelne Stück zwei gelbe und zwei rosafarbene Quadrate aufwies, die an die bunten Glasfelder eines Kirchenfensters erinnern sollten. Poirot fand den Namen ärgerlich. Kirchenfenster waren buntfarbig, das schon, aber sie waren auch durchsichtig und aus Glas. Ebenso gut hätte man ihn »Schachbrettkuchen« nennen können – daran musste Poirot immer denken, wenn er ihn sah: an ein Schachbrett, wenngleich ein zu kleines und in den falschen Farben gehaltenes.
»Ich habe heute Morgen bei Scotland Yard angerufen«, erklärte er Fee. »Es heißt, Catchpool mache Urlaub am Meer, mit seiner Mutter. Das klingt mir nicht wahrscheinlich.«
»Essen!«, sagte Fee.
»Oui, mais …«
»Aber Sie wüssten gern, wo Edward ist. Warum? Is was passiert?« Neuerdings nannte sie Catchpool beim Vornamen, allerdings nie, wie Poirot beobachtet hatte, in seiner Anwesenheit.
»Wissen Sie, wo er ist?«, fragte Poirot sie.
»Gut möglich.« Fee grinste. »Ich verrat Ih’n gerne alles, was ich weiß, sobald Sie versprochen ha’m, dass Sie mir helfen. Jetzt essen Sie.«
Poirot seufzte. »Inwiefern ist es Ihnen eine Hilfe, wenn ich ein Stück Ihres Kuchens esse?«
Fee setzte sich neben ihn und stemmte beide Ellbogen auf den Tisch. »Das is nich mein Kuchen«, flüsterte sie, als wäre von etwas Peinlichem die Rede. »Sieht genauso aus, schmeckt genauso, is aber nich von mir. Das is das Problem.«
»Ich verstehe nicht.«
»Sind Se hier mal von nem Mädchen bedient worden, was Philippa hieß – klapperdürr, Zähne wie’n Pferd?«
»Non. Die Beschreibung sagt mir nichts.«
»War nich lang hier. Ich hab se mal dabei erwischt, wie sie Essen klaute, und musste mit ihr Tacheles reden. Nich, dass se nich was auf den Rippen gebrauchen könnte, aber dass se sich von den Tellern von Leuten bediente, die wo treu un brav bezahlt hatten, das konnt ich nich durchgehen lassen. Ich hab zu ihr gesagt, Reste könnt se gerne haben, aber die waren ihr ja nich gut genug! Hat ihr nich gepasst, als Diebin bezeichnet zu werden – passt Dieben ja nie! –, und so hat se sich nich wieder blicken lassen. Schön, jetz serviert se in dem neuen Coffee House, Kemble’s, gleich bei der Weinhandlung auf der Oxford Street. Die können se herzlich gern behalten, un’ viel Vergnügen dabei – aber dann fangen Gäste an, mir zu erzählen, dass se meinen Kuchen bäckt! Anfangs, da hab ich ih’n nich geglaubt. Woher sollte se das Rezept kennen? Von meiner Uroma stammte das, dann kriegte es meine Oma, dann meine Ma un’ dann ich. Ich tät mir eher die Zunge abbeißen, als das irgendwem von außerhalb der Familie zu verraten, und hab ich auch nicht, keiner Menschenseele – ganz bestimmt aber nich ihr. Ich hab’s auch nirgendwo aufgeschrieben. Die einzige Art, wie sie’s wissen konnte, wär, wenn se mir heimlich dabei zugeschaut hätte, wie ich den Kuchen am Machen war … und als ich richtig nachgedacht hab, da hab ich gedacht, ja, das könnt so gewesen sein. Ein einziges Mal hätt schon gereicht, wenn se richtig aufgepasst hat, und so ganz ausschließen kann ich das nich. Die viele Zeit, wo wir nebeneinandergestanden hatten, immer in dieser winzigen Küche …«
Fee streckte einen vorwurfsvollen Finger aus, als wäre die Küche des Pleasant’s an allem schuld. »Is ja nich weiter ne Kunst, so zu tun, wie wenn se grad mit was andrem beschäftigt wäre. Und sie war ne richtige kleine Schnüfflerin … Wie auch immer, ich musste da hin und den probieren, oder? Und ich glaub, die haben recht, die, wo mir gesagt ha’m, sie würde meinen Kuchen backen. Ich glaub, die ha’m so was von recht!« Ihre Augen flammten vor Empörung.
»Was möchten Sie, dass ich tue, Mademoiselle?«
»Hab ich das nich gesagt? Essen Sie das, un’ dann sagen Se mir, ob ich recht oder unrecht hab. Das is der ihr Kuchen, nich meiner. Ich hab den in der Manteltasche verschwinden lassen, wie sie grad nicht hingeguckt hat. Sie hat nich mal mitgekriegt, dass ich überhaupt in ihrem Coffee House war – so sehr hab ich mich vorgesehen. Ich bin verkleidet hin – richtig kostümiert!«
Poirot hegte keinen Wunsch, ein Stück Kuchen zu essen, das sich in jemandes Tasche befunden hatte. »Ich habe Ihren Kirchenfensterkuchen seit vielen Monaten nicht gekostet«, erklärte er Fee. »Meine Erinnerung daran ist nicht so deutlich, dass ich ein Urteil fällen könnte. Überhaupt erinnert man sich an Geschmäcke nicht so genau – das ist unmöglich.«
»Mei’n Se, das wüsst ich nich selber?«, sagte Fee ungeduldig. »Gleich danach geb ich Ih’n ja ein Stück von meinem, oder? Hol ich direkt.« Sie stand auf. »Sie beißen ein Stückchen von dem einen ab, dann von dem anderen. Dann gleich noch mal, von jedem Stück ein bisschen. Un’ dann sagen Se mir, ob die nich beide von demselben Stück sein könnten.«
»Wenn ich das tue, sagen Sie mir dann, wo Catchpool ist?«
»Nö.«
»Nein?«
»Ich hab gesagt, ich würd Ihnen sagen, wo Edward is, wenn Sie mir helfen.«
»Und ich habe eingewilligt, den Kuchen zu …«
»Das Probieren is nich die Hilfe«, sagte Fee bestimmt. »Die kommt danach.«
Hercule Poirot beugte sich selten einem fremden Willen, aber Fee Spring zu trotzen war ein fruchtloses Unterfangen. Er wartete, bis sie mit einem weiteren Stück Kirchenfensterkuchen zurückkam, das dem ersten wie ein Ei dem andern glich, und kostete dann folgsam von beiden. Um sicherzugehen, entnahm er jedem Stück jeweils drei Proben.
Fee beobachtete ihn, wachsam wie ein Schießhund. Schließlich konnte sie sich nicht länger beherrschen und fragte: »Und? Gleich oder nicht gleich?«
»Ich kann keinen Unterschied schmecken«, entgegnete Poirot. »Nicht den geringsten. Aber ich fürchte, Mademoiselle, es gibt kein Gesetz, das es einem untersagte, exakt den gleichen Kuchen zu backen wie jemand anders, wenn er oder sie mit eigenen Augen beobachtet hat, wie …«
»Oh, ich hab nich vor, gerichtlich gegen sie vorzugehen. Was ich nur wissen will, is, ob sie selbs’ glaubt, dass sie den von mir gestohlen hat oder nich.«
»Ich verstehe«, sagte Poirot. »Sie sind nicht am juristischen, sondern am ethischen Aspekt des Tatbestands interessiert.«
»Ich möchte, dass Sie in der ihr Coffee House gehen, ihren Kuchen bestellen und se dann danach fragen. Fragen Se se, wo se das Rezept herhat.«
»Was, wenn sie sagt: ›Es ist das, was Fee Spring im Pleasant’s verwendet‹?«
»Dann geh ich persönlich bei ihr vorbei und verrat ihr, was se nich wusste: nämlich, dass das Familienrezept von den Springs von keinem anderen nachgebacken werden darf. Wenn’s ein Versehen war, ohne böse Absicht, werd ich’s entsprechend behandeln.«
»Und was wollen Sie tun, wenn sie eher ausweichend antwortet?«, fragte Poirot. »Oder wenn sie frech behauptet, sie habe das Rezept für ihren Kuchen aus anderer Quelle, und Sie glauben ihr nicht?«
Fee lächelte und machte ihre Augen schmal. »Oh, dann sorg ich dafür, dass sie’s schon bald bereut«, sagte sie, um rasch hinzuzufügen: »Also, nich so, dass Sie bereuen müssten, dass Se mir geholfen haben – dass das klar ist.«
»Das freut mich zu hören, Mademoiselle. Wenn Sie Poirot gestatten, Ihnen einen weisen Ratschlag zu geben: Nach Rache zu streben ist selten eine gute Idee.«
»Rumsitzen un’ Däumchendrehen, wenn jemand sich mit dei’m rechtmäßigen Besitz vom Acker gemacht hat, aber auch nich«, sagte Fee. »Was ich von Ih’n will, is die Hilfe, um die ich gebeten hab, nich Ratschläge, um die ich nich gebeten hab.«
»Je comprends«, sagte Poirot.
»Gut.«
»Bitte. Wo ist Catchpool?«
Fee grinste. »An der See mit seiner Ma, genau wie die bei Scotland Yard gesagt ha’m.«
Poirots Gesicht nahm einen gestrengen Ausdruck an. »Ich sehe, ich bin überlistet worden«, sagte er.
»Gar nich! Sie hatten de’n ja nich geglaubt, wo die es Ih’n gesagt ha’m. Jetzt sag ich Ihnen, dass es wahr ist, also wissen Sie’s. Da is er. Great Yarmouth, ob’m im Osten.«
»Wie ich schon sagte … das klingt nicht wahrscheinlich.«
»Er wollte auch eigntlich nich, aber er musste, damit das alte Mädchen endlich Ruhe gibt. Sie hatte schon wieder die perfekte Frau für ihn gefunden.«
»Ah!« Catchpools Mutters Ehrgeiz, ihren Sohn mit einer netten jungen Dame verpaart zu sehen, war Poirot wohlbekannt.
»Un’ dabei hatte diese spezielle auch noch ne Menge zu bieten – richtig was fürs Auge, meinte Edward, und aus or’ntlicher Familie. Dazu nett und gebildet. Er fand’s schwerer als sonst, Nein zu sagen.«
»Zu seiner Mutter? Oder machte ihm die jolie femme selbst den Heiratsantrag?«
Fee lachte. »Nö, die hatte sich seine Ma in’n Kopf gesetzt, das war alles. Hat das alte Mädchen richtig fertiggemacht, wie er gesagt hat, er hätt kein Interesse. Da hat se bestimmt gedacht: Wenn er sich nicht mal zu dieser bereden lässt … Da hat sich Edward gedacht, dass er was tun müsste, um se wieder aufzubauen, und sie liebt Great Yarmouth, und so sin’ se jetz dort.«
»Wir haben Februar«, sagte Poirot erbost. »Im Februar in einen englischen Badeort zu gehen heißt, das Unheil herauszufordern, ist es nicht so?« Wie elend muss es Catchpool gerade gehen, dachte er bei sich. Er sollte umgehend nach London zurückkehren, sodass Poirot mit ihm die Sache mit Barnabas Pandy erörtern könnte.
»Sie entschuldigen, Monsieur Poirot? Monsieur Hercule Poirot?« Eine zögernde Stimme unterbrach seine Gedanken. Er drehte sich um und sah sich einem elegant gekleideten Mann gegenüber, der ihn so anstrahlte, als wäre er von der lautersten Freude durchdrungen.
»Hercule Poirot, c’est moi«, bestätigte er.
Der Mann streckte ihm die Hand entgegen. »Welch ein Vergnügen, Sie kennenzulernen«, sagte er. »Sie haben einen formidablen Ruf. Es ist schwer zu entscheiden, wie man solch einen großen Mann ansprechen sollte. Ich bin Dockerill – Hugo Dockerill.«
Fee beäugte den Neuankömmling mit Argwohn. »Dann lass ich Se mal allein«, sagte sie. »Vergessen Se nich, dass Sie versprochen ha’m, mir zu helfen«, warnte sie Poirot, bevor sie den Tisch verließ. Er versicherte ihr, dass er es nicht vergessen werde, und bat dann den lächelnden Mann, Platz zu nehmen.
Hugo Dockerill war, obwohl nach Poirots Schätzung noch keine fünfzig, fast vollständig kahl.
»Es tut mir außerordentlich leid, Sie so zu überfallen«, sagte Dockerill mopsfidel und keineswegs bedauernd. »Ihr Diener sagte, ich könnte Sie vielleicht hier finden. Er ermutigte mich, einen Termin für den späteren Nachmittag zu vereinbaren, aber es drängt mich schon sehr, das Missverständnis aufzuklären. Also sagte ich ihm, dass ich Sie lieber früher als später sprechen würde, und als ich ihm erklärt hatte, worum es genau ging, schien er der Ansicht zu sein, dass Sie vielleicht mich recht dringend sprechen wollen würden – und da bin ich!« Er lachte wiehernd, als hätte er gerade eine humoristische Anekdote erzählt.
»Missverständnis?«, sagte Poirot. So langsam fragte er sich, ob möglicherweise ein vierter Brief … doch nein, wie sollte das angehen? Würde irgendjemand, selbst der enthusiastischste und optimistischste Mensch, unter solchen Umständen wie ein Honigkuchen strahlen?
»Ja. Ich erhielt vor zwei Tagen Ihren Brief, und … nun ja, die Schuld liegt mit Sicherheit gänzlich bei mir, und es wäre mir furchtbar unangenehm, wenn Sie glauben würden, dass ich mir auch nur die geringste Kritik an Ihnen herausnehmen möchte – nichts läge mir ferner«, quasselte Hugo Dockerill weiter. »Tatsächlich bin ich ein glühender Bewunderer Ihrer Arbeit, soweit sie mir bekannt ist, aber … na ja, ich muss unwissentlich etwas getan haben, was Sie auf falsche Gedanken gebracht hat. Dafür bitte ich um Vergebung. Ich neige tatsächlich zuweilen zur Schusseligkeit. Da brauchen Sie nur meine Frau Jane zu fragen – sie erzählt es Ihnen gern. Ich wollte Sie eigentlich stante pede aufsuchen, sobald ich Ihren Brief bekommen hatte, aber ich habe ihn fast umgehend verlegt …«
»Monsieur«, sagte Poirot streng. »Von welchem Brief sprechen Sie?«