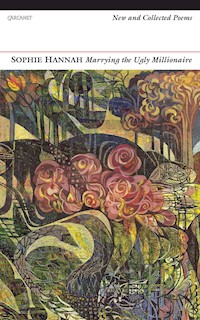7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Amber Hewerdine findet keine Ruhe mehr. Seitdem ihre beste Freundin bei einem Wohnungsbrand ums Leben kam und sie ihre beiden Töchter bei sich aufnahm, quält sie Nacht für Nacht die Schlaflosigkeit. Ein Besuch bei einer Hypnosetherapeutin lasst nur einen Schluss zu: Amber kennt den Killer. Und weiß, dass er wieder zuschlagen wird. Doch offenbar ist die Wahrheit so grauenhaft, dass sie sie noch nicht einmal vor sich selbst zugeben kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 692
Ähnliche
Sophie Hannah
DER KALTESCHLAF
Psychothriller
Aus dem Englischen vonAnke Angela Grube
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe: Copyright © 2012 by Sophie Hannah
Titel der englischen Originalausgabe: »Kind of Cruel«
Originalverlag: Hodder & Stoughton Ltd, a division of Hodder Headline, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher
Titelillustration: © plainpicture/PhotoAlto
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin
Erstellung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-4576-3
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
FÜR JULIET EMERSON, DIEMIRGEHOLFENHAT,VIELE RÄTSELZULÖSEN,AUTOBIOGRAPHISCHEWIEFIKTIONALE
Wenn Sie jemanden nach einer Erinnerung fragen und er daraufhin eine Geschichte erzählt, lügt er.
Ich mit fünf Jahren, zusammengekauert in meinem Versteck hinter dem Puppenhaus, voller Angst, von der Lehrerin entdeckt zu werden, im Wissen, dass genau das unvermeidlich war und ich mich innerlich darauf vorbereiten musste – das ist eine Erinnerung.
Daraus gemacht habe ich folgende Geschichte: An meinem ersten Schultag war ich wütend auf meine Mutter, weil sie mich an einem unbekannten Ort mit fremden Leuten alleinließ. Weglaufen war keine Option, denn ich war ein braves Mädchen – das versicherten mir meine Eltern ständig. Aber diesmal hatte ich so starke Einwände gegen das, was mir da zugemutet wurde, dass ich beschloss zu protestieren, indem ich mich so weit wie möglich dem Geschehen entzog. In einer Ecke des Klassenzimmers stand ein großes Puppenhaus, und als keiner hinsah, schob ich mich zwischen das Puppenhaus und die Wand. Ich weiß nicht, wie lange ich in meinem Versteck hockte und zuhörte, wie meine Klassenkameraden unerfreulichen Krach veranstalteten und die Klassenlehrerin versuchte, Ordnung herzustellen – aber es war lange genug, um mich allmählich unbehaglich zu fühlen. Ich bereute, dass ich mich versteckt hatte, aber wenn ich jetzt plötzlich wieder auftauchte, würde das einem Geständnis gleichkommen, und so etwas Unüberlegtes wollte ich nicht tun. Ich wusste, irgendwann würde ich entdeckt und streng bestraft werden, und meine Nervosität und Angst wuchsen. Ich weinte, so leise, dass mich keiner hören konnte. Gleichzeitig dachte ein Teil von mir: »Sag nichts, rühr dich nicht von der Stelle – vielleicht kommst du ja doch damit durch.«
Als ich hörte, wie Mrs Hill die Schüler aufforderte, sich im Schneidersitz auf den Teppich zu setzen, um die Anwesenheit zu überprüfen, geriet ich in Panik. Obwohl ich noch nie in der Schule und auch nicht im Kindergarten gewesen war, ahnte ich, was das bedeutete. Sie würde unsere Namen aufrufen, einen nach dem anderen. Wenn ich meinen Namen hören würde, musste ich mich melden. Wo auch immer ich mich befand, ich würde »Hier, Mrs Hill« sagen müssen. Der Gedanke, einfach nichts zu sagen, kam mir gar nicht, denn ein solches Ausmaß an Täuschung und Rebellion konnte ich mir noch nicht einmal vorstellen, geschweige denn in die Tat umsetzen. Trotzdem rührte ich mich nicht in meinem Versteck. Ich bin immer schon eine Optimistin gewesen, und so war ich nicht gewillt aufzugeben, bevor es unbedingt sein musste. Es könnte schließlich noch irgendetwas passieren, das die Klassenlehrerin davon abhalten würde, die Anwesenheit festzustellen, dachte ich. Vielleicht fliegt ja ein Vogel durchs Fenster herein, oder einer meiner Klassenkameraden erkrankt plötzlich und muss sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Oder mir würde in den letzten drei Sekunden irgendein brillanter Einfall kommen – irgendein Ausweg aus dem Schlamassel, in den ich mich da manövriert hatte.
Natürlich geschah nichts von alledem, und als die Klassenlehrerin meinen Namen aufrief, entschloss ich mich zu einem Kompromiss. Ich sagte nichts, aber hob die Hand, sodass sie über dem Puppenhaus deutlich zu sehen war. Ich habe meine Pflicht erfüllt, dachte ich – ich melde mich. Aber es bestand ja immer noch die Möglichkeit, dass ich wundersamerweise nicht entdeckt werden würde und als Belohnung für mein Pflichtbewusstsein den ganzen Tag nicht am Unterricht teilnehmen musste. Und dann konnte ich das Ganze am nächsten Tag noch einmal wiederholen. So weit meine Phantasie. Natürlich bemerkte Mrs Hill meinen hochgestreckten Arm sofort und verlangte, dass ich hinter dem Puppenhaus hervorkam. Nach dem Unterricht berichtete sie meiner Mutter, was ich getan hatte, und ich wurde bestraft, in der Schule und auch von meinen Eltern. Wie genau, daran erinnere ich mich nicht mehr.
Was ist wahr an dieser Geschichte? Das meiste, würde ich vermuten. Wahrscheinlich neunzig Prozent. An wie vieles davon erinnere ich mich noch? An kaum etwas. Eigentlich nur an zwei intensive Gefühle, an die Mischung aus Angst und Trotz, die ich empfand, als ich hinter dem Puppenhaus hockte, und an die schreckliche Demütigung, die es für mich bedeutete, herauskommen und mich der Klasse stellen zu müssen. Jeder wusste, dass ich ein Risiko eingegangen war, dann aber die Nerven verloren und mich selbst aufgegeben hatte. Ich spüre noch, wie sehr die Erinnerung daran mich beschämte, bereits Sekunden danach – eine Erinnerung in einer Erinnerung an meine dämliche Geste, im Versteck zu bleiben, aber dennoch stumm die Hand zu heben. Ich war auf Nummer sicher gegangen. Einfach jämmerlich, das war ich. Zu brav, um unartig zu sein, und zu unartig, um brav zu sein. Ich erinnere mich, wie sehr ich mir wünschte, jedes andere Kind in der Klasse zu sein, nur nicht ich selbst. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich all diese Gefühle empfand, obwohl mir mit fünf Jahren vermutlich der Wortschatz fehlte, sie auszudrücken. Allerdings kann ich mir bei alldem nicht ganz sicher sein, da die Geschichte, die ich aus dem Vorfall gemacht und mir vierzig Jahre lang erzählt habe, meine Erinnerungen niedergetrampelt und sie mittlerweile effektiv ersetzt hat. Wahre Erinnerungen sind zerbrechliche, fragmentarische Erscheinungen, sie können nur zu leicht von einer robusten Erzählung eingeschüchtert werden, die gewebt wurde, damit die Erinnerung schön im Gedächtnis bleibt. Fast unmittelbar nach einer Erfahrung beschließen wir, wie wir sie interpretieren wollen, und dann konstruieren wir eine dementsprechende Geschichte. Die Geschichte enthält den Teil der Erinnerungen, die diesem Zweck dienen – strategisch platziert, wie bunte Broschen auf dem Revers eines schwarzen Jacketts –, während die Erinnerungen, die nicht ins Konzept passen, weggelassen werden.
Jahrelang habe ich eine andere Version dieser Episode erzählt, eine Version, in der ich mit einem dreisten Lächeln auf dem Gesicht aus meinem Versteck herauskam und selbstsicher erklärte: »Was ist denn? Ich habe mich nicht versteckt. Ich habe schließlich die Hand gehoben, nicht wahr? Keiner hat gesagt, dass wir uns nicht hinter das Puppenhaus setzen dürfen.« Und dann, eines Tages, dachte ich mitten in meiner Erzählung: Kann das wirklich so passiert sein? Manchmal müssen wir die Geschichten, die wir uns ununterbrochen selbst erzählen, zerstören, um an die wahren Erinnerungen zu kommen. Es ist, als würde man Farbschicht um Farbschicht von einer Backsteinwand entfernen. Darunter finden sich die ursprünglichen Backsteine – verfärbt und in schlechtem Zustand, weil sie jahrelang nicht atmen konnten.
Das Komische ist, heute erscheinen mir beide Versionen der Geschichte wie Erinnerungen, weil ich beide so oft erzählt habe, mir selbst und anderen. Jedes Mal, wenn wir eine Geschichte erzählen, vertiefen wir die Bahnen, die sie in unserem Gedächtnis gegraben haben, und so erscheint sie uns mit jedem Erzählen realer.
Eine wahre Erinnerung dagegen ist eher das flüchtige Bild eines roten Mantels, ein Zitronenbaum, von dem man nicht mehr weiß, wo er stand, ein starkes Gefühl, der Name eines Menschen, den man einmal gekannt hat – nur der Name, weiter nichts. Richtige Erinnerungen haben keinen Anfang, keine Mitte und kein Ende. Es gibt keinen Spannungsbogen, keinen offensichtlichen Sinn, ganz bestimmt keine Moral, also nichts, was das Publikum zufriedenstellen könnte, und mit »Publikum« meine ich den Erzähler oder die Erzählerin, die immer das erste Publikum für die eigenen Geschichten sind.
All das gilt auch für Weihnachten 2003 und das, was in Little Orchard geschah, wobei es sich – wie Sie vermutlich mittlerweile erraten haben – nicht um eine Erinnerung, sondern um eine Geschichte handelt. Hoffen wir, dass diese Geschichte sich dafür eignet, ein paar der darin eingebetteten Erinnerungen aufzuspüren und vielleicht auch ein paar der verworfenen Erinnerungen, die nicht in die Geschichte passten und derer man sich entledigt hat.
1
DIENSTAG, 30. NOVEMBER 2010
Es ist kein besonderer Ort. Die Backsteine der Torpfosten haben Lücken, dort wo der Fugenputz herausgebrochen ist. Die Fenster haben hässliche Kunststoffrahmen. Es ist kein Ort, an dem Wunder geschehen.
Und ja, auch ich habe Anteil an dieser Atmosphäre, das will ich nicht leugnen, auch ich bin nichts Besonderes. Ich bin niemand, an dem sich Wunder vollbringen ließen.
Es wird nicht funktionieren. Ich darf also nicht enttäuscht sein, wenn es nichts bringt.
Ich bin ja auch nicht hier, weil ich glaube, dass es helfen könnte. Ich bin hier, weil ich es satthabe, ein strahlendes Lächeln aufzusetzen und erfreute, erstaunte Laute von mir zu geben, wenn mir mal wieder jemand erzählt, wie wunderbar es bei ihm geklappt hat. »Probieren Sie es doch mal mit Hypnose«, sagen praktisch alle, die mir begegnen, von den Kollegen bis zu meinem Zahnarzt, den Eltern in der Schule und den Lehrerinnen der Mädchen. »Ich war ja zuerst sehr skeptisch, und ich bin nur hingegangen, weil es der letzte Ausweg war. Aber dann war es wie Zauberei – ich habe nie wieder Zigaretten/Wodka/Sahnetorten/ Wettscheine angerührt.«
Mir ist aufgefallen, dass alle, die eine hochgradig unseriöse Lösung für ein Problem propagieren, stets betonen, wie skeptisch sie anfangs waren. Niemand verkündet: »Ich war und bin ein verzweifelter Idiot, ich würde wirklich alles glauben. Merkwürdigerweise hat Hypnose bei mir dann wirklich funktioniert.«
Ich sitze im Auto an der Great Holling Road, vor dem Haus von Ginny Saxon, einer Hypnotherapeutin, die ich ziemlich zufällig ausgewählt habe. Na ja, vielleicht nicht ganz. Great Holling ist das schönste Dorf im Culver Valley. Wenn ich schon mein Geld zum Fenster rauswerfe, dann doch wenigstens in schöner Umgebung, dachte ich. Wenige Orte sind derart idyllisch, dass man sich nur herablassend über sie äußern kann – »eine Scheinwelt« oder »bevölkert von arroganten Arschlöchern«, sagen die Leute dann. So ist es fast zu einem Klischee geworden, über die idyllische Abgeschiedenheit von Great Holling die Nase zu rümpfen und sich für einen Wohnort mit etwas mehr Lärm und Dreck zu entscheiden, in dem zufälligerweise die Immobilienpreise niedriger sind. »Selbst wenn ich es mir leisten könnte, in Great Holling zu wohnen, ich würde dort nie hinziehen. Es ist einfach zu perfekt.« Ja, natürlich!
Aber vielleicht sollte ich nicht so misstrauisch sein. Es gibt schließlich viele Leute, die genug Geld haben, es aber bewusst nicht dafür einsetzen, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Einige mir bekannte Volltrottel geben Quacksalbern ihr sauer verdientes Geld, um sich mesmerisieren zu lassen, in der Hoffnung, dass all ihre Probleme verschwunden sein werden, wenn sie wieder zu sich kommen.
Ginny Saxons Adresse ist aber offensichtlich genauso ein Schwindel wie die von ihr angebotene Therapieform. Wie sich herausstellt, wohnt sie gar nicht in Great Holling. Ich bin extra hier rausgefahren, nur um festzustellen, dass es eine Vortäuschung falscher Tatsachen war – und nicht nur die alberne Placebo-Behandlung, die sie anbietet, meine ich. Wenn ich mir die Adresse etwas genauer angesehen hätte, wäre mir vielleicht die doppelte Portion Dorfnamen darin aufgefallen – Great Holling Road 77, Great Holling, Silsford. Ich befinde mich gar nicht in Great Holling, sondern auf der Landstraße, die dorthin führt. Auf einer Seite befinden sich Häuser, unter anderem das von Ginny Saxon, auf der anderen Seite graubraune, matschig aussehende Felder. Das ist Agrarland, das sich als Landleben tarnt. Auf einem der Felder steht ein Schuppen mit Wellblechdach. Es ist eine Landschaft, die mich an Gülle erinnert, obwohl das nicht nett sein mag und ich keine Gülle rieche.
Du bist unfair. Was kann es schon schaden, ganz unvoreingenommen an die Sache heranzugehen? Vielleicht hilft es ja tatsächlich.
Ich stöhne. Es wird wehtun, wenn diese Scharade, an der ich gleich teilnehmen werde, mich genauso zurücklässt, wie ich gekommen bin. Und es wird vermutlich schlimmer werden als bei allen anderen Versuchen, die ich bislang unternommen habe und die nicht geholfen haben. Hypnose ist für jeden der allerletzte Ausweg. Danach gibt es nichts mehr, was man noch versuchen könnte.
Ich schaue auf die Uhr im Armaturenbrett. Punkt drei. Um drei habe ich meinen Termin, ich sollte jetzt reingehen. Aber es ist warm in meinem geheizten Renault Clio, und draußen ist es bitterkalt. Kein Schnee, nicht einmal die Art Schnee, die nicht liegen bleibt, aber jeden Abend kündigt die Wetterfrau des lokalen Nachrichtensenders mit immer größerer Schadenfreude in der Stimme Schneefall an.
»Wenn ich bis drei gezählt habe …«, ich stelle mir vor, das in meiner besten tiefen, hypnotisierenden Stimme zu mir selbst zu sagen, »wirst du aussteigen, das Haus auf der anderen Straßenseite betreten und eine Stunde lang so tun, als wärst du in Trance. Du wirst der Scharlatanin einen Scheck über siebzig Pfund ausstellen. Es wird phantastisch werden.« Ich ziehe den Zettel mit den handgeschriebenen Instruktionen aus der Jackentasche: Ginnys Adresse. Ich überprüfe sie und stecke sie wieder ein – eine Verzögerungstaktik, die mir nichts verrät, was ich nicht bereits wüsste. Ich bin hier richtig.
Oder falsch.
Na los.
Als ich auf das Haus zugehe, sehe ich, dass der Wagen, der in der Auffahrt steht, nicht leer ist. Eine Frau sitzt darin, eine Frau in einem schwarzen Mantel mit Pelzkragen, einem roten Schal und leuchtend rotem Lippenstift. Auf ihrem Schoß liegt ein offenes Notizbuch, in der Hand hält sie einen Stift. Sie raucht eine Zigarette und hat trotz der Temperatur das Fenster heruntergelassen. Sie trägt keine Handschuhe, und ihre Hände sind gerötet vor Kälte. Rauchen und Schreiben sind ihr offenbar wichtiger als ihr Wohlbefinden, denke ich, als ich die Wollhandschuhe sehe, die neben einer Packung Marlboro Light auf dem Beifahrersitz liegen. Sie blickt auf, lächelt und sagt Hallo.
Um Ginny Saxon kann es sich nicht handeln. Denn auf ihrer Website kann man nachlesen, dass Raucherentwöhnung eins der Dinge ist, bei denen Hypnose helfen kann. Es wäre also eher seltsam, wenn sie sich mit einer Zigarette in der Hand vor ihrem Haus ins Auto setzen würde. Dann bemerke ich etwas, das von der Straße aus nicht zu sehen war, ein kleines freistehendes Holzhäuschen hinten im Garten. Ein Schild verkündet: Great Holling Hypnotherapie-Praxis Ginny Saxon. Psychologin. Pädagogin. Mitglied der Gesellschaft für klinische Hypnose.
»Dort findet es statt«, sagt die Raucherin mit mehr als einer Spur von Bitterkeit in der Stimme. »In ihrem Geräteschuppen. Sehr vertrauenerweckend, oder?«
»Der Schuppen ist ansprechender als das Haus«, bemerke ich. Es gelingt mir problemlos, in den Unartige-Mädchen-ganz-hinten-im-Schulbus-Modus umzuschalten, und ich bete, dass Ginny Saxon nicht unvermittelt hinter mir auftaucht und mich dabei erwischt, wie ich ihr Haus heruntermache. Warum liegt mir daran, mich bei dieser fremden Frau einzuschmeicheln? »Zumindest hat der Schuppen keine Kunststofffenster«, füge ich hinzu. Ich weiß nur zu gut, wie absurd mein Verhalten ist, aber ich bin machtlos – ich kann nichts dagegen tun.
Die Frau grinst und wendet sich dann ab, als hätte sie sich das mit dem Gespräch anders überlegt. Sie blickt in ihr Notizbuch. Ich weiß, wie sie sich fühlt. Es wäre besser gewesen, wir hätten so getan, als wäre die andere gar nicht da. Wir können so sarkastisch sein, wie wir wollen, wir sind beide hier, weil wir ein Problem haben, das wir nicht selber lösen können, und wir wissen es – von uns selbst und von der anderen.
»Sie ist eine Stunde im Verzug. Ich hatte einen Termin um zwei.«
Ich versuche, den Eindruck zu erwecken, als mache mir das nichts aus, aber ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Das würde bedeuten … ich werde erst um vier drankommen, und um zehn nach vier muss ich los, wenn ich rechtzeitig zu Hause sein will, um Dinah und Nonie vom Schulbus abzuholen.
»Keine Sorge, Sie können meinen Termin haben«, sagt meine neue Freundin und wirft ihre Kippe aus dem Fenster. Wenn Dinah hier wäre, würde sie sagen: »Heben Sie Ihren Abfall auf, aber sofort, und werfen Sie ihn in den Mülleimer.« Die Idee, dass sie erst acht ist und nicht in der Position, einer fremden Frau, die mehr als fünfmal so alt ist wie sie, Befehle zu erteilen, würde ihr gar nicht kommen. Ich nehme mir fest vor, die Kippe nachher aufzuheben und in den nächsten Mülleimer zu werfen – wenn die Frau es nicht mehr mitbekommt und als Kritik auffassen könnte.
»Das würde Ihnen nichts ausmachen?«, frage ich.
»Dann hätte ich es nicht angeboten«, meint sie. Ihre Stimme klingt merklich munterer. Weil sie vom Haken ist? »Entweder ich komme um vier wieder oder …«, sie zuckt die Achseln, »oder auch nicht.«
Sie fährt das Fenster herunter und setzt rückwärts aus der Auffahrt, wobei sie mir auf eine Art zuwinkt, die mir den Eindruck vermittelt, ich sei hereingelegt worden – eine Mischung aus Lässigkeit und Überlegenheit, ein Winken, das auszudrücken scheint: »Jetzt bist du auf dich gestellt, du Dummerchen.«
»Kommen Sie doch herein, es ist so kalt«, sagt eine Stimme hinter mir. Ich drehe mich um und sehe eine füllige Frau mit einem runden, hübschen Gesicht und blonden Haaren, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind, aber so nachlässig, dass der Großteil sich aus dem Haargummi befreit hat. Sie trägt einen olivgrünen Cordrock, schwarze, knöchelhohe Stiefel, schwarze Strumpfhosen und einen cremefarbenen Polopullover, der um die Taille herum eng anliegt und die Aufmerksamkeit auf das zusätzliche Gewicht lenkt, das sie mit sich herumschleppt. Ich schätze sie auf etwa Mitte vierzig.
Ich folge ihr in das Holzhäuschen, das kein Schuppen ist und eindeutig auch nie einer war. Dafür sieht das Holz zu neu aus, innen wie außen. Nichts weist darauf hin, dass hier je eine matschige Schaufel oder ein ölverschmierter Rasenmäher gestanden hätten. Eine Wand ist von oben bis unten mit gerahmten botanischen Drucken bedeckt, und in drei der vier Ecken des Raums stehen himmelblaue Vasen mit Blumen. Ein weißer Teppich mit einer breiten blauen Kante bedeckt den größten Teil des Holzfußbodens. Auf einer Seite des Raums steht ein bequemer Drehstuhl aus rotbraunem Leder mit Kopfstütze und passendem Fußschemel, auf der anderen ein braunes Antikledersofa und ein kleines Tischchen, auf dem sich Bücher und Zeitschriften über Hypnotherapie stapeln.
Dieses letzte Detail ärgert mich, genau wie es mich ärgert, wenn ich beim Friseur einen Stapel Zeitschriften über Frisuren und nichts sonst finde. Es ist einfach zu aufdringlich. Muss ich mich wirklich derart intensiv mit haarigen Gedanken auseinandersetzen, während ich darauf warte, dass eine Jugendliche mit talgigem Teint meinen Kopf in ein Waschbecken rammt und kochendes Wasser darübergießt? Was ist, wenn ich gern etwas über den Aktienmarkt lesen würde oder das zeitgenössische Ballett? Zufälligerweise würde ich das nicht tun wollen, aber mein Einwand ist berechtigt.
Hypnotherapie ist zugegebenermaßen marginal interessanter als Spliss (obwohl ich fairerweise zugeben muss, dass meine vierteljährlichen Besuche im »Salon 32« mich immer wieder davon überzeugen, dass hier tatsächlich eine Dienstleistung erbracht wurde).
»Sie können sich die Bücher und Zeitschriften gerne ansehen«, sagt Ginny Saxon mit mehr Begeisterung, als gerechtfertigt ist. Sie spricht so, wie Medienleute sprechen. Ihr Akzent lässt sich nirgends verorten und verrät mir nicht, woher sie stammt. Nicht aus dem Culver Valley, wenn ich raten sollte. »Sie können sich gern so viele ausleihen, wie Sie wollen, wenn Sie sie wieder zurückbringen.« Entweder sie gibt sich viel Mühe mit ihrer Nummer, oder sie ist ein netter Mensch. Ich hoffe, sie ist nett. So nett, dass sie auch dann noch den Wunsch verspüren wird, mir zu helfen, wenn ihr klar geworden ist, dass ich nicht sonderlich nett bin.
Es ist anstrengend, ständig so zu tun, als wäre man ein besserer Mensch, als man eigentlich ist.
Ginny hält mir eine monatlich erscheinende Zeitschrift mit dem Titel Hypnotherapie hin. Mir bleibt nichts anderes übrig, als sie entgegenzunehmen. Die Zeitschrift klappt in der Mitte auf, ich lese eine Überschrift: »Hypnotherapeutische olfaktorische Konditionierung«. Was hatte ich erwartet? Die Frontalaufnahme einer hin- und herschwingenden Stoppuhr?
»Setzen Sie sich doch«, sagt Ginny und deutet auf den Drehstuhl mit der verstellbaren Rückenlehne samt Fußschemel. »Tut mir leid, dass Sie eine Stunde warten mussten.«
»Musste ich nicht«, teile ich ihr mit. »Ich bin Amber Hewerdine und habe einen Termin um drei. Die Frau dort draußen meinte, ich könne ihren Termin haben, sie würde nachher zurückkommen.«
Ginny lächelt. »Und das war alles?«
O Gott, bitte mach, dass sie nicht unser ganzes Gespräch mitangehört hat. Wie dick sind diese Holzwände? Wie laut waren wir?
»Ich habe nichts gehört, keine Sorge. Aber nach dem wenigen zu urteilen, das ich von dieser Frau weiß, nehme ich an, dass sie noch mehr gesagt hat als das, was Sie eben wiedergegeben haben.«
Keine Sorge? Was zum Teufel soll denn das bedeuten? Gestern Abend hatte ich Luke gefragt, ob er glaube, dass nur Leute sich als Hypnotherapeuten ausbilden lassen, denen es Spaß macht, das Gehirn anderer Leute zu manipulieren, und er lachte. »Gott helfe jedem, der das bei dir versuchen sollte.«
»Ihre genauen Worte lauteten: Entweder ich komme um vier zurück – oder auch nicht«, erzähle ich Ginny.
»Und Sie kamen sich vor wie eine Idiotin, weil Sie geblieben sind, oder? Entspannen Sie sich. Die Idiotin ist sie. Ich glaube nicht, dass sie wiederkommen wird. Letzte Woche hat sie sich auch schon gedrückt – sie hatte sich für ein Erstgespräch angemeldet und ist nicht aufgetaucht. Da sie den Termin nicht abgesagt hatte, habe ich ihr den vollen Betrag berechnet.«
Sollte sie mir das alles erzählen? Ist das nicht unprofessionell? Wird sie beim nächsten Klienten über mich herziehen?
»Warum erzählen Sie mir nicht, warum Sie hier sind?« Ginny öffnet den Reißverschluss ihrer knöchelhohen Stiefel, kickt sie von den Füßen und macht es sich auf dem Ledersofa gemütlich. Soll ich mich dadurch weniger gehemmt fühlen? Es funktioniert nicht, im Gegenteil, es irritiert mich. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Sie ist doch angeblich eine professionelle Therapeutin. Was wird sie zum zweiten Termin tragen – Mieder und Schlüpfer?
Aber das spielt keine Rolle, denn es wird keinen zweiten Termin geben.
»Ich leide unter Schlaflosigkeit«, sage ich. »Richtig.«
»Das zwingt mich zu der Frage: Wie leidet man unrichtig unter Schlaflosigkeit?«
»Wenn man Einschlafprobleme hat, dann aber acht Stunden fest durchschläft. Oder sofort einschläft, aber zu früh aufwacht – um vier statt um sieben. Es gibt Leute, die jammern: ›Ich kann nicht schlafen‹, und sie meinen damit, dass sie nachts zwei- oder dreimal aufwachen, weil sie auf die Toilette müssen – sie haben kein Schlafproblem, sondern eins mit der Blase.«
»Sie sprechen von Leuten, die ›leichten Schlaf‹ meinen, wenn sie ›Schlaflosigkeit‹ sagen?«, fasst Ginny zusammen. »Die von jedem kleinen Geräusch geweckt werden? Oder die nur mit Kopfhörer und Musik einschlafen können oder wenn das Radio läuft?«
Ich nicke und versuche, mich nicht davon beeindrucken zu lassen, dass sie alle Leute zu kennen scheint, die ich hasse. »Das sind die ärgerlichsten der Pseudo-Schlaflosen. Wenn jemand sagt, ›Ich kann nur schlafen, wenn …‹, leidet er nicht unter Schlaflosigkeit.«
»Hegen Sie einen Groll gegen Menschen, die gut schlafen?«, fragt Ginny.
»Nicht, wenn sie es zugeben.« Vielleicht bin ich zu erschöpft, um nett zu sein, aber ich würde gern glauben können, dass mein Verstand trotzdem noch funktioniert. »Ich habe nur etwas gegen Leute, die kein Problem haben, aber so tun, als hätten sie eins.«
»Leute, die von sich sagen: ›Ich schlafe wie ein Murmeltier, mich kann nichts aufwecken‹, sind also in Ordnung?«
Versucht sie, mir eine Fangfrage zu stellen? Ich bin versucht, ihr eine Lüge aufzutischen, aber warum sollte ich? Die Frau muss mich nicht mögen. Sie muss versuchen, mir zu helfen, ob sie mich mag oder nicht, dazu ist sie verpflichtet. Dafür bezahle ich sie. »Nein, die sind unerträglich selbstgefällig«, erkläre ich.
»Aber wenn es wahr ist, wenn sie tatsächlich schlafen wie die Murmeltiere, warum sollten sie das dann nicht sagen?«
Wenn sie noch mal von Murmeltieren spricht, gehe ich. »Es gibt schließlich verschiedene Möglichkeiten, jemandem mitzuteilen, dass man immer gut schläft.« Ich bin den Tränen gefährlich nahe. »Zum Beispiel, indem man darauf hinweist, dass man zwar gut schlafen kann, aber dafür jede Menge anderer Probleme hat. Schließlich hat jeder irgendwelche Probleme, oder?«
»Natürlich«, bestätigt Ginny, die aussieht, als hätte sie sich in ihrem ganzen Leben noch nie über irgendwas Sorgen gemacht. Ich starre an ihr vorbei. Hinter dem Ledersofa, auf dem sie sitzt, sind zwei große Fenster. Ginnys Garten ist ein langer, schmaler Grünstreifen. Am hinteren Ende kann ich einen braunen Fleck erkennen, einen Holzzaun, und dahinter Felder, die grüner und vielversprechender aussehen als die auf der anderen Seite der Straße. Wenn ich hier wohnte, würde ich mir Sorgen machen, dass irgendein Bauunternehmer das Land aufkaufen und so viele Häuser daraufstellen würde wie irgend möglich.
»Erzählen Sie mir von Ihren Schlafproblemen«, sagt Ginny. »Nach diesem Auftakt erwarte ich eine wahre Schreckensgeschichte. Unter der Armlehne ist ein Holzhebel, falls Sie den Stuhl zurückstellen möchten.«
Ich will mich nicht zurücklehnen, aber ich tue es trotzdem und stelle meine Füße auf den Schemel, sodass ich mich in beinahe liegender Position befinde. Es ist leichter, wenn ich ihr Gesicht nicht sehen kann, wenn ich mir einreden kann, dass ich mit einer Stimme vom Band spreche.
»Also. Niemand auf der Welt leidet schlimmer unter Schlaflosigkeit als Sie?«
Macht sie sich über mich lustig? Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass ich mich noch keineswegs in Trance befinde. Wann will sie denn endlich anfangen? Wir haben schließlich kaum eine Stunde Zeit.
»Nein«, entgegne ich steif. »Ich bin besser dran als viele Menschen, die überhaupt nicht schlafen können. Ich schlafe nachts immer mal wieder eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten. Und immer abends vor dem Fernseher. Das ist normalerweise der beste Schlaf, den ich kriege, so zwischen halb neun und halb zehn abends, oft eine ganze Stunde, wenn ich Glück habe.«
»Ein Mensch, der nie schläft, würde sterben«, sagt Ginny. Das verwirrt mich, bis ich begreife, dass sie über die Menschen redet, die ich eben in einem Nebensatz erwähnt habe, diejenigen, die weniger Glück haben als ich.
»Es gibt Menschen, die daran sterben«, entgegne ich. »Leute mit LFI.«
Ich spüre, wie sie darauf wartet, dass ich fortfahre.
»Letale familiäre Insomnie. Das ist eine Erbkrankheit. Nicht lustig. Absolute Schlaflosigkeit, Panikanfälle, Phobien, Halluzinationen, Demenz, Tod.«
»Fahren Sie fort.«
Ist die Frau eine Idiotin? »Das war’s«, entgegne ich. »Tod ist der letzte Punkt auf der Liste. Danach kommt normalerweise nicht mehr viel. Wäre ja eine Erleichterung, wenn man nur nicht zu tot wäre, um es würdigen zu können.«
Als sie nicht lacht, beschließe ich, noch düsterere Töne anzuschlagen. »Für manche Leute ist es natürlich ein zusätzlicher Bonus, dass ihre ganze Familie ebenfalls stirbt.« Ich warte auf ihre Reaktion. Ein leises Glucksen würde mir schon reichen. Ist sie so selbstsicher, dass sie meine Bemerkung einfach übergehen, einen Witz einen Witz sein lassen kann?
»Haben Sie den Wunsch, dass Ihre Familie stirbt?«
Vorhersagbar enttäuschend. Enttäuschend vorhersagbar.
»Nein. Das ist nicht das, was ich gesagt habe.«
»Haben Sie schon immer unter Schlafstörungen gelitten?«
Ein rascher und eleganter Themenwechsel, mit dem ich mich nicht wohl fühle. »Nein.«
»Wann hat es angefangen?«
»Vor anderthalb Jahren.« Ich könnte ihr das genaue Datum nennen.
»Wissen Sie, warum Sie nicht schlafen können?«
»Stress. Bei der Arbeit und zu Hause.« Ich formuliere es so unbestimmt wie möglich und hoffe, dass sie nicht nach Einzelheiten fragen wird.
»Und wenn eine gute Fee ihren Zauberstab schwenken und die Ursachen dieses Stresses beseitigen würde …?«
Ist das eine Fangfrage? »Dann würde ich gut schlafen können«, sage ich. »Früher habe ich immer gut geschlafen.«
»Das ist gut. Ihre Schlaflosigkeit hat also äußere Ursachen, nicht innere. Es ist nicht so, dass Sie, wegen etwas in Ihnen selbst nicht schlafen können. Sie können nicht schlafen, weil Ihre gegenwärtige Lebenssituation Sie unter unerträglichen Druck setzt. Jeder in Ihrer Lage würde es schwierig finden zu schlafen, richtig?«
»Ich glaube schon.«
»Das ist noch besser. Das ist die Art Schlaflosigkeit, die man haben möchte.« Ich kann hören, wie sie mich anstrahlt. Wie ist das möglich? »Nicht mit Ihnen stimmt etwas nicht. Ihre Reaktion ist absolut normal und verständlich. Können Sie Ihre Lebenssituation so verändern, dass die Stressquellen ausgeschaltet werden?«
»Nein. Hören Sie, aber … dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen, glauben Sie mir. All die Nächte, in denen ich wachgelegen und darüber nachgegrübelt habe, was alles nicht stimmt …« Jetzt nicht emotional werden. Betrachte es als Business-Meeting – du bist eine unzufriedene Kundin. »Ich kann die Stressquellen nicht aus meinem Leben entfernen. Sie sind mein Leben. Ich hatte gehofft, mit der Hypnotherapie könnte ich …« Ich kann nicht aussprechen, was ich eigentlich sagen wollte. Es würde lächerlich klingen, wenn ich es in Worte fasste.
»Sie hatten gehofft, ich könnte Ihr Gehirn täuschen«, fasst Ginny zusammen. »Sie wissen, und Ihr Gehirn weiß, dass es gute Gründe gibt, sich zu fürchten, aber Sie hatten gehofft, die Hypnose könne es dazu bringen zu glauben, dass alles in schönster Ordnung ist.« Also jetzt macht sie sich bestimmt über mich lustig.
»Wenn Sie das für eine so lächerliche Idee halten, warum haben Sie sich dann für diesen Beruf entschieden?«, sage ich kurz angebunden.
Sie sagt etwas, das klingt wie: »Versuchen wir es mit dem Baumschüttler.«
»Was?«
Ich muss beunruhigt geklungen haben. »Vertrauen Sie mir«, sagt Ginny. »Es ist nur eine Übung.«
Sie wird sich damit zufriedengeben müssen, dass ich ohne weitere Diskussionen nachgebe. Vertrauen ist ein zu kostbares Gut, um es jemandem abzuverlangen, den man kaum kennt.
»Vielleicht verspüren Sie den Wunsch, die Augen zu schließen – das macht es einfacher.«
Darauf würde ich nicht wetten.
»Es wird Sie vielleicht erleichtern, dass Sie so gut wie gar nicht sprechen müssen. Meistens werden Sie nur zuhören und zulassen, dass Erinnerungen an die Oberfläche kommen.«
Das klingt ziemlich einfach. Obwohl das »so gut wie gar nicht« erahnen lässt, dass ich irgendwann etwas werde sagen müssen. Aber was? Ich würde mich gern gedanklich darauf vorbereiten.
Als Ginny erneut das Wort ergreift, hätte ich fast gelacht. Sie spricht langsamer und eine Spur tiefer, trance-ähnlicher, ganz so wie die Karikatur eines Hypnotiseurs, die ich im Kopf hatte: »Sie fallen in einen tiefen, tiefen Schlaf.« Das ist es nicht, was Ginny sagt, aber allzu weit davon entfernt ist es auch nicht. »Ich möchte Sie einladen, sich auf Ihre Atmung zu konzentrieren«, intoniert sie, »und auf Ihren Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt entspannt sich.«
Warum tut sie das? Sie muss doch wissen, dass sie sich anhört wie ein Klischee. Wäre es nicht besser, wenn sie einfach normal weiterreden würde?
»Wandern Sie zur Stirn – die Stirn entspannt sich. Die Nase entspannt sich – Ihre Atmung fließt ruhig und regelmäßig, ruhig und regelmäßig – die Nase entspannt sich. Der Mund entspannt sich.«
Und was ist mit dem Teil zwischen Nase und Mund, wie immer er auch heißen mag? Was ist, wenn dieser Teil starr vor Anspannung ist? Den hat sie ausgelassen.
Es ist hoffnungslos. Ich kann das nicht. Ich wusste es ja.
Ginny ist bei meinen Schultern angelangt. »Sie spüren, wie die Schultern sinken und sich entspannen, wie die ganze Spannung dahinschmilzt. Ihre Atmung fließt ruhig und regelmäßig, ruhig und regelmäßig. Lassen Sie allen Stress und alle Anspannung los. Und nun wandern Sie zum Brustkorb, zu den Lungen – Brust und Lungen entspannen sich. So etwas wie ein Hypnose-Gefühl gibt es nicht, nur ein Gefühl wohliger, tiefer Ruhe und Entspannung.«
Ach ja? Warum bezahle ich dann siebzig Pfund dafür? Wenn ich mich nur entspannen müsste, könnte ich das auch zu Hause tun.
Nein, korrigiere ich mich. Könnte ich nicht. Kann ich nicht.
»Tiefe, wohlige Ruhe – und Entspannung. Wandern Sie zu Ihrem Bauch – der Bauch entspannt sich.«
Septum. Nein, das ist die Scheidewand zwischen den Nasenlöchern. Ich wusste mal, wie diese kleine Einkerbung zwischen Nase und Oberlippe heißt. Philtrum – genau, so heißt es, das ist der medizinische Fachbegriff. Jetzt, wo es mir eingefallen ist, sehe ich praktisch Luke vor mir, der es triumphierend verkündet. Ein Quiz. Eine dieser Wissensfragen, die er immer direkt beantworten kann und bei denen ich immer hoffnungslos aufgeschmissen bin.
Ich zwinge mich dazu, mich auf Ginnys leiernde Stimme zu konzentrieren. Ist sie schon bei meinen Zehen angelangt? Ich habe nicht zugehört. Sie könnte Zeit sparen, wenn sie alle Körperteile gemeinsam ansprechen würde und gleich den ganzen Körper auffordern würde, sich zu entspannen. Ich versuche, gleichmäßig zu atmen und meine Ungeduld zu zügeln.
»Manche fühlen sich ganz leicht, fast wie eine Feder«, sagt sie gerade. »Andere spüren, wie ihre Glieder immer schwerer werden, als könnten sie sich nicht bewegen, selbst wenn sie es wollten.«
Sie hört sich an wie die Moderatorin einer Kindersendung, sie lässt ihre Stimme »leicht« oder »schwer« werden, so wie es zu ihren Worten passt. Hat sie je probiert, etwas ausdrucksloser zu sprechen? »Wieder andere spüren eher ein Kribbeln in den Fingern. Aber alle fühlen eine wohlige, herrlich tiefe Ruhe und Entspannung.«
Meine Finger kribbeln ziemlich stark. Das taten sie schon, bevor sie das mit dem Kribbeln erwähnte. Bedeutet das, dass ich jetzt hypnotisiert bin? Ich fühle mich nicht entspannt, aber ich bin mir vermutlich der surrenden Neurosen in meinem Kopf stärker bewusst als vorher. Es ist, als wären sie und ich gemeinsam in einer dunklen Kiste eingesperrt, einer Kiste, die sich vom Rest der Welt losgelöst hat und davonschwebt. Ist das gut so? Aber wie könnte das gut sein?
»Und nun, während sie weiter ruhig und regelmäßig atmen, ganz ruhig und regelmäßig, stellen Sie sich bitte die schönste Treppe der Welt vor.«
Wie bitte? Damit überfällt sie mich ohne jede Vorwarnung? Ein Dutzend erstrebenswerter Treppen drängen sich in meinen Kopf und beginnen einen heftigen Wettstreit. Vielleicht eine Wendeltreppe mit schmiedeeisernem Geländer? Oder diese offenen Treppen, die aussehen, als schwebten sie in der Luft, mit Glas- oder Stahlgeländer – schön modern, klare Linien. Andererseits auch ein bisschen seelenlos, erinnern zu sehr an ein Bürogebäude.
»Ihre perfekte Treppe hat zehn Stufen«, fährt Ginny fort. »Ich werde Sie jetzt diese Treppe hinuntergeleiten, eine Stufe nach der anderen …«
Moment mal. Ich bin noch nicht bereit, irgendwo hinzugehen. Ich habe meine Treppe noch nicht ausgewählt. Ganz traditionell ist vermutlich das Beste: dunkles Holz, mit Treppenläufern auf den Stufen. Vielleicht irgendwas Gestreiftes …
»Schritt für Schritt gehen Sie jetzt weiter und tiefer in Ruhe und Entspannung hinein, Stufe für Stufe, immer weiter und immer tiefer in Ruhe und Entspannung hinein …«
Wie kann sie so schnell vorpreschen, obwohl sie einschläfernd langsam spricht?
Was ist mit Stein? Das ist ebenso traditionell und imposanter als Holz, wenngleich auch kälter. Aber wenn man die Stufen mit Teppich auslegt …
Ginny ist mir mittlerweile weit voraus, aber das ist mir egal. Ich bin fest entschlossen, mir alle Zeit zu nehmen, die ich brauche, um meine Treppe zu entwerfen – eine Abkürzung des Verfahrens, um dann mit einem Satz die Treppe hinunterzuspringen. Solange ich gleichzeitig mit ihr unten ankomme, ist das wohl egal.
»Und jetzt machen Sie den letzten Schritt und sind an einem Ort wohliger Ruhe und vollkommenen Friedens angekommen. Sie sind völlig entspannt. Und jetzt möchte ich, dass Sie in die Zeit zurückkehren, als Sie ein kleines Kind waren und die Welt noch ganz neu für Sie war. Erinnern Sie sich an einen Augenblick, in dem Sie Freude empfanden, eine so intensive Freude, dass Sie hätten explodieren können.«
Das verwirrt mich jetzt. Was ist mit der Treppe passiert? War das nur ein Kunstgriff, um mich zu dem ruhigen, entspannten Ort zu bringen? Schon habe ich meine Chance vertan, eine freudige Erinnerung hervorzukramen. Ginny ist bereits weiter und befiehlt mir – sofern man eine derart einschläfernd vorgebrachte Aufforderung als Befehl bezeichnen kann –, mich an eine Gelegenheit zu erinnern, bei der ich entsetzlich traurig war, so traurig, als würde mir das Herz brechen. Traurig, traurig, denke ich, und habe Sorge, noch weiter zurückzufallen. Sie ist schon wieder einen Schritt weiter und ist bei wütend angekommen – weißglühend, kochend vor Zorn –, und mir fällt einfach nichts ein. Ich werde auch noch Punkt drei verpassen. Ich könnte ebenso gut gleich aufgeben.
Während sie von Angst (»Ihr Herz hämmert, während Ihnen der Boden unter den Füßen wegzubrechen scheint«) zu Einsamkeit übergeht (»Wie ein kaltes Vakuum um Sie herum und in Ihnen, das Sie von allen anderen Menschen trennt«), überlege ich, wie oft sie diese Routine wohl schon abgespult hat. Ihre Beschreibungen sind ziemlich ausdrucksvoll – vielleicht ein bisschen zu sehr. Meine Kindheit war nicht sonderlich dramatisch. Es gab damals oder in meinen Erinnerungen an die Zeit nichts, was den extremen Seelenzuständen entsprechen würde, die sie beschreibt. Ich war ein glückliches Kind, ich fühlte mich geliebt und sicher. Mir brach das Herz, als meine Eltern im Abstand von zwei Jahren starben, aber zu dem Zeitpunkt war ich bereits Anfang zwanzig. Soll ich Ginny fragen, ob ersatzweise auch eine Erinnerung aus dem frühen Erwachsenenalter ginge? Sie sprach ausdrücklich von der frühen Kindheit, aber eine spätere Erinnerung ist sicher besser als gar keine.
»Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie würden ertrinken. Wohin Sie sich auch wenden, überall ist Wasser, es strömt Ihnen in Nase und Mund. Sie können nicht mehr atmen. Was für eine Erinnerung löst das bei Ihnen aus?«
Mein Philtrum würde ganz nass werden. Bedauere, mehr habe ich nicht zu bieten. Was will Ginny hier aufdecken? Ich bin mit den Gedanken nicht mehr bei Gefühlen, sondern bei U-Boot-Katastrophenfilmen.
Als sie mich auffordert, mir vorzustellen, dass ich mich in einem brennenden Haus befinde, von den Flammen gefangen, fühle ich mich ganz krank im Magen. Jeder Wohlfühlfaktor fehlt hier so eindeutig, dass ich nur beten kann, dass ich am Ende der Sitzung einen Auswertungsbogen in die Hand gedrückt bekomme, auf dem ich meine Einwände schriftlich niederlegen kann.
Ich will das nicht mehr.
»Gut, ganz wunderbar«, sagt Ginny. »Sie machen das großartig.« Ich höre, wie ihr Tonfall sich leicht verschärft, und weiß, der Augenblick für die Publikumsbeteiligung ist gekommen. »Jetzt möchte ich gern, dass Sie eine Erinnerung aufsteigen lassen und sie mir erzählen. Irgendeine beliebige Erinnerung aus irgendeiner Zeit Ihres Lebens. Analysieren Sie sie nicht. Es braucht nichts Bedeutsames sein. An was erinnern Sie sich, jetzt, in diesem Moment?«
Sharon. Aber das kann ich nicht sagen. Falls ich sie nicht missverstanden habe, möchte Ginny etwas Neues von mir hören, keine Überbleibsel aus der letzten Übung.
»Versuchen Sie nicht, etwas besonders Gutes auszuwählen«, sagt sie mit ihrer normalen Stimme. »Alles ist in Ordnung.«
Schön. Gut zu wissen, wie wenig wichtig das alles hier ist.
Nicht Sharon und ihr brennendes Haus. Es sei denn, du willst hier zusammenbrechen.
Dann also Little Orchard. Die Geschichte von meinen verschwundenen Familienmitgliedern. Kein Todesfall, keine Tragödie, nur ein Rätsel, das nie gelöst wurde. Ich mache den Mund auf, aber dann fällt mir ein, dass Ginny betont hat, ich solle nicht extra nach irgendwas suchen. Little Orchard ist zu auffällig, zu aufsehenerregend. Sie wird mir nicht glauben, dass diese Erinnerung eben erst aufgetaucht ist, und das mit Recht. Sie ist ständig in meinem Kopf. Ich grüble ununterbrochen darüber nach, obwohl es schon Jahre her ist. Auf diese Weise habe ich etwas zu tun, wenn ich nachts wachliege und ich mir bereits über jeden anderen Aspekt meines Lebens Sorgen gemacht habe.
»An was erinnern Sie sich?«, fragt Ginny. »Jetzt, in diesem Augenblick.«
Oh Gott, das ist ein Albtraum. Was soll ich bloß sagen? Egal, einfach irgendwas.
»Lieb. Grausam. Liebgrausam.«
Was soll das denn bedeuten?
»Könnten Sie das wiederholen?«, bittet Ginny.
Das ist wirklich seltsam. Was ist da gerade passiert? Ginny hat irgendwas Merkwürdiges gesagt, aber warum fordert sie mich auf, es zu wiederholen? Ich war mit der Aufmerksamkeit abgeschweift, ich muss für eine Sekunde zu Little Orchard zurückgekehrt sein, oder zu Sharon …
»Könnten Sie das noch einmal wiederholen?«
»Lieb. Grausam. Liebgrausam«, sage ich, unsicher, ob ich es richtig hinbekommen habe. »Was soll das bedeuten?« Ist es ein Zauberspruch, der entwickelt wurde, um widerspenstige Erinnerungen ans Licht zu zerren?
»Sagen Sie es mir«, entgegnet Ginny.
»Wie sollte ich? Sie haben das doch gesagt.«
»Nein, habe ich nicht. Sie haben es gesagt.«
Eine längere Pause entsteht. Warum befinde ich mich noch in liegender Position, warum sind meine Augen geschlossen? Ich sollte mich aufsetzen und darauf bestehen, dass diese fremde Frau aufhört, Lügen über mich zu erzählen.
»Nein, das waren Sie«, fahre ich sie verärgert an, da sie die Wahrheit doch ebenso gut kennen muss wie ich. »Und dann haben Sie mich gebeten, es zu wiederholen.«
»Schon gut, Amber, ich zähle jetzt bis fünf, um Sie aus der Trance zu führen. Wenn ich bei fünf angelangt bin, öffnen Sie bitte die Augen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf.«
Es ist seltsam, den Raum wieder zu sehen. Ich ziehe an dem Hebel unter der Armlehne des Stuhls und sitze wieder aufrecht. Ginny starrt mich an, ohne zu lächeln. Sie wirkt beunruhigt.
»Ich habe das nicht gesagt«, beharre ich. »Das waren Sie.«
*
Ich habe es so eilig, von hier wegzukommen, dass ich fast mit der Frau mit dem roten Lippenstift zusammenstoße. »Na, alles besser?«, fragt sie. Ihr Anblick schockt mich, warum, begreife ich zunächst gar nicht. Wie ist es möglich, dass ich sie so vollständig aus meinem Kopf gelöscht habe? Ich hätte mir denken können, dass sie möglicherweise vor der Tür warten würde. Mein Gehirn funktioniert nicht mit der üblichen Geschwindigkeit, und ich weiß nicht, ob es an der Müdigkeit liegt oder ob das die Nachwirkungen der Hypnose sind.
Ihr Notizbuch. Das hast du vergessen. Du hast gesehen, wie sie irgendwas in ihr Notizbuch schrieb. Was hat sie sich notiert?
Ich versuche angestrengt, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. So reagiere ich immer, wenn das Unerwartete mich aus dem Hinterhalt überfällt.
Es funktioniert nicht.
Warum sollte Ginny Saxon behaupten, ich hätte irgendwas gesagt, was ich gar nicht gesagt habe? Vor dem heutigen Tag kannte sie mich noch nicht einmal, sie hat nichts zu gewinnen, wenn sie mich anlügt. Wieso kommt mir dieser Gedanke erst jetzt?
Ich sollte etwas sagen. Die Frau mit dem roten Lippenstift hat mich etwas gefragt. Na, alles besser? Seit unserer letzten Begegnung vor einer Stunde hat sich ihre Bitterkeit in gutmütige Resignation verwandelt. Sie glaubt nicht daran, dass Ginny in der Lage ist, eine von uns beiden zu heilen, aber in dieser Farce mitspielen, müssen wir trotzdem. Ich starre auf unsere Atemwolken in der Luft und stelle mir vor, dass sie eine undurchdringliche Barriere darstellen, undurchdringbar für Worte und Verständnis. Ich kann nicht sprechen. Der Tag geht bereits zur Neige. Die Felder sehen aus wie flache dunkle Tücher, die neben der leeren Straße ausgebreitet wurden. Der Anblick erinnert mich an den Zauberer, den wir zu Nonies siebtem Geburtstag engagiert hatten, und das schwarze Satintuch, das er über sein kleines Tischchen breitete.
Was ist bloß los mit mir? Wie lange schweige ich jetzt schon? Meine Gedanken bewegen sich entweder zu schnell oder unerträglich langsam.
Ihre Hände, rot angelaufen vor Kälte, schwarze Wollhandschuhe auf dem Beifahrersitz neben ihr, ein Notizbuch auf ihrem Schoß, Worte auf der aufgeschlagenen Seite …
Ich widerstehe dem Drang, in die Wärme von Ginnys Holzhöhle zurückzuflüchten und um Gnade zu bitten. Ich bin zu ihr gekommen, damit sie mir hilft – und ich brauche immer noch Hilfe. Wie konnte das alles damit enden, dass ich sie als Lügnerin bezeichnete, mich weigerte zu bezahlen und wutentbrannt aus der Praxis gestürmt bin?
Lieb – Grausam – Liebgrausam.
»Vor einer Stunde konnten Sie noch sprechen, jetzt nicht mehr«, bemerkt die Frau mit dem roten Lippenstift. »Was hat sie da drin mit Ihnen gemacht? Blinzeln Sie, wenn Sie antworten wollen – zweimal bedeutet ja, einmal nein. Hat sie Sie darauf programmiert, ein Attentat auf ihre politischen Feinde zu verüben?«
Ich kann unmöglich fragen. Ich muss. Mir bleiben vielleicht nur wenige Sekunden, bevor Ginny sie hereinruft. »Ihr Notizbuch«, sage ich. »Das Sie vorhin in der Hand hielten, als Sie im Auto saßen. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber … haben Sie ein Gedicht geschrieben?«
Sie lacht. »Nein. Nichts derartig Ambitioniertes. Warum?«
Wenn es kein Gedicht war, warum dann die kurzen Zeilen?
Lieb
Grausam
Liebgrausam
»Wie hieß dieser Typ noch mal, der ein ganzes Buch diktiert hat, indem er mit dem linken Augenlid blinzelte?«, fragt sie und blickt über die Schulter zur Straße, als stünde dort jemand, der die Antwort kennen könnte. Sie will nicht über das reden, worüber ich reden will. Warum sollte sie auch, es ist ihr privates Notizbuch.
»›Lieb – Grausam – Liebgrausam‹. War es das, was Sie geschrieben haben? Ich bitte Sie gar nicht darum, mir zu verraten, was es bedeutet …«
»Ich weiß nicht, was es bedeutet«, sagt sie. Sie langt in ihre Handtasche und nimmt ein Päckchen Marlboro Lights und ein silbernes Feuerzeug heraus. »Abgesehen vom Offensichtlichen, lieb bedeutet lieb, grausam bedeutet grausam.«
»Ist es möglich, dass ich diese Worte in Ihrem Notizbuch gesehen habe?« Gibt dir irgendwas das Recht, ihr diese Frage zu stellen?
Ich warte, während sie sich eine Zigarette anzündet. Sie macht zwei tiefe Züge, kostet jeden aus: eine Werbung für die schlechte Angewohnheit, von der sie kuriert zu werden hofft. Auch wenn ich vermutlich nicht einfach davon ausgehen sollte, dass sie deshalb hier ist.
Man sollte nichts einfach annehmen. Insbesondere nicht, dass man im Recht ist und der Mensch, der einem zu helfen versucht, ein Lügner ist.
Warum habe ich bloß das Gefühl, dass sie Zeit schindet? »Nein, Sie hätten diese Worte nicht in meinem Notizbuch sehen können«, erwidert sie endlich. »Vielleicht war es irgendwo anders. Da wir gerade dabei sind, aufdringliche Fragen zu stellen, wie heißen Sie?«
»Amber. Amber Hewerdine.«
»Bauby«, verkündet sie zu meiner Verblüffung. »So hieß er – der Blinzel-Autor.«
Ich werde weiterfragen – ich kann nicht anders. »Sind Sie sicher? Vielleicht ist es schon eine Weile her, dass Sie es geschrieben haben, oder …« Oder es steht in Ihrem Notizbuch, ohne dass Sie etwas davon wissen, weil ein anderer es dort hineingeschrieben hat. Das sage ich dann doch nicht, weil es verrückt ist – noch verrückter als die Vorstellung, Ginny könne in ihrer Gartenpraxis im Culver Valley angehenden Attentätern eine Gehirnwäsche verpassen. Ich habe im Moment keinerlei Vertrauen in mein Urteilsvermögen, jeder Gedanke muss erst durch einen Normalitäts- und Plausibilitätsfilter laufen. Erkundige dich nicht, ob sie ihr Notizbuch vielleicht mit jemandem teilt. Niemand teilt sein Notizbuch.
Am besten ist es vermutlich, wenn ich so ehrlich wie möglich bin. »Ich erinnere mich, diese Worte irgendwo gesehen zu haben.« So wie du dich daran erinnerst, dass Ginny sie gesagt und dich dann gebeten hat, sie zu wiederholen? »Es war angeordnet wie eine Liste. ›Lieb‹ stand oben, dann ein paar freie Zeilen, dann darunter ›Grausam‹ und noch ein paar Zeilen tiefer ›Liebgrausam‹.«
Sie schüttelt den Kopf, und ich würde am liebsten schreien. Kann ich an einem Tag zwei Menschen der Lüge bezichtigen, oder ist das unangemessen? Mir kommt der Gedanke viel zu spät, dass ich ihr vielleicht sagen sollte, warum ich danach frage. Vielleicht ist sie dann eher bereit zu reden. »Ich will meine Nase nicht in Dinge stecken, die mich nichts angehen«, setze ich an.
»Aber das tun Sie.«
»Ich bin noch nie vorher hypnotisiert worden.« Erst, als ich es ausspreche, merke ich, wie jämmerlich das klingt. Sie zuckt leicht zusammen. Klasse. Jetzt habe ich dafür gesorgt, dass ich uns beiden peinlich bin. »Ich versuche nur herauszufinden, ob mein Gedächtnis noch richtig funktioniert, das ist alles.«
»Und wir haben jetzt geklärt, dass dem nicht so ist«, sagt sie. Warum beunruhigt sie dieses Gespräch nicht stärker? Ich weiß, wie seltsam ich mich aufführe, zumindest glaube ich, dass ich es weiß, aber ihre sachlichen Antworten bringen mich dazu, es anzuzweifeln.
Lieb – Grausam – Liebgrausam. Ich kann die Worte vor mir sehen, das Blatt Papier, auf dem sie stehen, und mehr noch, ich habe ein ebenso deutliches Bild von mir selbst, wie ich daraufblicke. Ich gehöre ebenso zu dieser Erinnerung wie die Worte, ich bin Teil der Szene. Genau wie diese Frau, wie ihr Notizbuch, ihre Zigarette …
»Sie beschreiben liniertes Papier«, sagt sie.
Ich nicke. Blassblaue waagerechte Linien und eine senkrechte rosa Linie links, zur Markierung des Rands.
»Die Seiten in meinem Notizbuch sind nicht liniert.«
Womit die Sache geklärt sein sollte. Sie schaut mich an, als wüsste sie, dass es nicht so ist.
Wenn nicht Ginny diese Worte ausgesprochen und mich dann gebeten hat, sie zu wiederholen, wenn ich sie nicht im Notizbuch der Frau gesehen habe …
Aber das habe ich. Ich weiß es. Dass ich mich bei Ginny getäuscht habe, heißt noch lange nicht, dass ich hiermit auch falschliege.
»Dürfte ich es mal sehen?«, frage ich. »Bitte. Ich werde auch nichts lesen. Ich bin nur …« Nur was? Zu blöd und zu stur, um ihr zu glauben, ohne es mit eigenen Augen gesehen zu haben? Warum ist mir bloß völlig egal, wie unerhört ich mich aufführe? Ich kann damit nicht weitermachen, dazu habe ich keinerlei Recht. »Zeigen Sie mir einfach irgendeine Seite, und wenn die nicht liniert ist …«
»Die Seiten sind nicht liniert.« Sie wirft einen Blick auf die Uhr und weist mit dem Kopf in Richtung Garten. »Ich gehe besser rein. Mein Termin war vor mehr als zwei Stunden, und für Ihren Termin bin ich fünfundsechzig Minuten zu spät, auch wenn der Großteil dieser Verspätung nicht meine Schuld ist …« Sie zuckt die Achseln. »Ob Sie es glauben oder nicht, ich würde mich lieber weiter mit Ihnen unterhalten. Und vielleicht zeige ich Ihnen eines Tages mein Notizbuch, vielleicht sogar schon bald – aber nicht jetzt.« Sie wirft mir einen bedeutungsvollen Blick zu, als sie diese eigentümlichen Sätze sagt. Baggert sie mich an? Sie hätte jedes Recht, wütend auf mich zu sein. Es muss einen Grund dafür geben, dass sie es nicht ist.
Vielleicht sogar schon bald. Warum glaubt sie, dass wir uns wiedersehen werden? Das ergibt doch keinen Sinn.
Bevor ich nachfragen kann, geht sie an mir vorbei in Ginnys Garten. Als ihr nachschaue, merke ich, dass ich selbst etwas derartig Ambitioniertes lieber nicht versuchen sollte, also bleibe ich reglos stehen. Vielleicht sollte ich warten, bis sie in einer Stunde wieder herauskommt. Doch das geht nicht. Ich muss die Kinder abholen. Ich muss sofort los, sonst komme ich zu spät. Trotzdem rühre ich mich nicht von der Stelle, bis ein Klopfgeräusch mir Beine macht. In wenigen Sekunden wird Ginny die Tür zu ihrer Holzpraxis öffnen. Ich kann nicht zulassen, dass sie mich sieht, nicht, nachdem ich sie derartig angeschrien habe. Wenn es eins gibt, dessen ich mir vollkommen sicher bin, dann das: Ginny Saxon und ich dürfen nie wieder aufeinandertreffen. Ich werde ihr einen entschuldigenden Brief schicken, einen Scheck über siebzig Pfund beilegen und mir dann einen anderen Hypnotherapeuten suchen – bei mir in der Nähe, in Rawndesley, einen, in dessen Gegenwart ich mich nie aufgeführt habe wie ein unausstehliches Gör. Luke wird lachen und mich einen Feigling nennen, mit Recht. Zu meiner Verteidigung könnte ich anführen, dass Feiglinge, die sich entschuldigen und zahlen, immer noch die besten Feiglinge sind.
Wem will ich hier was vormachen? Ich werde Luke nicht erzählen, wie schlecht ich mich benommen habe.
Das tust du nie. Ich schiebe den Gedanken beiseite.
Als ich in meinem mittlerweile eiskalten Auto sitze, lege ich die Stirn aufs Lenkrad und stöhne. Ginny hätte mit mir streiten können, aber sie hat es nicht getan. Sie war bereit, auf das Honorar für die Sitzung zu verzichten, da ich offensichtlich überzeugend rübergebracht habe, wie enttäuscht ich von ihr war. Vielleicht sollte ich ihr einen Scheck über den doppelten Betrag schicken. Nein, das würde zu verzweifelt wirken. Warum nicht gleich mein Testament ändern und alles ihr hinterlassen, vorausgesetzt, sie verspricht mir, mich nicht für das größte Arschloch zu halten, das ihr je über den Weg gelaufen ist.
Es ist neun Minuten nach vier. Wenn ich sofort losfahre, schaffe ich es noch. Wenn ich noch zehn Minuten bleibe und den ganzen Weg nach Rawndesley gefährlich schnell fahre, auch. Und es wird keine zehn Minuten dauern, denn die Frau mit dem roten Lippenstift hat ihren Wagen ganz sicher abgeschlossen. Also sitze ich in dreißig Sekunden wieder in meinem Auto und kann nach Hause fahren.
Ich weiß nicht, was es bedeutet. Sie hat das gesagt, als würde es sie noch mehr frustrieren als mich, dass sie die Bedeutung der Worte nicht versteht. Und es schien ihr egal zu sein, dass ich das bemerken könnte. Warum also hat sie dann bestritten, es geschrieben zu haben?
Ohne mir zu erlauben, darüber nachzudenken, was ich tue, steige ich aus, überquere die Straße und gehe Ginnys Auffahrt hinauf, genau wie vor einer Stunde. Ich bin froh, dass es dunkel ist. Offensichtlich hat die Bezirksverwaltung von Culver Valley mehr Angst vor der Liga gegen Lichtverschmutzung als vor deren Gegnern mit ihren ständigen Petitionen für eine lückenlose Ausstattung aller Landstraßen mit Straßenlaternen. Rentner und junge Mädchen sollen schließlich die Räuber und Vergewaltiger sehen können, die auf sie lauern.
Alles wird gut, wenn die Rote-Lippenstift-Frau nicht vergessen hat, ihren Wagen abzuschließen. Dann werde ich daran gehindert, etwas Kriminelles und Verrücktes zu tun. Gegen welches Gesetz ich wohl damit verstoße?, überlege ich. Irgendwas wie Sachbeschädigung vermutlich. Einbruch kann es nicht sein, ich breche ja keine Schlösser auf. Hausfriedensbruch vielleicht?
Ich versuche es mit der Fahrertür. Sie geht auf. Augenblicklich fühle ich mich mehr wie eine Gesetzesbrecherin als jemals zuvor. Meine keuchenden Atemzüge hängen wie neblige Graffitis in der Luft, sichtbare Beweise dafür, dass ich an einem Ort bin, an dem ich nicht sein sollte.
Aber schließlich habe ich lediglich eine Autotür geöffnet. Ist das so furchtbar? Ich könnte sie einfach wieder zumachen und weggehen.
Und nie herausfinden, ob du diese Wörter tatsächlich dort gesehen hast, wo du glaubst, sie gesehen zu haben.
Was ist, wenn sie nicht in dem Notizbuch stehen? Werde ich dann wieder annehmen, dass sie von Ginny stammen – dass sie mich doch gebeten hat, sie zu wiederholen, um es dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen abzustreiten?
Das Notizbuch liegt aufgeklappt auf dem Beifahrersitz, neben den schwarzen Handschuhen. Meine Hände zittern, als ich hinüberlange und danach greife. Ich fange an, es durchzublättern. Es steht viel auf den Seiten, aber ich kann nur gelegentlich ein Wort erkennen. Der Himmel ist zu dunkel, fast so schwarz wie die mich umgebenden Felder. Im Auto ist es heller – das Licht ist angegangen, als ich die Tür geöffnet habe, aber das nützt mir nicht viel, solange ich nicht …
Nicht darüber nachdenken. Tu’s einfach.
Mit hämmerndem Herzen setze ich mich auf den Fahrersitz. Ich lasse die Autotür offen und meine Beine draußen in der Kälte, damit nur ein Teil meines Körpers etwas Unrechtes tut. Ich schlage das Notizbuch erneut auf. Erst kann ich mich nicht konzentrieren, weil mein aus der Kontrolle geratener Herzschlag meine Aufmerksamkeit auf sich zieht – es fühlt sich an, als würde mir gleich das Herz aus dem Mund springen. Wird man um siebzehn Uhr meine Leiche im Auto einer fremden Frau finden, gestorben an einem Herzinfarkt? Zumindest habe ich endlich meine posthypnotische Benommenheit abgeschüttelt – es geht doch nichts über ein wenig Gesetzesbrecherei, um aus der Trance herauszukommen.
Laut Ginny gibt es so etwas wie ein Hypnose-Gefühl nicht. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, sie könnte sich täuschen.
Als ich wieder ruhig genug bin, um mich konzentrieren zu können, stelle ich fest, dass das Notizbuch Briefe enthält. Falls man etwas ohne Anrede und Unterschrift einen Brief nennen kann. Was ich nicht glaube. Ich vermute, dass diese Tiraden nicht geschrieben wurden, um abgeschickt zu werden, sondern damit die Schreiberin sich besser fühlt. Jeder der Briefe ist mehrere Seiten lang und voller zorniger Anklagen. Ich fange an, den ersten zu lesen, höre aber nach ein paar Zeilen auf, als eine Welle der Angst mich durchläuft.
Was zum Teufel mache ich da? Ich bin nicht hier, um mich in die Bitterkeit einer Unbekannten zu vertiefen – ich muss das finden, wonach ich suche, und schleunigst wieder verschwinden. Nachdem ich einen flüchtigen Eindruck von der verbalen Wut bekommen habe, mit der die Rote-Lippenstift-Frau auf jeden einprügelt, der ihr in die Quere kommt, bin ich noch weniger versessen darauf, dabei ertappt zu werden, wie ich ihre Sachen durchwühle.
Rasch blättere ich die Seiten durch: Tirade, Tirade, Tirade, Einkaufsliste, Tirade … Nach einer Weile höre ich auf, auf den Inhalt zu achten. Auf all diesen Seiten steht viel zu viel. Ich suche eine Seite, auf der nur vier Worte stehen, mit viel Platz darum herum, eine fast leere Seite.
Was für ein Idiot bin ich eigentlich. Die Seiten sind nicht liniert. Warum ist mir das nicht sofort aufgefallen? Warum sitze ich immer noch hier? Kann Hypnotherapie einen bleibenden Hirnschaden hervorrufen?
Ich blättere weiter, obwohl es eher unwahrscheinlich ist, dass das Notizbuch in der Mitte plötzlich Linien entwickelt.
Gib auf.
Nur noch eine Seite.
Ich blättere um und habe gerade die Worte erblickt, als ich das Klicken einer sich öffnenden Tür höre. Oh nein, oh Gott, das kann nicht sein.
Ich bin gefangen in einem länglichen Lichtkegel. Die Frau, in deren Auto ich eingedrungen bin, kommt auf mich zumarschiert. Ich versuche zu überlegen, ob ich noch genug Zeit habe, auszusteigen und wegzurennen, bevor sie bei mir angekommen ist, bleibe dann aber, wo ich bin. Warum bin ich bloß ein so irres Risiko eingegangen? Wie konnte ich nur so dämlich sein? Dinah und Nonie werden um halb fünf aus dem Schulbus steigen, und ich werde nicht da sein, um sie abzuholen. Wo werde ich sein? In einer Arrestzelle? Mein Magen krampft sich schmerzhaft zusammen, ein Adrenalinschub treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Habe ich eine Panikattacke?
»Legen Sie mein Notizbuch hin und steigen Sie aus meinem Auto aus.« Ihre ruhige Effizienz erschreckt mich. Irgendetwas an der Situation stimmt nicht, und es ist nicht nur die Tatsache, dass ich ohne Erlaubnis in ihrem Auto sitze. Sie müsste verärgerter sein. Sie sollte in der Praxis sein. Warum ist sie herausgekommen? War es eine Falle? Vielleicht wusste sie, was ich vorhatte, noch bevor ich es selbst wusste. Kann es sein, dass sie ihr Auto absichtlich nicht abgeschlossen hat, um mir Gelegenheit zu geben, mich selbst zu belasten und sich die Gelegenheit, mich dabei zu ertappen?
Ginny Saxon steht in der Tür ihrer Holzpraxis und beobachtet uns. »Alles in Ordnung?«, ruft sie. Ich kann sie nicht ansehen. Ich starre auf das aufgeschlagene Notizbuch in meiner Hand.
Dann klappe ich es zu und reiche es seiner Eigentümerin.
»Gehen Sie nach Hause, Amber«, sagt sie müde, als wäre ich ein unartiges Kind, das nachsitzen musste und jetzt gehen darf. »Bleiben Sie dort. Zu den Erklärungen kommen wir später, einverstanden?«
Ich habe keine Ahnung, was sie meint, aber ich bin nur zu gern bereit, uns beiden das Leben einfacher zu machen, indem ich verschwinde – weg von ihr, weg von Ginny, weg von der Great Holling Road 77, dem Schauplatz derartig vieler grauenhaft demütigender Erfahrungen, dass ich freiwillig nie wieder hierher zurückkehren werde.
*
Als ich wieder in meinem Auto sitze, zwinge ich meinen Geist dazu, ganz leer zu werden. Wenn ich irgendetwas denke, dann: »Fahr, fahr, fahr.« Ich kann es gerade noch rechtzeitig schaffen, wenn ich wirklich rücksichtslos fahre. Als ich mich dem Crozier-Bridge-Kreisverkehr nähere, ordne ich mich auf der Spur ganz links ein, auf der einzigen Spur, die frei ist. Im Kreisverkehr wechsle ich auf die richtige Spur, womit ich ein wütendes Hupkonzert der anderen Autofahrer auslöse. Dasselbe ziehe ich bei drei weiteren Kreisverkehren durch und erspare mir dadurch fast zehn Minuten Wartezeit.
Du bist rücksichtslos, und zwar nicht nur heute. Versuch nicht, so zu tun, als wäre dir dieses Verhalten neu.
Die Hypnotherapie scheint die Stimme in meinem Kopf verstärkt zu haben, die ständig versucht, mir Schuldgefühle einzureden. Oder auch nicht. Jedenfalls hat sich meine Paranoia eindeutig verstärkt.
Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr.
Mein Herzschlag verlangsamt sich auf ein kontrollierbares Niveau, als ich sicher sein kann, dass ich doch noch rechtzeitig beim Schulbus sein werde. Ich habe ihn noch nie verpasst, kein einziges Mal, und ich bin fest entschlossen, es auch weiterhin so zu halten. Darüber muss ich mir also keine Sorgen mehr machen. Das Problem ist nur, jetzt kommen die anderen Gedanken zurück.
Sie hat mich angelogen.
Die Wörter standen in ihrem Notizbuch. Genau die Worte, die ich vorhin ausgesprochen habe. »Lieb – Grausam – Liebgrausam.« Geschrieben wie eine Liste auf einer ansonsten leeren Seite. Kein liniertes Papier, das nicht, aber abgesehen von diesem Detail stimmte meine Beschreibung hundertprozentig. Warum also hat sie behauptet, ich könne es nicht gesehen haben?