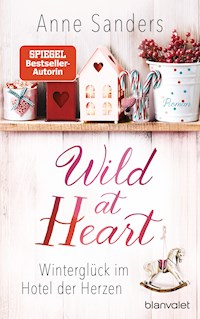9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeden Morgen sitzen sie im selben Wagon. Jeden Morgen treffen sich ihre Blicke. Werden sie einander näherkommen?
Jeden Morgen um 5:18 Uhr nimmt Emma den Zug von Brighton nach London. Sie liebt das Pendeln, denn es gibt ihr Zeit zum Nachdenken. Zum Beispiel über ... Tyler. Mit ihm ist Emma seit neun Jahren zusammen und das überwiegend glücklich – bis er sie dieses eine Mal betrog. Sie hat ihm verziehen, doch seit einigen Tagen zweifelt Emma. Hat ihr Freund etwa doch Geheimnisse vor ihr?
Jamie lebt in Brighton und will so schnell wie möglich nach London ziehen, denn das Pendeln geht ihm auf die Nerven. Er denkt dabei zu viel nach. Zum Beispiel über ... den neuen Job im Verlag seines Vaters. Der hat lange darauf gewartet, dass Jamie in seine Fußstapfen tritt, und diese Erwartungen machen Jamie Angst. Höllische Angst.
Jeden Morgen um 5:18 Uhr treffen Emma und Jamie im Zug aufeinander. Dem höflichen Geplänkel folgen immer ernstere Gespräche – bis die beiden merken, dass sie füreinander weitaus mehr sein könnten als nur eine Zufallsbekanntschaft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Jeden Morgen um 5:18 Uhr nimmt Emma den Zug von Brighton nach London. Sie liebt das Pendeln, denn es gibt ihr Zeit zum Nachdenken. Zum Beispiel über … Tyler. Mit ihm ist Emma seit neun Jahren zusammen und das überwiegend glücklich – bis er sie dieses eine Mal betrog. Sie hat ihm verziehen, doch seit einigen Tagen zweifelt Emma. Hat ihr Freund etwa doch Geheimnisse vor ihr?
Jamie lebt in Brighton und will so schnell wie möglich nach London ziehen, denn das Pendeln geht ihm auf die Nerven. Er denkt dabei zu viel nach. Zum Beispiel über … den neuen Job im Verlag seines Vaters. Der hat lange darauf gewartet, dass Jamie in seine Fußstapfen tritt, und diese Erwartungen machen Jamie Angst. Höllische Angst.
Jeden Morgen um 5:18 Uhr treffen Emma und Jamie im Zug aufeinander. Dem höflichen Geplänkel folgen immer ernstere Gespräche – bis die beiden merken, dass sie füreinander weitaus mehr sein könnten als nur eine Zufallsbekanntschaft …
Autorin
Anne Sanders lebt in München und arbeitete als Journalistin unter anderem für die »Süddeutsche Zeitung«, bevor sie sich für die Schriftstellerei entschied. Ihr erster Roman »Sommer in St.Ives« eroberte die SPIEGEL-Bestsellerliste im Sturm, weitere erfolgreiche Titel folgten. Auf Reisen lernte die Autorin die britischen Inseln kennen und lieben, und genau dort ist auch ihr neuer Roman »Das Glück auf Gleis 7« angesiedelt.
Von Anne Sanders bereits erschienen
Sommer in St. Ives · Mein Herz ist eine Insel · Sommerhaus zum Glück · Willkommen im Hotel der Herzen · Winterglück im Hotel der Herzen · Für immer und ein Wort
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
ANNE SANDERS
Das Glück auf Gleis 7
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2022 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
DK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN978-3-6412-7274-6V003
www.blanvalet.de
Für alle, denen der Sinn nach einem Neuanfang steht
1
Emma
Kennen Sie Brighton? Dieses quirlige Städtchen an der Südküste Englands? Mit seinen bunten Häuserfassaden, den angesagten Shops, mit seinem ewig feuchten Kiesstrand? Es ist das bekannteste Seebad des Landes, heißt es. Es gibt eine Seebrücke, das Gerippe einer Seebrücke und einen Aussichtsturm, der es ermöglicht, beides aus einer hundertdreiundsiebzig Meter hohen Vogelperspektive zu betrachten.
Fragen Sie den Reiseführer, ist Brighton das London am Meer. Fragen Sie meine Mutter, ist es der Ort all derer, die gern etwas ausgefallener leben – und nicht zu genau dabei beobachtet werden wollen. Für mich bedeutet Brighton Heimat. Aufwachen zum Geschnatter der Seevögel. Nachmittage mit Freundinnen am Pier. Es bedeutet Sonnenuntergänge am Strand und erste Küsse auf dem Riesenrad. Es bedeutet, die Bäckerin im Viertel zu kennen und den Mann hinter dem Postschalter, und auf dem Weg zum Bahnhof der alten Mrs. Granton über die Straße zu helfen, weil das mit dem Laufen in jüngster Zeit immer schwieriger geworden ist. Es bedeutet, die Liebe seines Lebens bereits in der Schule zu finden.
Vor sechsundzwanzig Jahren wurde ich, Emma Brook, in Brighton geboren und kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Weshalb das mit dem Pendeln kein Problem für mich darstellt. Ehrlich nicht. Ich habe mich wissentlich, freiwillig und gern darauf eingelassen, jeden Morgen an jedem Werktag der Woche in den Zug zu steigen, um nach London zu fahren und meiner Arbeit nachzugehen, weil ich es nicht übers Herz bringe, mein beschauliches Leben in meiner Lieblingsküstenstadt aufzugeben. Es macht mir nichts aus. Ich stehe gern früh auf. Bevor der Zug um fünf Uhr achtzehn aus dem Bahnhof in Richtung Norden rollt, habe ich mir bereits eine Stunde Yoga einverleibt sowie den Podcast zum Thema Wie bringe ich mehr Effizienz in meinen Alltag.
Das war natürlich ein Scherz. Alles andere aber ist wahr.
Ich arbeite seit viereinhalb Jahren bei Ten to Twelve im Westen von London und schaffe es nach wie vor nur knapp, den Zug zu erwischen, einen Kaffee in der einen, ein Croissant in der anderen Hand. Damit lasse ich mich in den Sitz fallen, bevorzugt in den mit der Nummer 86, gleich rechts hinter dem Einstieg in den letzten Wagen, unmittelbar vor der Kofferablage. Eine Platzreservierung ist in der Regel nicht notwendig, zumindest nicht so früh am Morgen, und eben weil es so früh ist, habe ich den Doppelsitz in vier von zehn Fällen sogar für mich allein. Ich hoffe sehr, heute ist auch so ein Tag. Bitte, lieber Gott des Zugverkehrs, mach, dass ich mich einfach in diesen freien Sitz fallen lassen, die Lider schließen und für einen Moment vergessen kann, was diese Augen gestern Abend sehen mussten.
Es fing auffallend harmlos an. Meine Schwester Amy und ich kamen wie immer ausgehungert von einem Abendessen bei den Eltern zurück, als Amys Freundin Carly uns beim Kühlschrankplündern erwischte. Carly ist klein, burschikos, forsch, aber herzlich, sie studiert Sozialpädagogik und arbeitet nebenher für einen Verein, der mit einem mobilen Spielbus Kinder auf Veranstaltungen bespaßt. Weil dieser Job allerdings nur halb so viel Geld abwirft, wie er Carly Vergnügen bereitet, jobbt sie die restliche Zeit in einem Pub namens Crab Shack, das folglich für uns alle zu so etwas wie einem zweiten Wohnzimmer geworden ist – ein reichlich abgewracktes, aber was soll’s. Carly ist außerdem nie glücklicher über ihre Schichten im Crab, als an den Tagen, an denen meine Eltern zum Essen einladen.
»Was gab es diesmal?«, fragte sie also.
»Gefüllte Aubergine.«
»Möchte ich wissen, womit die gefüllt war?«
»Möchtest du nicht.« Amy griff sich den Käse, während ich in der Schublade nach Crackern suchte, und anschließend versammelten wir uns um den runden Küchentisch, auf dem Carly bereits Schnapsgläser verteilt hatte. Sie reihten sich um eine Flasche Gin, die so kalt war, dass das Kondenswasser an ihr perlte, und ich dachte: Bravo, Carly! Du kennst unsere Mutter beinah genauso gut wie Amy und ich.
Womit ich vollkommen falschlag. Also, nicht mit Carlys Wissen um unsere Familie, zu der sie längst gehört, Amy und sie sind immerhin seit fast zwei Jahren ein Paar. Doch die Annahme, sie könnte uns den Schnaps wegen des zuverlässig ungenießbaren Essens meiner Eltern hingestellt haben, die traf zumindest an diesem Abend nicht zu. Was Carly antrieb, hatte nichts mit Verdauungsproblemen zu tun, das würde ich wenige Minuten später erfahren.
Ich bestrich einen Cracker mit Frischkäse. »Rose dachte, es sei eine gute Idee, die Hafergrütze mit Biss zu servieren«, erklärte ich Carly.
»Und Ben«, fuhr Amy fort, »ist inzwischen dazu übergegangen, alles in einen Saft zu pressen, was sich in seinem Garten tollt – heute war es der Kohlrabi.«
Tatsächlich. Kohlrabi. Lassen wir das kurz mal sacken.
In der Zwischenzeit möchte ich gern erklären, weshalb sich meine Eltern – Rose und Ben Brook – von ihren Töchtern mit Vornamen ansprechen lassen. Die beiden sind, sagen wir, speziell. Und ziemlich biegsam. Meine Mutter ist im April achtundsechzig geworden und ein Abbild von Patti Smith, die alternde, hagere Version. Mein Vater, vierundsechzig Jahre, verfügt über deutlich mehr Rundungen, aber er ist auch einen halben Kopf kleiner als meine Mum. Gemeinsam betreiben sie eines der ältesten Yoga-Studios in Brighton, in dem sie nach wie vor selbst unterrichten. Sie sind gechillt, gelassen, gütig, äußerst esoterisch versiert, der gelegentlichen Verwendung von Cannabis nicht abgeneigt. Sie sind das wandelnde Hippie-Klischee und beneidenswert unkompliziert. Ist es nicht tragisch, wie anstrengend unkompliziert manchmal sein kann? Anstrengend, aber auch sehr, sehr liebenswert?
Vor achtundzwanzig Jahren, meine Mutter war vierzig, mein Vater sechsunddreißig Jahre alt, kam ihr bester Freund und Trauzeuge bei einem Autounfall ums Leben. Seine Frau starb ebenfalls. Meine Eltern waren Paten der kleinen Amy, ein Adoptivkind aus Äthiopien, damals vier, und selbstverständlich nahmen sie sie bei sich auf. Sie war das Kind, das meinen Eltern bis dahin verwehrt geblieben war – was sie nicht daran hinderte, es weiterhin zu versuchen. Hier möchte ich bitte nicht ins Detail gehen müssen, sagen wir einfach: Es gibt einen Grund, weshalb es mich gibt.
Ich bin also ein absolutes Wunschkind. Mehr noch, ich wurde von meinen Eltern heiß ersehnt, was sie mich in jedem Augenblick ihres verrückten Lebens spüren lassen. Das heißt selbstverständlich nicht, dass sie Amy weniger lieben. Womöglich ist sogar das Gegenteil der Fall, nachdem meine große, schöne, exotische Schwester sich liebend gern bereit erklärt hat, mit ins Yoga-Studio-Business einzusteigen, im Gegensatz zu mir. Man mag es kaum glauben, aber wenn ich mich vorbeuge, schaffe ich es nicht einmal, mit den Fingerspitzen meine Zehen zu berühren. Mit herabschauenden Hunden, nicht wackelnden Bäumen oder fließenden Sonnengrüßen sollte man mich also besser verschonen.
Wie bin ich noch mal darauf gekommen? Ach ja, Rose und Ben. Amy nannte unsere Eltern immer schon beim Vornamen, und ich habe diese Tradition fortgeführt. So einfach ist es manchmal.
Womit wir wieder beim Kohlrabi wären.
»Vielleicht«, sagte Carly, während sie nacheinander die Schnapsgläser mit Gin füllte, »solltet ihr dort erst wieder auftauchen, wenn die Tomaten reif sind.«
»Da sagst du was.« Amy hob eins der Gläser, prostete uns zu und kippte den Schnaps weg.
Ich tat es ihr gleich, mit der überwältigenden Ahnung, dass ein Glas nicht ausreichen würde, um den Klumpen Getreide in meinem Magen in seine Bestandteile zu zersetzen.
Unsere Eltern sind vielerlei Dinge, gute Köche sind sie nicht. Was schon an sich ein Drama ist, wenn man bedenkt, welch nicht gerade unbeträchtliche Rolle die Ernährung neben dem Sport in ihrem Leben spielt. Erst ging es nur darum, auf Fleisch zu verzichten, dann auf sämtliche tierischen Produkte. Nach diesem Vorsatz lebten Rose und Ben eine Zeit lang ayurvedisch und zurzeit eben makrobiotisch – was auch immer es damit auf sich hat.
»Was kommt als Nächstes?«, fragte Amy. »Rohkost?«
»Dann fallen zumindest diese pampigen Eintöpfe weg, die immer aussahen, als seien sie schon verdaut.« Ich schüttelte mich.
»Schnaps?« Carly hielt mir die Flasche hin.
»Du bist der Teufel, weißt du das? Sich erst mit vorgeschobener Arbeit drücken und uns hinterher abfüllen.« Ich betrachtete sie aus schmalen Augen, die zerzausten, halblangen Haare, den unschuldigen Rehblick. Und natürlich griff ich trotzdem nach der Flasche. »Morgen ist Montag. Ich muss früh raus.«
»Klar. Du musst immer früh raus. Trotzdem denke ich, du solltest noch einen Schnaps trinken.«
»Das kann auch nur eine Studentin Schrägstrich Kellnerin sagen. Unsereins … ach, was soll’s.« Ich trank also den Schnaps. Und erst als ich das leere Glas absetzte, fiel mir auf, dass Carly gar nicht mehr grinste und auch nichts mehr sagte und stattdessen seltsame Blicke mit meiner Schwester tauschte.
»Was?« Ich sah von einer zur anderen. »Was hab ich jetzt wieder verpasst?«
»Ähm«, begann Carly zögerlich, »was hat eigentlich Tyler an diesem Wochenende gemacht?«
»Tyler?«
Und so nahm das Drama seinen Lauf.
»Er hat Besuch von einem Freund aus Glasgow«, sagte ich. »Ted oder Greg oder Fred. Ich kenne ihn nicht. Er ist bei irgendeiner Konferenz in London gewesen und hat für die zwei Tage einen Abstecher nach Brighton gemacht.«
»Ach, wirklich?«, fragte Carly.
Wiederum tauschte sie einen Blick mit meiner Schwester, und ich sah von einer zur anderen. »Hey, ihr zwei. Ich bin euch irrsinnig dankbar, dass ich bei euch wohnen darf. Und ich kann nachvollziehen, dass ihr Tyler nicht gerade vorurteilsfrei begegnet. Aber wir sind nun mal immer noch zusammen. Doch das heißt nicht, dass wir nicht auch mal getrennte Wege gehen können, selbst am Wochenende. Und das heißt auch, dass ich keine Lust habe, Tyler dauernd und ständig und immer wieder aufs Neue verteidigen zu müssen.« Ich schenkte nach, wider besseren Wissens. »Dauernd und ständig ist dasselbe. Da. Der Gin wirkt schon.«
»Emma …«
»Hm?«
Und dann öffnete Carly die Foto-App auf ihrem Handy.
Für den Bruchteil einer Sekunde rufe ich mir das Bild ins Gedächtnis, dann schiebe ich es genauso schnell von mir weg. Tyler mit einer fremden Frau beim Verlassen eines Clubs. Mein Tyler, wie er mit einer jungen, attraktiven Frau durch Kemptown spaziert, als liefe man dort nicht Gefahr, irgendjemanden zu treffen, den man kennt, zumal am Wochenende. Mein Tyler, wie er lachend auf diese Fremde hinunterblickt, die Hände in den Hosentaschen vergraben, als könnte er sich nur gerade so davon abhalten, einen Arm um sie zu legen. Das, selbstredend, ist reine Spekulation. Doch wenn du mit zwei Frauen, die deinem Freund ohnehin nicht wohlgesonnen sind, eine Flasche Gin auf den Kopf stellst, fangen eben irgendwann auch die Gedanken an, sich im Kreis zu drehen.
Sie tun es noch, irgendwie. Und auch mein Magen scheint nach zu viel Alkohol und zu wenig Schlaf noch nicht in Bestform zu sein. Sitzen, denke ich, das wird helfen. Dieses Rasen bis zum Bahnsteig hat meiner gesamten Verfassung nicht gerade gutgetan. Ein Glück, dass der Zug seine Reise in Brighton beginnt, er rollt also leer hier ein. Und ebenfalls zum Glück sind es überwiegend dieselben pendelnden Menschen, die sich zu dieser derart unchristlichen Stunde in die Bahn drängen, man kennt sich im Laufe der Zeit. Die Frau mit den roten Locken, den Typ mit der runden Brille, die ältere Dame mit der Aktentasche. Natürlich kennt man niemanden persönlich, geschweige denn gut, nur so vom Zunicken, vom wortlosen Hey, du auch hier?, doch man ist sich wohlgesonnen und würde nie auf die Idee kommen, dem anderen den Platz streitig zu machen, auf dem er aus irgendwelchen Gründen immer schon saß. Beinah verhält es sich im Zug so wie am ersten Schultag. Oder bei der Auftaktveranstaltung zu einem Wochenendseminar. Hast du erst mal einen Platz gefunden, bleibt er für die restliche Zeit der deine, so lautet das unausgesprochene Gesetz.
Doch natürlich steigt immer mal wieder jemand Neues zu. Und natürlich hat dieser Jemand zunächst keine Ahnung von den ungeschriebenen Gesetzen, die das Pendeln mit sich bringt.
2
Jamie
Oh, Sch… Verzeihung.«
»Ja. Schon gut. Nichts passiert.«
»Ich bin Ihnen auf den Fuß gestiegen.«
»Habe ich bemerkt.« Ich ziehe mein Jackett aus und hänge es an den Haken neben dem Fenster, bevor ich mich auf den Sitz am Gang fallen lasse, die Tasche mit dem Laptop auf dem Platz neben mir. Kein Grund, anzunehmen, dass sich hier noch jemand reinquetschen sollte. Der Zug startet in Brighton, freie Sitze gibt es demnach genug, erst recht um diese gottverlassene Uhrzeit.
»Es ist nur …«
Ich sehe auf. Das Trampeltier steht nach wie vor neben mir, auch wenn die Frau weit weniger schwer wirkt, als sich das Gewicht auf meinen Zehen angefühlt hat. Sie hält eine fettige Bäckereitüte in der einen, einen Mitnahmebecher in der anderen Hand. Der neigt sich gefährlich in Richtung meiner Schulter. Als mein Blick darauf fällt, rückt sie ihn gerade und sich selbst irgendwie auch. Sie ist leicht grün im Gesicht. Automatisch lehne ich mich ein Stück von ihr weg.
»Nichts«, sagt sie. Dann geht sie weiter.
3
Emma
Vom Bahnhof in Brighton braucht der Zug nicht ganz eine Stunde bis zur Victoria Station in London, und von dort fahre ich mit der U-Bahn weiter bis Wood Lane. Das Studio liegt inmitten der sogenannten White City, es ist verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen, doch wenn ich etwas benennen müsste, mich an meinem Arbeitsweg stört, dann das letzte Stück im überfüllten Untergrund. Üblicherweise ist das so. Heute lässt leider auch die Zugfahrt ihre übliche, herrliche Monotonie vermissen, denn wegen dieser übereifrigen Knalltüte sitze ich nun nicht nur nicht an meinem angestammten Platz, sondern auch noch entgegen der Fahrtrichtung, wo ich auf keinen Fall sitzen sollte, denn dann wird mir übel. Ich sehe mich nach einem anderen, freien Platz um, doch als habe der Pendlergott meinen vorherigen inneren Monolog mit angehört, nur um ihn ad absurdum zu führen, ist der Zug ausgerechnet heute voll wie nie. Es ist Montag, der 4. Juli. Vielleicht fangen viele heute einen neuen Job an. Vielleicht ist es nur Zufall. Wie auch immer, ich hätte auf den Fensterplatz bestehen sollen, denke ich. Den, den der Typ so subtil mit seiner Aktentasche blockiert hat. Doch im ersten Moment war ich zu verblüfft, im zweiten hatte ich mich schon auf den nächstbesten Sitz fallen lassen. Ich schenke der Croissant-Tüte einen wehmütigen Blick, bevor ich sie in meine Handtasche stecke. Wenn ich jetzt esse, verbringe ich den Rest der Fahrt auf der Zugtoilette.
Ich habe gesagt, das Pendeln macht mir nichts, und das entspricht der Wahrheit, allerdings: Würde ich meinen Job nicht in gleichem Maße lieben wie meine Heimatstadt, würde es mir vermutlich ein kleines bisschen schwerer fallen. Ich arbeite bei Ten to Twelve, einer der bekanntesten Morningshows des Landes. Ich bin dort Make-up-Artist. Und irgendwie auch Lebenskünstlerin. Weil mein Job nur zu vierzig Prozent mit Puder und Lidschatten zu tun hat, die restlichen sechzig Prozent sind reine Psychologie. Ich schminke die Gäste, mein Kollege Navin frisiert sie, bevor sie auf dem Talksofa Platz nehmen, doch unsere Fürsorge gilt nicht nur dem äußeren Erscheinen. Navin und ich kredenzen Tee oder Kaffee und ein offenes Ohr, beantworten Fragen (»Ist es wahr, dass man durch die Kamera fünf Kilo schwerer wirkt?«), beruhigen (»Nicht doch, unsere Kameraleute sind darauf trainiert, Sie im besten Licht erscheinen zu lassen.«), geben Tipps (»Frontal wirkt generell schmeichelhafter als im Profil.«).
Die Stunde, die die Gäste auf unseren Zauberstühlen sitzen, habe ich schon mit Flirten, Lachen, Trösten und Weinen verbracht – man weiß nie, was einen erwartet. Und das liebe ich an diesem Job. Tom und Kit, die zwei Moderatoren, halten uns für die guten Seelen der Redaktion, und das ist absolut etwas, womit ich leben kann.
Womit ich nicht leben kann, ist, dass Tyler mich womöglich betrügt.
»Morgen, Emma.«
»Guten Morgen, John.«
»Oh, ich weiß nicht, ob dieser Morgen wirklich gut ist. Du jedenfalls siehst nicht danach aus.«
Über die Schulter werfe ich unserem Portier einen gespielt verständnislosen Blick zu, während ich meine Mitarbeiterkarte aus der Handtasche krame, um damit den Sicherheitseingang zu passieren. »Ich weiß nicht, wovon du redest«, singe ich, obwohl ich ganz genau weiß, wovon er spricht und mir gar nicht nach singen zumute ist.
John ruft: »Am besten verwendest du dein Make-up heute mal für dein eigenes Gesicht!«, und ich winke, ohne mich noch mal umzudrehen, mit einer Hand und höchst prominentem Mittelfinger.
John lacht, ich grinse. Es fühlt sich bitter an, sobald ich außer Sichtweite bin.
Wieso ich Tyler nicht angerufen, ihn nicht zur Rede gestellt habe? Warum ich stattdessen mit Amy, Carly und einer Flasche Gin darüber diskutierte, was die Frau auf jenem ominösen Foto mit meinem Lebensgefährten zu tun haben könnte?
Nun.
Weil es nicht das erste Mal wäre, dass Tyler mich betrügt.
Es wäre nicht das erste Mal.
Als Tyler mir gestand, dass er mit seiner Kollegin Violet geschlafen hatte, lag die Tat bereits vier Monate zurück. Es war in Manchester passiert, wo Tylers Werbeagentur eine Dependance unterhält, und in dieser arbeitet Violet. Eins hatte zum anderen geführt, nämlich zu – nach seinen Worten – einem einzigen, alkoholbefeuerten, bedauernswerten Ausrutscher, von dem ich nie erfahren hätte, hätte Tyler mir den Betrug nicht selbst gestanden. Das hielt mich nicht davon ab, aus unserer gemeinsamen Wohnung aus- und bei meiner Schwester und ihrer Freundin einzuziehen, doch es bewirkte sehr wohl, dass ich mich in der Lage sah, Tyler zu verzeihen, es zumindest zu versuchen. Ich meine – er machte einen Fehler, doch er bereute ihn zutiefst, und er war ehrlich genug, ihn sich selbst und mir einzugestehen. Abgesehen davon wirft man neun Jahre nicht einfach so weg, weil der Mensch, den du liebst, einmal in all der Zeit eine falsche Entscheidung getroffen hat.
Richtig?
Das war vor sieben Monaten, und seither hat sich unsere Beziehung ausnahmslos zum Guten gewendet. Die Tatsache, dass wir nicht mehr zusammen wohnen und uns entsprechend nicht automatisch jeden Tag sehen, hat eine Sehnsucht geweckt, die lange unter einem Berg Alltag begraben lag. Diese Sehnsucht wiederum stachelte eine Leidenschaft an – mit einem Mal drücken wir uns wie Teenager in Hauseingängen herum, küssend, tastend, stöhnend; mit einem Mal sind wir das Paar, das von seinen Freunden dazu aufgefordert wird, sich ein Zimmer zu suchen. Und der Sex, der in besagtem Zimmer vollzogen wird, ist so viel besser, o Gott, er ist gut! Jede Routine, die wir je hatten: aus dem Fenster geworfen. Jeder Zweifel gleich hinterher. Tyler gab sich solche Mühe. Er tut es noch. Wenn ich dieses dumme Foto nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass mein Freund, Tyler Natt, eine andere Frau auch nur ansehen möchte, erst recht nicht auf diese Weise.
Obwohl ich es wirklich nicht tun will, ziehe ich mein Handy aus der Tasche und öffne das Fotoverzeichnis. Der Aufzug hält, doch ich blicke kaum auf, den Weg zu den Garderoben finde ich im Schlaf.
»Morgen, Emma.«
»Morgen, Daisy.«
»Lange Nacht gehabt?«
»Eher eine kurze.«
»Ein Glück, dass du nicht vor der Kamera stehst.«
»Oh, ja. Danke. Wie reizend.«
Schon ist sie an mir vorbei, die Nase wie üblich dicht über ihrem Klemmbrett, viel zu beschäftigt für Small Talk auf dem Gang. Daisy ist Produzentin der Show. Sie ist es gewöhnt, Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde zu treffen, und dies gilt auch für ihre Unterhaltungen.
»Hey, Emma.«
»Hi, Luke.«
»Harte Na…«
»Ah, entschuldige mich kurz, ich muss mal eben …« Bevor mich noch ein weiterer Kollege nach meiner Nacht fragen kann, biege ich auf die Damentoilette ab, die glücklicherweise leer ist. Ich beuge mich über eins der Waschbecken zum Spiegel.
Okay.
Zeit für mein Notfallmäppchen. Ein wenig Concealer, um die Augenringe aufzuhellen. Einen Hauch Puder gegen die roten Flecken auf den Wangen. Lidstrich und Wimperntusche, um die Augen größer wirken zu lassen und gleichzeitig von meiner Blässe abzulenken. Aus der schieren Notwendigkeit heraus lege ich zudem Lippenstift auf – ein unauffälliger Beerenton, der gut zu meinem dunkelbraunen Haar passt.
So.
Dafür, dass ich beruflich damit zu tun habe, trage ich privat extrem wenig Make-up, doch selbst zu dem wenigen hat heute Morgen die Zeit nicht gereicht. Womöglich liegt es gar nicht am Gin, dass mich jeder nach meinem Befinden fragt, denke ich zerknirscht. Womöglich liegt es daran, dass ich ungeschminkt durch die Gegend laufe wie Gwyneth Paltrow. Nein, ich habe keine Ähnlichkeit mit Gwyneth Paltrow. Bis auf die sparsame Verwendung von Schminke womöglich.
Bis ich vom Damenklo in die Garderobe gelaufen bin, habe ich das Bild von Tyler und der Fremden vorübergehend vergessen.
Als ich den Raum betrete, ist Navin bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt. Ursprünglich stammt er aus Indien, lebt aber schon seit bestimmt zwanzig Jahren in London, obwohl er felsenfest behauptet, nicht älter als neunundzwanzig zu sein. Wir wissen beide, dass das gelogen ist. Mit dieser ebenmäßigen Haut und den verdammt langen Wimpern sieht Navin jünger aus, als er ist, doch er ist sicher schon an die vierzig. Sein Geheimnis: Geh nie ins Bett, ohne dich abzuschminken. Und so, wie er mich über den Spiegel hinweg betrachtet, unterstellt er mir gerade, genau das getan zu haben.
»Ich habe versucht, es zu kaschieren«, verteidige ich mich vorschnell.
»Ist nicht wirklich gelungen«, gibt Navin zurück. »Was Bände spricht, wenn man bedenkt, dass du das Ganze beruflich machst.«
Er ist dabei, unseren Arbeitsplatz auf Hochglanz zu polieren – den mit Glühbirnen umrahmten Spiegel, der eine gesamte Breitseite des Raums einnimmt, die Ablage davor, die in der Regel mit Zeitschriften, Kaffeetassen und Wassergläsern übersät ist, seinen kleinen Beistellwagen, auf dem er Haarprodukte und sämtliche Geräte aufbewahrt, die er fürs Frisurenstyling benötigt.
Ich verfrachte Jacke und Tasche in die angrenzende Abstellkammer und ziehe mein eigenes Arbeitswägelchen hervor: ein mit jeder nur erdenklichen Schminkutensilie ausgestatteter Rollwagen, an dem Picasso seine Freude gehabt hätte (wäre er Visagist und nicht Maler gewesen, versteht sich).
»Also«, beginnt Navin, während er sich in einen der beiden Drehstühle fallen lässt, »was hat deinen Teint über Nacht derart ergrauen lassen? Erzähl’s Onkel Navin.«
Ich bringe die Lippenstifte in eine Farbordnung von hell nach dunkel und bin auf der Suche nach einer fehlenden Kappe, während ich überlege, was ich Navin antworten soll. Wir arbeiten hier seit gut anderthalb Jahren nebeneinander, wir verstehen uns bestens, haben aber über die Show hinaus nur wenig miteinander zu tun, was vor allem daran liegt, dass er in London lebt und ich in Brighton. Dennoch hat er das Drama um Tyler mitbekommen, denn ich bin nun mal nicht sehr gut darin, meine Gefühle zu verbergen, und Navin ist ein umso besserer Menschenleser, das bringt unser Job so mit sich. Er ist außerdem in psychologischer Betreuung ähnlich begabt wie ich. Auch das, wie bereits erwähnt, eine Begleiterscheinung des Berufes.
»Tyler«, sage ich am Ende meines inneren Monologs, und Navin reißt die Augen auf.
»Nicht schon wieder!«
»Nein. Nichts dergleichen. Zumindest – ich weiß nicht. Es ist … Carly hat ihn Sonntagmorgen aus einem Club kommen sehen. Mit einer Frau. Sie hat ein Foto davon gemacht.«
»Wow.« Navin verschränkt die Arme vor dem Körper. »Mein erster Gedanke hierzu: So dumm kann Tyler gar nicht sein, dass er sich in diesem Dorf von Brighton mit einer Frau sehen lässt, die nicht seine Freundin ist. Ich meine, es war doch zu erwarten, dass er dort jemandem über den Weg läuft, den er kennt, oder? Dass es ausgerechnet die Freundin deiner Schwester ist … tja. Karma is a bitch, richtig? Zeig mir das Foto.«
Ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche und rufe die Foto-App auf.
Navin betrachtet das Bild. Ich lasse mich in den zweiten Stuhl fallen und warte.
»Man sieht gar nichts«, sagt er schließlich. »Nur, dass er mit einer Frau aus dem Club kommt, aber das ist schon alles.«
»Hm.«
»Könnte sein, da ist was. Kann genauso gut sein, da ist gar nichts.«
»Vermutlich. Ja.«
»Was soll ich sagen: Ich bin kein großer Fan von deinem Freund, nach dem, was er getan hat. Aber Lachen ist noch kein Verbrechen.«
»Ich weiß. Ich weiß das. Aber Amy. Und Carly …« Ich zucke mit den Schultern. »Ich schätze, es könnte was dran sein. Oder eben auch nicht.«
»Egal was, es hat eine Flasche Gin gerechtfertigt, nehme ich an?«
»Du kennst uns zu gut. Wieso kennst du uns so gut?«
»Glaub es oder glaub es nicht, aber ich bin nun mal ein Frauenkenner.«
»Das glaube ich wirklich nicht.«
Er hält nach wie vor mein Telefon fest, und ich strecke die Hand danach aus.
»Hast du Tyler schon gefragt, was es damit auf sich hat?« Navin gibt mir das Handy zurück.
»Nein«, gestehe ich.
»Dann weißt du ja, was du als Nächstes mit diesem Telefon anstellst. Statt Schnappschüsse zu analysieren, die alles Mögliche und nichts bedeuten können.«
»Wo warst du nur gestern Abend, du Stimme der Vernunft? Eventuell hättest du mir einen Kater erspart.«
»Ich war dort, wo ich hingehöre, in Soho, auf einer Party. Auch wenn man mir das nicht ansieht.«
Er grinst. Und wie so oft habe ich das Gefühl, ich würde gern mehr Zeit mit Navin verbringen.
»Komm mal nach Brighton«, schlage ich deshalb vor. »Wir haben ein Gästezimmer.«
»Mit drei Verrückten unter einem Dach … Ich weiß nicht.«
»Du darfst in meinem Bett schlafen.«
»Das lockt mich natürlich sehr«, sagt Navin spöttisch. »Nicht.« Womit er mir einen vielsagenden Blick zuwirft – den letzten für die nächsten Stunden. Denn just in diesem Moment wird die Tür aufgerissen, das Moderatorenduo stürmt unsere Garderobe, und mit der Ruhe ist es vorerst vorbei.
Unsere Sendung ist nicht so populär wie Good Morning, Britain, sie ist eher die kleine Schwester der großen Show: die Themen nicht ganz so politisch, die Promis nicht ganz so berühmt, die Gespräche nicht ganz so ernst zu nehmend. Nichtsdestoweniger gibt es Ten to Twelve bereits seit zwei Jahrzehnten, und es sind die Details, die uns zu etwas ganz Besonderem machen, eben ganz besonders liebenswert. Rubriken wie Schöner mit Shauna zum Beispiel, in der Shauna, eine Lifestyle-Expertin, jeden Tag eine andere Zuschauerin mit Vorher-Nachher-Styles glücklich macht. Wir haben Teddy, das Orakel, das Anrufenden aus den Karten liest, und einen echten Wetterfrosch, der in seinem Terrarium Leitern rauf- und runterklettert. Und dann sind da natürlich Kit und Tom, die Moderatoren. Seit mehr als zwanzig Jahren sind die zwei verheiratet und vor wie hinter der Kamera unermüdlich dabei, einander aufzuziehen. Dennoch sind sie die einfühlsamsten Menschen, die ich kenne. Die jedem Gast – sei es der blonden Barbie aus dem neuesten TV-Trash oder der geplagten Mutter von Fünflingen – Interesse und Respekt entgegenbringen.
Tom ist so etwas wie die Vaterfigur der Nation. Groß, breitschultrig, graue Schläfen, entwaffnendes Lächeln. Ein unschlagbarer Optimist. Er ist der Typ, dem man sich anvertraut, wenn einen der Freund verlässt. Zu dem man rennt, wenn man etwas gewonnen, etwas verloren, etwas erlebt oder etwas verbockt hat. Solange ich ihn kenne, hatte er immer ein offenes Ohr, einen gut gemeinten Rat, Verständnis oder Mitgefühl. Kit, seine Frau, ist deutlich jünger und minimal distanzierter. Sie ist nicht weniger nett, nur etwas zurückhaltender eben. Manchmal denke ich, sie ist der Fels, an den Tom sich klammert, nachdem alle anderen sich an ihm festgehalten haben. Als seien die beiden eine unverrückbare Einheit. Als ergäben die zwei nur zusammen einen Sinn. Ja, das klingt abgrundtief kitschig, ich weiß. Das macht es nicht weniger wahr. Tom und Kit, sie sind so etwas wie eine Wahl-Familie für mich.
Ich fing als Praktikantin bei Ten to Twelve an und bin überzeugt davon, dass ich allein wegen der beiden dabeigeblieben bin. Tom und Kit gaben mir von Anfang an das Gefühl, nicht zur Arbeit, sondern nach Hause zu kommen. Nach Hause in diese große, glückliche TV-Familie.
Die zweistündige Show an sich bedeutet für Navin und mich allerdings hundertzwanzigminütige Anspannung, in deren Werbepausen Nasen gepudert, Locken zurechtgerückt und Kleider gerade gezupft werden. Sie bedeutet Small Talk mit Gästen und Moderatoren und vor allem, dass die eigenen Befindlichkeiten in den Hintergrund rücken, bis sie sich nach Ende der Sendung, Instandsetzung unseres Arbeitsmaterials und einer abschließenden Besprechung zum darauffolgenden Tag wieder ins Bewusstsein schleichen. Und so bin ich bereits auf dem Weg zur U-Bahn, als mir das Gespräch mit Navin wieder einfällt – der Teil, in dem es darum ging, mit Tyler zu sprechen, um genau zu sein. Bis zum Bahnhof Victoria Station denke ich darüber nach, wie ich es am besten anstelle, meinen Freund nach dieser unheilvollen Aufnahme zu fragen.
Hey, du hast dich am Wochenende gar nicht gemeldet. War es schön mit Fred (Greg oder Ted)? Habt ihr viel unternommen? Wart ihr, ich weiß nicht, in einem Club? Bis in die frühen Morgenstunden? Und … ihr wart … allein?
Ist dir klar, dass Carly dich mit einer Frau fotografiert hat?
Ich steige in den Zug nach Brighton, der weit weniger voll ist als am Morgen, da die meisten Pendler erst am Abend zurückfahren.
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche, um Tyler zu schreiben.
Ich halte es unverrichteter Dinge in der Hand, als der Zug eine Stunde später in Brighton einfährt, wo ich aufs Gleis trete, auf dem Tyler mir freudestrahlend entgegenläuft. Für eine Sekunde bin ich sprachlos. Dann hat er seine Arme um meine Taille geschlungen, mich hochgehoben und sich mit mir im Kreis gedreht.
Ich lache, es geht gar nicht anders. Tyler grinst mich an – diese Grübchen, diese Lachfalten – , und von einer Sekunde zur nächsten habe ich vergessen, worüber ich die vergangene Stunde nachgegrübelt habe.
Wobei. Nicht ganz. Mein Lächeln flackert ein wenig.
Tyler, der das nicht sehen kann, lässt mich an seinem Körper heruntergleiten und küsst mich. Er macht das wirklich gut – küssen. Mit genau dem nötigen Druck. Mit exakt der richtigen Mischung aus sanft und bestimmt. Ich liebe es, mich in Tylers Küsse hineinfallen zu lassen. Nur dann nicht, wenn ich vermuten muss, dass seine Lippen vor nicht allzu langer Zeit noch an einem ganz anderen Mund genagt haben.
»Was machst du hier?«, frage ich, nachdem ich mich von ihm gelöst habe.
Mein Noch-Wieder-Freund legt mir den Arm um die Schultern, und wir gehen auf den Ausgang zu. »Ich dachte, ich überrasche dich. Kommt mir vor, als hätten wir uns ewig nicht gesehen.«
Er bleibt stehen, küsst mich noch mal. Auf die Wange, dann auf den Hals. Wenn ich es nicht besser wüsste …
»Wenn ich es nicht besser wüsste«, sage ich, und selbst in meinen Ohren klingt mein Lachen unecht, »würde ich denken, du hast ein schlechtes Gewissen.«
»Wieso? Weil ich die Liebe meines Lebens vom Bahnhof abhole, nachdem ich sie drei Tage nicht gesehen habe?«
Ich habe ihn gekränkt, das ist ihm deutlich anzusehen. Seit dieser Sache mit Violet, der Arbeitskollegin, wird er nicht müde, mir zu erklären, wie wichtig ich ihm bin, wie sehr er mich liebt, in welchem Maße er mich braucht, dass ich die Liebe seines Lebens bin. Ich strenge mich an, ihm zu glauben, ich bemühe mich wirklich sehr. Aber ich kann nichts gegen den nagenden Zweifel in meinem Inneren machen, immer dann, wenn er nicht ans Telefon geht, sich länger nicht meldet, er auf Geschäftsreise ist – oder jemand mir ein Foto zeigt, auf dem er sich breit grinsend mit einer fremden Frau amüsiert.
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und zeige Tyler das Bild.
Er wird nicht blass, wie ich vermutet hätte, stattdessen aber ein kleines bisschen rot.
»Woher hast du das?«, fragt er, die Stimme hörbar kälter, allerdings auch reichlich verwirrt.
»Carly hat das Bild gemacht. Sie war auf dem Heimweg, als du ihr mit dieser Frau entgegenkamst.«
»Mein Gott, diese …« Er hält sich gerade noch zurück. »Carly«, sagt er nur. Ist ja nicht so, dass die Abneigung meiner Familie meinem Freund gegenüber seit der Tat einseitig wäre.
Er gibt mir das Handy zurück. »Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Brad hat sie in dem Pub aufgegabelt, in dem wir Dart-Spielen waren. Wir sind danach noch in den Club, und von da haben wir sie zu ihrem Auto gebracht. Hätte Carly nur fünf Sekunden gewartet mit ihrem Schnappschuss, hätte sie Brad mit draufgehabt. Er war nur noch auf dem Klo.«
»Brad.«
»Ja. Ich hab dir doch gesagt, dass er mich am Wochenende besucht.«
»Ich weiß. Ich erinnere mich.«
Ich blicke zu Tyler auf, und für eine Sekunde frage ich mich, was er sieht. Die Skepsis in meinem Blick? Die Fragen, die mir auf der Zunge liegen? Brad hat diese Frau aufgegabelt, nicht du? Du hast sie angesehen, als wärt ihr alte Freunde, aber du weißt nicht mal mehr ihren Namen?
Tyler steckt die Hände in die Taschen seiner Jeans, ganz so, wie er es auf dem Foto getan hat. Nur lacht er nicht. »Emma«, sagt er. Es klingt enttäuscht. Und wie ein Flehen. Ich weiß, dass er sich wünschte, ich könnte das Ganze vergessen, darüber hinwegsehen, dass es je passiert ist, ihm wieder vorbehaltlos vertrauen, so, wie ich es vorher getan habe. Ich weiß, dass er sich nichts mehr wünscht als das. Ich wünsche es mir auch. Weil ich es hasse, ihn anzuzweifeln, beinah genauso sehr, wie er es hasst.
»Okay?« Es klingt wie eine Frage, und trotzdem stelle ich mich auf die Zehenspitzen und umfasse mit den Händen seinen Nacken. »Es tut mir leid, dass ich unsicher war.«
»Du traust mir nicht.«
Da dies keine Frage war, antworte ich auch nicht.
Tyler seufzt, doch schließlich erwidert er die Umarmung, drückt mich fest an sich, bevor er sein Gesicht in meinen Haaren vergräbt. »Ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen.«
»Ich weiß.«
»Aber es geht nicht. Es geht nun mal nicht.«
»Hm.«
»Ich liebe dich.«
Ich lehne meinen Kopf an seine Brust, sauge seinen Duft ein, ganz, ganz tief.
»Emma?«
»Ja. Ich liebe dich auch.«
Es klingt vermutlich nicht sehr überzeugend, aber ich meine es so. Ich liebe Tyler wirklich sehr.
Und heute Abend gehe ich nicht zu meiner Schwester, ich bleibe bei ihm.
4
Jamie
Das einzig Gute an dieser Pendelei ist, dass der Zug in Brighton noch leer ist, einen Platz zu bekommen also kein größeres Problem darstellt. Ich sage bewusst, das einzig Gute, denn das ist es. Eine Stunde lang mit einer Horde Fremder in einem stickigen Zugabteil festzustecken, schlechten Atem einzusaugen und noch schlechteres After Shave, ist kaum die angenehmste Art, in den Tag zu starten. Die Bahn ist heute nicht überfüllt, aber leer ist sie auch nicht. Man kann froh sein, wenn der Sitz neben einem nicht beansprucht wird. Über den Tisch wäre ich beinah in Jubel ausgebrochen.
Ich lege mein MacBook darauf, verbinde mich mit dem WLAN und öffne dann die Seite mit dem Wohnungsmarkt. Ich will sobald wie möglich nach London ziehen, egal, wie sehr mir Brighton gefällt. Kann sein, dass ich zu all meinen anderen Neurosen in diesem Zug auch noch eine Klaustrophobie entwickle. Oder eine Angststörung gegen schlechte Gerüche. Wieso ich mir das überhaupt antue? Weil ich mich, wie offensichtlich viele andere auch, schlecht dabei fühle, jeden Tag mehr als hundertdreißig Meilen mit dem Wagen zurückzulegen und die Umwelt damit noch mehr zu belasten, als ich es ohnehin schon tue.
In diesem Netz wird das nichts. Es dauert ewig, bis sich die Seite öffnet, da kann ich gleich zu Fuß durch die Stadt latschen, auf der Suche nach freiem Wohnraum. Ich schließe den Internet-Explorer und öffne stattdessen einen der Ordner, die mein Vater mir gestern auf den Rechner gespielt hat. Es sind die Exposés zu den verschiedenen Zeitschriften, die unser Verlag herausgibt. Ich öffne die Übersicht, während die Worte sich in meinem Hirn zum Rhythmus der Räder wiederholen.
Unser Verlag.
Unser Verlag.
Unser Verlag.
Es ist der Verlag meiner Familie, von dem ich hier spreche, zu dem ich bis gestern ein eher ambivalentes Verhältnis pflegte. Heute dagegen … Heute sieht es so aus, als sei ich auf dem besten Wege, Leiter von unserem Verlag zu werden.
Ich spüre, wie mich dieser Gedanke beunruhigt. Es fühlt sich an, als würde sich Kälte in mir ausbreiten, sie kriecht von meiner Kehle hinunter, verteilt sich im Brustraum, sickert in den Magen. Meine Stirn beginnt zu pochen. Meine Fingerspitzen zucken. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich weiß nicht, was hier los ist, doch die Wahrheit ist – ich kenne diese Empfindungen nur zu gut, sie sind mein ständiger Begleiter. Und weil ich weiß, ich werde nicht dagegen ankommen, es niemals allein schaffen, diese aufkeimende Panik zu überwinden, weil ich das weiß, denn ich habe es schon hundertmal versucht, greife ich in die Innenfalte meiner Aktentasche und ziehe das Päckchen mit den Pillen hervor.
Mittlerweile zittern meine Hände.
Gott, James Carlton, du bist erbärmlich.
Ich beuge mich tief über den Sitz und die Tasche, niemand braucht dabei zuzusehen, wie ich diese Tablette schlucke. Als ich mich aufrichte, um sie mit einem Schluck Wasser hinunterzuspülen, fällt mein Blick auf eine der Mitfahrenden auf der anderen Seite des Gangs, ein paar Sitze von mir entfernt. Es ist das Trampeltier. Auf dem Platz, auf dem sie mir gestern den Fuß plattgetreten hat.
Ebenfalls wie gestern hält sie eine fettige Tüte in der Hand, aus der ein Stück Croissant herauslugt – etliches davon hat sie bereits auf ihrer Bluse verteilt. Ich beobachte, wie sie gedankenverloren hineinbeißt, während sie mit der anderen Hand in einer Zeitschrift blättert, und diesmal tropft ein Klecks Schokolade auf ihre Brust. Ich starre drauf. Ich würde ihr gern etwas Gesundes in die Hand drücken, denke ich. Einen Apfel oder eine Karotte. Weil es einfach keine gute Idee ist, dem Körper als Erstes am Morgen diese fatale Mischung aus Fett und Zucker zuzuführen.
Als sich unsere Blicke treffen, werden ihre Augen schmal, im selben Moment, in dem ich die Brauen hebe, und … Ich weiß nicht, weshalb ich mich so lange mit diesem Anblick aufhalte, ich schüttle über mich selbst den Kopf.
Wasser. Die Tablette löst sich schon in meinem Mund auf. Ich würge den bitteren Geschmack hinunter und wende mich wieder dem Laptop zu.
Ich bin Koch.
Nein, das ist Blödsinn. Eigentlich habe ich Verlagswirtschaft studiert, um im Grunde schon viel früher ins Familienunternehmen einzusteigen, doch dann konnte ich meinem Vater glaubhaft versichern, dass es, um einen Verlag zu führen, der auf Kochzeitschriften spezialisiert ist, womöglich gar nicht dumm wäre, wenn wenigstens einer aus der Familie auch die Praxis verstünde. Gute Idee, fand Dad. Ich denke nicht, dass er eine dreijährige Kochausbildung im Sinn hatte, doch er hielt mich auch nicht davon ab. Er hinterfragte nicht, weshalb ich lieber über heißen Pfannen und unter der Fuchtel von cholerischen Küchenchefs schwitzte, anstatt neben ihm meine Position als Firmenerbe anzutreten. Er drängte mich nicht, schneller zu machen, er fragte nicht einmal, wann ich endlich so weit sei. In allem, was ich in meinen bisherigen siebenundzwanzig Lebensjahren getan oder nicht getan habe, hat mein Vater mich bedingungslos unterstützt.
Das macht es so schwer, ihm die Wahrheit zu sagen.
Das macht es geradezu unmöglich, ihm zu beichten, dass ich lieber nicht die Leitung eines Verlags übernehmen möchte, der Angestellte im vierstelligen Bereich hat und zu den traditionsreichsten Häusern der ganzen Stadt zählt. Dass ich es nicht deshalb nicht möchte, weil ich es nicht will.
Sondern weil ich es nicht kann.
Nicht kann.
Nicht kann.
Nicht kann.
Dieses Rattern. Es wirkt beinah beruhigend.
Ich lehne mich zurück.
Kann nicht.
Kann nicht.
Kann nicht.
»Hey, Sie. Hey. Hallo? Sie müssen aufwachen. Hallo?«
»Was?« Mit einem Ruck öffne ich die Augen. Das Herz schlägt mir bis zum Hals.
»Prima, ich dachte schon, ich kriege Sie nie wach. Wir sind da. Victoria Station. Sie müssen aussteigen.«
Mit gerunzelter Stirn mustere ich die Croissant-Frau. Aus der Nähe betrachtet, sieht sie sehr hübsch aus. Ein ebenmäßiges Gesicht, dunkelbraune Augen. Klare Haut. Der Mund nur ein Stück zu breit. Dunkle Haare. Schulterlang. Pony.
»Hallo?«
Ist das eine Lücke zwischen ihren Schneidezähnen?
Ich schüttle den Kopf. »Ja.« Meine Stimme klingt rau und voller Schlaf – Schlaf, der mir nachts fehlt und der mich ausgerechnet hier ereilt, mitten in einem Zug.
»Danke«, sage ich, da ist sie bereits ausgestiegen.
Vom Bahnhof Victoria Station aus sind es zwanzig Minuten zu Fuß in den Verlag – zum Glück fährt keine U-Bahn in diese Richtung. Zu viele Menschen auf zu engem Raum, das ist nichts für mich. Überhaupt zu viele Menschen, egal wie eng der Raum ist. Manchmal reichen zwei oder drei, um mich zu beunruhigen. Ich bin nicht schüchtern, das ist es nicht. Ich bin nervös. Ja, das trifft es vermutlich am besten. Ich bin nervös, und ich habe panische Angst davor, vor Menschen zu sprechen.
So, jetzt ist es raus.
Ich habe eine Angststörung, eine soziale Phobie, wie auch immer wir das nennen wollen, ich habe es. Angeblich betrifft die Angst davor, vor anderen Menschen zu sprechen, fünfundsiebzig Prozent der Bevölkerung, doch ich könnte wetten, nur wenige leiden in dem Ausmaß darunter, in dem ich darunter leide. Die innere Kälte, die zitternden Hände, Nerven, die flirren, wenn ich mich abends ins Bett lege, um dann doch nur ein paar Stunden zu schlafen – all das ist Teil meines Lebens, solange ich denken kann. Aber es ist nichts, was ich herumerzählen würde. Und nichts, was ich nicht im Griff hätte. Ich wünschte manchmal, ich bräuchte die Tabletten nicht, doch dann mache ich mir klar, dass nicht wirklich etwas dabei ist, sie zu nehmen. Sie machen nicht abhängig. Es sind ganz normale Betablocker. Verschreibungspflichtig, ja. Gefährlich, sicher nicht. Sie haben mich durchs Studium getragen. Durch Prüfungen und Ausbildungen. Sie haben mir schon öfter den Arsch gerettet, als ich denken kann.
Was mich daran erinnert, dass ich Mike eine Nachricht schicken sollte. Die Schachtel ist bald leer, und Mike ist mein Freund, der Arzt, der sie mir verschreiben kann.
Ob ich es mit einer Therapie versucht habe?
Nein.
Ich habe die Sache im Griff, das sagte ich doch bereits.
»Guten Morgen, Mr. Carlton.«
»Guten Morgen, Stanley.«
Tag zwei meines Daseins als Verlagsmensch, und ich bin weit entfernt davon, Mr. Carlton zu sein. Weiter als je zuvor.
Mr. Carlton.
Himmel, das ist mein Vater. Carlton ist der Verlag. Ich bin James, Jamie, was auch immer, alles andere macht mir Angst.
Da.
Da ist es wieder.
Ich muss aufhören, vor allem und jedem Angst zu haben, ist es nicht so? Bloß wie? Wie stelle ich das an? Zumal ich es in meinen bisherigen siebenundzwanzig Jahren nicht geschafft habe?
Wobei siebenundzwanzig Jahre natürlich nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich noch weniger ängstlich war – nicht ganz so unbedarft und souverän wie andere, aber auch nicht der Paniker, den ich heute abgebe. Ich weiß, dass ich mich nie gern im Unterricht gemeldet habe, aber wenn ich aufgerufen wurde, brachte ich zumindest Antworten zustande. Es ging um die Aufmerksamkeit, um das im Mittelpunkt stehen, der Moment, in dem sich alle Augen auf dich richten und all die Ohren auf das, was du zu erzählen hast. Es war mir immer unangenehm, doch es gelang mir, wenn ich Blickkontakt mied, mir einen Punkt in der Ferne suchte, auf den ich mich konzentrieren konnte. Es half, das Herzklopfen zu ignorieren und die schweißnassen Hände. Erst mit den Jahren, in denen immer klarer wurde, dass sich keine Besserung abzeichnete, dass es, im Gegenteil, immer schwieriger wurde, vor Menschen zu sprechen, sich Prüfungen zu unterziehen, Vorstellungsgespräche zu meistern, den Führerschein zu machen oder sich einer Konfrontation mit einem Fremden zu stellen, wurde mir bewusst, dass diese Ängste zu meinem Leben gehörten, dass sie blieben, dass sie nicht von einem Tag auf den anderen von mir ablassen und woanders hinziehen würden. Dass ich etwas dagegen unternehmen musste. Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe.
Mike ist ein ehemaliger Klassenkamerad, mit dem ich mich erst in der Uni richtig anfreundete. Er studierte Medizin, experimentierte in seiner Freizeit mit Drogen und war trotz all seiner Oberflächlichkeit, mit der er Frauen und das Leben generell zu behandeln pflegte, erstaunlich aufmerksam, wenn es drauf ankam. Er merkte ziemlich schnell, dass immer dann etwas nicht mit mir zu stimmen schien, wenn Prüfungen anstanden. Und wie beiläufig erzählte er mir dann, dass er einen Artikel gelesen habe, in dem es um Betablocker ging und ihre Vorzüge für Menschen, die keine Herz- und Blutdruckprobleme plagten, sondern Lampenfieber. »Das nehmen Operndiven genauso wie Anwälte«, erklärte Mike, »es funktioniert für jeden, der in gewissen Situationen seinen Herzschlag beruhigen möchte. Alles ganz harmlos, die Dinger machen körperlich nicht abhängig.« Und: »Wenn ich dir welche besorgen soll, sag Bescheid.«
So fing es an. So ging es weiter. Die Betablocker helfen mir, das Zittern der Hände zu unterbinden und den Nebel im Kopf zu vertreiben. Ich funktioniere besser mit den Pillen, auch wenn ich mich manchmal fühle, als wäre ich nicht mehr ich, als wäre ich eine Mogelpackung, ein Fake. Dann tröste ich mich mit dem, was Mike mir versicherte: »Es gibt Länder, da werden Betablocker offiziell bei der Behandlung gegen Angststörungen eingesetzt.« Ich tröste mich auch damit, dass die Tabletten nicht körperlich abhängig machen.
Über eine psychische Abhängigkeit denke ich gar nicht erst nach.
Der Carlton-Verlag hat seinen Sitz in Westminster. Nicht gerade die traditionelle Fleet Street, aber trotzdem nahe der Themse, in jedem Fall nicht die schlechteste Gegend. Er befindet sich in einem alten Backsteinkarree, in dem mein Großvater vor beinah sechzig Jahren die erste Zeitschrift herausbrachte; die Marktlücke, ein Magazin, in dem sich alles ums Geld drehte.
Das Heft war keine große Nummer, es dümpelte am Kiosk vor sich hin. Doch mein Großvater war ein zäher, ehrgeiziger Mann, und als es mit dem Thema Finanzen nicht lief, versuchte er es eben mit den Bereichen Mutter sein, Erholung im Garten und Gesund durch Bewegung. Insbesondere die Themen Gesundheit und Sport bescherten dem Verlag solide Bilanzen, doch als mein Vater einstieg, begann die eigentliche Erfolgsgeschichte. Er war es, der die Idee hatte, auf Kochthemen umzuschwenken, und der aus dem Carlton-Verlag das Vorzeige-Imperium für Kochzeitschriften machte. Wie sich herausstellte, hatte mein Vater den absolut richtigen Riecher, wo auch immer er den hernahm. Manchmal denke ich, er verfügt schlicht über den siebten Sinn bei solchen Sachen. Erkennt einen Trend, lange bevor er Trend wird. Wir hatten den Grillmeister, bevor sich jeder Zweite einen Gasgrill auf die Terrasse stellte. Vegamania ging an den Start, als es noch nicht an jeder Ecke Tofu-Sandwiches zu kaufen gab.
Wenn man sich die Erfolgsgeschichte meines Vaters ansieht, müsste man meinen, einen knallharten Hierarchen dahinter zu entdecken, doch dann kommt die eigentliche Überraschung: Will Carlton ist der aufopferungsvollste Mann, den ich kenne. Loyal bis zum bitteren Ende. Ein liebevoller Ehemann. Ein großzügiger, verständnisvoller Vater. Ein Mensch, den du nicht enttäuschen möchtest, denn das kostet dich nicht nur ein paar Punkte, sondern das komplette Karma-Konto.
Habe ich schon erwähnt, dass ich am Arsch bin?
Ich nehme die Treppen, nicht den Aufzug. Jeder, der mir hier begegnen würde, müsste glauben, ich tue es, um mich fit zu halten, aber nicht doch. Menschen. Engster Raum. Ich erwähnte es schon. Mein Büro befindet sich im obersten, dem fünften Stock, doch bis ich dort ankomme, ist mir niemand begegnet, nicht um diese Uhrzeit. Um kurz vor sieben ist so gut wie keiner im Verlag, was einer der Gründe ist, weshalb ich den Tag so früh beginne.