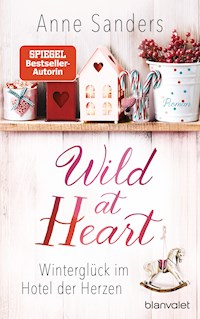9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Chestnut Road
- Sprache: Deutsch
Zimmer gesucht, Liebe gefunden
Zahnärztin Julie braucht eine Auszeit und ist heilfroh, in Brighton ein halbes Zimmer zu finden. Als sich jedoch herausstellt, dass die gerissene Vermieterin Mrs. Gastrell ein und dasselbe Zimmer an sie und den angehenden Anwalt Alex vergeben hat, ist Julie entsetzt. Ganz abgesehen davon, dass sie allein einziehen wollte, ist Alex das genaue Gegenteil von ihr: kühl, extrem diszipliniert, reichlich arrogant. Aus rein pragmatischen Gründen lässt sich Julie dennoch auf die unfreiwillige Wohngemeinschaft ein – ein Experiment, bei dem sie schon sehr bald feststellen muss, dass ihr WG-Partner vielschichtiger ist, als sie dachte. Vielschichtiger, extrem liebenswert und reichlich interessant …
Der Auftakt zur neuen Reihe von Bestsellerautorin Anne Sanders (Sommer in St. Ives, Hotel der Herzen)
Im Haus in der Chestnut Road zieht die Liebe ein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
Alex Logan hat ein klares Ziel vor Augen: Er will seiner Großmutter ein gutes Leben ermöglichen, so wie sie es für ihn getan hat. Deshalb hat er Jura studiert, obwohl ihn der Job in der Kanzlei mehr belastet, als dass er ihm Freude bereitet. Und deshalb zieht er in das Zimmer an der Chestnut Road ein, das er sich mit Julie teilt – um Geld zu sparen, und weil er ohnehin kaum zu Hause ist. Seine Mitbewohnerin scheint so chaotisch wie die bunt verstreuten Dinge im Bad. Doch irgendetwas geschieht mit Alex, wenn er in ihre großen, dunklen Augen blickt. Und während er auf seiner Seite des Zimmers im Bett liegt, fragt er sich immer öfter, was sie wohl hinter dem provisorischen Vorhang tut, den sie durch den Raum gespannt hat …
Zur Autorin:
Anne Sanders arbeitete als Journalistin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, bevor sie sich 2014 voll und ganz für die Schriftstellerei entschied. Ihre Liebe zu den Britischen Inseln zieht sich durch so gut wie all ihre Romane – auch durch die Jugendbücher, die sie unter anderem Namen verfasst. Die Bestsellerautorin lebt mit Mann und Katzen im Großraum München.
Lieferbare Titel:
Liebe kann doch jedem mal passieren (Das-Haus-in-der-Chestnut-Road-Reihe 1)
Originalausgabe
© 2024 by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildungen von Junge Frau und Haus: © Hauptmann & Kompanie
Werbeagentur; Wolken: shutterstock_563282638
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783749906789
www.harpercollins.de
1 Julie
Die Sache ist die: Entscheidungen und ich, wir werden niemals Freundinnen werden. Nehmen wir eine gewöhnliche Speisekarte. Es gibt Weißweinrisotto oder Pasta mit Auberginen, und was immer ich mir aussuche, es wird garantiert das Falsche sein. Vom Nebentisch weht der Duft des Risottos herüber, wahlweise der des Nudelgerichts, und siehe da – habe ich es nicht gleich geahnt? Es ist wie bei einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, bei der ich mich niemals werde austricksen können. Ich liege einfach immer daneben. Das mag bei der Wahl des Abendessens keine weitreichenden Folgen nach sich ziehen, aber was, wenn ich beispielsweise ein Zimmer mieten möchte? Sagen wir, für die nächsten drei Monate, weil ich wirklich dringend Abstand brauche von zu Hause? Weil ich mir über so vieles klar werden muss, Sie machen sich keine Vorstellung davon. Weil ich nun, mit beinah dreißig, an einem Punkt meines Lebens angelangt bin, an dem sich all die falschen Entscheidungen der vergangenen Jahre aufs Gemeinste zu rächen beginnen. Nein, es geht nicht mehr nur ums Essen. Es geht um so vieles mehr.
Es geht darum, sich an einer Weggabelung des Schicksals exakt in die falsche Richtung zu begeben und es fortan nicht zu schaffen umzukehren. Es geht darum, sich erst zu nichts entschließen zu können, nur um dann – überhastet und am Rande der Verzweiflung – das gänzlich Verkehrte zu wählen. Was mich exakt in dieses Zimmer führt. Das Zimmer, das ich gemietet habe, weil schlicht keine Zeit blieb, wochenlang das Für und Wider abzuwägen, bis mir ein Bart wächst.
Ich starre die alte Dame an, die die Misere, in die ich mich hineinmanövriert habe, offensichtlich kein bisschen besser zu machen gedenkt. Mrs. Gastrell. Wohnhaft: 23 Chestnut Road, Apartment 1A. Hochgewachsen, hager, wachsame Augen in einem strengen Gesicht. Wäre ich ihr persönlich begegnet, bevor ich den Vertrag zur Untermiete unterschrieb, ich hätte mir die Sache mit dem Bart womöglich noch einmal überlegt. Doch wie schon erwähnt: Alles musste so unglaublich schnell gehen. So schnell, dass mir dieses winzige Detail durch die Lappen gehen konnte, diese leicht zu übersehende Nebensächlichkeit, die sich in diesen Minuten zu einem ausgesprochenen Fiasko entfaltet.
»Ich verstehe es immer noch nicht«, wiederhole ich, ein kleines bisschen inständiger noch als zwei Minuten zuvor. »Wie kann man ein fünfundzwanzig Quadratmeter großes Zimmer an zwei Personen gleichzeitig vermieten? Dazu noch an völlig Fremde?«
»Und ich sagte Ihnen bereits«, erwidert sie kühl, »sehen Sie in Ihrem Vertrag nach.« Mrs. Gastrell hält die Arme vor ihrem schmalen Körper verschränkt, während – wie war doch gleich sein Name? – sich mit einer Hand die Stirn zu reiben beginnt, bevor er es abrupt wieder bleiben lässt. Er ist der weitere Grund, weshalb sich diese Szene gerade zu einer ausgewachsenen Tragödie entspinnt. Ein sehr, sehr ausgewachsener Grund noch dazu: Mein Alter, würde ich schätzen, aber das dürfte das Einzige sein, das wir gemeinsam haben. Er sieht aus wie ein Investment-Banker Schrägstrich Unternehmensberater Schrägstrich Immobilienhai. Mittelgroß, mittelblond. Schöne Zähne. Ich weiß, was mich hierhergeführt hat. Doch wie ist einer wie er da hineingeraten?
»Hören Sie, Miss …«, beginnt er und wirkt irgendwie erschöpft dabei.
»Cooper. Julie Cooper.« Ich dagegen klinge rastlos, ich höre es selbst, und er stockt, als würde er abwägen, wie sinnvoll es ist, gegen eine womöglich drohende Panikattacke anzureden. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich mich nicht für jemanden gehalten, der leicht in Angstzustände gerät, und nun seht mich an! Meine Finger zittern vor Anspannung, während ich den Mietvertrag, den Mrs. Gastrell mir via E-Mail hatte zukommen lassen, aus meiner Handtasche krame. Es ist der Vertrag, an den ich mich klammere, seit mein Leben vor zwei Wochen quasi implodierte, seit meine Zukunftsvision, so düster sie auch gewesen sein mochte, von einer Sekunde zur anderen in ihre Bestandteile zerbarst.
»Vertrag zur Untermiete«, lese ich vor. »Halbes Zimmer in geräumiger Altbauwohnung, 12,5 Quadratmeter, Fenster, 1. Stock, 23 Chestnut Road, Brighton. Eigenes Badezimmer. Küche zur Mitbenutzung.«
Ich blicke auf.
Mrs. Gastrell sagt: »Und was bitte schön ist an halbes Zimmer uneindeutig?«
Ungläubig starre ich sie an – diese personifizierte Gleichgültigkeit, diese gönnerhafte Ignoranz –, bevor sich meine Stimme doch noch überschlägt. »Ein halbes Zimmer!«, rufe ich. »Ein halbes Zimmer ist normalerweise eine Art Kammer, richtig? So etwas, das in, sagen wir, London oder Cambridge oder eben in Brighton andauernd vermietet wird, weil man sich in derlei Städten nun mal nichts anderes leisten kann als einen überdimensionierten Schuhkarton! Ein halbes Zimmer heißt: Der Raum ist klein. Nicht mehr als eine Rumpelkammer. Wenn man Glück hat, verfügt er über ein Fenster. Ein halbes Zimmer heißt aber nicht, dass das Zimmer eigentlich fünfundzwanzig Quadratmeter misst und dann doppelt vermietet wird. Es heißt nicht, dass sich eine fremde Frau und ein fremder Mann besagtes Zimmer teilen. Ich kann doch unmöglich die Einzige sein, die das wahnwitzig findet, oder etwa doch?« Ich sehe von einer zum anderen. Mein Herz fühlt sich an, als wäre ich gerade einen Marathon gelaufen, doch ich traue mich kaum, Luft zu holen, denn die knistert vor Anspannung.
»Sollen wir ein Fenster öffnen?«
»Was?«
Mein potenzieller Mitbewohner betrachtet mich stirnrunzelnd, bevor er sich einem der beiden Fenster zuwendet.
Typisch britische Kassettenform. Hoch und hell. Kurzzeitig abgelenkt, lasse ich den Blick über den dunklen Holzboden schweifen, zum Stuck an der Decke. Die Flügeltür – herrje, ich wollte schon immer in einer Wohnung mit Flügeltüren leben! Zu schade. Es ist ein wirklich hübsches Zimmer, geräumig, lichtdurchflutet, von geschmackvoller Eleganz. Ein richtig schönes Zimmer – das ich mir ganz sicher nicht mit einem Mann teilen werde.
»Sie sehen aus, als würden Sie hyperventilieren.« Er schiebt den Rahmen nach oben und lässt Luft in den Raum fließen.
Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Und Sie wirken erstaunlich gelassen.«
»Das könnte eventuell daran liegen, dass ich Verträge lesen kann.«
»Dass ich …« Ungläubig starre ich ihn an. »Ich kann Verträge lesen! Vielleicht habe ich nur nicht damit gerechnet, zwischen den Zeilen nach … nach verdeckten Stolperfallen zu fahnden. Freundlich ausgedrückt.«
Mrs. Gastrell verzieht keine Miene. Überhaupt ist sie eine erstaunlich schweigsame Person, muss ich feststellen. Sie folgt unserer Unterhaltung, als säße sie auf den Zuschauerrängen eines Tennisturniers. Ping, pong. Ping, pong.
»Ich sage es nur ungern«, meldet sich der Mitmieter erneut zu Wort, »aber tatsächlich ist es mehr als normal für britische Verhältnisse, dass Zimmer an zwei Personen vermietet werden. Ich habe meine komplette Studienzeit so verbracht.«
»Scheint schon eine Weile her zu sein«, bemerke ich freundlich. »Ist in Ihnen nie der Wunsch aufgekeimt, über sich hinauszuwachsen und ein eigenes Zimmer für sich ganz allein zu beanspruchen?«
Er öffnet den Mund im selben Augenblick, in dem sein Mobiltelefon zu läuten beginnt. Dass er es in der Hand hält, fällt mir jetzt erst auf. Mr. Busybody, wie es scheint. Und es passt. Der Anzug wirkt wichtig und teuer, und wieso trägt er überhaupt einen? Es ist Samstag, das ist kein Vorstellungsgespräch, wir haben beide den Mietvertrag bereits unterschrieben, er seinen, ich meinen … Und nun finde den Fehler in diesem Satz. Wir beide. Mietvertrag. Unterschrieben. Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Und ich kann immer noch nicht fassen, dass mir das passiert.
»Es geht nicht.« Ich stopfe das Dokument zurück in meine Tasche, überlege es mir im nächsten Moment anders und strecke ihn stattdessen der Vermieterin entgegen. »Ich kann das unmöglich tun. Hiermit trete ich von dem Vertrag zurück. Es tut mir leid, aber Sie werden sich jemand anderen suchen müssen.«
Mrs. Gastrell mustert mich ungerührt. »Das macht nichts«, erklärt sie. »Solange Ihnen klar ist, dass ich die Monatsmiete, die Sie im Voraus bezahlt haben, leider einbehalten muss.«
Ich lasse die Schultern sinken. Nichts anderes hatte ich von dieser Frau erwartet. Vermutlich kann ich froh sein, dass ich nicht hier einziehe. Wer will sich schon mit einem blonden Harvey Specter das Zimmer und mit Dolores Umbridge die Wohnung teilen?
Wehmütig denke ich an mein kleines Apartment in Newcastle. Aber sobald ich das tue, spulen sich auch die anderen Bilder in meinem Kopf ab; ich sehe die erstarrte Miene meines Vaters, den enttäuschten Blick meiner Mutter. Ich spüre wieder, wie sich meine Kehle zuschnürt und der Boden mir entgegenrast.
Abrupt drehe ich mich um und flüchte aus der Wohnung. Nur dass ich bereits auf der Treppe gegen das nächste Hindernis stoße.
2 Julie
Es ist eine ausladende Männerbrust, gegen die ich da remple, beziehungsweise mehr die gepolsterte Schulter – der Mann ist einen guten, halb kahlen Kopf kleiner als ich, das Gesicht so rot wie die Tomatenspritzer auf seiner ehemals weißen Kochschürze.
»Mio dio«, nuschelt er unter einem dichten, schwarz-grauen Schnauzbart hervor, sobald ich von ihm abgerückt bin. »Das war knapp.«
Er balanciert eine mit gegrilltem Gemüse beladene Platte, einen Korb mit aufgeschnittenem Weißbrot, einen Teller mit köstlich duftenden Spaghetti und eine kleine Flasche Rotwein, samt Glas, das er ebenfalls in letzter Sekunde vor einem Sturz auf den Treppenabsatz retten konnte.
»Entschuldigung, das tut mir wahnsinnig leid.« Spontan nehme ich ihm den Brotkorb ab, der unter seinem Kinn klemmt. Und da ich schon dabei bin, schnappe ich mir die Weinflasche, die unter seinem Arm steckt, auch noch.
»Grazie, ragazza.« Er lächelt mich an.
Ich starre, auf einmal unsicher, was mich bis vor einer Minute noch beschäftigt hat: die Gedanken an meinen Zusammenbruch, die Atemnot, die mich aus Mrs. Gastrells Wohnung hatte flüchten lassen. Ich schätze den Mann auf Mitte fünfzig, Anfang sechzig vielleicht, vermutlich ist er Italiener, doch er strahlt eine Ruhe aus wie ein tibetanischer Tempel-Mönch. Seine braunen Augen funkeln, und mit einem Mal besänftigt sich mein Herzschlag. Als hätte jemand eine Klangschale in Schwingung gebracht, die mir ein gut gemeintes Ommmmm ins Ohr raunt.
Ein seltsamer Nachmittag ist das heute. Mit seltsamen Begegnungen. Und noch seltsameren Entscheidungen.
»Der Aufzug ist kaputt. Mal wieder.« Er verdreht die Augen. »Helfen Sie mir, das nach oben zu tragen, dann bin ich ganz bei Ihnen.«
»Ich wollte eigentlich gerade …«, beginne ich, doch da ist er schon auf halbem Weg die Treppe rauf, und ich kann ihm ja schlecht Brot und Wein zurück in die Hand drücken – in welche auch? Also folge ich ihm bis ins Dachgeschoss, wobei ich mich schon frage, was er gemeint haben könnte mit: Dann bin ganz bei Ihnen.
Oben angekommen gibt es, anders als in den übrigen Stockwerken, nur eine statt zwei Eingangstüren, und vor dieser platzieren wir das kleine, italienische Menü, das mit einem beherzten Klopfen und einem »Etwas zu essen für Sie, Mr. Walker! Stellen Sie das leere Geschirr einfach wieder vor die Tür, ich hole es später ab«, angekündigt wird.
»Künstler«, raunt der Mann mir zu, als würde das alles erklären. »Wir machen uns manchmal Sorgen, er könnte vor lauter Malen und Hämmern das Essen vergessen. Darum bringe ich ihm ab und an etwas an die Tür. Wir wollen doch nicht riskieren, dass er zu schwach wird, um sie zu öffnen.«
Er zuckt die Schultern, nimmt dann meinen Arm und führt mich die Treppe hinunter, was sich merkwürdig vertraut und gleichzeitig völlig unangebracht anfühlt.
»Also«, fragt er, »was hat sie getan?«
»Wer?«
»Mrs. Gastrell!«
»Oh. Sie hat … Sie …« Verwirrt runzle ich die Stirn, als mir einfällt, dass ich längst aus dem Haus sein müsste, um mir irgendwo ein günstiges Zimmer für die Nacht zu suchen, und nicht am Arm eines Wildfremden durch ein knarzendes Treppenhaus stolzieren sollte. Und woher will er überhaupt wissen, dass Mrs. Gastrell irgendetwas getan haben könnte?
»Was auch immer es war«, bekomme ich zu hören, »es ist sicher nichts, was nicht mit einem guten alten Kräuterschnaps zu neutralisieren wäre.«
Signore Orlando Esposito ist, wie ich keine drei Minuten später herausfinde, Inhaber des italienischen Lokals, das sich im Erdgeschoss des Mietshauses befindet und Little Italy heißt. Nachdem er mir dies erklärt hat, verliert er keine Zeit, mich vor sich her an seine Bar zu scheuchen.
»Nein, ich möchte wirklich nichts trinken«, protestiere ich.
»Unsinn, ragazza! Das ist ein altes Familienrezept! Du willst unsere Familie doch nicht beleidigen?«
Für eine Sekunde überlege ich, ob Orlando Esposito im Entferntesten an einen Mafiaboss erinnern könnte. Es würde zu diesem Tag passen, wenn ich am Ende in die Fänge eines Paten gerate. Aus dem Augenwinkel betrachte ich die weiß-rot eingedeckten Holztische, die Tropfkerzen in den bauchigen Weinflaschen, die zahllosen Bilder an den Wänden, die Orte, Strände und Personen in und aus Italien abbilden. Sieht so eine Mafia-Hölle aus? Absolut, befinde ich. Es sei denn, irgendjemand hat einen ahnungslosen Inneneinrichter vor die Aufgabe gestellt, eine klassisch italienische Taverne zu gestalten, die kein Klischee auslässt und wirkt wie eine Filmkulisse.
Signor Esposito – Orlando, wie er betont – schiebt mir ein kleines Glas hin, gefüllt mit einer trüben, dunklen Flüssigkeit. Er stößt sein eigenes dagegen und prostet mir zu.
»Wirklich … ich … also, normalerweise … Wissen Sie, wie viele gesundheitliche Risiken auf den regelmäßigen Verzehr von Alkohol zurückgehen?«, protestiere ich schwach. Orlando sieht mich eindringlich an. »Gut. Okay. Ich kann eine Ausnahme machen, nehme ich an. Wow. Das ist … « Ich beginne zu husten und höre erst wieder damit auf, als mir von hinten jemand auf den Rücken klopft.
»Der Familienschnaps?«, fragt eine weibliche Stimme. »Orlando, was hat die Ärmste verbrochen, dass du ihr dieses zweifelhafte Gebräu antust?«
»Sie hatte eine zweifelsohne denkwürdige Begegnung mit Mrs. Gastrell.«
»Oje.« Die junge Kellnerin schiebt ihr leeres Tablett auf die Theke, bevor sie sich auf den Barhocker neben mich hievt. Sie hat blondes, halblanges Haar, helle Augen und schöne, gerade Zähne. »In diesem Fall«, sagt sie, »nehme ich alles zurück und verlange auch einen Schnaps. Manche Menschen können einen schnurstracks zum Alkoholismus geleiten, und Mrs. Gastrell gehört ganz sicher dazu.« Sie seufzt vielsagend, bevor sie mich anlächelt. »Hallo. Ich bin Hannah.«
»Julie«, krächze ich. Meine Kehle fühlt sich leicht verbrannt an. »Was stimmt denn nicht mit Mrs. Gastrell?«
»Das hast du nicht selbst rausgefunden?«
»Sie hat bei dem alten Drachen ein Zimmer gemietet«, erklärt Orlando, »in ihrer Wohnung. Mehr weiß ich noch nicht.«
Es klingt vorwurfsvoll. Dabei ließ der Weg aus dem vierten Stock ins Little Italy nicht wirklich Raum für ausführliche Erklärungen. Also fasse ich die Problematik kurz zusammen und erkläre, dass mir nicht klar war, dass ich das Zimmer, welches ich gemietet hatte, würde teilen müssen, erst recht nicht mit einem Mann, und dass sich Mrs. Gastrell darüber hinaus als äußerst uneinsichtig erwies.
»Unglaublich«, sagt Hannah. »Ich meine, nicht das mit dem Zimmer für zwei, das ist unglücklicherweise inzwischen gar nicht mehr so unüblich, wie es sein sollte. Aber dass sie dir vorher nichts davon gesagt hat!«
»Sie behauptet, ich hätte es dem Mietvertrag selbst entnehmen müssen.«
Beide schütteln wir den Kopf, als einer der Gäste ruft. »Hallo? Fräulein? Könnte ich wohl noch was bestellen?«
»Einen kleinen Moment!« Hannah sieht über die Schulter zu dem Tisch neben der Küche, an dem ein junger Typ sitzt und mit seinem Handy spielt.
»Dante?«
»Hm?« Mit leichter Verzögerung hebt er den Blick von seinem Smartphone.
»Die Pause ist zu Ende.«
»Ach, wirklich?« Er hat schwarze, halblange Haare, dunkle Augen und ein anzügliches Grinsen auf dem Gesicht, das mich auf der Stelle erröten lassen würde, wäre ich nicht schon längst über meine Zwanziger hinweg.
Orlando bellt ihm einen Strang italienischer Sätze entgegen, und schließlich verdreht der Junge die Augen und nimmt betont lasziv den Weg in Richtung des wartenden Gastes auf. Als er an uns vorbeikommt, zwinkert er mir zu. Ich meine, ich kann nicht sicher sein, aber doch … Genau das hat er getan!
»Also, wo waren wir?«
Ich sehe Hannah an. Vermutlich besteht mein Blick aus lauter Fragezeichen, und sie lacht.
»Das war Dante«, erklärt sie. »Einer von Orlandos Söhnen. Beachte ihn gar nicht. Er hält sich für den italienischen Ryan Gosling oder so was.«
»Wenn er sich wenigstens für Marcello Mastroianni halten würde«, grummelt Orlando. »Also, wie viel verlangt sie?«
»Wer?«
»Mrs. Gastrell! Für dieses Zimmer! Das halbe!«
Ich nenne den beiden den Betrag.
»Was?« Hannah schreit auf, Orlando greift erneut zur Schnapsflasche. »Für die Hälfte des Zimmers?«
Ich nicke. »Es war das Günstigste, das ich in der Eile gefunden habe.«
»Wieso hattest du es eilig?«, fragt Hannah prompt.
Ich zögere ein paar Sekunden zu lange, und sie bemerkt es.
Orlando ebenfalls. Er sagt: »Ich werde mich mal wieder um die Bar kümmern. Bleib du ruhig sitzen, Hannah.« Dann verschwindet er ans andere Ende des Tresens.
Es ist ein seltsames Gefühl, an dieser Bar zu sitzen. Genauso wenig, wie ich mich bis vor ein paar Tagen für eine Anwärterin von Panikattacken gehalten hätte, gehöre ich nicht zu den Menschen, die allein, wahlweise flankiert von völlig unbekannten Personen, am Tresen eines Restaurants ausharren. Ich trinke auch keinen Schnaps, zumindest unter normalen Umständen nicht. Ich meine, ich bin Ärztin. Es mag Kolleginnen geben und Kollegen, die sich gerade deshalb in unnatürlichen Mengen einen hinter die Binde kippen, ich gehöre nicht dazu. Ich trinke nicht, maximal selten. Habe nie eine Zigarette angerührt. Die Zahl meiner Sexualpartner lässt sich bequem an zwei Fingern abzählen. Noch nie in meinem Leben habe ich einen Orgasmus vorgetäuscht.
Na, fabelhaft. Wie bin ich jetzt darauf gekommen?
Ah, ja, richtig. Weil ich ansonsten im Vortäuschen falscher Tatsachen gar nicht mal so untalentiert bin.
»Er ist ein guter Chef, oder?«, frage ich, während ich Orlando nachsehe und jeden weiteren Gedanken daran, was mich hierher nach Brighton geführt hat, von mir wegschiebe.
»Oh ja«, erwidert Hannah. »Der Beste. So einen hätte ich auch gern.«
Überrascht blicke ich sie an. »Er ist nicht dein Chef?«
»Nein, ich arbeite hier nicht wirklich, ich helfe nur hin und wieder mal aus.« Sie verzieht das Gesicht. »In letzter Zeit eher öfter. Eigentlich sollten Dante und Romeo – das ist der andere Sohn – sich mehr einbringen, immerhin ist das ein Familienbetrieb, doch die zwei sind zurzeit schwieriger zu bändigen als eine Horde Wühlmäuse.«
Orlando brummt etwas Unverständliches, während er eine Flasche Wasser, eine Schale Oliven sowie zwei weitere Gläser Schnaps vor uns abstellt und erklärt: »Wenn die beiden je erwachsen werden, veranstalte ich ein Feuerwerk!«
»Orlando!«
Ich zucke zusammen ob der Lautstärke der fremden Frauenstimme.
»La saltimbocca!«
»Meine Liebste«, erklärt Orlando lächelnd, bevor er voller Inbrunst zurückruft: »Sì, Maria, ich komme, ich komme.«
Hannah greift nach zwei Gläsern und schenkt uns Wasser ein, während sich zwischen Tresen und Küche eine hitzige Unterhaltung auf Italienisch entspinnt. Von meinem Platz aus kann ich Orlandos Frau nicht sehen, zu hören ist sie allerdings prächtig, weshalb ich mich beinah ängstlich im Raum umblicke, um zu prüfen, ob sich unter den Gästen jemand gestört fühlt. Offenbar nicht. Niemand sieht auch nur in die Richtung des Gezeters.
»Falls du dich das fragst«, beginnt Hannah, als hätte sie meine Gedanken gelesen, »ja, es geht hier meistens so turbulent zu. Ich meine, der Laden heißt nicht umsonst Little Italy. Ich war noch nie in Italien, aber so in etwa stellt man es sich vor, oder? Laut und lustig.«
»Sie streiten also gar nicht?«
»Auf keinen Fall! Orlando vergöttert Maria. Und solange er sie nicht infrage stellt, streitet auch niemand.« Sie grinst. »Manchmal höre ich sie bis in den zweiten Stock. Und mittlerweile wirkt dieser leicht überdrehte Italo-Soundtrack fast wie eine Art Einschlafmusik auf mich.«
Ich blinzle überrascht. »Du wohnst auch hier?«
»Jawohl. Und die Espositos direkt unter mir. Das macht es so praktisch, ab und zu einzuspringen, wenn Orlando Hilfe braucht. Aber eigentlich bin ich Journalistin – oder sagen wir: Lokalreporterin. Ich arbeite für den Argus.«
»Ah.« Ich setze eine wissende Miene auf.
»Du hast noch nie davon gehört, gib’s zu.«
»Äh … Nein. Tut mir leid.«
»Macht nichts.« Sie zuckt mit einer Schulter, und ich bekomme den Eindruck, dass es sehr wohl etwas macht.
»Irgendwann werde ich sicher mal für eine größere Zeitung schreiben, zumindest habe ich mir das fest vorgenommen. Bis dahin – Lokalnews, und ab und an das Little Italy. Es gibt wahrlich schlimmere Aushilfsjobs.«
»Aushilfsjob«, wiederhole ich nachdenklich.
»Genau.«
Hannah sieht mich fragend an, und ich schüttle den Kopf. »Ach, nichts. Ich dachte nur gerade, dass ich mir einen Aushilfsjob suchen sollte, um mir ein ganzes Zimmer zu leisten.« Ich könnte es mir natürlich auch so leisten, allerdings würde das eine gehörige Delle in meine Ersparnisse hämmern, und das gilt es besser zu vermeiden. Schließlich zahle ich zu Hause immer noch mein Apartment ab. Und ob ich nach meiner Rückkehr noch einen Job habe, steht in den Sternen. Ob ich ihn dann noch haben will, genauso.
»Was ist denn dein Beruf?«, fragt Hannah, und unwillkürlich verziehe ich das Gesicht. »Was, ist er so furchtbar?«
»Nein. Vermutlich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht doch. Ich bin Zahnärztin.«
»Ooooh.« Nun ist es an Hannah, schmerzvoll das Gesicht zu verziehen, und ich muss lachen.
»Ganz genau. Ooooh.«
»Bei manchen Berufen fragt man sich, wie jemand auf die Idee kommen kann, das lernen zu wollen, oder? Solche Jobs wie … Tatortreiniger! Schlachter! Oder eben Zahnärztin! Oh, sorry, das waren miese Vergleiche.« Hannah lacht.
»Nein, schon gut.« Ich greife nach dem Schnapsglas. Orlando hat recht, er mildert den Stress ungemein. »Es stimmt, was du sagst – es gibt womöglich kaum etwas Schlimmeres.«
»Mich würde schon das Geräusch des Bohrers wahnsinnig machen. So grässlich!«
»Und ob«, stimme ich zu. »Ich hasse dieses Geräusch. Allein der Gedanke daran bereitet mir Gänsehaut.« Und weil es sicher nicht schaden kann, greife ich mir den Schnaps von Hannah auch noch, und dies ist der Punkt, an dem ihr Lächeln ein kleines bisschen ins Flackern gerät. Sie ist Journalistin, denke ich. Vermutlich wittert sie die Geschichte dahinter – eine Geschichte, die es definitiv gibt, auch wenn ich sie so ungern wie selten erzähle und generell lieber gar nicht.
»Mie signore!« Orlando ist zurück und stellt je einen Teller dampfender Spaghetti vor uns ab.
»Was …«, beginne ich.
»Pasta alla nonna«, sagt er. »Die heutige Empfehlung meiner lieben Maria gegen stressvolle Begegnungen aller Art. Dazu ein Glas Rotwein?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, stellt er Gläser und eine Karaffe vor uns ab, und ich sehe Hannah an. »Es ist ein solch kolossaler Jammer, dass ich hier nicht einziehen kann.«
»Ich wette, sie hat die Miete trotzdem einbehalten«, vermutet Orlando.
»Das hat sie«, rufe ich. »Allerdings hat sie das!«
Ich probiere die Nudeln, und sie sind fantastisch! Die Tomatensoße ist süß und kräftig, ich schmecke Knoblauch und Oliven, unter einer Decke frisch geriebenen Parmesans – herrlich! Vielleicht sollte ich öfter jemand anderen für mich entscheiden lassen, nicht nur, was das Essen betrifft. Vielleicht ist das das Geheimnis zu meinem Glück.
»Als würde sie das Geld brauchen.« Hannah schüttelt den Kopf, während sie ihr Glas hebt und mir zuprostet. Nach mittlerweile drei Schnäpsen auf nüchternen Magen sollte ich vermutlich nichts mehr trinken, aber – mein Gott. Harte Tage erfordern harte Maßnahmen. Also stoße ich mein Weinglas gegen ihres und nehme einen Schluck. So gut! Orlando weiß, wie man seine Gäste verzückt, das steht fest.
»Wobei«, fährt Hannah fort. »Vielleicht braucht sie das Geld doch? Ich meine, wie sonst sollte sie auf die Idee kommen, mit jemandem zusammenleben zu können? Diese Frau ist so wenig mit der menschlichen Rasse kompatibel wie ein Moskito.«
»Sie hatte einen Ehemann!«, wirft Orlando ein. »Er hat sie nur nicht überlebt.«
»Aaah, das tut mir wiederum leid.« Das tut es wirklich. Ich bin kein Unmensch. »Vielleicht hat sie eine kleine Rente und will sie aufbessern?« Ich sehe fragend in die Runde.
»Vielleicht«, beginnt Orlando, »hat sie irgendjemandem einen Auftragskiller auf den Hals gehetzt oder sie plant, jemandem einen Auftragskiller auf den Hals zu hetzen, und braucht jetzt dringend Zusatzeinnahmen. Ah, scusa. Ich muss zurück an den Zapfhahn.«
Hannah zuckt mit den Schultern. »Bei Mrs. Gastrell ist alles vorstellbar. Alles.«
»Ist sie wirklich so furchtbar?«
»Ich will es mal so formulieren: Vermutlich niemand im Haus hat sie je ein freundliches Wort sagen hören, Small Talk ist ganz und gar nicht ihr Ding, lächeln auch nicht. Und obwohl sie scheinbar keinerlei Interesse an ihren Haus-Mitbewohnern zeigt, weiß sie doch immer über alles genauestens Bescheid und taucht in den unmöglichsten Momenten hinter dir auf, fast wie ein Geist.«
Ich starre Hannah an. »Allmählich tut mir der Kerl leid, der die andere Hälfte des Zimmers gemietet hat.«
»Wird er denn einziehen?«
»Es sah ganz danach aus.«
»Dann stört ihn diese seltsame Konstellation nicht?«
Ich schnaube. »Er sagte, er habe seine gesamte Studienzeit so gewohnt. Und es klang, als wollte er es auch nicht anders. Da fällt mir ein …« Ich nehme eine weitere Gabel voll Pasta und krame dann mein Handy aus der Tasche, um auf die Uhr zu sehen. Es ist zwanzig nach sechs. Und ich habe zwei verpasste Anrufe von meiner Mutter. Seufzend schiebe ich das Telefon zurück in die Tasche. »Ich sollte langsam aufbrechen und mir ein Hotelzimmer suchen, zumindest für die nächsten paar Nächte. Bis ich ein anderes zur Untermiete gefunden habe.«
»Es tut mir ehrlich leid, dass ich dir nicht anbieten kann, bei mir zu wohnen«, sagt Hannah. »Bis vor Kurzem hatte ich noch ein Zimmer frei, aber dann ist meine Schwester zu mir gezogen.« Ein Schatten huscht über ihr Gesicht, ganz kurz nur, was mich auf den Gedanken bringt, dass in unser aller Leben Schatten lauern, manche finster, manche schwarz.
»Ein paar Nächte«, fügt Hannah schließlich hinzu, »könntest du aber sicher auf der Auszieh-Couch in meinem Arbeitszimmer schlafen.«
»Oh, nein, das geht wirklich zu weit. Du und Orlando wart schon netter zu mir, als ich je gutmachen kann. Ehrlich gesagt wart ihr das Beste, was mir seit langer Zeit passiert ist.« Es stimmt, denke ich. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist mir so viel Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft noch nie begegnet. Für eine Sekunde lasse ich mich von der Vorstellung treiben, in dieses Haus zu ziehen, mich mit Hannah anzufreunden, mich abends mit ihr hier auf ein Glas Rotwein zu treffen … Bei dem Gedanken an noch mehr Wein fange ich bereits im Sitzen an zu schwanken. Als ich versuche, vom Hocker zu klettern, wird es schlimmer.
»Nein, ich werde einfach meinen Koffer …« Beinah wäre ich umgekippt, doch mitten in der Bewegung erstarre ich. Mein Koffer! Ach, du heiliger Mist, ich habe meinen Koffer oben in der Wohnung gelassen!
Ich fasse Hannah am Arm, will ihr gerade mitteilen, dass ich tatsächlich so dumm war, mein Gepäck in Mrs. Gastrells Höllenschlund zu vergessen, als mir jedes weitere Wort in der Kehle stecken bleibt. In der Tür zum Little Italy steht Mrs. Gastrells derzeit einziger Mieter, die blonden Haare vom Wind zerzaust, die Anzugjacke von Regentropfen gesprenkelt, in der Hand meinen dunkelblauen Rollkoffer.
Und Hannah erklärt mit weit aufgerissenen Augen: »Na, also den würde ich unbedingt auch auf meiner Couch schlafen lassen.«
3 Alex
Ich gebe zu, ich war nicht gerade begeistert, als mir klar wurde, dass sich im Erdgeschoss meiner neuen Bleibe ein Restaurant befindet, und nun fühle ich mich in meiner Ahnung bestätigt: Der Laden ist knallvoll, das Stimmengewirr lauter als dieser furchtbare italienische Schlager, den sie hier herunterdudeln, und würde es nicht schon seit Stunden regnen, wären die Tische und Stühle draußen sicher ebenfalls besetzt. Selbstverständlich zeigen die Fenster in meinem Zimmer zur Straße. Ich kann von Glück sagen, dass ich ohnehin so gut wie nie hier sein werde und dass, wenn ich spät nach Hause komme, das Restaurant bereits geschlossen sein wird.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Richtig?
Trotz der vielen Menschen in dem Lokal entdecke ich sie sofort: Sie lehnt an der Bar, die Hand auf dem Arm einer blonden, jungen Frau, und sie blickt in meine Richtung. Die Art, wie sie die Stirn runzelt, wirkt so angestrengt, dass ich allein vom Hinsehen Kopfschmerzen bekomme. Obwohl ich damit gerechnet hätte, dass sie längst über alle Berge ist, bin ich nicht überrascht darüber, sie hier anzutreffen. Mrs. Gastrell sagte etwas in der Art wie Sie ist unten beim Italiener, verlassen Sie sich drauf, und – keine Ahnung, woher sie das wissen konnte – offensichtlich hatte sie recht. Ich traue dieser Frau nicht. So viele Jahre sie auf dem Buckel hat, so faustdick hat sie es hinter den Ohren. Ich schwöre, ich kenne diesen gerissenen Blick. Meine Großmutter sieht ganz genauso aus, wenn sie etwas im Schilde führt. Und ich glaube dieser ach so ahnungslosen Dame keine Sekunde lang, dass ihr nicht klar war, dass Julie Cooper völlig unbedarft in dieses Mietverhältnis geschlittert ist. Und dass sie sich nicht zudem köstlich über die Szene amüsiert, die sich vorhin in ihrer Wohnung abgespielt hat.
Ich schiebe den Koffer vor mir her, während ich auf meine Beinah-Mitbewohnerin zugehe.
»Hallo«, beginne ich. »Mrs. Gastrell hatte so eine Vermutung, dass ich Sie hier finden würde. Sie haben Ihren Koffer stehen lassen.«
»Ha!«, ruft die Blonde neben ihr. »Sie hatte so eine Ahnung. Verstehst du jetzt, was ich meine?«
Für ein paar Sekunden sieht Julie verwirrt von mir zu ihrer Freundin und wieder zurück, dann sagt sie: »Danke. Ich wollte ihn gerade holen.«
Sie ist einen guten Kopf kleiner als ich. Und als würde ihr im selben Moment auffallen, dass sie zu mir aufsehen muss, klettert sie zurück auf den Barhocker, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen. Sie wirkt etwas ruhiger als vorhin, allerdings immer noch weit entfernt von gelassen. Warum auch immer verursacht sie mir ein schlechtes Gewissen, obwohl ich im Grunde gar nichts getan habe. Klasse.
»Hören Sie«, beginne ich. »Es tut mir leid, wie das eben gelaufen ist. Ich würde Ihnen das Zimmer überlassen, aber ich fange übermorgen einen neuen Job an, außerdem besteht sie darauf, den Raum an zwei Personen zu vermieten. Andernfalls an eine, die eben die doppelte Miete zahlt.«
»Und das können Sie sich nicht leisten, nehme ich an.«
Das klang erstens nicht wie eine Frage und zweitens beinah zynisch. Hinter ihr taucht ein korpulenter Barmann auf und stellt zwei Schnapsgläser mit einem trüben, bräunlichen Gebräu auf dem Tresen ab. Er macht keine Anstalten, wieder zu gehen, verschränkt stattdessen die Arme auf der Theke und sieht mich neugierig an. Ohne mit der Wimper zu zucken, kippen die zwei Frauen den Inhalt der Gläser hinunter.
»Warum sollte ich sie mir leisten wollen?«, frage ich schließlich. »Ich habe einen gültigen Mietvertrag für ein halbes Zimmer, und das gedenke ich zu nutzen.«
»Und das gedenkt er zu nutzen«, wiederholt der Wirt.
Julie Cooper sieht mich an. Ihre dunklen Augen sind groß und rund und vorwurfsvoll. Sie stechen aus ihrem Gesicht hervor, trotz der Brille, trotz der dichten, markanten Brauen, die eigentlich alles dominieren müssten. Sie sieht aus wie eine dieser grau-braunen Rennmäuse mit Riesenaugen, und bereits zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen fünf Minuten frage ich mich, weshalb ich mich schlecht fühle. Ich habe nichts weiter getan, als mir nach bestem Wissen und Gewissen eine möglichst bezahlbare Unterkunft zu suchen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich unterdrücke ein Stöhnen, dann sehe ich weg, geradewegs in das lachende Gesicht von Julies Sitznachbarin.
»Hi.« Sie streckt mir eine Hand entgegen. »Ich bin Hannah. Zweiter Stock, Apartment 2B.«
»Alex. Logan. 1A, schätze ich.«
»Sind Sie Anwalt?«
»Was?«
»Ich weiß nicht, Sie klingen wie einer.«
Der Wirt murmelt irgendwas auf Italienisch und füllt die Schnapsgläser nach. Julies Blick fällt darauf, und ich bin kurz davor, einen Kommentar abzugeben, etwas wie: Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Körpergewicht in Alkohol aufwiegen möchten?, doch in letzter Sekunde lasse ich es sein. Es geht mich nichts an. Nicht, wie viel sie trinkt, und nicht, ob sie später hier auf dem Tresen schläft. Oder darunter.
»Hier ist Ihr Koffer. War nett, Sie kennenzulernen.«
»Ganz meinerseits.« Als sie mich jetzt erneut ansieht, fällt mir auf, wie glasig ihre Augen sind, das tiefe Braun längst nicht mehr so klar wie in meiner Erinnerung.
Ach, verdammt. Ich würde mir die Haare raufen, hätte ich mir verräterische Gesten dieser Art nicht während des Jura-Studiums abgewöhnt. »Also gut«, beginne ich. »Was haben Sie jetzt vor? Wollen Sie eine Nacht darüber schlafen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen?«
Sie legt den Kopf schief. »Sind Sie wirklich Anwalt?«
»Ist das eine Fangfrage?«
»Sie sind tatsächlich Anwalt und können sich kein eigenes Zimmer leisten?«
Für eine Sekunde hat sie mich aus dem Tritt gebracht. Die Frau hat keine Ahnung, wie viel Wahrheit in dieser Frage steckt. Und wie viel Tragik.
»Ich bin sehr selten zu Hause«, erkläre ich schließlich. »Falls Sie es sich anders überlegen. Ich meine, die Miete für den ersten Monat haben Sie ohnehin schon bezahlt.«
Ich warte ihre Antwort nicht ab, drehe mich um und halte auf den Ausgang zu.
4 Alex
Ich kann verstehen, dass Julie Cooper keine Lust hat, sich mit einem fremden Mann ein Zimmer zu teilen, das kann ich wirklich. Und ich muss zugeben, meine bisherigen Mitbewohner waren allesamt männlich, aber um ehrlich zu sein, andersherum wäre es mir auch egal. Es stimmt, was ich ihr gesagt habe: Ich bin ohnehin so gut wie nie zu Hause. Wenn man das hier ein Zuhause nennen kann. Es ist mehr ein Provisorium, etwas anderes soll es auch nicht sein. Eine günstige Möglichkeit für mich, regelmäßig ein paar Stunden zu schlafen und meine Sachen unterzustellen.
Als ich vom Restaurant in die Wohnung zurückkehre, ist darin kein Laut zu hören, und dennoch habe ich das sichere Gefühl, dass Mrs. Gastrell nichts entgeht. Für ein paar Sekunden bleibe ich ganz still stehen, den Blick auf die Tür am Ende des Flurs gerichtet, hinter der sich die Räume der alten Dame befinden. Ich höre gar nichts, keine Schritte, keinen Fernseher, nicht mal ein Knarzen. Ich frage mich, weshalb sie sich Untermieter ins Haus holt, es würde mich wirklich interessieren. Die Wohnung ist Altbau, aber überaus stilvoll, mit Stuck an den hohen Decken, edlen Holzböden und verschnörkelten Türen. Mein Blick fällt auf den Läufer, auf dem ich stehe – ein echter Perser, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht kann sie sich die Miete allein nicht mehr leisten. Vielleicht will sie es nicht.
Ein letztes Mal lausche ich in die Stille, dann öffne ich die Tür zu meinem Zimmer und sehe mich um. Es ist geräumig, quadratisch, verfügt über zwei hohe Fenster, durch die immer noch Licht in den Raum fällt, obwohl es draußen bereits dämmert. Es ist möbliert, aber nur minimal: Je ein Bett, je ein Schrank. Auf jeder Seite ein Nachttisch mit Lampe. Ein großer Tisch unter dem Fenster, zwei Stühle davor. An der Decke eine Art Kristallleuchter. Der Raum mag puristisch eingerichtet sein, doch die Möbel sind antik und ganz sicher nicht billig gewesen.
Ich beginne damit, mein Zeug aus den zwei Kisten zu räumen, die ich neben einem Koffer mitgebracht habe. Sachbücher hauptsächlich, Nachschlagewerke, Fachliteratur. Die Anzüge habe ich in Kleidersäcken transportiert, damit sie nicht verknittern. Bügel um Bügel Zweiteiler in allen erdenklichen Grautönen, von hell bis dunkel, für jeden Anlass. Ich hänge sie in den Schrank. Staple die Hemden daneben, noch einmal doppelt so viele, beige, weiß, rosa, grau. Krawatten, Einstecktücher. Wenn ich etwas an diesem Job hasse, dann diese grässliche Einheitlichkeit der Garderobe, die sich wie eine Uniform anfühlt. Wobei, das ist falsch. Es gibt weit gravierendere Dinge an der Arbeit in der Kanzlei zu hassen als die Notwendigkeit, sich zu verkleiden. Canton, Briar & Best zählt nicht umsonst zu den namhaftesten Anwaltsbüros in diesem Teil Englands. Der Umgangston ist kühl, die Erwartungen sind hoch, das Arbeitspensum enorm. Und dennoch, oder womöglich deswegen, sollte ich dankbar sein, dass ich das Auswahlverfahren für mich entscheiden konnte.
Ich frage mich, ob Mrs. Gastrell ein Bügelbrett im Haus hat. Ich könnte die Hemden in die Reinigung geben, ich könnte mir das Geld dafür aber auch sparen. Und sparen wäre in meiner Situation sicher die bessere Idee.
Ich bin gerade dabei, Socken und Schuhe zu verstauen, als mein Handy klingelt, zum wiederholten Mal an diesem Abend. Und es ist, wenig überraschend, noch einmal Gran am Apparat.
»Hey«, melde ich mich knapp.
»Alex, hallo. Hier ist deine Granny.«
»Ich weiß. Die Nummer leuchtet auf, du erinnerst dich?«
»Natürlich. Ich bin doch nicht senil. Das ist reine Höflichkeit. Du weißt noch, was das ist?«
Ich würde den Kopf schütteln, hätte ich das Telefon nicht unters Kinn geklemmt. An ihren guten Tagen ist meine Großmutter eine derart scharfzüngige, schlagfertige Person, dass es mir an den anderen, nicht so guten Tagen umso schwerer fällt, mit ihrer beginnenden Altersdemenz umzugehen. Aber es ist, wie es ist. Und das Wohnheim die derzeit beste Lösung für uns alle, auch wenn sie das im Augenblick leider anders sieht.
»Weißt du, ich habe nachgedacht: Die Enkelin von Mrs. Parker … Du weißt noch, wer Mrs. Parker war? Die alte Dame, die in der Redrode Street neben uns gewohnt hat? Sie ist leider vor ein paar Jahren gestorben, was ich gar nicht mitbekommen hätte, weil wir ja schon ewig nicht mehr dort wohnen, aber Mr. Hersher, der Hausmeister …«
»Gran? Komm zum Punkt, ja? Was ist mit der Enkelin von Mrs. Parker?« Mit einer Hand teste ich die Stärke der Matratze, bevor ich mich daraufsetze und ein paarmal hoch und runter wippe.