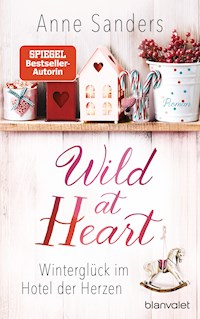8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Anne Sanders macht uns einfach Lust auf Urlaub.« Frau von Heute
Wer träumt nicht von einem Haus in Cornwall? Elodie hatte bisher eigentlich andere Pläne – bis ihre Beziehung spektakulär scheitert und ihr Exfreund ihr statt ewiger Liebe Geld für einen Neuanfang bietet. Als sie auf das Inserat für ein hübsches kleines Bed & Breakfast in St. Ives stößt, räumt Elodie kurz entschlossen das Konto leer, kauft das Haus und reist nach Südengland. In dem kleinen Fischerdörfchen stürzt sie sich nicht nur in die Renovierung, sondern lernt auch die schüchterne Helen und die lebenslustige alte Dame Brandy kennen, mit denen sie bald eine tiefe Freundschaft verbindet. Gemeinsam erleben die drei Frauen einen unvergesslichen Sommer, nach dem nichts mehr so sein wird, wie es war – vor allem nicht in Elodies Herz …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Wer träumt nicht von einem Haus in Cornwall? Elodie hatte bisher eigentlich andere Pläne – bis ihre Beziehung spektakulär scheitert und ihr Exfreund ihr statt ewiger Liebe Geld für einen Neuanfang bietet. Als sie auf das Inserat für ein hübsches kleines Bed & Breakfast in St. Ives stößt, räumt Elodie kurz entschlossen das Konto leer, kauft das Haus unbesehen und reist nach Südengland. In dem kleinen Fischerdörfchen stürzt sie sich nicht nur in die Renovierung, sondern lernt auch die schüchterne Helen und die lebenslustige alte Dame Brandy kennen, mit denen sie bald eine tiefe Freundschaft verbindet. Gemeinsam erleben die drei Frauen einen unvergesslichen Sommer, nach dem nichts mehr so sein wird, wie es war – vor allem nicht in Elodies Herz …
Autorin
Anne Sanders lebt in München und arbeitet als Autorin und Journalistin. Zu schreiben begann sie bei der Süddeutschen Zeitung. Als Schriftstellerin veröffentlichte sie unter anderem Namen bereits erfolgreich Romane für jugendliche Leser. Die Küste Cornwalls begeisterte Anne Sanders auf einer Reise so sehr, dass sie spontan beschloss, ihren Roman Sommer in St. Ives dort spielen zu lassen. Dieser eroberte die Herzen der Leserinnen und wurde zum Bestseller. Auch Mein Herz ist eine Insel war ein großer Erfolg. Sommerhaus zum Glück ist nun ihr dritter Frauenroman bei Blanvalet.
Von Anne Sanders bereits erschienen
Sommer in St. Ives
Mein Herz ist eine Insel
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Anne Sanders
Sommerhauszum Glück
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: James A. Guilliam/Photolibrary/Getty Images
JF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21450-0V002www.blanvalet.de
Für meine Mutter,die mich erst auf den Zauber von St. Ives aufmerksam gemacht hat.
März
1. Elodie
Der Augenblick, in dem der Groschen fällt und es dennoch nicht klick macht?Das ist garantiert der, in dem ich mich gerade befinde, und das nicht erst seit den zwei Minuten, die ich hier stehe und an einer Tür rüttle, die sich einfach nicht öffnen lassen will. Noch einmal drücke ich gegen das Holz. Nichts. Ich ziehe den Schlüssel heraus, schiebe ihn zurück ins Schloss, ich drehe ihn ein wenig, woraufhin er tatsächlich einrastet, doch darüber hinaus – absolut nichts. Frustriert trete ich von der störrischen Eingangstür einige Schritte zurück, dann steige ich die Stufen zur Straße hinunter und blicke von dort an der alten, grau-weißen Hauswand des Cottages hinauf.
Die Adresse? Stimmt.
Das Häuschen? Sieht genauso aus wie auf den Fotos.
Der Himmel? Wirkt, als wolle er mich verspotten mit seinem klaren Sternenzelt, das bis vor fünf Minuten noch unter einer wütenden, regenpeitschenden Wolkendecke verborgen lag, die mich vom Bahnhof St. Ives vor sich hergetrieben und meine komplett durchnässten Klamotten zu verantworten hat. Ich schüttle den Kopf, während ich nach meinem Koffer greife. Voller Ungeduld zerre ich an dem Plastikgriff, der sich prompt aus seiner Halterung löst – ich umklammere ihn mit der Hand, während der Trolley mit einem dumpfen Laut auf den nassen Asphalt klatscht.
Für einen Moment schließe ich die Augen. Dann öffne ich sie wieder. Ich sehe von dem Griff in meiner Hand zu dem Koffer zu dem Cottage, das ich nie zuvor betreten habe, das aber mir gehört, auch wenn ich es nicht fertigbringe, diese vermaledeite Tür zu öffnen. Über mir kreischt eine Möwe, und ich sehe, was da auf mich zukommt, und ich kann gerade noch verhindern, dass mich der Vogelkot ins Auge trifft. Er landet auf meiner Hand, die ich mir schützend über das Gesicht gehalten habe, und ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht.
Neuanfang im Nirgendwo? Niemand sonst könnte so zielsicher vom Regen in die Traufe schlittern wie Elodie Hoffmann.
Doch wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ist es nicht so?
2. Helen
Hast du gehört? Das Peek-a-boo ist unter der Haube. Die neue Besitzerin ist gestern Abend angereist, sagt Mrs. Barton. Also, entweder ist sie die neue Besitzerin, oder sie wollte einbrechen, hat aber letztlich die Tür nicht aufbekommen. Eine ziemlich junge Frau. Hatte einen Koffer dabei. Ist damit in Richtung Sloop Inn abgezogen.«
»Ich denke nicht, dass man bei einem Haus davon sprechen kann, es sei unter die Haube gekommen«, erwidere ich abwesend. Ehrlich, ein altes Cottage ist doch kein Heiratskandidat. Ich wische mir die Hände an meiner Schürze ab und lasse den Blick zu der Wanduhr über der Kaffeemaschine schweifen. Punkt neun. Wäre diese Uhr nicht bereits gestellt, könnte man es nach der Zeit tun, zu der Brandy jeden Morgen unser Café betritt.
»Helen?«
»Hm?«
»Wo bist du mit deinen Gedanken, Kindchen?«
»Äh …« Das Peek-a-boo, richtig. »So jung kann die Frau nicht sein«, sage ich, »wenn sie es sich leisten kann, ein Bed & Breakfast zu kaufen, oder?«
»Mmh.« Brandy lässt sich auf ihrem Stammplatz an dem kleinen Tisch in der Ecke nieder, während die Türglocke einen weiteren Gast ankündigt.
»Hi, Dory«, begrüße ich Doreen, die ein paar Häuser weiter eine kleine Boutique betreibt. Sie hat ihr Telefon ans Ohr gepresst und bedeutet mir mit einer Hand, dass ich kurz warten soll. Ich schiebe zwei Scones in eine Papiertüte, dann befülle ich den Wasserkessel, gebe Tee in die Kanne, die ich für Brandy zubereite, und welchen in den Becher für Doreen, ohne dass eine von beiden eine Bestellung hätte aufgeben müssen. So ist das hier, in Kennard’s Kitchen, Chapel Street, St. Ives. Die Holzböden sind alt, die Metallstühle abgenutzt, der Geruch von Schwarztee und Gebäck hängt in den Wachstüchern wie die Seeluft über dem Hafen. Dieselben Gäste bestellen die gleichen Speisen, die Liam in der Küche auf die immer gleiche Weise zubereitet. Die Touristen bringen Abwechslung, aber niemals genug, und am Ende wiederholt sich ihre Anwesenheit in unserem Ort, wie sich die Gezeiten wiederholen. Sie kommen, und sie gehen, wieder und wieder.
Das Geklimper von Brandys Parka reißt mich aus meinen Gedanken. Dieses Ding. Nie geht sie ohne diese Jacke aus dem Haus, selbst bei strahlendem Sonnenschein nicht, das soll mir mal einer erklären. Der Stoff ist grün wie schmutziger Tang und mit Taschen übersät, in denen Brandy weiß der Himmel was aufbewahrt.
»Was schleppst du da nur mit dir herum?«, frage ich wie beinahe jeden Morgen, während sie das speckige Ungetüm über den Stuhl neben sich drapiert. Und wie beinahe jeden Morgen bleibt die Frage unbeantwortet.
»Sorry, Helen, irgendwas ist da mit einer Lieferung schiefgelaufen«, begrüßt mich Dory, nachdem sie ihr Telefongespräch beendet hat.
»Macht doch nichts«, antworte ich. Dann reiche ich ihr den Thermobecher Tee und die Tüte mit den Scones, und sie legt mir dafür die passende Anzahl Pfund auf den Tresen. Alles wie immer.
»Was er wohl dafür verlangt hat?«, überlegt Brandy laut. »Immerhin hat er sich seit Jahren nicht um das Haus gekümmert. Ich will gar nicht wissen, wie es da drinnen aussieht.«
»Das will keiner«, stimme ich zu. Das Peek-a-boo steht seit Ewigkeiten leer, seit die Besitzer, Olive und Peter, es an ihren Neffen und Alleinerben überschrieben haben, der allerdings in Australien lebt und niemals Anstalten machte, sich um die kleine Pension zu kümmern. Jetzt, nach Olives und Peters Tod, hat er sich offenbar dazu entschlossen, das Haus zum Verkauf anzubieten. Erzählte die alte Mrs. Barton, die im Cottage nebenan lebt und immer mindestens eines ihrer altersschwachen Augen auf ihre Nachbarn gerichtet hat.
»Redet ihr vom Peek-a-boo?« Dory ist schon fast wieder zur Tür hinaus. »Mrs. Barton erzählte mir vor ein oder zwei Monaten, dass jemand gekommen sei, um nach dem Rechten zu sehen und ein bisschen sauber zu machen.«
»Ach ja?« Ich werfe Brandy einen fragenden Blick zu. Wenn es wirklich so gewesen wäre, müsste sie eigentlich davon wissen, denn Brandy weiß alles. Immer.
»Huh«, macht sie. »Ich hatte ja keine Ahnung! Die alte Dame gehört allmählich wirklich nicht mehr zu den verlässlichsten Quellen, wenn es um wichtigen Tratsch geht.«
Ich lächle über ihren entrüsteten Gesichtsausdruck und über die »alte Dame«, denn Brandy ist selbst nicht mehr die Jüngste, womöglich sogar ähnlich alt wie Mrs. Barton, wer weiß das schon? Ich betrachte meine Freundin, die ich seit so vielen Jahren kenne und die bereits so viele Geschichten erzählt hat, doch in den seltensten Fällen handelten die von ihr selbst. Brandy kann alles aus jedem herauskitzeln, mit ihrem offenen Wesen, den großen, vertrauenswürdigen Augen und … Keine Ahnung, wie genau sie es anstellt. Am Ende jedenfalls scheint sie jedes Detail über den anderen zu wissen und niemand etwas über sie. Ist es tatsächlich möglich, dass ich nicht einmal sagen kann, wie alt Brandy ist? Ich schüttle den Kopf – obwohl es stimmt –, dann verabschiede ich Dory und laufe in die Küche, um Brandys Omelett zu bestellen.
»Ist viel los draußen?«, fragt Liam.
»Noch nicht«, erwidere ich. Durch die Durchreiche betrachte ich ihn, wie er mit dem Rücken zu mir auf der Anrichte Zwiebeln würfelt. Breitbeinig steht er da, die Schultern gestrafft, die muskulösen Arme vibrieren im Takt seines Schneidemessers. Liams halblanges helles Haar wird im Nacken mit einem einfachen Küchengummi zusammengehalten, doch schon bald wird er es wieder radikal abrasieren, zum Sommer hin, wenn die Surfsaison beginnt und ihn nach Feierabend nichts mehr in dieser Küche hält. Oder in diesem Haus. In unserer Wohnung, an unserem Tisch. Nicht ich, nicht die Zwillinge, nicht das, was ein Familienleben sein sollte. Es gab Zeiten, da sind wir zusammen nach Newquay gefahren, sind mit den Brettern rausgepaddelt, dem Sonnenuntergang entgegen. Aber das ist lange her. Dass wir Spaß hatten, ist lange her. Dass wir glücklich waren, richtig glücklich, daran kann ich mich kaum mehr erinnern. Okay, das stimmt so nicht. Ich könnte mich daran erinnern, doch ich habe mir lange nicht mehr die Mühe gemacht.
Ich seufze, unbeabsichtigt, und Liam wirft mir über die Schulter einen Blick zu.
»Was ist los?«, fragt er.
Wenn ich das wüsste, denke ich. »Gar nichts.« Ich drehe mich um und kehre in den Laden zurück.
Inzwischen sind zwei weitere Tische besetzt. Ich bringe Brandy ihren Tee, den sie, ohne hinzusehen, eingießt, während sie Lorna am Nachbartisch lautstark von der jungen Frau berichtet, die das Peek-a-boo erworben hat. »Irgendwas stimmte mit dem Schlüssel nicht«, erklärt sie, »die Tür ging nicht auf. Also hat sie ihren Koffer genommen und ihn ins Sloop Inn geschleppt. Ich nehme an, dass sie sich dort ein Zimmer gemietet hat.«
»Aber wieso sollte sie das tun, wo ihr doch jetzt ein ganzes Bed & Breakfast gehört?«
»Weil sie Probleme mit dem Schlüssel hatte«, rufe ich in Lornas Ohr.
»Aaaaah«, macht die. Und: »Oh, Kindchen, bringst du mir ein Stück von Liams Früchtekuchen? Ge…«
»…toastet, ich weiß.«
Brandy wirft mir einen Blick zu. Ich sage: »Sie hat ihr Hörgerät nicht drin«, doch das ist nicht der Grund, weshalb sie mich so durchdringend ansieht.
»Du wirkst abgelenkt, Helen«, sagt sie. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Ja, sicher.« Ich nicke ihr zu, während ich auf den Tisch neben der Tür zusteuere, wo sich tatsächlich ein Touristenpaar niedergelassen hat, aus Italien, dem Akzent nach zu urteilen. Ich nehme ihre Bestellung auf. Dann gebe ich Liam in der Küche Bescheid, schneide zwei Scheiben Früchtebrot auf und stecke sie in den Toaster, und wieder laufe ich zurück zu Liam, um Brandys Omelett abzuholen.
»Alfie ist immer noch nicht aufgetaucht«, knurrt der, als ich den Teller aus der Durchreiche nehme.
Alfie, Liams Küchenhilfe. »Ich rufe ihn gleich an«, erwidere ich.
Ich bringe Brandy ihr Frühstück. Und wieder beschleicht mich dieses merkwürdige Gefühl, das heute schon den ganzen Morgen an mir haftet. Wie ein Déjà-vu in Dauerschleife. Als bestünde mein ganzes Leben aus nicht mehr als einer Aneinanderreihung von Dingen, die ich schon einmal getan habe, schon tausendmal eigentlich. Brandy sieht mich wissend von der Seite an. Die Uhr zeigt 9:17. Werden die Tage länger, oder kommt es mir nur so vor?
3. Elodie
Was soll das heißen, er ist nicht zu erreichen? Als es darum ging, mir eine überteuerte Bruchbude zu verkaufen, war er durchaus zu sprechen. Er ist wo bitte? Auf einem Retreat? Yoga? In den tasmanischen Bergen?« Göttin der Nachsicht, gib mir Kraft. »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Er ruft mich umgehend zurück, ist das klar? Sonst hetze ich ihm eine Meute Anwälte auf den Hals.«
Ich knalle das Smartphone auf den Tisch, greife mit beiden Händen in meine Haare und ziehe einmal kräftig daran. Mann! Das darf ehrlich nicht wahr sein. Ich weiß, mein Umzug hierher war überstürzt, ich weiß, es war riskant, ein derart altes Cottage zu kaufen. Doch hätte ich auch nur einen Augenblick darüber nachgedacht, ich wäre in Frankfurt geblieben und hätte das getan, was ich immer tue – eine Liste geschrieben, abgewogen, das Für und Wider betrachtet, mich natürlich dagegen entschieden. Und dann was? Was dann? Ich spüre, wie mir Tränen in die Augen steigen, doch nicht aus Verzweiflung, sondern aus Wut. Über mich selbst. Darüber, dass ich mich habe hinreißen oder besser: vertreiben lassen, darüber, dass ich meine Gefühle nicht besser im Griff hatte und am Ende geflohen bin wie ein Kaninchen vorm Fuchs.
Du hast es dir noch nicht einmal vorher angeschaut, raunt eine Stimme in meinem Kopf. Du bist über die Anzeige gestolpert, hast über den günstigen Preis gestaunt, hast dich vor diesem Häuschen stehen sehen und hast auf den Kontakt-Button geklickt. Und dann hast du an Per gedacht und bist noch einen Schritt weiter gegangen.
Gekauft.
Hast du es seinetwegen getan, Elodie? Aus Rache? Um ihn zu strafen?
»Und fängst du jetzt an, mit dir selbst zu sprechen?«, murmle ich.Dann blinzle ich die dummen Tränen fort und lasse mich auf einen der zwölf Stühle fallen, die zu diesem riesigen ovalen Tisch gehören.
Der ganz nett ist, wie ich zugeben muss. Eine kleine Ausbesserung hier, ein wenig Politur da, so wird am Ende sicherlich ein schönes Möbelstück daraus. Vom Boden ziehe ich meine Handtasche auf den Sitz neben mir und zerre meinen Planer heraus, um eine neue Liste anzulegen. Einkauf, schreibe ich darauf, darunter: Holzpolitur. Dann stutze ich. Was braucht man noch, um einen alten Tisch auf Vordermann zu bringen? Lappen? Lappen sind gut. Ich setze Lappen auf die Liste und dazu Schmirgelpapier, denn mit irgendwas sollte ich die Macken wohl ausbessern, oder nicht? Ich starre auf die Liste vor mir, bis die Buchstaben vor meinen Augen zu flirren beginnen. Dann lege ich den Kopf auf den Wörtern ab und schlage mit der Stirn ein paarmal dagegen.
Ich habe keine Ahnung, wie man Möbel restauriert.
Geschweige denn, wie man ein altes Bed & Breakfast wieder auf Vordermann bringt.
Ich habe niemals eine Wand gestrichen oder ein Loch gebohrt, noch eine Lampe angeschlossen.
Ich hebe den Kopf und schreibe Do-it-yourself-Ratgeber auf die Liste. Und dann noch Scheuermittel, Putzschwämme, Bodenreiniger. Einmalhandschuhe. Putzen werde ich wohl können, und wenn schon, dann mit Stil.
Das Telefon brummt laut gegen die Tischplatte. Mein Vater. Ich verziehe das Gesicht. Gott, er fehlt mir jetzt schon. Und wenn ich in diesem Augenblick mit ihm spräche, würde er das auch wissen, also ignoriere ich das Geräusch, schiebe das Handy in die Gesäßtasche meiner Jeans und mache mich mit meinem Lebensplaner unter dem Arm auf zur näheren Inspektion meines neuen Eigenheims.
Neben dem Esszimmer, das aus besagtem Riesentisch, den Stühlen und einer dazu passenden Anrichte besteht, befinden sich im Erdgeschoss die Küche und auch der Wohnbereich, in dem einige mit ehemals weißem Leinen verhangene Möbel stehen. Mit den Fingerspitzen hebe ich ein verstaubtes Laken an, unter dem sich womöglich ein Sessel befindet oder aber eine Armee Spinnen, wer weiß das schon? Letzteres ist glücklicherweise nicht der Fall. Und der Sessel sieht nicht schlecht aus. Das Sitzkissen scheint ein wenig ausgebleicht, doch – ich hebe das Tuch ein Stück höher – das Möbel wirkt ebenso antik wie seine Verwandten im Esszimmer.
Ich reiße die Laken herunter, eines nach dem anderen. Zwei Sessel treten zutage, breite Sitzflächen, mit einem feinen hellgrünen Stoff bespannt, und Schnitzereien in den Holzeinrahmungen. Der Couchtisch und ein wirklich hübscher Vitrinenschrank sind aus dem gleichen Holz, und dann ist da noch diese atemberaubende Ledercouch, wie sie in alten Bibliotheken oft steht. Die Wände müssen gestrichen werden, die Böden vermutlich abgeschliffen, doch die Möbel, die waren ganz sicher ein Schnäppchen.
Der Kühlschrank dagegen hat schon bessere Tage gesehen, an den Gasherd traue ich mich nicht heran. Das große Fenster und die Glastür daneben zeigen von der Küche auf einen winzigen Garten, der von Unkraut aufgefressen wird. Dahinter Häuser, weitere Cottages, alt, mit bröckelnder Fassade. Kein Meer weit und breit. Ich traue mich gar nicht, laut zu denken, doch es war von Meerblick die Rede in dieser Anzeige von dem schmucken, ehemaligen Bed & Breakfast im malerischen St. Ives, ideal für Nostalgieliebhaber. Meerblick. Handwerkliche Fähigkeiten von Vorteil, aber kein Muss.
Oh, Elodie.
Ich steige die schmale Treppe hinauf in den ersten Stock. Es ist schummrig in diesem Gang, also sehe ich mich nach einem Lichtschalter um, doch als ich ihn betätige, macht es nicht einmal klick. Im Dämmerlicht des Fensters am Ende des Flurs zeichnen sich drei Türen ab, die zu den Gästezimmern führen müssen. Als ich die erste öffne, bleibt mir für einen Augenblick die Luft weg. Das Zimmer ist kahl, bis auf einen schmutzigen, vormals beigefarbenen Teppich, die Fensterrahmen sind ergraut und abgesplittert, die Wände fleckig. Das kleine angrenzende Bad ist dunkelgrün gefliest – viel mehr lässt sich ohne Licht nicht erkennen, denn es hat kein Fenster. Einem plötzlichen fachfraulichen Impuls folgend, gehe ich trotzdem hinein und drehe im Schein meines Smartphones an den zwei Hebeln des Wasserhahns. Nichts passiert, dann keucht und spuckt das matte Silberrohr rostroten Dreck ins Becken. Ich öffne die anderen beiden Türen, das nahezu gleiche Bild zeichnet sich ab.
Wie benommen lasse ich mich auf die Stufen der Treppe sinken – mir wohl bewusst, dass ich die Jeans danach werde desinfizieren müssen, wer weiß, wer in diesen Teppichen haust –, schlage meinen Planer auf und beginne eine weitere Liste.
– Türschloss kaputt, muss ausgetauscht werden
– Kein Strom
– Was ist mit dem Wasser?
– Gästezimmer müssen komplett renoviert werden
– Heizung funktioniert vermutlich nicht
Letzteres ist nicht mehr als eine Mutmaßung. Es ist eiskalt in diesem Haus, dabei waren einige der Heizkörper aufgedreht.
Ich sehe nach oben, wo sich laut Vertrag das Dachgeschossstudio befinden sollte, in dem ich künftig wohnen werde, so man darin wohnen kann, versteht sich. Ich brauche einen Moment, um mich auf den nächsten Schock vorzubereiten, der ganz sicher auf mich wartet. Ich habe damit gerechnet, dass einiges zu tun sein wird, natürlich habe ich das. Ich meine, Nostalgieliebhaber? Handwerkliche Fähigkeiten? Dann der Kaufpreis. Ich habe womöglich ein wenig über meinen Sachverstand hinaus gehandelt, aber ich bin kein Esel. Es hieß, das Haus sei bezugsfertig. Dass nun kein Strom da ist und kein Wasser, dass nicht einmal die Tür aufzubekommen war, das verblüfft mich nun doch. Hätte eine Nachbarin, Mrs. Barton oder so ähnlich, mir nicht geraten, durch die Garage zu gehen und es an der Hintertür zu versuchen, säße ich vermutlich immer noch auf den Stufen vorm Haus.
Was noch?, kritzele ich also auf das Papier, einfach, weil ich beim Schreiben besser denken kann. Was kommt da noch auf mich zu? Schon jetzt habe ich den Eindruck, diese Aufgabe hier ist größer, als meine Courage es jemals war. Und meine Torheit. Alles zusammen.
Erneut surrt mein Telefon.
Ich seufze.
»Hey, Papa.«
»Elodie.« Er lässt ein paar Sekunden verstreichen, als habe er nach wie vor keine Worte dafür, dass seine Erstgeborene quasi fluchtartig das Land verlassen hat, um in England ganz von vorn anzufangen. »Wie ist das Wetter?«
»Ähm …« Ich rapple mich auf und gehe zu dem Fenster hinüber, das auf die Gasse vor dem Haus zeigt und auf andere Häuser, die vermutlich Meerblick haben. »Das Wetter ist schön«, erkläre ich und spähe zu dem blauen, nur von wenigen Wattewolken betupften Spalt Himmel hinauf, der von hier aus zu sehen ist. »Es ist frisch, aber sonnig.«
»Mmmh«, macht mein Vater. Dann seufzt er. »Ich fürchte, alles andere traue ich mich nicht zu fragen. Vielleicht sollte ich später noch mal anrufen.«
Ich ignoriere seinen Einwand. »Ich bin gut angekommen«, sage ich, »alles hat bestens geklappt. Der Ort scheint sehr hübsch zu sein, und das Haus …« Ich drehe mich einmal um die eigene Achse, während ich mir auf die Lippen beiße. »Ich werde es mir erst noch etwas genauer ansehen und melde mich dann wieder bei dir, in Ordnung?« Da. Nur zur Hälfte gelogen.
»Das hört sich nicht sehr überzeugend an. Wie sieht das Haus aus? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du einfach so einen Kaufvertrag unterschrieben hast, ohne dich zu beraten. Dass dir eine Bank dafür Geld gegeben hat, ist mir ein Rätsel. Und England? Wieso ausgerechnet Cornwall?«
Ich lasse den Kopf hängen. Mein armer, armer Vater kennt leider nur einen Bruchteil der Wahrheit, und ich habe keine Ahnung, wie ich ihm den Rest beibringen soll. Zum Beispiel dass das Geld keinesfalls von einer Bank stammt.
»Und weshalb so überstürzt? Ist etwas vorgefallen? In deinem Büro? Ich dachte, du liebst deinen Job?«
»Ich …« Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Habe ich meinen Job geliebt oder nur die Tatsache, dass ich ihm dadurch nah sein konnte? Im Nachhinein ist es schwer nachzuvollziehen, weshalb ich mich überhaupt auf eine derartige Konstellation eingelassen habe. Mittlerweile kommt es mir so vor, als sei ich geistig umnachtet gewesen – die vergangenen zwei bis drei Jahre lang circa.
»Ich ruf dich wieder an, Papa, versprochen«, sage ich.
»Lass mich wissen, wenn ich etwas für dich tun kann, Spätzchen.«
»Das mache ich vielleicht wirklich.«
»Verdammt, Elodie, ich wusste es, du brauchst einen Anwalt. Was ist los? Sag es mir!«
Ich ringe mir ein Lachen ab und beschwichtige ihn so weit, dass er sich auf später vertrösten lässt. Mein Vater mag Anwalt sein, ein gerissener noch dazu, doch von seinen Töchtern hat er sich immer kleinkriegen lassen. Ich bin ein Papakind, durch und durch. Und ein Familienmensch, absolut. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, ihn, meine Stiefmutter und meine Stiefschwester zurückzulassen, um hier ganz allein von vorn anzufangen.
Und schon wieder das Telefon.
»Wirklich, Papa, ich rufe dich wieder an, heute noch, versprochen.«
»Per hier.«
Ich klicke den Anruf weg. Dann starre ich auf das Handy, während es erneut zu vibrieren beginnt, Pers Nummer auf dem Display, die ich schon vor Wochen aus meinen Kontakten gestrichen habe. Dumm nur, dass ich sie dennoch auswendig kann.
Ich nehme das Gespräch an, während ich wütend die Treppe nach oben ins Dachgeschoss stapfe. »Ich dachte, wir hätten das geklärt«, sage ich kalt. »Ruf mich nicht mehr an.«
»Wo steckst du, Elodie?«
»Ehrlich, Per, du bist der Letzte, der das Recht hat, mich irgendetwas zu fragen, und das weißt du genau.«
Schweigen. Dann: »Elodie.« Mehr Schweigen. »Du fehlst mir.«
Ich lege auf. Ich kann diese Stimme nicht mehr ertragen. Dieses blöde Gesäusel mit dem beknackten schwedischen Akzent. Du liebe Güte, er lebt seit zwanzig Jahren in Deutschland. Vermutlich spielt er diesen dämlichen Tonfall nur vor, so wie er alles andere auch vorspielt.
Wütend reiße ich an der Tür zum Dachgeschosszimmer. Sie quietscht, als ich sie aufstoße, was mir eine Gänsehaut bereitet. Der Anblick des sich vor mir erstreckenden Raums tut nichts, um das ungute Gefühl zu vertreiben. Tropfendes Dach, schreibe ich auf meine Liste. Schimmel? Ich lehne im Türrahmen, den Lebensplaner wie einen Rettungsanker umklammernd, und lasse den Blick durch den leeren Raum schweifen, über die feuchten Flecken auf dem Teppich zu den schmutzigen Fenstern und weiter zu den Holzbalken, in deren Winkeln sich Staub und Spinnweben sammeln.
Eine SMS trifft ein.
PERS NUMMER: War es wirklich die schlaueste Idee, das Geld für eine Bruchbude in Cornwall zu verpulvern?
Der Mund steht mir offen, während ich auf mein Telefon starre. Dieser Scheißkerl! Und fragt noch so scheinheilig, wo ich bin. Woher weiß er es? Woher weiß er, wofür ich das Geld …
PERS NUMMER: Für 250 000 bekommt man kein Hotel, Liebling, hat dir dein Papa das nicht gesagt? Wenn du Geld brauchst, um es wieder loszuwerden, sag mir Bescheid.
PERS NUMMER: Komm nach Haus, Elodie. Du fehlst mir.
Am Türrahmen rutsche ich nach unten, bis mein Hintern den verseuchten Fußboden berührt. Meine To-do-Liste ergänze ich um: Neue Telefonnummer.
4. Elodie
Wenn man aus einer Stadt wie Frankfurt kommt, denke ich, mit ihrer geschäftigen Versunkenheit und fast ausnahmslosen Anonymität, dann kann so ein Ort wie St. Ives wirken wie ein Schock auf das Immunsystem: Alle Sinne sind auf einmal aktiviert, man bekommt große Augen angesichts der unfassbaren Schönheit, die Lunge atmet tiefer – frische, salzige Meeresluft –, man möchte alte Steinmauern berühren, den Sand durch die Finger rinnen lassen, die Zehen darin vergraben. Auf der anderen Seite aber fühlt man sich auch verletzlicher, denn St. Ives ist klein, und als Fremde in der Vorsaison sticht man heraus wie ein roter Luftballon unter einem Dutzend weiße. Vor allem, wer sich nicht als Touristin outet. Wer sich mit einem Schlüssel an der Tür eines alten Cottages zu schaffen macht, ohne es aufzubekommen.
»Sie sollten sich jemanden suchen, der sich damit auskennt, junges Fräulein«, sagte Mrs. Barton, meine neue und offenbar äußerst interessierte Nachbarin heute Morgen zu mir, nachdem ich meinen Rundgang durchs Haus beendet und noch einen Versuch in Sachen Eingangstür unternommen hatte. »Soll ich jemanden für Sie anrufen?«
Ich zögerte, aber nur kurz. Ich werde wohl nicht darum herumkommen, das hier – und einiges andere – reparieren zu lassen. Und wenn man jemandem trauen darf, dann doch wohl einer so freundlichen alten Dame?
Also fragte ich: »Wüssten Sie denn jemanden?«, woraufhin Mrs. Barton kicherte.
»Aber natürlich, Kindchen, was denken Sie denn?«, sagte sie, trippelte zurück in ihr Haus und kehrte nach fünf Minuten mit der Information wieder, ein Mann namens Chase Bellamy wolle gegen vierzehn Uhr vorbeischauen, um sich die Misere, wie sie es nannte, anzusehen.
Die Misere. Ich trat einige Meter zurück, auf die andere Straßenseite, um mich bei Tageslicht davon zu überzeugen, dass das Cottage, das nun mir gehört, genau das nicht ist.
Es ist ein altes Häuschen, ja, aber nicht mehr oder weniger heruntergekommen als seine ebenso betagten Nachbarn, zumindest von außen nicht. Es war einmal weiß und ist es immer noch halbwegs, die Fenster im Erd- sowie Obergeschoss sind die typisch englischen Rechtecke, die man nicht kippt, sondern von unten nach oben schiebt. Vor den Fenstern hängen Blumenkästen, die es zu bepflanzen gilt, wie auch die Kästen an dem schmiedeeisernen Geländer, das eine Art Terrasse umgibt – so lang wie das Häuschen selbst und bestimmt vier Meter breit –, von der dann die Treppe auf den Gehsteig führt. Links daneben schließt sich eine schmale Einfahrt an mit einer ebenso engen Garage, durch die man wiederum eine Hintertür erreicht, die in die Kammer neben der Küche führt.
Es ist nicht viel. Doch es ist meins.
Und wie ich so dastand, auf der Straße vor dem Cottage, da wurde mir bewusst, dass wir ein paar Dinge gemeinsam hatten, mein neues Haus und ich. Beide hatten wir schon einiges erlebt, offensichtlich, und auch schon bessere Tage gesehen, wir wirkten erschöpft und ein wenig angeschlagen. Das, was wir jetzt brauchten, waren Ruhe und ein bisschen Pflege und die Chance auf einen Neuanfang.
Ich nickte dem Cottage wohlwollend zu.
Ich werde mich um uns zwei kümmern. Und ich werde das Beste aus diesem Neuanfang machen, ganz egal, was der Rest der Welt davon hält.
Ich nippe an meinem Kaffee und verziehe das Gesicht. Diese Plörre ist wahrlich ungenießbar, doch was will ich von einem Getränk, das der Wirt eines Pubs in einen offensichtlich in die Jahre gekommenen Mitnahmebecher ohne Deckel kippt, auch erwarten? Ich schiebe ihn ein Stück von mir weg über den schmalen Holztisch vor dem Sloop Inn, von dem aus man einen fantastischen Blick über den Hafen genießt. Oh ja, die Aussicht ist weit besser als der Kaffee, das lässt sich auf keinen Fall leugnen. Boote schaukeln im Wasser. Möwen stolzieren auf der Brüstung, die die schmale Straße von dem kleinen Strand trennt. Musik begleitet ihren Spaziergang, ein Song aus dem Schlagen der Wellen, dem Läuten der Schiffsglocken und dem sporadischen Gekreische ihrer Artgenossen. Am Ende des Piers zeichnet sich ein weißer Leuchtturm gegen den strahlend blauen Himmel ab. Dahinter: noch mehr Wasser und noch mehr Sand, als gäbe es in diesem Elftausend-Einwohner-Städtchen kaum etwas anderes als Strand und Meer. Das ist doch schon etwas, denke ich. Das Cottage mag noch viel Anstrengung erfordern, aber mit diesem Ort hier hatte ich recht. Er ist genauso zauberhaft wie auf den Fotos im Internet, genauso wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Ich ziehe den Kaffeebecher wieder zu mir heran und versuche einen weiteren Schluck. Doch bevor ich darüber erneut eine Grimasse schneiden kann, halte ich inne: An der Brüstung, neben zuvor erwähnten spazierenden Möwen, lehnt ein Mann. Er trägt eine schwarze Anzughose, ein weißes, kurzärmeliges Hemd und eine Sonnenbrille, und obwohl ich seine Augen hinter den getönten Gläsern nicht erkennen kann, bilde ich mir ein, dass er mich mustert, ja, doch, ziemlich sicher, mit zusammengepressten Lippen und finsterem Blick. Ich weiß nicht, weshalb mir sofort Per in den Sinn kommt, aber er tut es. Womöglich wegen unseres Gesprächs heute Morgen. Oder weil dieser Typ all das verkörpert, was ich in Frankfurt hinter mir gelassen habe. All die Steifheit und Überheblichkeit und … das ganze Testosteron.
Ich wende den Blick ab. Die Sache mit dem Kaffee lasse ich bleiben. Ich nehme den Becher, werfe ihn in den nächsten Mülleimer und mache mich auf den Weg in das fremde Haus, das mein neues Zuhause werden soll.
Das Schloss sei verrostet, erklärt Chase Bellamy mir, sobald er sich den Schaden an der Tür besehen hat. Das Salzwasser in der Luft greife das Metall an, das passiere bei den Häusern an der Küste ständig.
»Aha«, murmle ich.
Er lächelt mich an. »Ich gebe Ihnen die Nummer des Schlossers, okay? Das dürfte ganz schnell erledigt sein.«
»Im Gegensatz zum Rest der Misere, wie Mrs. Barton das nennt.« Damit führe ich ihn durch die Garage zur Hintertür und dann ins Haus hinein.
»Der Strom funktioniert nicht«, erkläre ich ihm auf dem Weg zur Treppe, »die Heizung ebenso wenig. Und oben fehlt das halbe Dach. Ich frage mich, was sich der Kerl dabei gedacht hat, diese Immobilie in einem solchen Zustand zu verkaufen.«
Der Mann, der darauf besteht, dass ich ihn Chase nenne und nicht Mr. Bellamy, lacht, und ich runzle irritiert die Stirn.
»Sorry«, sagt er, und ich muss zugeben, sein Grinsen ist entwaffnend. »Es ist bloß – das ist ein wirklich altes Haus, in dem wirklich lange nichts mehr gemacht wurde. Sind Sie zur Besichtigung auch durch die Hintertür gekommen?«
»Nun …« Ich überlege noch, wie ich einem Fremden am besten erkläre, dass ich das Haus keineswegs vor dem Kauf besichtigt habe, ohne komplett verrückt rüberzukommen, da ist Chase durch eine Tür verschwunden, die ich bisher noch nicht geöffnet hatte.
»Der Sicherungskasten«, ruft er mir aus der kleinen Abstellkammer zu, während er einen in die Wand eingelassenen Schrank öffnet. »Aaaaah«, macht er, und dann klickklickklick, und schon flackert über meinem Kopf eine Lampe auf.
Chase kehrt zurück in den Flur. »Die Sicherungen waren draußen, das ist alles«, sagt er. »Vermutlich eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem der Strom wieder angestellt wurde.«
»Allmählich komme ich mir dumm vor«, sage ich, »aber man hat mir versichert, dass Strom und Wasser funktionieren würden. Und im Dach sind wirklich Löcher«, füge ich hinzu.
Wieder lacht er, und ich stelle fest, dass er ein offenes, sympathisches Grinsen hat und warme, verschmitzte Augen, komplett mit Lachfältchen drum herum. Chase Bellamy ist ein attraktiver Mann, keine Frage, doch ich bin weiß Gott nicht mehr an seiner Art interessiert, seien einzelne Exemplare noch so adrett anzusehen. Ich führe ihn die Treppe hinauf ins Dachstudio, dann in eines der Badezimmer, damit er sich das rostrote Wasser ansehen kann. Schließlich lenke ich ihn in den Keller, wo sich der Heizkessel befindet – das vermute ich, denn ganz sicher setze ich keinen Fuß in dieses Verlies, aus dem mir kalte, feuchte Luft entgegenschlägt. Auch Chase kommt schnell wieder nach oben, zwei Stufen auf einmal nehmend. Als er zu seinem Schlussplädoyer ansetzt, zücke ich meinen Planer und Stift, um mir Notizen zu machen.
»Mit dem Dach«, sagt er, »kann ich Ihnen helfen. Es sieht danach aus, als sei die Abflussrinne defekt, was die Ziegel an manchen Stellen durchfeuchtet hat – das könnte schlimm ausgehen, wirkt aber so, als sei es erst vor Kurzem passiert. Die Heizung dagegen – wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der Kessel muss ausgetauscht werden. Den Keller sollte sich ebenfalls jemand genauer ansehen, er ist ziemlich feucht. Und was die Wasserleitungen betrifft, würde ich einen Sanitärfachmann hinzuziehen. Möglich, dass man das lösen kann, ohne gleich die Rohre austauschen zu müssen.«
»Die Rohre austauschen?«
Das Entsetzen muss mir ins Gesicht geschrieben stehen, denn Chase setzt ein aufmunterndes Lächeln auf. »Alles kann, muss aber nicht«, sagt er. »Das gilt wohl auch für den Rest des Hauses.«
»Okay«, krächze ich. Dollarzeichen tauchen vor meinem inneren Auge auf, nein Pfundzeichen. Ich fürchte, ich werde nun doch meinen Vater einschalten müssen, ich kann nicht das ganze Haus sanieren lassen, dafür reicht mein Geld nicht.
Ich habe eine kleine Pension gekauft, doch ich kann nicht darin wohnen. Stattdessen sitze ich am Abend erneut im SloopInn, wo der Wirt mir großzügigerweise abermals das schöne Zimmer mit Sicht auf den Hafen zur Verfügung gestellt hat, ich teile mir den Tisch mit einem sagenhaften Steak und meinem Kaufvertrag, und beides bearbeite ich wie eine Verhungernde ihr Gemüsebeet. »Da steht nichts von Löchern im Dach und Rohren, die erneuert werden müssen«, grummle ich, während ich mit meinem Stift Kreuze und Kringel und Ausrufezeichen in das Papier säge. Doch da steht, dass das B&B vererbt wurde und sich schon länger nicht mehr in seiner vorgesehenen Nutzung befindet. Ich drücke auf meinem Kugelschreiber herum, Mine raus, Mine rein. Schließlich raufe ich mir die Haare in der Erkenntnis, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als meinen Vater darum zu bitten, dieses Bürokratenkauderwelsch für mich durchzusehen, mit dem er sich auskennt, ganz im Gegensatz zu mir.
Und warum hast du ihn nicht schon vorher um Hilfe gebeten, Elodie, hm? Warum nicht?, fragt die Stimme in meinem Kopf.
»Weil er mich nicht hätte gehen lassen wollen«, raunze ich zurück, dann nehme ich einen kräftigen Schluck von meinem Weißwein.
»Wer wollte Sie nicht gehen lassen, Kindchen? Und wohin?«
Vor meinem Tisch steht eine rundliche alte Frau mit einem strubbeligen grauen Haarturm auf dem Kopf und veilchenblauen Augen. Sie trägt einen schlammgrünen Parka, der von Taschen übersät ist, und darunter Leggins und ein Paar schwarze Gummistiefel.
»Äh …«, versuche ich.
»Ich bin Brandy«, erklärt sie und lässt sich auf dem Stuhl mir gegenüber nieder. »Hier, Sie sehen aus, als könnten Sie ihn vertragen.« Damit schiebt sie mir einen Schokoriegel entgegen, der ganz den Eindruck erweckt, als sei er schon einmal verschenkt worden.
»Nun …« Ich starre einen Moment auf die Schokolade, dann auf die runzelige Gestalt, schließlich sehe ich verstohlen auf die freien Plätze um uns herum.
»Harter Tag?«, erkundigt sie sich.
Ich ziehe meine Unterlagen – Kalender, Vertrag, Handy – auf meine Seite des Tisches, um ihr Platz zu machen. »Könnte man sagen«, murmle ich dann. »Ausnehmend schön war er jedenfalls nicht.«
»Mmmh.«
Ich betrachte noch einmal Brandys Gesicht, dann werfe ich einen Blick in Richtung Bar, von wo mir der mittlerweile vertraute Wirt zuruft: »Essen Sie den Schokoriegel nur. Sie haben ein Steak bestellt, da kann man beim Nachtisch ein Auge zudrücken.«
Auf dem Tisch brummt mein Telefon, und Pers Nummer leuchtet auf, die ich zwischenzeitlich als Gustav Arschloch abgespeichert habe. Ich setze abermals mein Glas an die Lippen, nippe daran, Brandy sieht auf das Display, wiederholt in einem lächerlich komischen Akzent das Wort Arschloch, und ich pruste die Hälfte des Weins durch die Nase zurück auf den Tisch.
»Klingt ein bisschen wie arse«, sagt Brandy noch, und ich lache lauter. Sie sieht mich aus großen Augen an, in denen Belustigung schimmert, aber auch Wissen und Verständnis und – ich weiß nicht, was es mit dieser alten, forschen, beinahe unverfrorenen Dame auf sich hat, aber ich finde sie … nett.
»Elodie«, stelle ich mich vor. »Elodie Hoffmann.«
»Ah, was für ein schöner Name. Sind Sie Französin?«
»Meine Mutter war aus Paris.«
War. Erneut flackert Erkenntnis in Brandys Augen auf, aber sie kommentiert die Bemerkung nicht. »Es freut mich, Sie kennenzulernen, meine Liebe. Willkommen in St. Ives.«
»Oh, danke schön«, erwidere ich. »Ich wurde schon bestens willkommen geheißen. Von einem wirklich euphorischen Wolkenbruch beispielsweise. Dann kam ich nicht in das Haus, das ich gekauft habe, weil sich die Tür nicht öffnen ließ. Und schließlich …« Ich nehme ein Taschentuch aus meiner Handtasche, um damit über die besudelte Tischplatte zu wischen, »… hat mir noch eine Möwe auf den Kopf geschissen.«
Brandy lacht so laut, dass ich automatisch wieder mit einfalle. »Aaah, ich könnte mir vorstellen, das bringt Glück, Kindchen«, sagt sie, und als sie schließlich auf mein Handy deutet und fragt: »Also, wer ist Gustav Arschloch?«, bin ich mir zwar nicht sicher, was ich von ihrer unverhohlenen Art halten soll, doch es ist spät, ich bin müde, der Tag war wirklich hart, und womöglich ist es an der Zeit, sich bei jemandem auszuheulen, und wenn es nur für drei Minuten und bei einer völlig Fremden ist.
»Mein Ex«, sage ich also, aber das Wort kommt mir dann doch nur schwer über die Lippen. Darf ich Per als meinen Ex bezeichnen, wo wir offiziell nie richtig zusammen waren? Wo ich immer nur das schmutzige Geheimnis war, das er vor der Welt und speziell vor seiner Frau verborgen hielt? Mir dreht sich der Magen um bei diesen Gedanken, und schnell greife ich noch einmal zu meinem Glas, in der absurden Hoffnung, Alkohol könne ihn beruhigen.
»Trinken Sie nichts?«, frage ich.
Aus einer der zahllosen Taschen ihres Parkas zieht Brandy einen Flachmann hervor. »Ich habe mein Getränk immer dabei«, sagt sie und nippt daran, bevor sie sich verschwörerisch nach vorn beugt. »Absinth«, flüstert sie. »Ich lasse ihn aus Frankreich einfliegen.« Und als sie meinen nervösen Blick in Richtung Bar bemerkt: »Oh, Jack weiß davon, so wie alle anderen in St. Ives auch. Ist kein Problem für sie.« Damit nimmt sie einen weiteren Schluck aus ihrem Fläschchen, bevor sie es wieder in ihrer Jackentasche verschwinden lässt.
»Ist er der Grund, weshalb Sie hierhergekommen sind? Herr Arschloch, meine ich?«
Ich sehe Brandy an. Womöglich habe ich gedacht, ich würde über Per sprechen wollen, vielleicht habe ich das wirklich, doch es stellt sich als nicht ganz leicht heraus. Ich habe einfach noch nicht oft über ihn geredet, mit niemandem. Deshalb nicke ich nur, reiße das Papier um den Schokoriegel auf, beiße hinein und kaue, ohne mir anmerken zu lassen, wie alt die Schokolade schmeckt. Dann lenke ich das Gespräch in eine andere Richtung. »Jetzt stehe ich da mit diesem Haus, das ich gekauft habe«, sage ich, »und es entpuppt sich als … nicht so schön.«
»Ja, Kindchen, das Peek-a-boo stand viele Jahre leer. Wir waren alle sehr gespannt, wann es wieder zum Leben erweckt wird. Und von wem.«
»Peek-a-boo?« Mehr noch als die Tatsache, dass sie darüber Bescheid weiß, welches Haus ich gekauft habe, verwundert mich der Name. »Das B&B hat einen Namen?«
»Das Cottage selbst hat einen Namen«, erwidert Brandy, »wie viele der alten Häuser hier.«
»Peek-a-boo«, murmle ich. »Klingt irgendwie niedlich. Leider sieht es nicht niedlich aus – zumindest nicht von innen.« Ich erzähle Brandy von dem Heizkessel und den Wasserleitungen und davon, dass die verstopfte Regenrinne dafür gesorgt hat, dass es zum Dach hereintropft. »Es mündet darin«, erkläre ich, »dass ich mir ein Haus gekauft habe und doch in einem Pub übernachten muss.«
Brandy schnalzt mit der Zunge. »Das klingt nach einem hübschen Haufen Arbeit«, sagt sie.
»Und nach einem hübschen Haufen Geld.«
»Mmmm.«
Abermals zieht Brandy ihren Flachmann hervor. »So ein Neuanfang ist manchmal steinig«, sagt sie zwischen zwei Schlucken, »doch unter den höchsten Ruinen finden sich oft die größten Schätze.«
»Ja«, sage ich. »Danach suche ich noch.«
»Haben Sie denn schon jemanden, der Ihnen hilft?«
»Nun …« Ich will gerade ansetzen, von Chase Bellamy und seiner Schadensanalyse zu erzählen, als der Barkeeper Brandys Namen ruft. »Draußen warten sie schon auf dich!«, erklärt er.
»Was? So spät ist es schon?« Brandy zieht eine Uhr aus einer der vielen Taschen ihres Parkas und zuckt die Schultern. »Also dann: War mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben, Kindchen, aber nun muss ich los, die Arbeit ruft.« Mit den Fingerknöcheln klopft sie auf die Tischplatte, bevor sie aufsteht.
»Arbeit?« Verwundert sehe ich auf meinem Handy nach der Uhrzeit. »Aber es ist schon gleich neun!«
»Genau, Schätzchen.« Brandy grinst. »Zeit, die Geister zu wecken. Einer muss es ja tun. Wir sehen uns wieder. Ganz sicher.«
Ich blicke ihr nach, während sie sich ihren Weg durch das Pub bahnt, an beinahe jedem der Tische stehen bleibt, hier mit dem und dort mit jenem quatscht. Ich habe keine Ahnung, welche Geister Brandy heute wecken will, ich kann nur hoffen, dass es meine nicht sein werden.
Gibt es den Hollywood-Moment wirklich?
Als ich Per das erste Mal traf, war es keiner dieser Hollywood-Momente, ganz im Gegenteil.
Ich war auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch bei Benton & Partner und hetzte durch die Lobby dieses schicken Finanzturms in der Frankfurter Innenstadt, den Blick auf meine Fußspitzen geheftet, um auf dem spiegelglatten Boden in den für meinen Geschmack viel zu hohen Schuhen den Halt nicht zu verlieren. Ich schaffte es unbeschadet zu den Aufzügen, dann in letzter Sekunde hinein. Eine Gruppe von Menschen drängte darin gegeneinander, Männer überwiegend, Anzugträger, die Wolke teuren Aftershaves betäubend. Der Knopf zur siebzehnten Etage leuchtete bereits, und während ich an einem der nadelgestreiften Ärmel vorbei auf die Zahl starrte, fragte ich mich zum wiederholten Mal, was ich hier eigentlich tat. Ich meine, ein Jobwechsel, ja. Doch das hier, Nobelfoyer, Armani-Invasion und verspiegelter Hightechfahrstuhl, das kam mir wie die völlig falsche Richtung vor. Vom Regen in die Traufe. Von der Hölle in den Schlund des Bösen.
Der Aufzug blieb so abrupt stehen, dass ich auf meinen turmhohen Schuhen ins Wanken geriet, allerdings schaffte ich es gerade noch, das Gleichgewicht zu halten. Die Hand, die sich mir entgegengestreckt hatte, um mich zu stützen, schloss sich eine Sekunde zu lang um meinen Ellbogen.
»Das darf doch wohl nicht wahr sein«, murmelte ich.
»Verzeihung, ich wollte nur helfen.«
»Wie?« Stirnrunzelnd sah ich zu dem Mann auf, dem die Hand gehörte, und meine Gedanken gerieten für einen Augenblick durcheinander. Das Erste, das mir in den Sinn kam: Da hat der Beauty-Doktor ganze Arbeit geleistet. Wie war es möglich, so weiße Haare zu haben und so glatte Haut? Wie ich schon sagte, keiner dieser Wow-Momente. Doch Wegsehen konnte ich irgendwie auch nicht. Per war … Per ist der charismatischste Mann, den ich bis heute kennengelernt habe. Kantige Gesichtszüge, warme braune Augen, dazu die schlohweißen Haare, die seinem jugendlichen, gebräunten Gesicht einen wahnwitzigen Kontrast verleihen. Und nein, kein Schönheitschirurg hatte hier die Finger im Spiel, wie ich später erfuhr, und auch keine Botox-Spritze war beteiligt. Per ist nicht alt, er ist kaum älter als ich, doch seine Haare sind weiß wie die eines Greises, und grau wurden sie schon, als er ein Teenager war.
Er hob abwehrend die Hand, und ich schüttelte den Kopf. »Ah ja, danke, das meinte ich nicht.« Über die Schulter des Vordermanns versuchte ich, einen Blick auf die Leiste mit den Leuchttasten zu werfen.
»Was ist passiert?«, rief ich. »Sind wir stecken geblieben?« Bei diesen Hochglanzfahrstühlen war das doch eigentlich gar nicht möglich, oder doch?
»Ich fürchte schon«, antwortete der Mann, und wieder blickte ich verwundert zu ihm auf. Dieser Akzent. Er sah eigenartig aus, und er sprach eigenartig, und trotzdem oder gerade deswegen übte er eine Faszination auf mich aus, die mich sofort alle Warnsysteme auf einmal hochfahren ließ. Bing, bing, bing, Achtung, Elodie, mach nicht wieder den gleichen Fehler, bing, bing. Wozu man wissen sollte: Mein Erfolg in Liebesangelegenheiten gestaltete sich bis dato ebenso unbefriedigend wie meine Karriere. Anzahl Beziehungen? Drei. Längste Beziehung? Acht Monate. Aktueller Status: Verweigerungshaltung. Mit Anfang dreißig hatte ich endlich beschlossen, dass mir selbst genug zu sein nicht nur ein Kalenderspruch ist.
Während ich also mein Gegenüber im Fahrstuhl musterte und mir vornahm, nicht weiter über Ausstrahlung, Anziehungskraft und damit verbundene Folgeschäden nachzudenken, schaltete sich offenbar mein Verstand aus. Sonst hätte mir wohl bereits in diesem Augenblick klar sein müssen, wen ich da vor mir hatte, doch, peinlich genug, war ich absolut ahnungslos. Womöglich ließ sich das meiner Nervosität zuschieben. Vorstellungsgespräche machen mich nun einmal nervös. Womit wir beim Thema wären.
»Ich bin spät dran«, brabbelte ich, während ich in meiner Umhängetasche nach meinem Handy kramte. Drei Minuten noch. Mist. »Ich bin auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch.«
»Ach wirklich?«
Ich nickte, während ich gleichzeitig versuchte, einen weiteren Blick nach vorn zu erhaschen. Jemand hielt die Notruftaste gedrückt und brüllte hinein.
»Ich denke nicht, dass die am anderen Ende taub sind«, sagte ich laut, was mir den erbosten Blick eines Anzugträgers einbrachte.
Der Mann fragte: »Finden Sie nicht, es ist ein seltsames Zeichen, auf dem Weg zu einem neuen Job im Fahrstuhl stecken zu bleiben?«, und ich blinzelte ihn an.
»Zeichen?« Zeichen. Welch Ironie im Nachhinein, nicht wahr?Irgendwer verhöhnte mich. Damals rief ich: »Kann man das etwas beschleunigen?«, denn allmählich wurde ich wirklich, wirklich unruhig, und das hatte so gar nichts mit dem Mann neben mir zu tun. Dachte ich zumindest.
»Sie machen sich mehr Sorgen darüber, dass Sie Ihren Termin erreichen, als darüber, dass der Fahrstuhl stecken geblieben ist«, stellte er fest.
»Na ja, das eine hängt mit dem anderen zusammen, oder nicht?«
»Was, wenn wir abstürzen?«, fragte er. »Oder ersticken?«
Ich hörte den Humor in seiner Stimme, doch ich antwortete ihm dennoch. »Abstürzen? In dieser Hightechmaschine? Das geht doch überhaupt nicht. Die Aufzugkabine hängt an bis zu zehn Seilen, die werden unmöglich alle auf einmal reißen. Und der Schacht hat immer eine Öffnung ins Freie, und die Kabine hat Öffnungen zum Schacht.« Aus dem Augenwinkel sah ich nach oben, um meine eigene Theorie zu überprüfen – als wenn diese Öffnungen sichtbar wären –, und stattdessen traf mein Blick auf den meines Leidensgenossen, der mich interessiert musterte. »Was?«
»Sie haben sich gut informiert.«
»Ich habe mich nicht informiert.« Ich hatte es tatsächlich einmal getan, aber das brauchte er ja nicht zu erfahren. Ich weiß gern, worauf ich mich einlasse, verhaftet mich doch. »Aber jedes Kind weiß schließlich auch, wie ein Flugzeug funktioniert, sonst würde doch niemand in eines einsteigen, oder?«
»Das sollte man meinen. Wobei …« Er lächelte. »Wie funktioniert denn ein Flugzeug?«
»Auftrieb, Schubkraft, Überdruck, Unterdruck.« Ich wedelte mit meiner Hand herum. »Es gibt YouTube-Videos darüber, wissen Sie das?« Und so wirklich kapieren tut es ohnehin keiner.
»YouTube-Videos über das Fliegen? Nein, das wusste ich nicht.«
»Ich stelle Ihnen gern eine Liste zusammen.«
»Eine Liste?«
Eine Liste? Was redete ich da? Mangels einer besseren Idee wandte ich den Blick erneut auf die Insassen vor mir, die nach wie vor mit dem Lautsprecher diskutierten, während andere auf ihren Smartphones herumtippten oder hineinmurmelten.
»Ein paar Minuten noch, in Ordnung«, rief jemand von vorn, und wieder sah ich auf mein Telefon, um die Uhrzeit zu überprüfen. Ich würde auf jeden Fall zu spät kommen.
»Ach, verdammter Mist«, murmelte ich. »Jetzt bin ich definitiv zu spät.«
Der Mann neben mir räusperte sich. »Wissen Sie, da sind Sie nicht die Einzige. Ich muss ebenfalls zu einem Vorstellungstermin erscheinen, und zwar in …« Er sah auf seine Uhr, die man schon von Weitem als Rolex identifizieren konnte. »Es läuft bereits seit einigen Minuten. Höhere Gewalt, schätze ich, oder was würden Sie sagen? Das lassen wir gelten.«
Mit einem Pling setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung. Ein Raunen durchlief die Kabine. Und dann bekamen der Mann und ich doch noch unseren Hollywood-Moment, genau in dem Augenblick, in dem sich die Aufzugtüren zum siebzehnten Stock öffneten.
»Nach Ihnen«, erklärte er und bedeutete mir mit einer Geste vorzugehen. Und bevor ich erfassen konnte, weshalb er wusste, in welchem Stockwerk ich aussteigen wollte, fügte er hinzu: »Bisher ist Ihr Gespräch doch ganz gut gelaufen, Frau Hoffmann. Wenn Sie mir in mein Büro folgen wollen, klären wir den Rest.«
Während ich neben ihm ging, sprachlos und mit einem Mal auf wirklich wackligen Beinen, wurde mir so einiges klar. Der Akzent. Per Gunnarson. Ich kannte den Namen meines künftigen Chefs, und ich hatte gelesen, dass er aus Schweden kam. Ich hatte ein Bild gegoogelt, Himmel noch mal! Aber er sah alt aus auf diesem Schwarz-Weiß-Foto, ehrlich alt. Mitte fünfzig! Offensichtlich hatte ich die abgebildete Version nicht mit der Realität in Verbindung bringen können. Und natürlich wusste er, wie ich aussah – vermutlich lag meine Bewerbungsmappe mitten auf seinem Tisch.
Und so begann unsere Geschichte. Wir landeten gemeinsam im Fahrstuhl. Im selben Stockwerk. Im selben Büro. Ich musste feststellen, dass er der Konterpart meines Vorstellungsgesprächs war.
Später habe ich mich oft gefragt, weshalb er mich tatsächlich einstellte. Wegen dieser kurzen Unterhaltung im Aufzug? Wegen meines Gestammels über YouTube-Videos? Weil er spürte, dass ich mich seinem Charme widersetzen würde, wie es – auch das erfuhr ich erst mit der Zeit – kaum jemand tat? Was immer es war, er stellte mich ein. Ob er es je so bereut hat wie ich?
5. Helen
Sieh mal, Helen, wen ich mitgebracht habe«, ruft Brandy, sobald sich die Tür des Cafés hinter ihr geschlossen hat. »Das hier ist Elodie, die neue Besitzerin des Peek-a-boo. Habe sie quasi aufgegabelt und vor einem Frühstück im Sloop Inn bewahrt. Elodie, das ist Helen Kennard, Helen, das hier ist Elodie Hoffmann.«
»Aufgegabelt würde ich das nicht nennen«, sagt Elodie, während sie mir die Hand reicht, »wohl eher aus dem Bett gehämmert. Hi, sehr erfreut.«
»Ebenfalls«, erwidere ich. Ich wische mir die Hand an der Schürze ab, bevor ich ihre schüttle. Elodie ist kleiner als ich, ein gutes Stück, aber auch jünger, Anfang, Mitte dreißig würde ich schätzen. Ihre Haare sind hellblond, mit einem dunklen Ansatz, die Augen groß und dunkelbraun. Sie sieht aus wie eine amerikanische Cheerleaderin mit ihrem breiten Lächeln und den strahlend weißen Zähnen, doch natürlich ist sie das nicht.
»Elodie ist aus Frankfurt hergezogen«, erklärt Brandy, während die beiden sich an den angestammten Tisch setzen.
»Oh, dann ist das hier sicherlich ein Schock für dich.« Ich folge ihnen und fahre noch einmal mit dem Lappen über das Wachstuch, obwohl ich den Tisch zuvor schon abgewischt habe. »Von der Großstadt in ein so kleines Kaff wie St. Ives.«
Elodie blinzelt zu mir hoch. »Oder vom grau melierten Dschungel ins smaragdgrüne Paradies, wie ich es nenne.« Sie lässt den Blick zum Fenster schweifen, hinaus auf die Straße, und dann lacht sie. »Auch kein Meerblick. Wie in meinem neuen, baufälligen Häuschen.«
»Oh, das Peek-a-boo hat durchaus Meerblick, man muss nur ein wenig um die Ecke schauen«, sagt Brandy.
»Aaaah, natürlich«, erwidert Elodie in gespieltem Ernst. »Heißt es deshalb so? Peek-a-boo?«
»Wer weiß das schon, Kindchen?«
»Weiß man denn genau, um welche Ecke man schauen muss, um das Meer zu sehen?«
Brandy überlegt einen Augenblick, bevor sie mit ihrer Geisterbeschwörerinnen-Stimme erwidert: »Manche Häuser lüften ihre Geheimnisse mit der Zeit. Andere nie.«
Ich sehe zu, wie sich Elodies hübsches Gesicht einmal mehr aufhellt, wie sie ihre Hand auf Brandys Arm legt und die beiden zusammen lachen, und aus welchem Grund auch immer versetzt mir das einen Stich. Vielleicht, weil ich nicht mit einstimmen kann. Weil heute einfach nicht mein Tag oder mir schlicht nicht zum Lachen ist. Weil Brandy meine Freundin ist und ich gerade jetzt ihre ungeteilte Aufmerksamkeit brauche. Womöglich auch nur, weil im Augenblick alles trostlos erscheint, wofür meine miese Laune die Verantwortung trägt, nicht Brandy oder sonst wer.
»Was hättest du gern?«, frage ich Elodie.
»Einen Cappuccino, bitte. Und einen Obstsalat.«
»Obstsalat.« Ich nicke. Dann gebe ich die Bestellungen auf, bereite Tee und Kaffee zu, wie an jedem anderen Morgen auch.
Heute ist Sonntag. Der Vormittag verläuft hektisch. Bis elf Uhr ist unser kleines Café gefüllt mit einer Vielzahl hungriger Einheimischer, die sich zu einem späten Frühstück aufgerafft haben, und voller Touristen noch dazu. Wo die auf einmal herkommen?, frage ich mich. Von gestern auf heute ist das Kennard’s bis auf den letzten Platz besetzt, als habe man eine Busladung Fremder durch die Tür gekippt. Ein paar Minuten nach elf kommt endlich Kayla heruntergeschlurft. Ich sehe demonstrativ auf die Uhr.
»Du bist spät dran«, sage ich vorwurfsvoll. »Neun war vereinbart, du erinnerst dich? Das ist kein Kaffeekränzchen, bei dem man auftaucht, wann man will, oder auch gar nicht, wenn es nicht passt.« Meine Tochter verdreht die Augen, und ich sehne mich nach der Zeit zurück, als sie noch nicht vierzehn, pubertär und einfach nur anstrengend war.
»Wieso hast du mich dann nicht geweckt?«, erwidert sie. In diesem Tonfall. Dem, der mein Blut zum Kochen bringt, weil ich weiß, es kann nichts Gutes aus dieser Unterhaltung erwachsen. Ich antworte ihr nicht. Nicht dass ich nicht versucht habe, sie zu wecken, doch ich musste feststellen, dass sie ihre Tür zugesperrt hatte. Mein Klopfen rief niemand anderen auf den Plan als Liam, der mir daraufhin diesen Blick zuwarf, den Blick, der besagt: Wie viel willst du ihr noch durchgehen lassen?
Kayla bindet sich ihre Schürze um und geht zu den zwei Tischen links am Fenster, an dem sich soeben neue Gäste niedergelassen haben. Ich seufze. Von vorn sieht es nun so aus, als trüge sie gar nichts unter der Schürze, von hinten bedecken ihre viel zu kurzen Shorts kaum ihr Hinterteil. Kayla ist groß, sehr groß für ihr Alter. Sie hat endlose Beine und rotbraune Locken, die seidig sind und glänzend, nicht kurz und irgendwie strohig wie meine. Dazu hat Liam ihr seine strahlend blauen Augen vermacht, und alles in allem ist sie schöner, als ihr guttut. Sie ist geradezu besessen von ihrem Äußeren, von Make-up und Mode. Sie ist so versessen darauf zu gefallen, dass ich manchmal fürchte, dies ist der einzige Gedanke, der ihren Kopf bewohnt.
»Soll ich den Cappuccino noch stehen lassen?« Ich beuge mich über Elodie, um das schmutzige Geschirr abzuräumen, den Blick auf die halb volle Tasse gerichtet. »Er ist sicher längst kalt, oder?«
»Äh …« Sie lächelt mich an, während sie die Tasse von sich schiebt. »Über den erstklassigen Obstsalat habe ich den ganz vergessen. Vielleicht nehme ich noch einen Tee? Es ist noch ganz schön frisch für die Jahreszeit.«
»Apropos Kaffee«, sagt Brandy. »Habt ihr gewusst, dass in der Fore Street ein Coffeeshop eröffnen wird? Da, wo der kleine Asia-Imbiss war. Ein Pop-up-Store, heißt es. Was auch immer das bedeuten mag.«
»Es bedeutet, dass er nur für kurze Zeit da sein wird«, erklärt Elodie. »Diese Stores tauchen auf, haben für eine gewisse Zeit geöffnet und schließen dann wieder.«
»Huh.« Brandy beißt in den Keks, den ich ihr jeden Morgen zum Tee dazulege und den sie immer als Letztes verspeist.
»Einige sind saisonal angelegt«, fährt Elodie fort. »Wie … Eisläden im Sommer. Lebkuchenshops im Winter.«
»Lebkuchen.« Brandy nickt. »Damit würde er hier wohl mehr Leute anlocken. Die Engländer und ihre Biscuits. Kaffee dagegen …« Sie verzieht das Gesicht.
Elodie lacht. »Nun, womöglich wird es den einen oder anderen Touristen geben, der eine gute Tasse echten italienischen Cappuccino zu schätzen weiß.«
»Die können Helens Kaffee trinken, Kindchen, der ist gut genug.«
Ich werfe Elodie einen Blick zu und könnte schwören, sie wird rot. Ich würde gern wissen, was mit unserem Kaffee nicht stimmt, frage aber nicht danach. Stattdessen nehme ich die Tasse mit zur Spüle und setze eine Kanne Tee für die beiden auf.
»Wer ist das da an Brandys Tisch?«, fragt mich Kayla, nachdem sie Geschirr abgeräumt, Bestellungen aufgenommen und Frühstücksteller ausgetragen hat.
»Elodie Hoffmann. Sie hat das Peek-a-boo gekauft.«
»Den alten Schuppen?« Sie verzieht das Gesicht.
»Sind hier nicht alle Häuser alt?«, halte ich dagegen.
»Nicht nur die Häuser«, sagt sie.
Tja. Und genau das meinte ich. Meine Tochter und ich können nicht zwei harmlose Sätze miteinander wechseln, ohne dass sie eine Spitze auf mich, meine Art oder mein Leben im Allgemeinen loslässt. Ich habe mich daran gewöhnt, doch dass es mir gefällt, kann ich nicht behaupten.
»Sie hat tolle Haare«, fährt Kayla fort, und ich sehe von meinen Teebeuteln auf.
»Gefärbt, schätze ich. Sieh dir den dunklen Ansatz an.«
»Trotzdem nice.« Sie fährt sich durch ihre eigenen Locken, wie um zu prüfen, ob ihre Haare ebenfalls nice sind. »Und sie hat eine Topfigur.«
Ich atme tief ein. Einem Außenstehenden würde es ziemlich sicher gar nicht auffallen, doch seit einigen Monaten provoziert mich meine Tochter bei jeder Gelegenheit, die sich ihr bietet, und mich nicht provozieren zu lassen scheint meine einzige Waffe dagegen.
»Für ihr Alter«, fügt Kayla hinzu, bevor sie in die Küche verschwindet.
Ich atme aus.
In solchen Momenten. An solchen Tagen. Da frage ich mich, ob das tatsächlich mein Leben sein soll.
»Ich weiß ja nicht, wie viel man bei euch für ein Haus bezahlt, Kindchen, aber das hier ist Cornwall, Englands schönstes Fleckchen.«
»Lass das nicht die Leute im Lake District hören«, sage ich zu Brandy, während ich den frischen Tee an ihren Tisch serviere.
Sie rollt mit den Augen. »Wie dem auch sei. Zweihundertfünfzigtausend? Dafür bekommt man auch hier höchstens eine Butze.«
Elodie stöhnt und lässt ihre Stirn auf ein riesiges pinkfarbenes Buch fallen, das eindeutig viel zu groß für einen Taschenkalender ist. Mit einer Faust umklammert sie einige Dokumente, mit der anderen ihren Nacken. »Meinem Vater wird das nicht gefallen«, nuschelt sie kläglich. »Er wird kein gutes Haar an mir lassen.«
»Wer weiß, Liebchen. Vielleicht findet er ja noch eine Möglichkeit, wie du aus der Sache wieder herauskommst.«
Damit setzt sich Elodie auf. »Das ist es ja. Ich will aus dieser Sache nicht herauskommen. Ich kann jetzt noch nicht aufgeben, ich hab ja noch nicht einmal angefangen! Und ich kann nicht zurück nach Frankfurt.« Sie beißt sich auf die Unterlippe, während sie mir einen Blick zuwirft.
»Männer«, erklärt Brandy wissend.
»Du hast wegen eines Mannes alles hinter dir gelassen und bist hierhergezogen?« Ich setze mich neben Elodie und mustere sie neugierig. »Das klingt ziemlich dramatisch.«
Sie verzieht das Gesicht. »Es war … sagen wir, es war eine Übersprunghandlung.«
Brandy nickt, und nachdem Elodie diese Geschichte offenbar nicht weiter erläutern will, nicke ich ebenfalls.
»Ich hab ein bisschen gespart«, murmelt sie schließlich. »Ich werde sehen, wie lange es reicht, ohne dass ich an diesem Haus bankrottgehe.«
»Wenn es erst mal läuft«, sagt Brandy, »ist ein B&B in St. Ives eine Goldgrube.«
»Und Chase hilft dir, oder?«, füge ich hinzu. »Mrs. Barton hat davon erzählt. Wenigstens hast du mit ihm jemanden gefunden, der dich nicht über den Tisch ziehen wird. Bei Handwerkern weiß man ja nie.«
»Das stimmt«, ergänzt Brandy. »Und Chase mag zwar kein richtiger Handwerker sein, aber er macht seine Sache besser als jeder andere.«
»Wie bitte?« Elodie sieht verwirrt von Brandy zu mir und wieder zurück. »Was soll das heißen, er ist kein richtiger Handwerker? Ich dachte, er sei Dachdecker?«
»Architekt, Liebchen«, erklärt Brandy. »Aber in Teilzeit spielt er gern den Zimmermann.«
»Oh, großartig.« Elodie lässt sich in ihren Stuhl zurückfallen. »Jetzt habe ich auch noch einen Architekten auf meiner Honorarliste.«
»Dafür war das Haus wahrlich ein Schnäppchen«, sagt Brandy, und obwohl ihr sicher nicht zum Lachen ist, prustet Elodie los und Brandy mit ihr, und ich falle schließlich selbst in das Lachen mit ein, und ich denke: Ja, das ist tatsächlich mein Leben. Und in manchen Augenblicken ist nicht alles schlecht daran.
6. Elodie
Es ist Mittag, als ich Kennard’s Kitchen