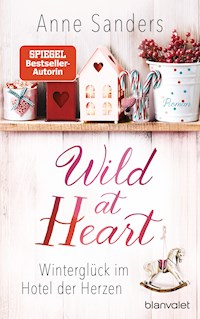12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine kleine Insel an der Westküste Schottlands und ein Geheimnis, das alles verändert ...
Isla Grant ging es schon mal besser. Ohne Wohnung und ohne Job bleibt ihr keine andere Wahl, als nach Hause zurückzukehren, nach Bailevar, eine winzige Insel an der rauen Westküste Schottlands. Und das, obwohl sie kaum Kontakt zu ihrer Familie hat. Als sie auch noch ausgerechnet ihre Jugendliebe Finn wiedertrifft, sind alle unliebsamen Erinnerungen zurück. Ihr einziger Lichtblick ist die alte Dame Shona, die wie keine andere Geschichten erzählt, besonders gern die Legende von der verschwundenen Insel. Doch schon bald erkennt Isla, welch tragisches Geheimnis Shona zu verbergen versucht. Und auch ihre eigene Vergangenheit holt Isla unaufhaltsam ein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Isla Grant ging es schon mal besser. Ohne Wohnung und ohne Job bleibt ihr keine andere Wahl, als nach Hause zurückzukehren, nach Bailevar, eine winzige Insel an der rauen Westküste Schottlands. Und das, obwohl sie kaum Kontakt zu ihrer Familie hat. Als sie auch noch ausgerechnet ihre Jugendliebe Finn wiedertrifft, sind alle unliebsamen Erinnerungen zurück. Ihr einziger Lichtblick ist die alte Dame Shona, die wie keine andere Geschichten erzählt, besonders gern die Legende von der verschwundenen Insel. Doch schon bald erkennt Isla, welch tragisches Geheimnis Shona zu verbergen versucht. Und auch ihre eigene Vergangenheit holt Isla unaufhaltsam ein …
Autorin
Anne Sanders lebt in München und arbeitet als Autorin und Journalistin. Zu schreiben begann sie bei der Süddeutschen Zeitung. Als Schriftstellerin veröffentlichte sie unter anderem Namen bereits erfolgreich Romane für jugendliche Leser. Die Küste Cornwalls begeisterte Anne Sanders auf einer Reise so sehr, dass sie spontan beschloss, ihren nächsten Roman dort spielen zu lassen. Sommer in St.Ives eroberte die Herzen der Leserinnen und war wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Mein Herz ist eine Insel ist ihr zweites Buch bei Blanvalet.
Von Anne Sanders bereits erschienen
Sommer in St. Ives
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Anne Sanders
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2017
by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagabbildungen: living4media/Jalag/Olaf Szczepaniak;
www.buerosued.de
JvN ∙ Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-19507-6V004
www.blanvalet.de
Für blö, meinen Pelz in der Brandung.Fels, meine ich. Fels.
1
Isla
Wenn ich an Bailevar denke, denke ich an Krabben. Tonnen davon. Eimerweise hässliche rotbraune Schalentiere, mit starren Augen und klackernden Scheren, und dann an das Knirschen, das diese Schalen erzeugten, wenn meine Mutter sich ihrer annahm. Ich sitze mit einem Malbuch am Küchentisch, und krrrrrk. Ich spiele mit den Filzpuppen, und knackknackknackknackknack. Meine Mutter, die dünnen Arme in viel zu großen Gummihandschuhen, bis zu den Ellbogen in Krustentierleichen vergraben. Der Gedanke bereitet mir Gänsehaut, auch jetzt noch. Der Gedanke an diese Insel, an mein Elternhaus, an dieses Bild und all die anderen beschwört einen Widerstand in mir herauf, so stark, dass er eigentlich den Bus zum Stillstand zwingen müsste, in dem ich gerade sitze. Nur tut er es nicht.
Die Räder holpern über Viehgatter, die schmale Straße entlang, vorbei an grünen Weiden, dunklen Waldstücken, farnbedeckten Hügeln. Wie oft ich diese Strecke gefahren bin. Von Oban nach Craignure nach Fionnphort nach Bailevar. Mein halbes Leben habe ich auf Fähren und in diesem Bus verbracht, so kommt es mir jedenfalls vor. Und dass ich heute noch einmal hier sitze, auf dem Weg in mein sogenanntes Zuhause, ohne Plan und ohne Rückfahrkarte, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Nicht vor einem Jahr, nicht vor einer Woche. Nicht bis gestern, als mir Eric eröffnete … als er mir sagte … Ich kneife die Augen zusammen und drücke den Hinterkopf in die Lehne meines Sitzes. Ich kann jetzt nicht an Eric denken. Wenn ich an Eric denke, verliere ich das letzte bisschen Verstand.
Der Bus hält am Fährpunkt von Fionnphort, und es beginnt zu regnen, was absolut nicht überrascht. Das Klima an der Westküste ist rau, auf den Inseln rauer, und nun, Anfang September, ist es rau und nicht selten nass. Gott, ich klinge wie ein Reiseführer. Das ist es, was Bailevar mit mir macht. Es gibt so vieles, woran ich hier nicht zurückdenken möchte, dass ich mich freiwillig mit dem Wetter beschäftige.
Und wenn ich schon dabei bin – der Wind ist stark. Meine Haare wirbeln aus der Kapuze meiner Regenjacke, mir ins Gesicht, während ich den Koffer zur Fähranlegestelle zerre und meine Leinentasche, die ich in der anderen Hand halte, so nervtötend oft gegen mein Schienbein schlackert, als wolle sie mich piesacken. Soll ich das als Zeichen verstehen? Was, wenn ich gar nicht heimkehren, sondern mein blödes Gepäck zurück in den Bus hieven und mich schleunigst in die andere Richtung davonmachen sollte? Ich seufze. Als könnte ich irgendwohin. Hätte ich in Edinburgh bleiben sollen? Wohl kaum. Nach dem Streit mit Eric wollte ich nur eines: weg. Dass ich in Bailevar enden würde, wurde mir erst klar, als ich am Bahnhof stand und das Ticket nach Oban in der Hand hielt. Und was sagt das jetzt über mich aus? Dass ich in der Krise meines Lebens genau dorthin flüchte, von wo ich seinerzeit nicht schnell genug fortkommen konnte? Von wo ich annahm, schon die schlimmsten Miseren meines Lebens hinter mir gelassen zu haben? Nun, gut gemacht, Isla. Mit deinen zweiunddreißig Jahren bist du genauso planlos, wie du es mit zweiundzwanzig warst.
Wobei, das ist nicht ganz richtig. Mit zweiundzwanzig, da hatte ich Pläne, Myriaden davon. Ich weiß noch genau, wie ich damals auf diesem Schiff stand, draußen an Deck, Kyles alten Rucksack umgeschnallt, die Nase in den Wind gereckt, den Kopf voller Ideen. Studieren stand ganz oben auf der Liste, und ja – aus Sicht der schottischen Fischerfamilie schien diese Idee geradezu aufständisch. Die eigenen vier Wände. Weg vom Vater. Von den Brüdern. Der Insel. Den Erinnerungen. Ein ganz neues Leben.
Die Sohlen meiner Stiefel klackern über das Metall der Laderampe, und dann wuchte ich Koffer und Tasche ins Innere der muffigen Kabine, an schäbigen Sitzbänken vorbei in den hinteren Teil, wo ich vor einem Fenster stehen bleibe, mit dem Rücken zum Raum. Dieses Schiff war schon alt, als ich ein Kind war. Und es knarzt und riecht und schwankt genauso wie damals. Überhaupt ist alles genau wie damals. Die alte Fähre, das raue Meer, die Insel Iona, Bailevars berühmte Nachbarin, auf die das Boot zusteuert, bevor es links daran vorbeizieht. Ich blicke aus dem Fenster, doch durch die regenverhangenen Scheiben kann ich die Abbey kaum erkennen, gerade mal Ionas verschwommene Konturen zeichnen sich ab. Die meisten, die in Fionnphort auf die Fähre steigen, wollen dorthin, die wenigsten nach Bailevar, denn da gibt es nichts zu sehen. Von da wollen die Menschen weg. Ich zumindest, ich wollte das. Ich und meine Mutter.
Ich sehe aus wie sie. Weshalb ich die Kapuze meiner Jacke auch im Innern des Schiffs aufbehalte. Die bleiche Haut, die roten Locken, das alles ist zu auffällig, um nicht aufzufallen. Aus dem Augenwinkel sehe ich mich nach den anderen Passagieren um, die mit dem Rücken zu mir auf den Sitzbänken ausharren. Ich hoffe wirklich, dass ich hier niemanden treffe, den ich nicht treffen möchte. Dass mich niemand anspricht, bevor ich mir überlegt habe, was ich auf all die Fragen antworten werde.
Bailevar ist klein, wirklich winzig. Es leben kaum sechzig Menschen dort, und die kennen alle und jeden und wissen alles und mehr, und das hat mich damals verrückt gemacht und wird es diesmal wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, auf diesem Schiff sind einige, die mich kennen. Wer sonst sollte auf die Fähre steigen? Zumal es die letzte ist, die heute ablegt. Nach achtzehn Uhr ruht die See. Dann gibt es kein Entkommen mehr, kein Hin und kein Zurück, zumindest nicht für die, die nicht selbst ein Boot besitzen.
Ist das Lilian McIntyre da vorne? Oh, Mist. Ich hoffe, sie entdeckt mich nicht. Solange niemand bemerkt hat, dass ich hier bin, ist es vielleicht auch nicht wahr. Ich ziehe die Kapuze ein Stück tiefer in die Stirn und wende den Blick wieder dem Fenster zu.
Die Fahrt dauert fünfundzwanzig Minuten, die nach Iona nur zehn. Das bedeutet, dass wir auf Bailevar noch ein ganzes Stück weiter draußen liegen, da, wo sich nichts mehr vor uns auftürmt außer den eisgrauen Wellen des Nordatlantiks. Das Leben auf der Insel ist ruppig, und die Menschen sind es auch. Ich frage mich, wieso Lilian McIntyre immer noch hier ist. Weshalb es überhaupt jemand vorzieht, auf diesem Eiland zu bleiben, statt in der Zivilisation zu leben, ist mir ein Rätsel. Wobei, natürlich, es ist ihr Zuhause. Und das hat schon manche daran gehindert zu gehen. Meinen Vater, meine Brüder, den alten Graham und all die anderen Farmer und Fischer, und Shona natürlich. Allerdings nicht Finn. Das Letzte, was ich von Finn weiß, ist, dass er in irgendeinem angesagten Restaurant in London in der Küche stand. Also gut, nicht in irgendeinem – in dem Restaurant. Eric hat zwei Monate lang darauf gewartet, einen Tisch zu bekommen, was ich erst dann erfuhr, als wir unsere Koffer für das Wochenende packten und er mir eröffnete, dass mein Ex inzwischen wohl sehr gut mit dem Kochlöffel umgehen könne, und fragte, ob das eventuell auf andere seiner Qualitäten schließen ließe (zwinker, zwinker).
Letztlich sind wir nicht nach London geflogen, aber es gab keinen Streit deswegen. Man muss Eric zugutehalten, dass er mich nicht ärgern oder provozieren wollte, sondern tatsächlich überraschen: Er dachte, ich würde mich freuen, Finn wiederzusehen, zumal dieses hypergehypte Lokal an sich schon den Flug nach England wert gewesen wäre, ganz abgesehen davon, dass ich mit einem der Köche geschlafen hatte, aber das habe ich nicht laut gesagt, sondern lediglich in Gedanken hinzugefügt. Ich hätte es genauso gut aussprechen können. Wenn Eric etwas nicht war, dann eifersüchtig – offensichtlich –, und auch wenn mich das zu Beginn unserer Beziehung einige Male irritierte, habe ich es mir mit den Jahren abgewöhnt, es persönlich zu nehmen. Besser gesagt, es nicht auf Erics Gefühle zu mir zu beziehen. Er war nicht deshalb nicht eifersüchtig, weil ich ihm nicht wichtig war. Er hat mir vertraut. Und ja, er war ein von sich eingenommener Pfau, der nicht im Traum daran gedacht hätte, ich würde ihn mit einem dahergelaufenen schottischen Inselkoch betrügen. Aber er hat mir auch vertraut. Und ich ihm. Bis gestern Abend.
Ich kann jetzt nicht über Eric nachdenken. Wenn ich an Eric denke, setzt mein Herz aus.
Also gut.
Finn.
Ich bin froh, dass er nicht auf Bailevar ist. Unsere gemeinsame Geschichte ist so alt wie Methusalem und so unaufregend wie Toastbrot, aber irgendwie bin ich froh, dass ich mich ihr nicht auch noch stellen muss. Wenn ich es recht bedenke, fühle ich mich im Augenblick überhaupt nicht in der Lage, mich irgendwem oder irgendetwas zu stellen, und ja, die Ironie entgeht mir nicht: In einer solchen Situation meinem Vater gegenüberzutreten ist womöglich nicht die glanzvollste Idee. Ich seufze. Und dann bleibe ich einfach stehen und lasse das Meer an mir vorüberziehen.
»Isla?«
Oje. Ich starre weiter aus dem Fenster. Durch den Regen schimmert die überschaubare Küste Bailevars, die Reihe der kleinen Cottages am Wasser, der schmale Steg. Womöglich vier Minuten noch, dann legen wir an, und beinahe hätte ich die Überfahrt ohne Zwischenfälle überstanden. Mist.
Mist, Mist, Mist.
»Isla Grant?«
Ich nehme einen tiefen Atemzug, dann drehe ich mich zu Lilian um.
»Lilian, hey«, sage ich, redlich bemüht um einen entspannten Gesichtsausdruck. »Das ist aber eine Überraschung! Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Wie geht es dir?«
Lilian blinzelt verwirrt, und ich kann es ihr nicht verübeln. Ich bin selbst erstaunt über diesen Redeschwall. Angriff ist eben die beste Verteidigung. »Du siehst sehr gut aus«, lege ich nach. »So … frisch.«
»Oh, na ja, ich … danke.« Aus ihren viel zu großen Augen sieht sie mich viel zu lange an. Ehrlich, mit diesem Kugelblick wirkt sie wie ein übergroßes Stofftier, das man in zu weite Kleidung und zu hohe Schuhe gestopft hat. Was macht sie in diesen Pumps auf dem Schiff? Das sind mindestens sechs Zentimeter Absatz. »Du siehst auch gut aus«, sagt sie schließlich. »Hast dich gar nicht verändert.«
»Mmmmh.«
Wir blicken einander an, während die Fähre ihre Kurve in Richtung Anlegestelle dreht. Wie eigentlich alle in dieser Gegend haben Lilian und ich eine Geschichte. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Wir waren nicht die engsten Freundinnen, denn Lilian ist … sie war, damals zumindest, mehr Einzelgängerin, als ich es je hätte sein können, denn immerhin hatte ich Finn. Lilian hatte nie jemanden, aber sie schien auch nicht unglücklich deswegen. Sie war gut in der Schule, obwohl sie ihr nie wichtig war, denn die Farm ihrer Eltern war das, worauf es letztlich ankam. Ich nehme an, sie ist immer noch dort, was sie mit einem ihrer nächsten Sätze bestätigt.
»Ich hatte ein Vorstellungsgespräch im Tobermory-Hotel«, sagt sie. Sie schwankt und greift nach dem Geländer vor dem Fenster. Ich werfe erneut einen Blick auf ihr lächerliches Schuhwerk, das hiermit erklärt wäre.
»In den nächsten Monaten gibt es auf der Farm nicht allzu viel für mich zu tun, also …« Sie zuckt mit den Schultern.
Ich nicke. Ich weiß, wovon sie spricht. Auf einer Insel wie Bailevar gibt es nie für alle Jobs, im Winter noch weniger als in den restlichen Monaten des Jahres, weshalb viele der Bewohner auf den nächstgrößeren Inseln arbeiten oder gleich auf der Hauptinsel. Ich selbst hatte nach der Schule eine Stelle in Oban. Auch in einem Hotel. Das ist es wohl, was wir Inselmädchen so tun, während die Männer Fischer werden oder Farmer. Oder Koch.
»Du wohnst jetzt in Edinburgh, oder?«, fragt sie.
»Ähm, ja?« Das klang wie eine Frage. »Und du?«, gebe ich schnell zurück. »Du lebst immer noch auf der Farm deiner Eltern?«
Lilian nickt, dann sieht sie aus dem Fenster.
Und ich weiß, was sie denkt: Es kann nicht jeder den Absprung schaffen, zu irgendeinem Künstler ziehen, die Familie im Stich lassen, sich aus dem Staub machen mit qualmenden Sporen. Das ist, was sie alle insgeheim denken. Was sie mich haben spüren lassen, jedes Mal, wenn ich in den vergangenen Jahren zurückgekehrt bin. Weshalb ich in zehn Jahren nur dreimal hier war, vor sechs Jahren das letzte Mal.
Lilian sieht wieder mich an. »Weiß dein Vater, dass du heimkommst?«
Womit wir beim Thema wären. »Nun«, beginne ich, doch dann wird unser Gespräch seligerweise durch das Knistern der Lautsprecher unterbrochen, durch die der Fährmann auf unsere Ankunft auf Bailevar aufmerksam macht. Ich bin nicht überrascht, die Stimme unseres Nachbarn zu erkennen, Anthony Scott. Er hat schon damals – schon immer eigentlich – die Fähre gelenkt, und es ändert sich eben nichts in dieser kleinen, beschränkten, einöden Welt.
Ich hätte nicht herkommen sollen.
»Es war richtig nett, dich zu treffen«, sage ich, während ich nach meinem Gepäck greife. »Bestimmt laufen wir uns in den nächsten Tagen noch öfter über den Weg.« Bis Lilian antworten kann, bin ich bereits halb aus der Tür, die aufs Deck hinausführt.
»Ich hoffe, du bleibst ein bisschen«, ruft sie mir nach. »Bis dann!«
»Genau«, rufe ich über die Schulter zurück. Dann ducke ich mich zwischen den restlichen Passagieren hindurch und laufe auf den Ausgang zu.
Den ganzen Weg über fühle ich mich verfolgt. Während ich die Rampe vom Schiff nach oben eile, auf die Straße einbiege und in Richtung meines Elternhauses laufe, bohren sich Blicke in meinen Rücken und wabern Sprechblasen über meinem Kopf, ich spüre es. Ist das nicht Isla? Was will sie hier? Hat sie ihrem Vater nicht schon genug zugemutet?, steht darin geschrieben, und ich gehe immer schneller, die Kapuze beinahe bis über die Nase gezogen.
Von der Anlegestelle bis zu unserem Haus ist es nicht weit. Ich muss im Grunde nicht einmal abbiegen, ich gehe einfach die Straße hinunter, parallel zum Wasser, die Häuserreihe entlang, bis die Abstände zwischen den Cottages größer werden, sie rechts und links vor mir auftauchen wie in die Landschaft gesprenkelte Farbtupfen, und dann, vor dem rosafarbenen auf der rechten Seite, bleibe ich stehen.
Ich atme tief durch.
Die Fenster sind erleuchtet, der Kamin pafft graue Rauchwolken in den noch graueren Himmel, und aus dem aufgeschobenen Küchenfenster dringen Stimmen zu mir nach draußen. Tiefe Stimmen. Mein Vater und zumindest einer meiner Brüder sind zu Hause, Will vermutlich. Herrje, was mache ich hier? Ich blicke nach links, am Gartenzaun entlang zu der Stelle, an der der alte Kiosk meiner Mutter steht, und sogleich habe ich das Gefühl, mein Magen sei ein Stück tiefer gerutscht. Die Glasfront, die zur Straße zeigt, ist mit Brettern zugenagelt, das Dach verwittert. Von dieser Position aus kann ich nicht erkennen, ob der Schriftzug noch zu lesen ist, aber ich erinnere mich genau, wie diese kleine Holzbude einmal strahlte. Catie’s Crabs. Mein Vater hat ihr den Kiosk gebaut. Er funktionierte den alten Geräteschuppen um, sägte ein Fenster aus der halben Vorderfront, montierte Läden, brachte Schlösser an, bemalte ihn in einem dunklen Rot, das Caitrionas Lieblingsfarbe war und zugleich an einen Krebs erinnerte. Viel ist nicht davon übrig geblieben, weder von der Farbe noch von seinem Glanz. Der kleine Kiosk sieht aus, als habe ihn seit einem Vierteljahrhundert niemand mehr betreten, was gut und gerne wahr sein kann. Ich wende den Blick ab und starre stattdessen die Eingangstür des Hauses an, während ich mich zum wiederholten Mal frage, ob das wirklich eine gute Idee war. Womöglich hätte ich zu Mac fahren sollen, doch streng genommen ist er nicht nur mein Freund, sondern auch Erics, und … Ich weiß nicht. Vermutlich hätte ich egal wohin fahren sollen, nur nicht hierher.
Der Hausschlüssel hängt an meinem Schlüsselbund, und der ist in meiner Handtasche, die wiederum in meiner Leinentasche steckt, was im Grunde völlig egal ist, denn auf Bailevar sperrt sowieso niemand zu. Auf Bailevar kommt der Postbote ins Haus und legt die Briefe auf dem Küchentisch ab, denn eben, die Türen sind alle offen. Seltsamerweise bin ich trotzdem nie auf die Idee gekommen, den Schlüssel vom Bund zu nehmen. Obwohl ich so viele Jahre nicht hier war. Obwohl ich ihn schon damals kaum benutzt habe. Ich bin versucht, es jetzt zu tun. Ihn abzunehmen, meine ich. Nach sechs Jahren, die ich meine Familie nicht gesehen habe, ist es vermutlich an der Zeit, den Schlüssel zurückzugeben, der mir ohnehin nicht zusteht.
Von der Straße sind es genau sieben Schritte bis zur Haustür, dort stelle ich Koffer und Tasche ab und drücke auf den Klingelknopf. Drinnen brummt es. Dann wieder Stimmen, Geschirr klappert, Schritte. Als sich die Tür öffnet, steht mein Vater da – groß, breit, ungekämmt, mit weit aufgerissenen Augen. Nach einer Ewigkeit sagt er:»Isla.« Seine Stimme klingt schroff.
»Hi, Dad.«
Mein Herz klopft. Schneller, als der Rauch abzieht.»Isla? Isla Grant?« Hinter meinem Vater taucht Wills schwarzer Haarschopf auf, aber im Gegensatz zu Dad grinst er über das ganze Gesicht. »Rotkäppchen«, ruft er, während er meinen Vater zur Seite schiebt, beide Arme um mich legt und zudrückt. »Was hast du angestellt? Bist du auf der Flucht und suchst ein sicheres Versteck? Hast du eine Bank ausgeraubt? Einer alten Dame die Handtasche geklaut?«
»Sehr witzig«, nuschle ich in sein T-Shirt, aber ich muss doch lachen, als er mich loslässt, beide Hände um mein Gesicht legt und meinen Kopf hin und her dreht, als betrachte er ein seltenes Kunstobjekt. »Geh weg«, sage ich ihm, »deine Finger riechen.« Was wahr ist. »Hilfe, was ist das?«
»Blutwurst, Little Red. Hab gerade Abendessen gemacht.« Er sieht mich an und wirft dann einen Blick auf unseren Vater, bevor er mich hinter sich her in die Küche zieht. »Wie lange warst du nicht mehr hier? Zehn Jahre? Fünfzehn?« Er zwinkert mir zu. »Ich wette, ich kann mittlerweile besser kochen als du. Sieh dich doch an – dünner als ein Segelmast. Gibt es in diesen Schickimicki-Kreisen nichts zu essen?« Mit einer Hand drückt er mich auf einen Stuhl, mit der anderen wuschelt er durch meine Haare, und während ich seinen Arm wegschlage, wird mir klar, was er da tut – er nimmt meinem Vater die Gelegenheit, seine Schockstarre zu überwinden und das zu tun, was vermutlich darauf folgen würde. Mich zu fragen, was zum Henker ich hier zu suchen habe, wieso ich glaube, er sollte mich überhaupt reinlassen, wo dies doch das Haus ist, das ich vor zehn Jahren nicht schnell genug verlassen konnte. Sein Haus. Bevor er mich einfach vor der Tür stehen lässt.
Will macht sich am Ofen zu schaffen, und ich ziehe langsam den Reißverschluss meiner Regenjacke auf. Ich spüre den Blick meines Vaters auf mir, der in der Tür steht, in der einen Hand meinen Koffer, in der anderen die Leinentasche. Als ich mich zu ihm umdrehe, sieht er mich an, als würde er mich am liebsten zurück zur Fähre begleiten.
»Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze«, sage ich.
»Ist etwas passiert?«
Ich zögere. Er sieht schlecht aus. In der Zeit, die ich nicht hier war, scheint mein Vater um die doppelte Anzahl an Jahren gealtert zu sein. Er ist immer noch groß und breit und muskulös, ganz Arbeiter, ganz Fischer. Doch seine Haut wirkt eingefallen, die braunen Augen wässrig, die Haare sind stahlgrau, schmutzig und definitiv zu lang, die Kleidung ungepflegt. Früher, sehr viel früher, da war Nathanial Grant ein gut aussehender, strahlender Mann. Ein Kraftprotz, voller Energie und Selbstvertrauen. Nie der aufgeschlossene Spaßvogel, der sein Sohn Will ist, mein Bruder Kyle kommt sicher mehr nach ihm. Ernst, eigenbrötlerisch und hübsch dominant, wenn es drauf ankommt, jedoch mit einem großen brummigen Herzen. Meiner Mutter hat das gefallen. Caitriona Kavanagh ließ alles hinter sich, inklusive ihres Verlobten, um bei meinem Vater bleiben zu können. Nicht, dass ich das von ihr weiß – als sie uns verließ, konnte ich noch nicht mal meinen Namen schreiben. Ich sehe meinem Vater in die Augen. Und ich denke, der Zorn, den wir gegen Caitriona hegen, ist womöglich das Einzige, was uns verbindet.
»Isla?«
Ich blinzle mich aus meinen Grübeleien. Mein Bruder steht an die Spüle gelehnt, den Pfannenwender in der Hand, die Augenbrauen hochgezogen. Mein Blick huscht zurück zu unserem Vater. »Ich dachte, ich könnte ein paar Tage hierbleiben. Ich …« … kann jetzt gerade nicht erklären, weshalb, vollende ich den Satz im Stillen. Stattdessen zucke ich mit den Schultern. »Eventuell ziehe ich weg aus Edinburgh«, murmle ich noch, dann ist es still. Dad steht nach wie vor mit dem Gepäck da, bis Will zu ihm geht, es ihm aus der Hand nimmt und die Taschen neben der Treppe abstellt.
»Du kannst in der kleinen Kammer neben dem Bad schlafen«, sagt er, als er zurück in die Küche kommt. Er platziert einen Teller vor mir, Besteck, ein Glas. »Es steht eine Schlafcouch drin, falls mal einer von den Jungs es nicht mehr zurück auf seine eigene Insel schafft.«
Waaa, wie das klingt. Zurück auf seine eigene Insel. Hinter Wills Rücken verdrehe ich die Augen. Und dann frage ich mich, weshalb ich das tue. Ich meine, so ist es nun mal – wer auf den Inseln wohnt, besitzt statt eines Autos besser ein Boot, und wer hier aufgewachsen ist, hat ziemlich sicher auch Freunde auf Iona oder Mull, mit denen er zur Schule gegangen ist und die er dann und wann besucht. Da ist nichts seltsam dran oder ungewöhnlich oder lachhaft. Ich seufze.
Ach, Will. Er bemüht sich. Und ich bin eine schlecht gelaunte Kuh.
»Was ist mit meinem Zimmer passiert?«, frage ich.
»Das«, erklärt er, während er Blutwurst, Kartoffelbrei und Zwiebelringe auf unsere Teller verteilt, »ist wie der Rest des ersten Stockwerks in meinen Besitz übergegangen.« Für einen Augenblick zögert mein Bruder, so als wolle er noch etwas hinzufügen, dann stellt er die Pfanne zurück auf den Herd, nimmt drei Bier aus dem Kühlschrank, öffnet sie und platziert sie in der Mitte des Tischs.
Die Haustür fällt ins Schloss.
Wir drehen uns zur Tür um, wo gerade noch mein Vater stand und jetzt nichts mehr ist.
»Lass ihm Zeit«, sagt Will. Er setzt sich an den Tisch, mir gegenüber, und fängt an zu essen, die Augen auf mich gerichtet. Ich starre auf meinen Teller. Gebratene Blutwurst mag für manche das Ekligste sein, das sie sich vorstellen können, aber ich habe sie früher tatsächlich gern gegessen. Besonders dann, wenn sie frisch von MacFarnham kam, dem besten Metzger im Umkreis von dreißig Seemeilen. Als Kinder hat unser Vater uns einmal im Monat dorthin mitgenommen, wir haben groß eingekauft, für mehr als hundert Pfund, und dann alles in die Gefriertruhen im Keller eingeschichtet. In dieser Familie wurde immer nur Fleisch gegessen, was absolut grotesk ist, gemessen daran, dass sie größtenteils aus Fischern besteht. Aber mein Vater hasst Fisch. Es war das Letzte, das sie ihm auf den Tisch stellte, bevor sie ging.
»Hat er gedacht, er sieht mich nie wieder?«, frage ich. »Hat er es gehofft?«
»Ach, komm schon, Isla, er ist überrascht, das ist alles.«
»Überrascht.« Ich greife nach einer der Flaschen und schenke mir ein. Ich bin keine große Biertrinkerin, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ein paar Gläser davon könnten mir heute nicht schaden. Seit fünf Jahren esse ich kein Fleisch mehr, aber ich bringe es nicht über mich, Will dies zu gestehen. Dass mein eigener Bruder so etwas nicht über mich weiß, ist erschütternd.
Ich betrachte ihn. Er sieht aus wie immer. Die dunklen Haare in Form gegelt, das schwarze T-Shirt, das über der breiten Brust spannt, ein Tattoo, das aus irgendeinem dunklen Muster besteht und sich über seinen linken Arm schlängelt. Mein Bruder ist vierunddreißig Jahre alt und lebt noch immer im ersten Stock seines Elternhauses. Möchte ich wissen, wieso das so ist?
»Warst du überrascht?«, frage ich schließlich.
»Ich hätte eher mit dem Weihnachtsmann gerechnet als mit dir«, gibt er ohne zu zögern zurück.
»Okay.« Ich nehme eine Gabel von dem Kartoffelbrei, der nicht mit Blutwurstfett kontaminiert ist. »Vermutlich hätte ich anrufen sollen. Es kam nur alles ziemlich plötzlich. Und ich weiß nicht, womöglich dachte ich, das hier ist immer noch mein Zuhause, also … Wenn ich allerdings geahnt hätte, dass er davonläuft, sobald er mich sieht, dann …«
»Isla.« Will hält sein Besteck still und starrt mich nieder. Mein ansonsten vor Charme sprühender Bruder sitzt da mit einer Miene, die mich an das erinnert, was ich vor einigen Minuten schon einmal dachte: Diese heitere Begrüßung diente allein dem Zweck, meinem Vater den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jetzt, im dämmrigen Licht der abgenutzten, niedrigen Küche, wird klar, dass Will nicht halb so unbekümmert ist, wie es zunächst den Anschein hatte. Er wirkt verärgert. Schlimmer noch, verletzt. »Das ist nicht seine Schuld, okay? Niemand ist hier an irgendetwas schuld.« Er sieht mich weiter an, und als ich nicht antworte, seufzt er. Ein weiteres Mal wirkt es so, als wolle er noch etwas anderes sagen, etwas Deutlicheres womöglich, doch dann klappt er den Mund zu und macht sich daran, Blutwurst und Zwiebeln auf seine Gabel zu häufen.
»Was?«, frage ich. »Nun spuck’s schon aus. Du findest es nicht richtig, dass ich hergekommen bin.«
»Quatsch, Isla, was soll der Mist?«
»Was dann? Niemand ist schuld, aber doch irgendwie ich?«
Er schüttelt den Kopf, und dann seufzt er noch einmal. »Du könntest fragen, wie es uns so ergangen ist«, sagt er schließlich. »Wie es ihm geht. Du kommst hier an, nach so vielen Jahren, und ich freue mich wirklich, dich wiederzusehen, aber statt dich gleich in Selbstmitleid zu suhlen, weil Dad anlässlich deiner doch ziemlich überraschenden Heimkehr keinen Freudentanz aufführt, könntest du dich einfach auch mal umsehen, wie es anderen damit ergeht.«
Ich spüre, wie ich rot werde, obwohl Wills Blick seinen Worten einen guten Teil ihrer Schärfe nimmt, und sofort lenkt mein Bruder ein. Wie schon angedeutet, ist er der Unkomplizierteste von allen, die kleinste Hürde. Dass er sich auch nur mit einem Satz gegen mich wendet, könnte mir gut und gerne die Tränen in die Augen treiben, würde er nicht hinzufügen: »Okay, Rotkäppchen, stell dich nicht so an. Du bist gerade erst gelandet, und so schnell kommt niemand wieder runter von dieser Insel. Bleibt noch ausreichend Zeit für Small Talk.« Er stopft sich mehr Kartoffelbrei in den Mund. »Außerdem«, fährt er undeutlich fort, »weiß Kyle noch nichts davon, dass du wieder hier bist. Das wird witzig.« Sagt’s, grinst und spült sein Essen mit einem halben Pint Bier hinunter.
Ich stöhne, innerlich und laut, im gleichen Augenblick, als sich die Haustür öffnet und mit dem Windstoß mein Vater hereinweht, den Arm voller Feuerholz. »Das werden wir brauchen«, brummt er, stapft an uns vorbei und legt die Scheite in den Korb neben dem altmodischen Ofen.
Ich hatte ganz vergessen, wie es hier ist. Dass in diesem Haus auf dem mit Holz beheizten Küchenofen gekocht wird, und das bereits ab Spätsommer. Dass die Decken so niedrig sind, dass selbst ich mit meinen eins zweiundsiebzig Angst habe, mir am Türrahmen den Kopf zu stoßen. Dass es im Gang nach kaltem Stein riecht und in Caitrionas altem Zimmer nach Lavendel. Dass es auf dieser Insel nur einen einzigen Ort gibt und ein einziges Pub, dass die Leute arm sind und stur, und dass es hier Fische gibt, überall Fische. Und Krabben. Die Luft riecht nach Meer, und sie schmeckt nach Algen. Das alles weiß ich. Und ich weiß, warum ich so viele Jahre nicht hier gewesen bin.
Aus diesen Gründen. Aus all diesen Gründen.
2
Isla
Der Lavendelduft ist es, der mich noch vor der Morgendämmerung weckt, der mich die halbe Nacht nicht hat schlafen lassen. Das hier ist nicht Caitrionas altes Zimmer, und doch hängt der Duft mir in der Nase, als hätte ich mir einen Strauß Blüten um den Hals gehängt. Ich liege auf der Ausziehcouch und blicke durch den Vorhangspalt durchs Fenster. Dieser Raum ist tatsächlich nicht mehr als eine Kammer, nicht einmal drei Meter breit, und mit dem aufgeklappten Sofa und der kleinen Kommode davor wirkt er ausreichend vollgestopft. Das werden ja gemütliche Tage werden, denke ich. Ein Grund mehr, möglichst bald einen Plan zu entwerfen und weiterzuziehen.
Von hier aus kann ich das Meer sehen. Noch nicht deutlich, dazu ist es zu dunkel, doch es lässt sich erahnen. Ich liebe das Meer. Obwohl es hier so übermächtig ist und ich die Insel verabscheue, habe ich das Meer immer vermisst. Edinburgh hat einen Hafen, aber das ist kein Vergleich zu dem schroffen, unverbauten Blick, den man an beinah jedem Punkt Bailevars hat. Diese Insel ist das letzte Stück Land vor einer Riesenmenge Atlantischen Ozeans, und das macht sie automatisch zur Kämpferin und mit ihr jeden ihrer Bewohner. Ich schüttle den Kopf, während ich die Decke zurückschlage und aus dem Bett steige. Vermutlich bin ich zu schwach. Vermutlich bin ich deshalb weggegangen, um mich hinter den graubraunen Mauern Edinburghs zu verstecken, hinter einem Mann, der zehn Jahre lang nicht nur mein Partner, sondern auch mein Arbeitgeber war und der Besitzer der Wohnung, in der ich gelebt habe, und der mich nun, nachdem besagte Mauern um mich herum auseinanderbröckelten, als hätten sie noch nie aufrecht gestanden, leer zurücklässt. Absolut leer.
Ich ziehe mich an und gehe nach unten. Das Haus ist still, aber es kann nicht mehr lange dauern, bis mein Vater und Will es verlassen, um mit dem Boot rauszufahren. Nun, Zeit für ein fulminantes Frühstück, würde ich sagen. Der gestrige Abend gestaltete sich nicht übermäßig lang und mehr oder weniger einsilbig, weshalb es heute eigentlich nur besser werden kann.
Ich heize den Ofen an, und es ist wie eine Zeitreise. Beinahe witzig. Es raucht und qualmt in der alten Küche, und ich kichere bei dem Gedanken daran, wie sauber und ordentlich es jetzt gerade an Erics Hochglanztheke zugeht, auf der er sich maximal ein Eiweißomelett zubereitet, lieber jedoch einen grünen Smoothie. Ich öffne das Fenster weit und wische mir die Tränen aus den Augen. Lachtränen, wohlgemerkt. Dann brate ich ein Omelett mit Zwiebeln, dazu Speck für Vater und Bruder, ich toaste Brot und brühe Kaffee auf, und bis ich meine erste Tasse getrunken habe, stehe ich immer noch alleine da. Wie früh bin ich aufgestanden? Ich laufe zurück nach oben, um mein Handy zu suchen und nach der Uhrzeit zu sehen, und auf dem Weg dorthin bleibe ich vor Wills Schlafzimmer stehen. Es ist kein Laut zu hören. Ich öffne die Tür, und das Bett ist leer. Mein Handy zeigt 6:17 Uhr an. 6:17 Uhr und sieben verpasste Anrufe, zwölf Text- und zwei Voicemailnachrichten. Ich ignoriere alles außer der Uhrzeit und lasse das Telefon zurück in meine Tasche fallen. Ich muss vergessen haben, wie spät die Sonne um diese Jahreszeit aufgeht, natürlich sind die anderen längst mit dem Boot draußen. Das fulminante Frühstück also wird ein ziemlich einsames werden, mit zu vielen Eiern, nicht verzehrtem Speck und eingebranntem Kaffee.
Der Ort hat sich kein bisschen verändert. Um genau zu sein, ist es gar kein Ort, damals wie heute nicht, er hat ja nicht mal einen eigenen Namen. Ist es merkwürdig, dass das Dorf auf Iona »Baile Mor« heißt? Und wir hier auf Bailevar, wir haben nur das? Nur diesen einen Namen? Bailevar Dorf also besteht aus einer übersichtlichen Anzahl von Häusern, die meisten alt, die meisten bunt, einer Hauptstraße, die durch Wiesen und Weiden zu einer winzigen Kapelle führt, in der schon seit Ewigkeiten niemand mehr einen Gottesdienst abgehalten hat, weil der Pfarrer nur noch auf Iona predigt, und hinter der nurmehr Pfade zu den Klippen und den darunterliegenden Stränden führen. In die andere Richtung, zur Fähranlegestelle hin, führt die Straße unter anderem an Brimer’s Craft Shop vorbei und an Shonas kleinem Gemischtwarenladen. Und noch weiter, unten am Hafen und neben der verwitterten Fischhalle, steht The Old Man’s Inn, das einzige Pub Bailevars und sozialer Dreh- und Angelpunkt der Insel. Ich frage mich, ob dort immer noch die Band spielt, bei der mein Dad mitmacht. Ob Finns Vater nach wie vor den Tresen schmeißt, während seine Frau in der Küche Burger und Fisch brät. Ob Finn noch oft herkommt, um seine Eltern zu besuchen … Ich schiebe den Gedanken beiseite, während ich das klobige Gebäude passiere und einige weitere, bevor ich hinter Mason’s Cottage nach rechts abbiege und den Hügel hinaufsteige in Richtung Golfplatz. Hinter dem Areal liegen drei Farmen, unter anderem die Schaffarm von Lilians Familie. Und an der Südspitze der Insel, an ihrem zackigen, von schroffen Felsen geformten Ende, da steht die Ruine des Leuchtturms, die heute nur noch den wilden Hasen als Zufluchtsort dient.
Diese Insel. Ich kenne jeden Fleck auf ihr und jeden Menschen, und früher kannte ich mit Sicherheit auch jedes Schaf. Ich weiß, wo man den besten Sonnenuntergang sieht, wo die Seehunde liegen und die Otter räubern, ich bin im Winter im Meer geschwommen und im Sommer durch Höhlen geklettert, habe Muscheln gesammelt und in der alten Halle Krabben sortiert, die die Fischer kurz nach Mittag aus ihren Booten dort abladen. Vom Golfplatz aus schlage ich den Pfad ein, der sich auf den höchsten Punkt des Hügels schlängelt. Ich stemme mich gegen den Wind. Es regnet nicht, aber die Luft bläst kalt in mein Gesicht, und die Sonne bereitet sich gerade erst darauf vor, sich zu zeigen. Noch bin ich niemandem begegnet, obwohl ich wette, dass achtundneunzig Prozent der Inselbewohner bereits auf den Beinen sind. So ist das Leben hier. Es ist einsam, und es verlangt dir einiges ab.
Als ich die Spitze des Hügels erreicht habe, bleibe ich stehen. Der Wind zerrt an mir, aber das stört mich nicht. Mit einer Hand schirme ich meine Augen ab und blicke auf den Ozean hinaus, der schwarzblau glänzt und auf dessen Oberfläche Fischerboote tanzen. Vier Stück. Ich weiß nicht, welches davon meiner Familie gehört, aber sicherlich sind sie dort draußen, mein Vater, Will und Kyle, dessen Begrüßung mir immer noch bevorsteht. Wäre ich hiergeblieben, würde ich vermutlich gerade Krabben pulen oder Mayonnaise zubereiten oder nach Fionnphort übersetzen, um den Großeinkauf zu erledigen, all das tun, was ich nie wollte. In Edinburgh dagegen habe ich um diese Zeit noch im Bett gelegen, bis mindestens neun Uhr, denn vorher macht in den Künstlerkreisen, in denen Eric und ich verkehrt haben, niemand einen Finger krumm. So viele wichtige Menschen, die ich durch ihn kennengelernt habe – Fotografen wie er, Models, Designer, yada, yada, yada – und doch keinen einzigen, den ich nach dem Streit mit ihm hätte anrufen wollen. Mac eventuell, ja. Und das auch nur, weil er Eric seit jeher für einen blasierten Snob hält. Mac wäre womöglich als Einziger nicht überrascht gewesen von Erics Geständnis, aber ihn anzurufen kam mir dennoch falsch vor. Eric ist kein blasierter Snob. Er hat mich auch nicht mit einem seiner Models betrogen, wie es Mac schon hundertmal vorausgesagt hat. Er hat sich in eine Frau verliebt, die sieben Jahre älter ist als er und dazu verheiratet. Macht es das alles nur noch schlimmer? Möglicherweise.
Die Sonne geht auf. Sie erhellt den Himmel und schiebt die Wolken beiseite. Noch einmal lasse ich den Blick über die Landschaft schweifen, über die bucklige Weide und die zerzausten Gräser zu dem strahlend weißen Sandstrand, der beinahe karibisch wirkt. Zeit, sich vom Hügel und unter die Menschen zu begeben. Früher oder später wird sich die Nachricht meiner Rückkehr ohnehin verbreitet haben. Womöglich statte ich Shona einen Besuch ab und kaufe ein paar Lebensmittel ein, zur Abwechslung etwas Grünes. Nachdem es mit dem Frühstück nichts wurde, kann ich vielleicht beim Abendessen punkten. Ganz sicher wird Kyle auftauchen. Er wird die deutlicheren Fragen stellen, so viel steht fest. Fürchte ich mich davor? Oh, ja. Doch das Schlimmste habe ich bereits hinter mir, denn schließlich bin ich hier.
Die Türglocke ist noch nicht verklungen, da höre ich schon Schritte, die eilig über den Steinboden schlurfen, und dann steht Shona vor mir, und ich breche auf der Stelle in Gelächter aus.
»Was, um Himmels willen, ist mit deinen Haaren passiert?«, japse ich. »Du siehst aus, als hättest du dir rosa Zuckerwatte in den Zopf geflochten.«
»Isla Grant!«, ruft Shona, und es klingt ehrlich entgeistert, und ich frage mich allmählich, was an meinem vollen Namen so faszinierend ist, dass es niemand bei Isla belassen will. »Das wird deinen Vater umgehauen haben, habe ich recht? Hat er überhaupt einen Ton herausbekommen? Der alte Toffel. Kind, du siehst wunderbar aus! Was auch immer dich hierher zurückverschlagen hat, es steht dir gut zu Gesicht.«
»Eine Trennung, Shona«, sage ich trocken, und Shona schmatzt ihre pink bemalten Lippen zusammen, als hätte sie es schon immer geahnt, ganz die weise alte Dame, die sie nun mal ist.
»Manche Männer lassen einen in der Tat strahlender zurück, als sie einen aufgefunden haben«, erklärt sie, und schon wieder bringt sie mich zum Lachen. Womöglich habe ich mehr von dieser Insel vermisst als das Meer.
»Also«, sage ich, während ich Shona tiefer in den Laden hinein folge. »Die Haare?«
»Nichts weiter«, gibt sie zurück. »Ich könnte schwören, da stand Schaumfestiger auf der Flasche, nicht Schaumtönung. Aber was macht’s? Ein bisschen Farbe im Leben, das hat noch keinem geschadet. Rosa dazu! Ich fühle mich wieder wie ein Backfisch!«
Ich laufe grinsend hinter Shona her, durch den Laden, an der kurzen Theke vorbei, hinter der Ally Donne steht und mir mit offenem Mund nachsieht, durch eine hintere Tür in den niedrigen Hausgang und hinauf in den oberen Stock. Hier hat Shona ihre Wohnung, seit fast sechzig Jahren schon, seit sie Boyd Thomson, den Gemischtwarenhändler, heiratete und mit ihm den Laden übernahm.
»Was macht Ally Donne hinter dem Tresen?«, frage ich, als ich Shona in die Küche folge. »Habt du und Boyd endlich beschlossen, euch ein wenig Hilfe zu holen?« Ally ist die Frau von Harris Donne, der Fischer ist und ein guter Freund meines Vaters. Die beiden gehen angeln in ihrer Freizeit – wie bizarr ist das? Darüber hinaus haben die Donnes eine Tochter, Isobel. Sie ist einige Jahre jünger als ich, deshalb kenne ich sie kaum, aber sie sah schon damals aus wie ein Mannequin, die Inselschönheit sozusagen. Isobel Donne. Ob sie es wohl weg geschafft hat?
»Ally ist schon seit fast vier Jahren im Laden.« Shona geht zum Herd, nimmt den Kessel und füllt ihn mit Wasser. »Sie hat ihn übernommen, als Boyd starb.«
»Was?« Das Lächeln gefriert auf meinem Gesicht, denn, Gott, das wusste ich nicht. Shonas Mann ist vor vier Jahren gestorben, und ich erfahre erst jetzt davon? »Das tut mir so leid«, stammle ich. »Hätte ich gewusst, dass … ich wäre zur Beerdigung gekommen. Es tut mir wirklich schrecklich leid.« Es gibt überhaupt keine Worte dafür, wie leid mir das tut, doch Shona zuckt mit den Schultern.
»Du warst nicht hier«, sagt sie. »Du führst dein eigenes Leben.« Sie setzt sich zu mir an den Tisch, während das Teewasser heiß wird, und nimmt meine Hand. »Mach dir darüber nicht auch noch Gedanken, Isla, du hast gerade ganz andere Probleme.« Ihre blauen Augen blitzen. »Was hat Kyle gesagt? Ist er sehr sauer, dass du dich sechs Jahre nicht gemeldet hast? Hat er dir Schimpfwörter an den Kopf geworfen und sich den Bart gerauft wie ein Eumel?«
»Wie ein …« Ich pruste, doch dann verziehe ich das Gesicht. »Das steht mir wohl erst noch bevor«, sage ich, und nun ist es Shona, die lacht.
»Ein bisschen Entrüstung hast du verdient«, sagt sie. »Aber nur ein bisschen.«
Wir sehen einander an wie zwei alte Freundinnen, die sich Jahre nicht gesprochen haben, und genauso fühle ich mich. Shona ist die Großmutter, die ich nie hatte, und jetzt, da ich ihrer zähen, kleinen Gestalt gegenübersitze, wird mir klar, wie sehr sie mir gefehlt hat. Sie sieht aus wie ein Mädchen mit ihrem dicken, weiß-rosa geflochtenen Zopf und dem bunten Strickkleid, zu dem sie Gummistiefel trägt. Ihr Gesicht ist rund, obwohl sie eine so schmale Person ist, und ihre Augen lächeln fast immer. Shona ist ein achtundachtzig Jahre altes Mädchen, und ich könnte sie aufessen, so gern hab ich sie.
»Wie ist es dir ergangen?«, frage ich. »Ich meine …« Ohne Boyd, meine ich, aber schon wieder schießt mir Röte in die Wangen angesichts meiner Ignoranz, die mir in diesem Augenblick unerträglich selbstsüchtig erscheint. Was, wenn nicht Boyd, sondern Shona selbst … Ich darf überhaupt nicht daran denken, was dann gewesen wäre.
»Ich komme gut zurecht«, sagt Shona. »Es war anfangs ein bisschen ungewohnt, aber du kennst die Insel. Hier kümmert sich jeder um jeden, weshalb ich mir nicht vorkomme wie eine einsame alte, verwitwete Frau.« Sie lächelt mich an, und ich denke: Nun, das ist genau das, was mich damals vertrieben hat, aber ich spreche es nicht aus. »Boyd ist friedlich eingeschlafen«, fährt Shona fort. »Er hätte es sich nicht anders wünschen können. Und er fehlt mir, an jedem einzelnen Tag. Aber so ist das Leben, Isla. Damit müssen wir uns abfinden.«
»Ach, Shona …« Sie ist so tapfer. Und ich fühle mich nach wie vor schlecht.
»Hätte mir zu Beginn meines Lebens jemand erzählt«, sagt sie, »dass ich einmal fünfundfünfzig Jahre mit ein und demselben Menschen verbringen würde, ich hätte es nicht geglaubt. Selbst als …« Sie stockt, und dann schüttelt sie den Kopf und lässt den Satz in der Luft hängen.
»Waren deine Eltern nicht auch ihr ganzes Leben lang zusammen?«, frage ich.
»Damals sind die Menschen aber nicht so alt geworden, Kindchen.« Sie seufzt. »Ich bin achtundachtzig Jahre alt und fühle mich wie achtundsiebzig. Das muss die Seeluft sein.« Sie zwinkert mir zu, und dann beginnt der Wasserkessel zu pfeifen.
Während Shona den Tee zubereitet, nehme ich zwei der geblümten Tassen aus der Vitrine neben der Tür, mitsamt Unterteller und Zuckerdose, und stelle sie vor uns auf den Tisch, so wie früher. Shonas Küche ist ganz anders als unsere – verspielter und bunter und gemütlicher, weniger rustikal, irgendwie. Vor Jahren, als Kind und als Jugendliche, habe ich mehr Zeit hier verbracht als bei uns zu Hause. Shona und Finn waren Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben, noch bevor er und ich so eine Art Paar wurden. Shona ist Finns Großtante, die Schwester seines Großvaters. Und sie ist das Herz dieser Insel, zumindest für mich.
»Nun«, beginnt sie, als sie sich zurück an den Tisch setzt und die Kanne vor uns abstellt, »erzähl mir von dieser Trennung, die dich dazu bewogen hat, nach all den Jahren hierher zurückzukehren. Was hat er angestellt, dein Fotografen-Freund?«
»Er …« Ich stocke. Es auszusprechen macht es irgendwie so wahr, doch schließlich sage ich es doch: »Er hat sich in eine andere verliebt.«
»Er hat dich betrogen?«
»Nicht körperlich, nein.« Ich seufze, aber nur deshalb, weil es wirklich wehtut, darüber zu sprechen. »Er hat diese Frau kennengelernt, eine Kundin. Sie hat sich an Eric gewandt, weil sie für einen offiziellen Empfang der Stadt eine Art Fotocollage von … ach, egal. Das ist nicht wichtig. Jedenfalls: Sie ist verheiratet und sieben Jahre älter als er. Sie ist kein Model, nicht einmal annähernd so schön wie die Mädchen, die er schon fotografiert hat. Aber er fühlt sich mit ihr verbunden, sagt er. Und ihr geht es offenbar genauso. Doch ›bevor sie dem nachgeben, wollten beide erst bereinigen, was es zu bereinigen gibt‹, so hat er sich ausgedrückt.«
Shona sieht mich an, die Augen rund und groß. »So etwas Dummes habe ich noch nie gehört«, sagt sie.
Ich gieße Tee ein. »Nicht wahr? Bereinigen, das klingt so medizinisch«, sage ich, doch Shona schüttelt den Kopf.
»›Bevor sie dem nachgeben‹?«, fragt sie ungläubig. »In welchem Jahrhundert leben die beiden? Sollte er nicht, du weißt schon, bevor er ›es bereinigt‹, wissen, wie der Hase läuft?«
Ich runzele die Stirn. »Shona, ich denke nicht, dass das unbedingt das Thema …«
»Und ob das ein Thema ist«, ruft sie. »Ihm muss doch klar sein, wogegen er dich eintauscht! Was, wenn es zwischen den Kissen nicht stimmt? Dann ist es mit der Verbundenheit ganz bald vorbei.«
»Nun, das ist dann sein …«
»War der Sex gut zwischen euch? Ich meine, ihr wart nicht erst seit gestern zusammen, habe ich recht? Da können einem schon mal die Füße einschlafen bei dem Thema.«
»Shona«, beginne ich, bevor mir für einen Sekundenbruchteil der Gedanke kommt, ob sich darum die Textnachrichten und Voicemails auf meinem Handy drehen. Ob Eric festgestellt hat, dass es mit der Neuen »zwischen den Kissen nicht stimmt«, und nun verzweifelt versucht, mich nach Edinburgh zurückzuholen? Auf der Stelle verwerfe ich den Gedanken wieder. Es ist gerade mal zwei Tage her. Was auch immer er mir zu sagen hat, gründet sich ganz sicher nicht auf ungezähmter Leidenschaft. Es hat wohl eher damit zu tun, dass sein Gewissen ihm zu schaffen macht. Und er Mitleid mit mir hat. Und sein Mitleid ist das Letzte, was ich jetzt brauche.
»Ich denke, das Thema wird Eric keine Schwierigkeiten bereiten«, bringe ich schließlich hervor. »Gott, Shona, du bist wirklich unglaublich.«
»Das muss dir nicht peinlich sein.«
»Es ist mir nicht peinlich«, sage ich, »solange es dir nicht peinlich ist, mich so unverblümt auf mein Ex-Sexleben anzusprechen.«
»Ist es nicht.«
Ich lache. »Ja, das höre ich.«
»Nun ja, ich war auch mal jung«, beginnt sie, »und das war gar keine so unaufregende Zeit. Selbst als ich noch nicht mit Boyd …«
»Noch Tee?« Ich greife nach der Kanne. »Was ist das? Earl Grey? Schmeckt sehr, sehr gut.«
Shona grinst mich an. »Also gut«, erklärt sie, »dann lass dir wenigstens das Eine gesagt sein: Er versucht, durch diese Verschleierungstaktik als Unschuldslamm dazustehen, aber du solltest ihm nicht auf den Leim gehen. Er ist und bleibt der Halunke in diesem Spiel.«
»Ich weiß. Das tue ich nicht.«
»Er hat dich für eine andere verlassen, das kann niemals nobel sein, auch wenn er noch so ehrenhaft tut. Von wegen, ›alles ist fabelhaft, ich bin schließlich nicht mit ihr in die Kiste gehüpft‹.«
Ich nicke.
Wir trinken Tee.
Und ich denke, ich habe noch nicht annähernd begriffen, was zwischen Eric und mir geschehen ist und was das für mich bedeutet.
»Und du bist hier, weil du nirgendwo anders hinkonntest?«, fragt sie schließlich, und als ich automatisch das Gesicht verziehe, tätschelt sie wieder meine Hand.
»Wir haben in seinem Loft gelebt«, grummle ich. »Ich habe in seinem Studio gearbeitet.« Ich schüttle den Kopf, denn mehr fällt mir dazu nicht ein. Dass mein gesamtes Leben mit Eric Cunningham verknüpft war, habe ich erst bemerkt, als es auseinanderbrach.
»Es ist gut, dass du hergekommen bist«, sagt Shona. »Das hier ist dein Zuhause. Und du bist immer willkommen.«
»Das sah gestern Abend nicht wirklich danach aus.«
»Ach, gib diesen Sturköpfen ein wenig Zeit. Nathanial mag mürrisch und abweisend wirken, aber er hat das Herz am rechten Fleck, und er ist immer noch dein Vater. Den ich übrigens schon kannte, als er noch in seine Hosen geschippert hat«, fügt sie hinzu. »Bei Bedarf kann ich das gern einmal anbringen.«
»Ich werde darauf zurückkommen.«
»Tu das, Kindchen.« Sie sieht mich an, als wolle sie noch etwas sagen, doch dann schüttelt sie den Kopf.
»Was?«, frage ich. Wieso versucht hier jeder, die Gespräche mit mir auf halbem Wege abzubrechen? »Du wolltest noch was sagen. Ich hoffe nur, es hat nichts mit den Hosen meines Vaters zu tun.«
»Nein, hat es nicht«, sagt Shona, und dann seufzt sie. »Du weißt, dass Libby eine Fehlgeburt hatte?«
»Ja.« Ich sehe sie überrascht an. »Es ist Jahre her, oder? Das war, kurz bevor ich das letzte Mal hier war.«
Shona nickt. »Nun, sie hatte noch zwei weitere in den darauffolgenden Jahren«, fährt sie fort, »und gerade ist sie wieder schwanger.«
Für einen Augenblick weiß ich nicht, was ich sagen soll, nur eines weiß ich ganz sicher: dass es in den kommenden Tagen noch unzählige solcher Augenblicke geben wird, in denen ich mich frage, wie es passieren konnte, dass ich die Menschen, die mir einmal am nächsten standen, so sehr aus den Augen verloren habe. So sehr, dass ich nicht einmal weiß, dass die Frau meines älteren Bruders Höllen durchlebt haben muss, während ich in Edinburgh Lichtreflektoren hin und her geschoben habe. Dass Kyle, mein großer, brummiger, starker Bruder, vermutlich zusammengebrochen ist über diesen Nachrichten, denn er sehnt sich nach Kindern, nach einer Familie. Unbedingt.
Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein verkommener, egoistischer Mensch. Wieso hat Will nichts erwähnt?
»Ich denke, das solltest du wissen, bevor du Kyle begegnest«, sagt Shona.
Ja, das sehe ich genauso. »Danke, dass du es mir gesagt hast. Wie geht es Libby jetzt? Wie weit ist sie?«
»Ich bin mir nicht sicher, aber schon in der zweiten Schwangerschaftshälfte, denke ich. Bestimmt geht es diesmal gut.« Shona lächelt mir zu. »Hoffen wir es, insbesondere für deinen Bruder. Libby mag aussehen wie eine Elfe, aber sie ist stark wie ein Bär. Kyle dagegen hat das alles sichtlich mitgenommen, mehr als sie, zumindest hatte es den Anschein.«
»Ich kann nicht glauben, dass ich …« Nicht für ihn da war, denke ich, doch ich spreche den Satz nicht aus, wozu auch? Ich war ewig nicht hier, es war meine Entscheidung, nun muss ich die Konsequenzen tragen, auch wenn das bedeutet, dass Kyle mich hassen wird und der Rest der Insel auch. Alle, bis auf Shona vermutlich.
»Hier.« Sie schiebt einen Teller mit Plätzchen zu mir hin, mit riesigen, unförmigen Teigklötzen, um genau zu sein.
»Was ist das?« Ich nehme einen der Kekse in die Hand und beäuge ihn misstrauisch. Er sieht aus wie ein Haufen Sand, mit winzigen Einkerbungen, die … Bäume darstellen könnten, mit Ästen und Blättern und einem Küstenstreifen mit Sand und Meer und viel Fantasie. Dieser Keks ist auf jeden Fall eine komplette Mahlzeit, groß wie mein Handteller, und meine Hände sind ehrlich nicht klein.
»Die verlorene Insel«, sagt Shona. »Ich backe sie selbst und verkaufe sie unten im Laden.«
Ich blinzle einige Sekunden lang, dann starre ich erneut auf das Gebäck in meiner Hand. »Die verlorene Insel«, wiederhole ich. Die verlorene Insel. Gott, das hätte ich beinahe vergessen. Das einzige Mysterium, das Bailevar je umgab und an das kaum jemand mehr glaubt als Shona. Die Insel vor der Insel, die einst im Meer versank.
»Orange-Ingwer«, sagt Shona. »Schmecken nicht übel.«
Ich lege den Inselkeks vor mir ab und betrachte ihn von allen Seiten. »Du backst die selbst? Ist das nicht eine Heidenarbeit?«
»Ich backe doch nicht jeden per Hand, Dummchen. Ich habe mir einige Formen anfertigen lassen. Beziehungsweise Finn hat das für mich organisiert.«
Finn. Ich bin nicht sicher, ob ich den Namen laut ausgesprochen habe oder nicht, er hallt auf jeden Fall nach in meinem Kopf. Und mir entgeht nicht, dass auch Shona ihren Worten nachspürt, sie studiert mein Gesicht, als wolle sie es malen.
»Du stehst also immer noch unten im Laden?«, frage ich, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Obwohl Ally da ist?«
Shona winkt ab. »Ally hat so gut wie alles übernommen«, sagt sie. »Ich kümmere mich nur noch um die Souvenirs.«
Ich blicke wieder auf den Keks, damit Shona nicht den Zweifel in meinen Augen entdeckt. Ich meine, Souvenirs von Bailevar – wer kauft die? Selbst von einer untergegangenen Insel, vorausgesetzt, es hat sie je gegeben, will niemand einen Keks, solange kein Tourist den Weg hierherfindet. Ich frage nicht, welche anderen Andenken sie dort unten im Laden hütet oder wer ihr je etwas davon abgekauft hat. Ich beiße in den Keks und sage: »Hmmm, der ist richtig gut, Shona.« Das ist er wirklich. »Er schmeckt … wie … ich weiß nicht, wie …«
»… die Orangen-Ingwer-Marmelade, die Finns Mutter früher von ihren Einkäufen aus London mitgebracht hat.«