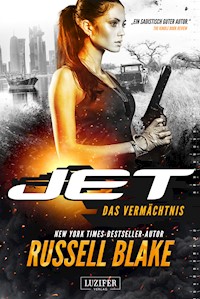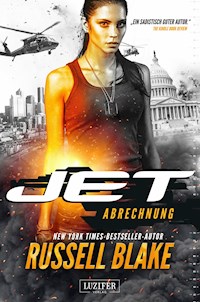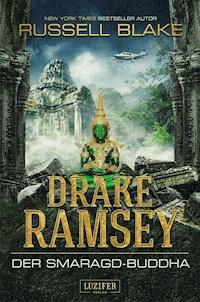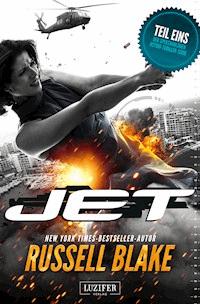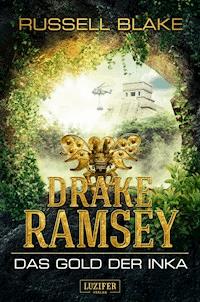
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Drake Ramsey
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Als ein vergessenes Notizbuch Jahrzehnte nach dem Verschwinden von Drake Ramseys Vater im Dschungel des Amazonas auftaucht, entschließt sich Drake, in dessen Fußstapfen zu treten und sich auf die Suche nach dem legendären Schatz der Inka aufzumachen, der in der verlorenen Stadt Paititi versteckt sein soll. Doch er ist nicht allein auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt - sowohl der CIA als auch russische Auftragskiller sind Drake dicht auf den Fersen und auch der Dschungel selbst hält einige Überraschungen für den frisch gebackenen Abenteurer bereit. Ein wahnwitziger Wettlauf um Ruhm, Geld und das nackte Überleben beginnt … ---------------------------------------------------------- "Bestes Buch in dieser Kategorie für mich!" [Lesermeinung] "Ein filmreifes Abenteuer" [Lesermeinung] "Russell Blake hat es wieder mal hingekriegt, einen wunderbaren Page-Turner voller Action und Spannung zu schreiben. Ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen und hatte es innerhalb weniger Tage durch. Von mir gibt es eine klare Leseempfehlung" [Lesermeinung] "Russel Blakes spannender und actionreicher Abenteuerroman ist eine Empfehlung für alle, die diese Art von Geschichten mögen. Es war eine Freude für mich dieses Buch zu lesen." [Lesermeinung]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DRAKE RAMSEY
Das Gold der Inka
Russell Blake
aus dem Amerikanischen übersetzt von
Copyright © 2015 by Russell Blake All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information, contact: [email protected].
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 350 Fifth Avenue. Suite 5300
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: RAMSEY'S GOLD Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Kalle Max Hofmann
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-119-6
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Kapitel 1
Südwestlich von Cajamarca, Peru, 1532 n. Chr.
Blitze zuckten durch die dunkelgrauen Wolken über dem Regenwald, während grollender Donner den Boden erzittern ließ. Eine endlos scheinende Karawane aus Lamas schlängelte sich auf einem Trampelpfad zwischen den Bäumen hindurch. Die Tiere quälten sich unter den schweren Lasten, die ihnen auf die Rücken geschnallt worden waren, ihre Hufe rutschten immer wieder auf dem matschigen Boden aus und sie waren bis auf die Knochen durchnässt.
Tausende dieser bemitleidenswerten Kreaturen waren auf diese Höllentour jenseits der Anden geschickt worden, und ihre Hirten passten mit Adleraugen auf, dass sich keines der Tiere mit seiner wertvollen Fracht ins Dickicht verirrte. Inkarri, der Leiter dieser Expedition, hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass es um nichts Geringeres ging, als das Überleben der Inka-Zivilisation.
Zwei Monate zuvor hatten die spanischen Eroberer den Inka-Kaiser Atahualpa hintergangen und gefangen genommen. Obwohl Unmengen Gold als Lösegeld in die besetzte Inka-Stadt Cajamarca gebracht worden waren, hatten die Spanier ihr Wort gebrochen und Atahualpa ermordet. Die Kunde von diesem Verrat hatte sich wie ein Lauffeuer in der Gemeinde der Inka verbreitet und es war ein einstimmiger Entschluss gefasst worden: Der Nationalschatz der Inka musste in Sicherheit gebracht werden, weit weg von den Eindringlingen.
Inkarri war seitdem ohne Pause unterwegs. Erst hatte er die Anden überquert und sich dann über die Hochwasser tragenden Flüsse des Dschungels hinweg gekämpft. Er hatte absolut unwägbares Terrain bezwungen, um möglichst viele natürliche Hindernisse zwischen sich und die spanischen Conquistadores zu bringen. Jetzt, hunderte Meilen von Zuhause entfernt, gingen seiner Truppe langsam die Ressourcen aus. Viele der Lasttiere waren bereits verendet, und die, die noch lebten, stellten durch ihren Futterbedarf eine unhaltbare Belastung dar.
Inkarri wusste, dass er diesen Trek nicht lange fortsetzen konnte. Der letzte Angriff feindseliger Amazonenkrieger hatte seinen Tribut gefordert – Hunderte seiner Männer mussten bei der Verteidigung ihr Leben lassen. Er verlangsamte sein Tempo und legte den Kopf schief. Seine bronzene Haut war ausgemergelt von den Strapazen der Reise, doch voller Aufmerksamkeit lauschte er in den Dschungel.
Aus dem Unterholz kam ihm Lomu entgegen, sein Stellvertreter, der mit einer kleinen Gruppe mögliche Routen ausgekundschaftet hatte. Inkarri hielt eine Hand hoch über den Kopf, um der Karawane einen Halt zu signalisieren.
Lomu wischte sich den Regen aus dem Gesicht, bevor er sich nah zu seinem Anführer hinüberbeugte. »Ich habe eine vielversprechende Stelle ausgemacht, etwa eine Stunde von hier. Dort sind einige Bäche, Ausläufer des großen Stromes, also wird es da reichlich Fisch geben«, sagte er leise. »Und ich habe ein bedeutsames Omen gesehen. Einen Jaguar, der mitten auf einer kleinen Lichtung stand. Genau darauf haben wir gewartet. Deutlicher hätten die Götter es nicht sagen können.«
Inkarri schaute zum Himmel auf. »Eine Stunde, sagst du? Sehr gut. Wir haben noch Zeit, bis die Dunkelheit anbricht. Was meinst du, wie ist diese Stelle gegen Angriffe zu verteidigen?«
»Wir hätten in jedem Fall eine erhöhte Position und damit einen Vorteil. Außerdem liegt am nördlichen Ende der kleine Fluss, der als natürliche Barriere dient.«
Inkarri nickte. »Dann lasse die Kunde verbreiten: Wir nähern uns unserer neuen Heimat.«
Lomu beeilte sich, seinen Männern die Frohe Botschaft mitzuteilen. Ihre Reise stand kurz vor dem Ende, und ein neues Leben in einer unerschlossenen Wildnis stand bevor. Ihre Mission war eindeutig: Eine Siedlung zu errichten, in der ihre Schätze sicher waren, weit weg von den Spaniern. Wenn dies geschehen war, würde Inkarri ins Kaiserreich zurückkehren und Fehlinformationen streuen, um die Conquistadores auf falsche Fährten zu locken. Denn er wusste, die Gier der Spanier nach Gold und Edelsteinen würde niemals versiegen und sein Volk würde niemals sicher sein.
Es würde Monate dauern, bis sie eine bewohnbare Enklave errichtet haben, aber wenn es erst einmal soweit war, würde er zurückkehren, um Frauen und arbeitsfähige Männer in die neue Hauptstadt zu führen.
Inkarri beobachtete, wie Lomu die Karawane erschöpfter Lamas entlanglief und die frohe Kunde unter die Männer brachte, die Qualen hinter sich hatten, die in der Geschichte seines Volkes einzigartig waren. Der Dschungel östlich der Berge war immer die Grenze ihres Reiches gewesen, und nur die absolute Verzweiflung hatte seine Gruppe darüber hinaus getrieben.
Eine knappe Stunde später hatten sie ihr Ziel erreicht. Die Sonne brach durch die Wolken, nachdem es bis zu diesem Moment drei Tage lang ununterbrochen geregnet hatte. Inkarri betrachtete die Baumreihen und nahm aufmerksam Maß. Nach einigen Momenten des Schweigens begab er sich langsam in die Mitte der Lichtung, wo er die Arme ausbreitete. Die Strahlen der untergehenden Sonne wärmten ihn, während er ein kleines Dankesgebet zum Himmel schickte. Als er sich seinen Kampfesbrüdern zuwandte, die inzwischen einen Halbkreis um ihn herum gebildet hatten, strahlte er geradezu vor Zuversicht und Stärke.
»Unsere Reise ist zu Ende. Nehmt den Tieren ihre Lasten ab und gewährt ihnen Ruhe. Teilt einen Wachdienst für die kommende Nacht ein, denn ab morgen beginnen wir ein neues Leben an diesem gesegneten Ort.« Inkarri legte eine Pause ein und erfreute sich an den dankbaren Blicken seiner Männer. »Oh Inti, Gott des Lichtes und der Sonne, und Apocatequil, Gott des Donners, habt Dank, dass ihr uns hierher geführt habt! Wir werden euch mit einer Stadt ehren, wie man sie noch nicht gesehen hat. Paitit soll sie heißen, nach dem Jaguar-Vater, den ihr uns als Zeichen gesendet habt. Ihre Reichtümer werden der Stoff von Legenden sein!«
Lomu starrte die Säcke an, welche die Männer auf dem feuchten Boden platzierten. Hunderte waren es, bis zum Rand gefüllt mit Gold und Juwelen, und schließlich ruhten seine Augen auf dem größten Schatz der Inka: Einer Kette aus massivem Gold, deren mit Edelsteinen bedeckte Glieder in der tief stehenden Sonne glitzerten. Sie war so schwer, dass es hundert Mann gebraucht hatte, sie hierher zu tragen. Und selbst direkt neben all den anderen Reichtümern auf dieser Lichtung wirkte sie einfach atemberaubend und einzigartig. Lomu verspürte eine grenzenlose Genugtuung darüber, dass es ihnen gelungen war, dieses Prachtstück in Sicherheit zu bringen.
Die Zeit, die nun vor ihnen lag, würde schwer werden. Aber sie würden es schaffen, ihr Volk würde überleben, und eines Tages würden sie die Spanier zurück in die See treiben. Hier würden Tempel gebaut und Babys geboren, Handelsrouten würden errichtet werden und das Imperium erneut florieren. Von ihren Taten würde man noch in Hunderten Jahren in Ehrfurcht und Hochachtung sprechen.
Für sie würde der Traum in Erfüllung gehen, in ihrer Kultur unsterblich zu werden – in bester Erinnerung bis ans Ende aller Zeit. Ihre Geschichte würde an Lagerfeuern erzählt, und der Name ihrer Stadt würde als das Kronjuwel in der gesamten Welt der Inka bekannt sein: Paititi, die Stadt aus Gold.
Kapitel 2
Patricia hetzte aus ihrem Blumenladen in Richtung Auto. Die Nacht war schon vor Stunden angebrochen und der Feierabendverkehr längst vorbei, die Innenstadt wirkte wie ausgestorben. Normalerweise blieb sie nicht so lange im Geschäft, aber am Monatsende musste sie die Buchhaltung erledigen. Es waren harte Zeiten und sie musste sich selbst um den Papierkram kümmern – dabei durfte sie sich glücklich schätzen, dass sie ihren Betrieb überhaupt am Laufen halten konnte.
Ihre Absätze klackerten laut auf dem Gehweg, ihr Atem wurde in der eiskalten Nacht zu Dampfwolken, und dann hörte sie plötzlich wieder dieses Geräusch – jemand oder etwas war hinter ihr her. Sie gab sich Mühe, ruhig zu bleiben, während sie in ihrer Handtasche nach dem Pfefferspray wühlte, das sie vor Jahren dort versteckt hatte, in der Hoffnung, es würde noch funktionieren. Sie versuchte auch, sich an die effektive Reichweite zu erinnern, konnte aber keinen anderen Gedanken fassen, als dass sie anfangen sollte, zu rennen. Sie musste rennen, und zwar so schnell sie konnte; zu ihrem wartenden Auto, wo sie in Sicherheit sein würde.
Sie zögerte an einer düsteren Straßenkreuzung und lauschte nach akustischen Anzeichen ihres Verfolgers. Ein kratzendes Geräusch hinter ihr, nicht einmal zwanzig Meter entfernt, bestätigte ihre schlimmsten Befürchtungen. Doch sie zwang sich erneut zur Ruhe. Das hätte alles Mögliche sein können. Eine Katze zum Beispiel. Oder der Deckel einer Mülltonne, der vom Wind bewegt wurde. Oder eine Ratte, die darin nach Schätzen grub.
Als sie um die Ecke bog, startete sie trotzdem einen Sprint in Richtung des Parkplatzes und ließ den letzten Anschein von Gelassenheit fallen. Wer auch immer hinter ihr her war, bekam jetzt auf jeden Fall mit, dass sie alarmiert war. Da konnten sich die Stimmen in ihr noch so lange streiten, sie war davon überzeugt, dass ihr jemand folgte.
Visionen von Serienkillern plagten ihre Gedanken, als sie die hüfthohe Betonmauer erreichte, die den Parkplatz umschloss. Sie kämpfte sich durch das verrostete und laut quietschende Drehkreuz und kramte in ihrem Mantel nach dem Schlüssel, während sie sich dem Wagen näherte. Dabei betete sie zu Gott, dass die alte Mühle beim ersten Versuch anspringen würde und verfluchte sich selbst, dass sie den dringend nötigen Gang in die Werkstatt nun schon monatelang aufgeschoben hatte.
Sie hoffte sehnlich, dass diese Entscheidung nicht ihren Tod bedeuten würde.
Patricia fummelte mit den Schlüsseln herum und schaffte es, die Autotür zu öffnen. Ohne Zeit zu verlieren, glitt sie auf den Fahrersitz und ließ ihre Handtasche neben sich fallen. Als sie den Zündschlüssel drehte, verriegelten sich automatisch die Türen, doch der Anlasser leierte nur kraftlos vor sich hin.
»Oh Gott, nein! Nun mach schon!«, murmelte sie.
Zwei schwarzbehandschuhte Fäuste krachten gegen die Fahrerscheibe. Patricia schrie auf und drehte den Zündschlüssel erneut. Mit einem heiseren Röhren stieß der Wagen eine schwarze Wolke aus. Sie legte den Vorwärtsgang ein und trat das Gaspedal durch; genau in diesem Moment nahm sie die eindeutige Form einer Pistole im Außenspiegel wahr. In Panik schleuderte sie auf die Straße zu und duckte sich, als sie die orangefarbene Blüte eines Mündungsfeuers im Rückspiegel erhaschte, Sekundenbruchteile bevor ihre Heckscheibe in einem Regen aus Sicherheitsglas zersprang.
Das altersschwache Auto holperte über die Bordsteinkante, weil sie die Ausfahrt viel zu eng nahm, und dann raste sie die Straße hinunter. Hinter ihr tauchte ein Paar Scheinwerfer auf, das sich unangenehm schnell näherte. Fassungslos starrte sie in den Rückspiegel und raste weiter in Richtung des Highways, der sie in die relative Sicherheit ihres bescheidenen Häuschens etwa zehn Minuten außerhalb der Stadt führen sollte.
Patricia fegte über die rote Ampel am Fuße der Auffahrt hinweg. Doch ihr Triumphgefühl hielt nicht lange an, denn der Verfolger blieb ihr nicht nur auf den Fersen – er kam auch immer näher, obwohl sie das Gaspedal schon fast durch den Unterboden trat. Sie hörte ihren Puls in den Ohren hämmern und ein unsichtbares Band schnürte ihr den Atem ab.
»Komm schon, komm schon …«, zischte sie und trieb ihren alten Buick zu Höchstleistungen an, während sie an der Tankstelle vorbeiraste, die die Stadtgrenze markierte.
Ein kalter Wind zerrte an den Bäumen am Rande des Highways und der Tacho quälte sich langsam an der 80-Meilen-Markierung vorbei. So schnell war der Wagen noch nie gefahren, doch es reichte nicht, um dem Verfolger zu entkommen: Ihr Blick schnellte wieder in den Rückspiegel und das andere Auto war nicht einmal 50 Meter entfernt.
Mit inzwischen 96 Meilen pro Stunde bekam sie die Kurve direkt vor der Brücke nicht mehr. Die Reifen quietschten wie ein sterbendes Tier, und dann flog der Wagen in einem kraftlosen Bogen durch die Luft.
Die Limousine, die gefolgt war, rollte langsam aus und kam am Rande der Brücke zu stehen. Ein Handschuh des Beifahrers griff nach oben und schaltete die Innenbeleuchtung aus. Langsam schaute er sich um und stellte fest, dass sonst niemand auf der Straße unterwegs war. Er ging auf das Geländer der Brücke zu und starrte in die Dunkelheit des trüben Wassers, das fünfzig Meter unter ihm vorbeidonnerte. Am Fuße der Böschung lag der Buick halb versunken und völlig zerstört im Wasser.
Er schüttelte den Kopf und zog seinen Kragen hoch; ein schwacher Schutz gegen den eisigen Wind. »Das kann niemand überlebt haben«, sagte er, als er zum Auto zurückkehrte.
»Und jetzt?«, fragte der Fahrer, dessen Hände lässig auf dem Lenkrad ruhten.
Sein Gegenüber warf einen Blick auf den Vollmond, der schief zwischen den Wolken hindurch grinste. »Jetzt kommt der schwierige Teil.«
Kapitel 3
Drake Simmons linste über das Armaturenbrett seines Honda Accord und hielt die Reihe schäbiger Einfamilienhäuser fest im Blick, wobei er sich einen weiteren Schluck seiner lauwarmen Cola genehmigte.
Er hasste es, auf der Lauer zu liegen. Stundenlang einfach nur herumsitzen um auf einen Straftäter zu warten, der vielleicht niemals auftauchen würde. Das Ganze auf einer strengen Diät aus Koffein und Donuts, und Pinkeln musste man in eine leere Plastikflasche. Er fuhr sich mit einer Hand über die Bartstoppeln auf seinem schlanken Gesicht und fragte sich wieder einmal, wie er in diesem Metier landen konnte, statt etwas aus seinem abgeschlossenen Journalisten-Studium zu machen.
Nachdem er die Uni verlassen hatte, waren die Jobaussichten allerdings alles andere als rosig gewesen. Immerhin hatte das Aufspüren von Kriminellen, die gegen ihre Meldepflicht verstoßen hatten, einige Parallelen zu seinem Traum vom Enthüllungsreporter: Man brauchte in beiden Bereichen Geduld, feste Entschlossenheit, ein gutes Händchen für Recherche und Nachforschungen, aber vor allem ein besonderes Maß von diesem verrückten Draufgängertum, das ihn seit seiner Kindheit ausgemacht hatte. Sein jetziger Job war also nur eine anspruchslosere Version seiner Wunschvorstellung, der Star einer großen Zeitung zu sein.
Die Tür von einem der heruntergekommenen Häuschen öffnete sich und ein Mann mit der verbitterten Ausstrahlung eines Junkies tänzelte die Treppe entlang, wobei er aufmerksam die Straße beäugte. Drake rutschte in seinem Sitz herunter, rückte seine Sonnenbrille zurecht und spähte dann vorsichtig übers Lenkrad.
Keine Frage, er hatte seinen Mann gefunden. Alan Crawford, bereits zweimal wegen Einbruchs verurteilt und nun kurz vor dem dritten Gang ins Kittchen. Ein Dieb, ein Betrüger, und aktuell auch noch auf der Flucht, da er letzte Woche nicht zu seiner Urteilsverkündung erschienen war. Das Interessanteste an ihm waren allerdings die fünftausend Dollar, die auf seine Ergreifung ausgesetzt waren. Das waren zehn Prozent der Kaution, die seine arme, alte Mutter für ihn hingelegt hatte, nur Sekunden bevor er sie und seinen Bewährungshelfer zu Boden schlug.
Das passte zu dem gewalttätigen Ruf, vor dem Harry Rivera, Drakes Arbeitgeber und langjähriger Freund, ihn gewarnt hatte.
»Sei vorsichtig, mein Junge. Er ist verschlagen wie ein Kojote und doppelt so gefährlich«, hatte er in seiner typisch kratzigen Kettenraucherstimme geraunzt. »Bei seinem letzten Knastaufenthalt hätte er um ein Haar seinen Zellengenossen umgebracht. Da musst du echt auf Zack sein.«
»Genau meine Art Mensch«, hatte Drake geantwortet, die Fotos des Flüchtigen in der Hand. »Ein richtiger Chorknabe. Ich werde ihn einfach höflich bitten, mit mir zu kommen – das sollte klappen!«
»Drake, übertreib’ es nicht, okay? Ich kann mir keine weiteren Beschwerden leisten. Hörst du mir zu?«
»Beschwerden? Natürlich beschweren die sich alle. Ich zerre sie vor den Richter. Was erwartest du?«
»Keine unnötige Gewaltanwendung. Ich habe immer noch Stress wegen Jarvis.«
Mel Jarvis war ein Drogendealer, der bei einer Kaution von achtzigtausend Dollar das Weite gesucht hatte. Als Drake ihn bei seiner meth-süchtigen Freundin aufgespürt hatte, wollte der Typ ihm mit einem Kantholz den Schädel spalten. Drake hatte ihn auf dem Gehweg niedergerungen, wobei Jarvis mit dem Kopf auf den Bordstein geknallt war, was ihm eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde eingebracht hatte. Natürlich hatte die Freundin ausgesagt, dass die Verletzungen entstanden seien, weil Drake bis zur Bewusstlosigkeit auf den Mann eingeprügelt hatte. Die Polizei untersuchte den Fall immer noch, obwohl es nicht zur Anklage gekommen war – die hatten eben auch nicht viel Verständnis für flüchtige Kriminelle.
»Jarvis war nichts als ein Stück Scheiße. Er hätte mich fast umgebracht. Was hätte ich denn da machen sollen? Böse gucken?«
»Seine Holde hat aber etwas anderes erzählt.«
»Ich liebe es, wenn du so altmodische Wörter benutzt.«
»Bring ihn einfach ohne gebrochene Knochen zurück, okay? Wenn du den Job nicht willst, habe ich noch drei Typen am Start, die mich um Arbeit anbetteln.«
»Ich werde ganz sanft sein, versprochen. Vielleicht versuche ich es mal mit Sarkasmus. Knackis, kurz vor der dritten Verurteilung, reagieren da ganz sicher prima drauf. Wenn er mir komisch kommt, klatsche ich einfach ironisch in die Hände oder so was!«
»Okay, du Spaßvogel. Jetzt schnapp’ ihn dir endlich, statt hier meine Luft wegzuatmen!«
Drakes Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück, als er sah, wie sich Cranford noch einmal der Haustür näherte. Jemand reichte ihm einen Rucksack von drinnen. Anschließend beäugte Cranford noch einmal aufmerksam die Straße und lief dann langsam los, in Richtung der Hauptstraße, die etwa zwei Blocks entfernt war.
Drake angelte sich den klobigen Pistolengriff seines Elektroschockers und verließ den Wagen, wobei er die Waffe in seinem grauen Kapuzenpulli versteckte, den er bei solchen Gelegenheiten gerne anzog. Er prüfte kurz das Vorhandensein von Handschellen in seiner Hosentasche und verriegelte dann den Wagen. Anschließend überquerte er die Straße, wobei er so tat, als würde er mit dem Handy telefonieren.
Erst sah alles nach einer ganz einfachen Verhaftung aus, bis irgendein Teil von Cranfords kriminellem Gehirn auf den Trichter kam, dass er verfolgt wurde. Er schlug einen Haken nach rechts und flitzte über den braunen Rasen eines verbarrikadierten Hauses, wobei er für einen Drogensüchtigen eine erstaunliche Geschwindigkeit entwickelte. Drake nahm die Verfolgung auf; seine Turnschuhe prügelten regelrecht auf den Boden ein, als er Tempo aufnahm. Cranford sprang über einen schulterhohen Maschendrahtzaun und landete im Garten des Nachbarhauses. Drake zögerte für einen Moment, doch seine Bedenken wurden sofort von dem Gedanken an die fünftausend Doller zerstreut, die eine Verhaftung für ihn bedeuten würden.
So landete auch er auf der anderen Seite des Zauns und sah Cranford über eine ungepflegte Grasfläche flitzen, die mit Müll und Hundehaufen übersät war. Am Ende angekommen, zog er sich an einer Holzwand hoch und verschwand hinüber. Als Drake ihm folgen wollte, hörte er eine Tür hinter sich knarrend aufgehen und dann die reibeisenhafte Stimme einer Frau: »Sie! Was machen Sie in meinem Garten! Verdammter Penner! Brutus, fass!«
Drake beeilte sich, ebenfalls die Holzwand hochzukommen und verfluchte Cranford innerlich, dass er es ihm so schwer machte. Brutus demonstrierte derweil die Kraft eines 50-Kilo-Rottweilers, indem er Drake beherzt ins Bein biss. Der schrie und trat nach dem Monster, während er seinen von Schmerzen durchdrungenen Körper über das Hindernis hievte.
Als er auf der anderen Seite unsanft aufkam, verzog er das Gesicht. Er stellte kurz sicher, dass die Zähne der Bestie keinen größeren Schaden angerichtet hatten, und machte sich dann wieder auf die Jagd nach Cranford. Der fummelte gerade an einem Metalltor auf der anderen Seite des Hauses herum. Als Drake ihn fast erreicht hatte, drehte sich Cranford mit einem fiesen Grinsen zu ihm um. Die metallene Mülltonne neben ihm erzählte mit ihrem blumigen Gestank von einem erfolgreichen Angeltrip am Meer.
Drake zog seinen Elektroschocker und zielte auf sein Gegenüber.
»Es ist vorbei. Du musst jetzt nur noch wählen zwischen der entspannten Tour, oder der mit ein paar tausend Volt und höllischen Schmerzen. Mir ist es egal.«
Cranford antwortete, indem er zur Seite wegtauchte und die Mülltonne vor sich hielt, um Drakes Schussbahn zu blockieren. Als er zum Wurf ansetzte, versuchte Drake noch auszuweichen, doch er wurde an der Brust getroffen und bekam einen Schwall Fischabfälle und leere Bierflaschen ab. Mit einem Grunzen landete er auf dem Hintern, und bis er sich umgedreht und den Taser in Stellung gebracht hatte, trat Cranford auch schon nach seinem Gesicht.
Drake bekam einen Stiefel gegen die Schläfe und ein wahres Feuerwerk aus Schmerzen explodierte in seinem Kopf – im Affekt schoss er dem Angreifer direkt zwischen die Beine. Cranford heulte auf und fiel unkontrolliert zuckend neben Drake zu Boden. Der versuchte gerade, einen klaren Kopf zu bekommen, und verpasste Cranford zur Sicherheit noch eine Ladung.
»Na, gefällt dir das? Hattest du dir das so vorgestellt?« Drake stand auf und warf seinem Opfer die Handschellen hin. »Zieh' dir die Dinger an. Bei der nächsten falschen Bewegung röste ich dich!«
Hinter ihm donnerte auf einmal eine Stimme aus dem Haus. »Was ist hier los? Ich habe ein Gewehr!«
Super. Genau das hatte noch gefehlt.
Drake blickte über seine Schulter. »Ich verfolge einen Verbrecher, Sir. Bitte erschießen Sie mich nicht.« Drake widmete seine Aufmerksamkeit wieder Cranford. »Zieh' die Handschellen an, oder ich drücke ab!«
Grunzend tat der Angesprochene wie ihm geheißen, sein Kampfgeist hatte ihn eindeutig verlassen. Der Mann mit der Schrotflinte kam inzwischen näher.
»Was haben Sie in meinem Garten zu suchen?«
»Dieser Taugenichts ist über Ihren Zaun gesprungen und hat sich am Tor zu schaffen gemacht. Ich habe ihn aufgehalten.«
Der Blick des Mannes verengte sich. »Sind Sie ein Bulle?«
Drake schüttelte den Kopf. »Nein, er ist auf Kaution draußen.«
»Also sind Sie so eine Art Kopfgeldjäger.«
»Ich bevorzuge die Bezeichnung Ergreifungs-Dienstleister.«
»So, so, Herr Ergreifungs-Dienstleister … wissen Sie was? Mein Bruder sitzt gerade wegen einem wie Ihnen im Kittchen. Deswegen rufe ich jetzt die Bullen und zeige Sie wegen Hausfriedensbruch an. Bewegen Sie sich nicht von der Stelle!«
Mit diesen Worten zog er ein Handy aus der Hosentasche, während Drake sich innerlich verfluchte. Hausfriedensbruch war in seinem Metier ein Kardinalfehler. Harry würde ihm den Kopf abreißen, und was noch schlimmer war, er würde auf jeden Fall Schuld bekommen, wenn er den Mann nicht von der Anzeige abbringen konnte.
»Natürlich Sir, Sie sind vollkommen im Recht. Ich hätte auch Ihr Eigentum niemals betreten, wenn dieser Kerl hier nicht eine ernsthafte Gefahr darstellen würde.«
»Schnauze. Wer so sein Geld verdient, muss auch mit den Folgen leben.«
Eine junge Stimme drang durch die offen stehende Tür. »Igitt, Mister. Sie sind ja voll mit Fischresten!«
Drake seufzte und gab sich Mühe, nicht von dem Gestank der Eingeweide würgen zu müssen, die sein Pullover immer tiefer einsaugte.
»Ich weiß, Junge.«
Der Mann grunzte über seine Schulter: »Bailey, zurück ins Haus! Sofort!«
»Ich bin doch im Haus.«
»Soll ich dich übers Knie legen? Verzieh' dich!«
»Willst du die Männer erschießen?«
Der Mann grinste und entblößte dabei grauenhaften zahnärztlichen Pfusch, der Drake erschaudern ließ. »Mann kann nie wissen, mein Sohn! Und jetzt verzieh' dich!«
Wenige Minuten später wurde die Gruppe von Sirenen begrüßt und Drake stand in aller Seelenruhe daneben, während der grummelige Hausbesitzer seine Anzeige zu Protokoll gab. Ein zweites Polizeiauto fuhr vor, um Cranford wieder ins Gefängnis zu bringen, während der andere Beamte die Anzeige unterschreiben ließ.
»Okay Simmons, Sie kennen das ja. Wir müssen Sie mit auf die Wache nehmen.«
Drake schüttelte den Kopf. »Nein, das kenne ich nicht. Machen Sie Witze?«
»Schön wär's. Ach ja, Ihren Taser muss ich auch konfiszieren.«
Drake übergab zähneknirschend die Waffe, während der Hausbesitzer triumphierend grinste.
»Was zur Hölle ist das für ein Gestank? Riecht wie eine Jauchegrube«, beschwerte sich der Cop, als er Drake zum Streifenwagen begleitete.
»Hatten Sie auch schon mal so einen Tag?«
Der Polizist blieb stehen und öffnete Drake die hintere Tür, dann nickte er. »Jeden Tag, Mann. Vorsicht mit dem Kopf.«
Kapitel 4
Das Licht des Nachmittags wurde orangefarben, als die Sonne sich dem Horizont näherte. Harry ging hinter seinem Schreibtisch auf und ab und betrachtete die Baumwipfel hinter seinem Büro, einen kalten Zigarettenstummel zwischen den Zähnen.
»Es tut mir leid, mein Junge, aber ich habe dich gewarnt. So eine Scheiße darf nicht mit meiner Firma in Verbindung gebracht werden.«
»Was für eine Scheiße? Ich hab ihn doch erwischt«, protestierte Drake.
»Und dabei hast du Hausfriedensbruch begangen. Du hast Glück, dass die alte Dame nebenan nicht auch noch auf den Zug aufgesprungen ist!«
»Die hatte eher Glück, dass ich sie nicht wegen dem Hundebiss angezeigt habe.«
Harry schüttelte den Kopf und ließ sich in seinen abgewetzten Chefsessel fallen. Seine Nervosität war endlich verflogen und er zog eine metallene Schatulle aus der Schreibtischschublade.
Drake fing das Bündel Hunderter, die mit einem Gummiband fixiert waren, lässig mit einer Hand.
»Gute Reflexe«, lächelte Harry.
»Danke. Sind das die fünf Mille?«
»Jawoll. Und jetzt hör’ mir mal zu, Drake. Wir haben schon viel zusammen erlebt, deswegen gebe ich dir einen gut gemeinten Rat: Mach mal eine Pause. Fahr in den Urlaub. Such dir ein Mädchen und betrinke dich. Und dann überlege mal, den Beruf zu wechseln. Das hier ist nichts für dich. Du bist zu schlau, um ein Kopfgeldjäger zu sein. Du hast doch dein ganzes Leben noch vor dir … und verschwendest nur deine Zeit.«
Drakes Blick fixierte sich auf Harrys Gesicht. »Du schmeißt mich raus? Ernsthaft?«
»Du bist kein Angestellter. Du bist ein Freelancer. Deshalb kann ich dich gar nicht feuern. Aber ich werde dir erst mal eine Weile keine neuen Aufträge geben. Den Stress kann ich gerade nicht gebrauchen. Du weißt doch, dass du keinen privaten Grund und Boden betreten darfst. Und Cranford hat sich beschwert, dass du unnötige Gewalt eingesetzt hast. Das könnte vor Gericht landen.«
»Was? Ich hab ihn doch nur getasert!«
»In die Kronjuwelen.«
»Weil er versucht hat, mir das Gesicht zu zertreten!«
»Gibt trotzdem kein gutes Bild ab.« Harrys Blick wanderte zu seinem Notizblock. »Junge, du bist mein bester Mann, wenn es darum geht, herauszufinden, wo diese Wichser sich verstecken. Es ist schon fast unheimlich, wie ein sechster Sinn. Aber du hältst dich nicht an die Regeln, und das ist ein echtes Problem. Denn es fällt im Endeffekt auf mich und meine Firma zurück.« Er kniff die Augen zusammen, um seine eigene Handschrift entziffern zu können.
»Oh, hey, das habe ich fast vergessen: Ein Typ hat nach dir gefragt. Anwalt, sagte er.« Harry riss die Notiz heraus und drückte sie Drake in die Hand, der sie mit fragendem Gesichtsausdruck studierte.
»Hat er gesagt, was er wollte?«
»Nö. Vielleicht will dich ja noch jemand verklagen. War selbst für deine Verhältnisse ein langer Tag, oder?«
»Sehr witzig. Kann ich mal telefonieren?«
»Klar. Und dann mach dich dünne. Wenn du wirklich weiter arbeiten willst, ruf’ mich in vier Wochen an. Aber bis dahin bist du runter von der Liste. Nimm es bitte nicht persönlich.«
»Natürlich nicht.« Drake stand auf und ging zur Bürotür. »Ich nehme Bettys Telefon, okay?«
»Mi casa, su casa! Sorry, dass ich dich auf Eis legen muss.«
»Kein Problem. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht sollte ich irgendwohin fahren, wo es warm ist, und ein bisschen Sightseeing machen. Mexiko oder so. Da soll man ja günstig über die Runden kommen.«
»Das ist die richtige Einstellung! Du brauchst ein bisschen Farbe! Und einen Schwips! Und natürlich eine Señorita. Du bist noch jung. Lebe mal ein bisschen!«
»So jung bin ich auch nicht mehr.«
»Was denn, fünfundzwanzig? Da hab ich ja in meiner Tiefkühltruhe Sachen, die älter sind!«
»Ich bin sechsundzwanzig. Nicht, dass ich mitzählen würde.«
»Natürlich nicht.«
Drake saß hinter Bettys Empfangstresen und wählte die Nummer. Der Vorwahl nach zu urteilen ging der Anruf in den Bundesstaat Washington. Es klingelte dreimal, bis sich eine Frauenstimme meldete.
»Baily, Crane und Lynch. Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich glaube schon. Ich soll einen Michael Lynch zurückrufen.«
»Verstehe. Wen darf ich durchstellen?«
»Drake Simmons.«
Die nächsten dreißig Sekunden spülte Warteschleifen-Musik seine Ohren, bis sich ein voluminöser Bariton im Hörer breitmachte. »Michael Lynch.«
»Mister Lynch, hier ist Drake Simmons. Sie wollten mich sprechen?«
»Das ist korrekt. Lassen Sie mich Ihnen zunächst mein Beileid aussprechen.«
»Beileid?«
»Genau. Ihre Tante, Patricia Marshall, ist vorgestern von uns gegangen.«
»Entschuldigen Sie bitte. Patricia Marshall? Das soll meine Tante gewesen sein?«
»Korrekt. Ich schließe daraus, Sie kannten sie kaum?«
»Das muss ein Irrtum sein. Ich kenne überhaupt keine Patricia Marshall.«
»Hm. Offensichtlich war sie die Schwester Ihres Vaters.«
»Soweit ich weiß, hatte mein Vater keine Schwester.«
»Wie auch immer, als Vollstrecker ihres letzten Willen und Testaments hat sie mir sehr klare Anweisungen gegeben. Ich habe hier ein Päckchen für einen Drake Simmons, wohnhaft in der San Antonio Road in Mountain View, Kalifornien. Ihr Arbeitgeber war so freundlich, mir Ihre Identität zu bestätigen. Ich bin außerdem bevollmächtigt, Ihnen ein Flugticket nach Seattle zu bezahlen, weiterhin die Unterkunft für zwei Tage. Und natürlich eine Aufwandsentschädigung.«
»Aufwandsentschädigung?«, plapperte Drake nach. Seine Aufmerksamkeit stieg sprunghaft an.
»Ja, eintausend Dollar pro Tag für Ihre Zeit. Dazu kommt selbstverständlich das, was sie Ihnen hinterlassen hat.«
»Sie hat mir noch etwas hinterlassen, abgesehen von diesem … Päckchen?«
»Korrekt. Fünfundzwanzigtausend Dollar. Ihre gesamten Ersparnisse.«
»Mister Lynch, es tut mir wirklich leid, aber das kann nur ein Missverständnis sein. Ich kannte diese Frau nicht! Natürlich tut es mir leid, dass sie verstorben ist, aber ich weiß gerade nicht, was ich mit diesen Informationen anfangen soll. Woher soll ich wissen, dass die Sache Hand und Fuß hat?«
»Sie haben doch in unserer Kanzlei angerufen. Wenn Sie wollen, stellen Sie Nachforschungen an – ich bin Mitglied der Anwaltskammer, unsere Kanzlei existiert seit über zwanzig Jahren, das sollte alles kein Problem sein.« Lynch machte eine Pause. »Mister Simmons, hier liegen fünfundzwanzigtausend Dollar für Sie bereit, dazu ein Päckchen, das ich Ihnen nur persönlich übergeben darf. Können Sie es wirklich nicht einrichten, dieses Erbe anzutreten?«
»Genau da liegt das Problem. Wie kann ich etwas von einer Person erben, die ich nicht mal kannte?«
»Rechtlich ist das überhaupt kein Problem. Das Geld gehört Ihnen, sobald Sie hier erscheinen und das Erbe antreten.«
Drake dachte über diese Ansammlung merkwürdiger Umstände nach. »Und es gibt keinen Haken?«
»Nein. Sie müssen nur persönlich erscheinen, sich ausweisen, unterschreiben, und dann das Päckchen sowie das Geld entgegennehmen. Das ist alles.«
Drake schnappte sich einen von Bettys Kugelschreibern. »Okay. Ich kann morgen abreisen. Ich überprüfe Ihre Angaben und wenn das alles stimmt, sitze ich in der ersten Maschine. Wie komme ich an das Ticket, und sind Sie um die Mittagszeit im Büro?«
***
Als Drake am nächsten Mittag im Gebäude der Kanzlei ankam, war er von dem barocken Dekor und den holzvertäfelten Wänden beeindruckt. Die Räumlichkeiten rochen nach Wohlstand, gravierenden Entscheidungen und wichtigen Menschen. Die Empfangsdame war eine perfekt gestylte Asiatin, kaum älter als Drake selbst. Sie inspizierte ihn über den Rahmen ihrer Designerbrille mit der Präzision eines Chirurgen. Ein einziger Blick auf ihre Businesskleidung gab ihm das Gefühl, völlig underdressed zu sein, denn er trug nur eine graue Cargohose und ein blaues Poloshirt. Seine Windjacke hielt er zusammengequetscht in einer Hand, während er auf Lynch wartete.
Ein großer, bärtiger Mann mit leicht ergrautem Haar, der in einem kohleschwarzen Anzug steckte, näherte sich ihm wenig später mit einer ausgestreckten Hand und einem Seriosität ausstrahlenden Gesichtsausdruck.
»Drake Simmons? Michael Lynch. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise?«
»Ja, war okay.«
»Sehr gut. Würden Sie mir bitte in den Besprechungsraum folgen?«
»Klar.«
Sie durchquerten die ruhige Lobby und betraten einen großen Raum mit einem lang gezogenem Tisch. Ein Bücherregal mit juristischen Werken säumte eine komplette Wand, während gegenüber ein Panoramafenster einen fantastischen Blick auf Seattle zeigte. Lynch bot Drake einen Stuhl direkt am Fenster an. Dann begab er sich zum Kopf des Tisches, wo ein kleines Bündel aus braunem Packpapier auf ihn wartete, daneben ein schwerer, lederner Einband mit Formularpapieren.
»Lassen Sie uns doch gleich zur Sache kommen«, sagte Lynch, »würden Sie sich bitte ausweisen?«
»Klar. Reicht mein Führerschein?«
»Sicherlich.«
Drake schob die Karte über den Tisch, worauf der Anwalt einen Knopf an seiner Gegensprechanlage drückte. »Würden Sie bitte eine Kopie für mich machen?«
Ein paar Sekunden später erschien eine Blondine in einem schwarzen Businessdress und nahm wortlos Drakes Dokument entgegen. Sie lächelte knapp und verschwand dann wieder mit der gleichen professionellen Eleganz, mit der sie gekommen war.
Lynch machte etwas Smalltalk, bis die Dame mit einer Fotokopie zurückkam, die sie vor ihm auf den Tisch legte. Er studierte das Blatt Papier so aufmerksam, als würde darauf die Relativitätstheorie erklärt, woraufhin er den Lederumschlag aufklappte und ihn zusammen mit dem Führerschein zu Drake hinüber schob.
»Unterschreiben Sie bitte auf der Linie«, erklärte er. Drake tat wie ihm geheißen und steckte seine Fahrerlaubnis wieder ein.
»Sehr schön. Dann hätten wir das. Und dies, junger Mann, gehört jetzt Ihnen.« Er händigte ihm einen Verrechnungsscheck sowie das Päckchen aus. »Oh, und eine Kleinigkeit gibt es doch noch. Nichts Wildes.«
»Eine Kleinigkeit?«, wiederholte Drake und war sofort misstrauisch.
»Richtig. Sie müssten das Päckchen bitte hier in diesem Raum öffnen und sich die Nachricht darin durchlesen. Sobald Sie das getan haben, und sich dazu entscheiden, das Päckchen nicht behalten zu wollen, werden Sie Ihre zweitausend Dollar Spesengeld erhalten und können gehen. Ich wurde instruiert, den Inhalt in diesem Fall einem großen Museum in New York zukommen zu lassen. Für Sie wäre die Sache dann damit abgeschlossen.«
»Moment. Ich muss nur die Nachricht einer Frau lesen, von der ich nie gehört habe?«
»Ihre kürzlich verstorbene Tante.«
»Klar. Okay. Holen Sie schon mal den Scheck. Das wird nicht lange dauern.«
»Wie Sie wünschen. Seien Sie vorsichtig mit der Verpackung. Sie werden nicht wollen, dass die Nachricht beschädigt wird«, sagte Lynch mit einer Spur Enttäuschung in der Stimme. »Ich bin gleich wieder da.«
Drake wartete, bis die schwere Tür sich schloss und er alleine war. Nun gut. Er würde dieses Spielchen mitmachen. Der alte Knacker nahm seinen Job offensichtlich sehr ernst, und die Freude konnte er ihm machen. Ein bisschen Interesse vortäuschen und dann mit dem Geld abhauen. Fünfundzwanzig Mille. Oder sogar siebenundzwanzig, mit den zwei Tausendern für die Spesen. Zusammen mit der Prämie für Cranford konnte er es sich damit mindestens ein Jahr am Strand von Baja gut gehen lassen.
Er lehnte sich nach vorne und begann, an dem braunen Papier herumzuzerren, das auf ihn wie eine alte Brötchentüte wirkte. Dann erinnerte er sich an Lynchs Warnung und ließ es etwas vorsichtiger angehen. Er faltete das Ding auseinander, löste das vergilbte Klebeband und fand einen gefalteten Briefbogen auf einem dicken Leder-Notizbuch vor, das mit einem Bindfaden vor dem Auseinanderfallen bewahrt wurde. Drake klappte den Brief auseinander und betrachtete die flüssige, definitiv weibliche Handschrift, die die Seite füllte.
Lieber Drake,
wenn du diese Zeilen liest, bin ich tot. Wieso und warum ist jetzt nicht von Belang. Wichtig ist, dass du einige Dinge über deine Vergangenheit erfährst. Wichtige Dinge über deinen Vater, meinen Bruder.
Nach seinem Tod bin ich aus Portland weggezogen und habe alles hinter mir gelassen. Das habe ich getan, weil die Männer, die ihn umgebracht haben, auch nach mir suchen würden. Genau wie sie deine Mutter gesucht hätten, wäre sie nicht schon gestorben. Was mir übrigens wirklich sehr leidtut, denn sie war ein wahrer Engel und ich vermisse sie.
Wo soll ich anfangen?
Ich war bei deiner Taufe dabei. Bei deinen ersten vier Geburtstagen. Bei unzähligen Ausflügen, Picknicks, Abendessen. Doch dann hat sich alles verändert. Dein Vater ging fort und kehrte nie mehr zurück. Aber damit greife ich der Geschichte zu weit vor.
Kennst du die Geschichte zu deinem Vornamen? Du wurdest nach einem der größten Abenteurer aller Zeiten benannt: Sir Francis Drake. Dein Vater bewunderte seinen Mut, und das hat vermutlich sein Schicksal besiegelt. Dein richtiger Nachname ist Ramsey. Drake Ramsey. Deine Mutter und ich hatten unsere Namen nach dem Tod deines Vaters geändert, und deinen natürlich auch. Warum du also nicht mehr Ramsey heißt, ist eines der Hauptthemen dieses Briefes.
Dein Vater hat dich über alles geliebt. Worte können seine Freude darüber, dass du auf die Welt gekommen bist, gar nicht ausdrücken. Dass du ihn selbst nie wirklich kennenlernen wirst, bricht mir das Herz.
Dein Vater, Ford Ramsey, war ein Abenteurer. Ein Schatzjäger. Er war ein guter Mann, aber er hatte etwas Wildes an sich, das sich nicht im Zaum halten ließ. Deine Mutter wusste das, als sie ihn heiratete, doch es machte ihr nichts aus.
Er wurde getötet, als er eine Inka-Stadt suchte, die Überlieferungen zufolge den größten Schatz aller Zeiten beherbergen soll. Das Notizbuch enthält alle seine Recherchen und Überlegungen dazu, bis zu dem Punkt, da er nach Südamerika aufbrach. Wenig später erreichte uns die Nachricht, dass er im Dschungel umkam – ermordet unter ungeklärten Umständen. Ich weiß das überhaupt nur, weil sein treuester Freund und Begleiter, der ebenfalls seinen Namen geändert hat und sich nun Jack Brody nennt, mit dem Leben davon gekommen ist.
Ich habe dir das wenige Geld überlassen, das ich in meinem Leben ansparen konnte. Dazu das wertvollste Geschenk, das ich bieten kann: Die Worte deines Vaters, in seiner eigenen Handschrift, die sein Vorhaben detailliert beschreiben. Lies seine Aufzeichnungen und pass gut darauf auf. Ihr Wert ist unschätzbar.
Deine dich liebende Tante,
Patricia Ramsey.
Kapitel 5
Drake las die Nachricht noch dreimal komplett durch und fragte sich, ob das alles wahr sein konnte. Er hatte keine Erinnerungen an seinen Vater, zumindest keine konkreten. Da gab es nur den vagen Eindruck eines Mannes bei der ersten Geburtstagsfeier, an die er sich erinnern konnte. Vier Jahre war er damals alt geworden, er hatte einen roten Cowboyhut getragen und versucht, den Schwanz an einen Esel aus Pappe anzupinnen. Bei seiner Mutter stand eine verschwommene Gestalt, männlich, hochgewachsen, aber ein genaueres Bild konnte er einfach nicht heraufbeschwören. Das war sein einziges Bild von seinem Vater, von dem seine Mutter behauptet hatte, er wäre bei einem Unfall gestorben. Abgesehen davon, dass sie immer wieder betont hatte, wie sehr er Drake geliebt habe und dass er ein guter Mann gewesen sei, hatte sie Gespräche über ihn vermieden. Wenn es doch einmal dazu kam, lieferte sie bloß oberflächliche Details. Er war Autor und Fotograf gewesen, sehr smart und engagiert. Und einige Eigenschaften soll Drake von ihm übernommen haben: Ein fotografisches Gedächtnis und das Talent, aus scheinbar zusammenhanglosen Daten komplexe Schlüsse zu ziehen, die jeder andere übersah.
Die wenigen Fotos, die sie von ihm besaß, zeigten einen gut aussehenden Mann Anfang vierzig, der ebenso dichtes, braunes Haar wie Drake hatte und dessen Augen einen Schimmer purer Lebensfreude ausstrahlten. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Männern war offensichtlich, aber das verstärkte Drakes unstillbare Sehnsucht nach seinem Vater nur noch mehr.
Und jetzt gab es auf einmal eine Verbindung, einen direkten Draht in die Vergangenheit: die Gedanken und Beobachtungen seines Vaters schwarz auf weiß, in seiner eigenen Handschrift.
Kein Wunder, dass seine Neugier kaum zu bremsen war. Er befreite das Büchlein mit zitternden Händen von dem geknoteten Bindfaden und schlug endlich das verwitterte Deckblatt auf.
Lynch kehrte in den Raum zurück, ließ Drake aber sofort wieder allein, als er ihn lesend sah, damit er ungestört mit den Geistern der Vergangenheit in Kontakt treten konnte. Drake bekam das gar nicht mit, so vertieft war er in die Aufzeichnungen seines Vaters, und als Lynch das nächste Mal den Raum betrat, war bereits eine Stunde vergangen. Erstaunt sah Drake von den vergilbten Seiten auf.
»Wie ich sehe, haben Sie beschlossen, sich mit Patricias Erbe zu beschäftigen«, stellte der Anwalt fest.
»Es … es ist wirklich faszinierend. Was wissen Sie darüber?«
»Absolut nichts, abgesehen von den Eckdaten, die ich Ihnen genannt habe. Ich sollte Ihre Reise hierher arrangieren, Ihnen den Scheck und das Päckchen sowie Patricias letzten Willen übergeben. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Haben Sie sich schon entschieden, ob Sie es behalten möchten, oder eine Spende an das Museum bevorzugen?«
Drake nickte, schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich nehme es mit.«
»In diesem Fall habe ich weitere Anweisungen, die von Ihrer Entscheidung abhängig waren. Patricia hatte eine Lebensversicherung. Kein Vermögen, aber doch substanziell. Ich wurde autorisiert, Ihnen die Mittel daraus zukommen zu lassen, sobald diese ausgezahlt sind.«
Drake stutze. »Substanziell? Wie viel ist es denn?«
»Wenn ich richtig informiert bin, beläuft sich die Summe auf siebzigtausend Dollar.«
Drake musste sich wieder setzen. Gestern war er noch pleite gewesen, hatte Drogensüchtige durch fiese Gegenden gejagt, und auf einmal war er im Besitz von fast hunderttausend Dollar … und noch dazu der spannendsten Lektüre, die er je in den Händen gehalten hatte.
»Wirklich? Wann wird das denn ausbezahlt?«
»Ich warte noch auf die Todesurkunde. Sobald diese eingetroffen ist, dürfte es sich nur noch um fünf bis zehn Tage handeln.«
Drake nickte stumm. Er lehnte sich nach vorne und faltete seine Hände, das Notizbuch an seiner Seite. »Wie gut kannten Sie denn … meine Tante?«
Lynch wirkte, als hätte er diese Frage bereits erwartet. »Ich wurde ihr von einem anderen Klienten empfohlen. Ich habe kleinere rechtliche Angelegenheiten für sie erledigt. Und dann natürlich ihr Testament und den letzten Willen, wie Sie wissen.«
»Wie ist sie denn gestorben?«
»Es war ein Autounfall. Der Gerichtsmediziner sagte, sie war bei dem Aufprall sofort tot, also musste sie nicht leiden.«
»Wo hat sie gewohnt?«
»In Idaho.« Lynch machte keine genaueren Angaben und Drake hatte das Gefühl, dass er keine weiteren Details preisgeben wollte. Aber er musste es versuchen.
»Haben Sie eine Ahnung, warum sie ihren Namen geändert hat?«
Lynch schüttelte den Kopf und räusperte sich. »Sie haben jetzt alle Informationen, die mir vorlagen. Ihre Kontodaten sollten Sie mir noch mitteilen, damit ich sofort eine Überweisung veranlassen kann, wenn die Versicherung ausgezahlt wird.«
Drake schloss die Augen und sagte seine Bankverbindung aus dem Kopf auf, wobei Lynch alles sorgfältig notierte. Anschließend stand Lynch auf und räusperte sich erneut. »Dann haben wir es. Ich lasse Sie wissen, wenn die Überweisung unterwegs ist. So bleibt mir nur noch, Ihnen für Ihr Kommen zu danken. Oh, und hier ist der Scheck über die zweitausend Dollar, zuzüglich der Dreihundert für Ihr Hotel.«
Drake nahm das Stück Papier entgegen. Die Kanzlei hatte seinen Flug bezahlt und damit war alles erledigt. Abgesehen von der Lebensversicherung. Lynch schüttelte Drakes Hand und entließ ihn dann in die Lobby, wo er sich ein Taxi rufen ließ und den Fahrstuhl ins Erdgeschoss nahm. In der einen Jackentasche hatte er die Aufzeichnungen seines Vaters, in der anderen ein kleines Vermögen.
Er ließ sich von dem Fahrer bei der nächsten Filiale der Bank absetzen, die den Scheck ausgestellt hatte und wartete geduldig in der Schlange, bis er ihn einlösen konnte. Dabei ignorierte er den skeptischen Blick des übergewichtigen Angestellten, der ihm das Geld in Hundert-Dollar-Noten auszahlen sollte.
Das Taxi stand immer noch auf dem Parkplatz, als er mit dicken Geldbündeln in den Hosentaschen wieder nach draußen kam. Er gab dem Fahrer als Nächstes die Adresse seines Hotels und ließ sich dann in den Sitz fallen. Seine Gedanken drehten sich nur um die unglaubliche Entwicklung der letzten Ereignisse. Er hatte jetzt buchstäblich die Taschen voller Geld und nichts zu tun, außer sich mit den Aufzeichnungen seines Vaters auseinanderzusetzen.
Anschließend nahm Drake ein spätes Mittagessen ein, wobei er sich einen Hamburger und ein Bier gönnte. Dann las er an einem ruhigen Tisch im Hotelrestaurant. Als der Kellner auftauchte, um seinen leeren Teller abzuräumen, war Drake überrascht – eine halbe Stunde war im Handumdrehen verflogen, das Büchlein hatte ihn regelrecht in seinen Bann geschlagen. Er zahlte die Rechnung, kehrte auf sein Zimmer zurück und verbrachte den Rest des Tages mit Lesen. Als die Nacht hereinbrach, war er fertig, und der bereitgelegte Schreibblock des Hotels war voller Notizen.
Ford Ramseys Aufzeichnungen zufolge hatten die Inka um das Jahr 1600 herum auf der Flucht vor den Spaniern ihre Reichtümer in den Dschungel geschleppt, wo sie eine neue Siedlung gründeten: Paititi, die Inka-Stadt aus Gold. Für etwa ein Jahrhundert florierte die Stadt, doch dann änderte sich etwas. Der Fluss, der die Metropole versorgte, wurde verunreinigt, und die Bevölkerung verlor dadurch ihre Reproduktionskraft. Irgendwann war der letzte Bewohner verstorben und es blieb nur eine Geisterstadt zurück. In den Hunderten von Jahren, die seitdem vergangen sind, haben sich immer wieder Abenteurer auf die Suche gemacht, doch alle kamen mit leeren Händen zurück … zumindest diejenigen, die überhaupt zurückkamen. Ramsey hatte jedes Fitzelchen Informationen zusammengetragen, selbst aus den obskursten Quellen, und dadurch eine grobe Vorstellung vom Standort der Stadt erhalten. Sie musste irgendwo im östlichen Dschungel Perus liegen, oder schon an der Westgrenze des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien. Er hatte den Einschlagsort eines Meteoriten um das Jahr 1700 herum ausgemacht, der möglicherweise das Wasser in der Region verseucht haben könnte.
In den Notizen ließen sich alle Details finden, die den Vater zu seinen Schlüssen gebracht hatten. Dazu gehörte seine Überzeugung, dass die Inkas einige Außenposten auf dem Weg nach Paititi errichtet hatten, um Nachzüglern den Weg zu weisen. Wenn man diese Orte aufspüren könnte, würden sie den Weg nach Paititi weisen. Drakes Vater hatte eine Ahnung, wo er nach den letzten Gliedern dieser Kette suchen musste, und war deswegen auf eine schicksalhafte Reise nach Peru aufgebrochen, die seine letzte sein sollte.
Als Drake das letzte Kapitel erreichte, nahm die Geschichte allerdings noch eine ominöse Wendung. In völlig leidenschaftsloser Sprache schilderte sein Vater, dass er von einem amerikanischen Geheimdienst mit einem Angebot konfrontiert worden war, das er nicht ausschlagen konnte. Die Sache unterlag offensichtlich höchster Geheimhaltung und wurde entsprechend nicht weiter ausgeführt.
Das war der letzte Eintrag seiner Aufzeichnungen.
Drake lehnte sich zurück und betrachtete das kleine Büchlein nachdenklich. Sein Instinkt als investigativer Journalist war vollends geweckt und die letzten Seiten hatten ihm ganz deutlich gemacht, warum sein Vater auf die Suche nach der verlorenen Stadt aufgebrochen war. Es ging nicht nur darum, dass Paititi ein historischer Fund wäre, sondern ganz offensichtlich ging es auch um Belange der nationalen Sicherheit – wobei die Zusammenhänge zwischen einer Inka-Stadt und amerikanischen Geheimdiensten vielleicht sogar ein noch größeres Mysterium waren als Paititi selbst.
Drake schaute seine Notizen durch und stellte sich dem Ansturm von Gefühlen in seinem Kopf. Er hatte gerade einen Einblick in die Gedankenwelt seines Vaters bekommen, und durch sein offenbar erbliches Talent, die gleichen Muster zu erkennen und dieselben Schlüsse zu ziehen, wurde er regelrecht in diese Welt hineingesogen. Nachdem er einige der notierten Namen umkringelt hatte, holte er sein iPad hervor und startete Suchen nach Paititi und diversen anderen Begriffen. Er las die Legende des verlorenen Schatzes und schnell wurde ihm klar, dass dessen Verlockung ihn bereits voll erfasst hatte.
Natürlich plante er nicht wirklich, sich selbst auf die Suche nach einem Inka-Schatz zu machen. Das wäre Wahnsinn. Aber es sprach nichts dagegen, den alten Freund seines Vaters ausfindig zu machen, um zu erfahren, was in den letzten Tagen von Ford Ramseys Leben geschehen war. Diesem Unterfangen stand rein gar nichts im Wege, denn er hatte keinen Job mehr aber die Taschen voller Geld.
Seine erste Aufgabe würde es sein, diesen Mann ausfindig zu machen. Drake besuchte eine Webseite, die er zur Suche von Kriminellen benutzte und fing an zu tippen. Das Interface flackerte und blinkte, Zahlen und Buchstaben liefen hypnotisch über den Bildschirm, bis ein Fenster aufploppte und Drake weitere Informationen hinzufügte. Es wurde ihm allerdings schnell klar, dass diese Suche nicht einfach werden würde. Es gab Hunderte von Treffern und Drake hatte keine anderen Suchkriterien als den Namen, und der war so nichtssagend, wie es nur irgend ging.
Jack Brody.
Mehr hatte er nicht.
Aber mit genügend Beharrlichkeit würde es reichen.
Kapitel 6
Als Drake auf dem Flughafen von San Jose landete, ging die Sonne bereits unter, da sich sein Abflug in Seattle um zwei Stunden verspätet hatte. Er beeilte sich, in das Parkhaus und dort zu seinem Wagen zu kommen, denn er fieberte schon seiner kommenden Computersession entgegen. An seinem Rechner würde es ihm sicherlich gelingen, den richtigen Jack Brody zu finden, die Möglichkeiten auf dem Tablet waren hingegen einfach zu beschränkt – ein Umstand, der seine Wartezeit in Seattle noch frustrierender gemacht hatte.
Rosa- und orangefarbene Wolkenbänder marmorierten den zwielichtigen Himmel, als er aus dem Parkhaus kam. Als er das Fenster herunterkurbelte, um den Parkwächter zu bezahlen, fühlte sich die Luft schwer und feucht an – ein Frühjahrsregen war im Anmarsch.
Die Fahrt nach Hause war erwartungsgemäß zäh, denn die Freeways waren vom Feierabendverkehr verstopft. Die nicht enden wollenden und immer gleich aussehenden Einkaufszentren und Autoläden, an denen er vorbei rollte, wirkten wie Altare des Kommerzes auf ihn und versetzten ihn in eine melancholische Stimmung.
Als er es endlich nach Hause geschafft hatte, lagen auf seiner Türschwelle die Zeitungen der vergangenen beiden Tage, doch er kickte sie achtlos beiseite. Und als er sich in seiner Wohnung umschaute, wurde ihm einmal mehr klar, dass er eine viel zu hohe Miete für dieses schäbige Zimmer zahlte. In Menlo Park waren die Preise durch den nicht enden wollenden Boom Silicon Valleys immer mehr in die Höhe geschossen, und dadurch war eigentlich die gesamte südliche Halbinsel für Menschen, die nicht gerade im Softwarebusiness waren oder High-Tech-Elektronik entwickelten, kaum noch zu bezahlen. Grimmig knipste er das Licht an und begab sich in die lächerlich kleine Küchenecke.
Dort zog Drake die drei dicken Bündel von Hundert-Dollar-Noten aus seinen Taschen und legte sie nebeneinander auf den Tisch. Er war überrascht, wie wenig Platz dreißigtausend Dollar einnahmen. Das wirkte schon fast wie Betrug. Bei seiner normalen Arbeit hätte es sechs bis acht Monate gebraucht, in denen er sein Leben auf der Jagd nach Kriminellen riskiert hätte, um diese Summe zusammen zu bekommen – und es waren einfach nur drei kleine Stapel Papier.
Er ließ das Geld liegen und ging zu seinem Lebensmittelregal, das sich als komplett leer entpuppte. Also machte er den Kühlschrank auf, doch auch dort bot sich kein viel besserer Anblick. Ein Klumpen eingefallenen Weißbrotes, vier Energydrinks, Reste vom Italiener von vor vier Tagen sowie sieben Flaschen Bier. Er schnappte sich die weiße Styroporbox und beäugte skeptisch die halbe Lasagne darin. Nachdem er ein paar Mal vorsichtig geschnuppert hatte, zuckte er mit den Schultern und schob das Gericht in die Mikrowelle. Dann machte er sich ein Bier auf.
Das verdammte Notizbuch hatte ihn in eine griesgrämige Stimmung versetzt, die er einfach nicht los wurde. Im Vergleich zum Leben seines Vaters war sein Alltag einfach nur erbärmlich öde. Sein Dad hatte jede Nacht nach der Arbeit eine Reise in den Amazonas-Dschungel geplant und vorbereitet, und was machte er? Steckte in seiner miesen Laufbahn als Kopfgeldjäger bereits in einer Sackgasse, fuhr eine alte Rostlaube, und sein Liebesleben war nichtexistent. Wirklich toll für einen Top-Studenten, der als Bester seines Jahrgangs abgeschlossen hatte. »Ein begnadeter Autor mit einem scharfen, analytischen Verstand« war die Zusammenfassung eines begeisterten Professors gewesen. All das hatte ihm im echten Leben überhaupt nicht weitergeholfen. Er hatte es nicht mal geschafft, einen Job als Juniortexter in einer kleinen Werbeagentur zu bekommen, und sein Nischentalent, in wirren Daten Muster zu erkennen, hatte beruflich gesehen überhaupt keinen Wert – auch wenn er die mathematischen und naturwissenschaftlichen Studiengänge damit locker hinter sich gebracht hatte.
Das Ping der Mikrowelle holte ihn aus seinen Tagträumen zurück und der Geruch einer fragwürdigen sizilianischen Überraschung waberte durch die Wohnung. Achtlos schob er das Geld beiseite und setzte sich mit seinem Festmahl an den Esstisch. Er aß direkt mit dem beiliegenden Plastikbesteck und fragte sich, warum dieses libanesische Ehepaar um die Ecke eigentlich ausgerechnet italienisches Essen verkaufte.
Mit mechanischer Entschlossenheit kaute er sich durch die zähen Pastaschichten, während seine Gedanken ganz woanders waren. Nachdem er den letzten Bissen heruntergewürgt hatte, schaute er auf die Uhr und wog seine Optionen für den weiteren Abend ab. Es gab die Möglichkeit, irgendeine Bar aufzusuchen und mit seinem neugewonnen Reichtum um sich zu schmeißen, oder eine lange Nacht vor dem Rechner zu verbringen und den Freund seines Vaters ausfindig zu machen. Sofort kam ihm ein Bild in den Sinn, wie er in einer dunklen Bar stand, den nackten Körper nur mit aufgeklebten Hundert-Dollar-Noten bedeckt. Vielleicht könnte er aus den Scheinen auch eine Art Fächer konstruieren, mit dem er dann wie ein Pfau herumstolzieren würde, um willigen Hennen seine Paarungsbereitschaft zu signalisieren …
Diese Vorstellung überzeugte ihn sofort, sich der Recherche zu widmen. Immerhin belohnte er sich für seine Vernunft mit einem weiteren Bier – diese grüne Flasche würde sein einziger Freund und Begleiter in einer langen Nacht der Einsamkeit vor einem flackernden Bildschirm sein.
***
Lynch gähnte, als er endlich mit dem Papierkram auf seinem Schreibtisch fertig war, und starrte die Akten dann noch eine Weile an, als wären sie radioaktiver Giftmüll. Immer ein sicheres Zeichen dafür, dass die Zeit für den Feierabend gekommen war. Das Nötigste hatte er für heute geschafft, die Lebensversicherung hatte Drakes Kontodaten bekommen und damit war Patricias letzter Wille geschehen.
Er war Drake gegenüber nicht gerade offen gewesen, was die gemeinsame Vergangenheit der beiden anging, aber er hatte keine Veranlassung gesehen, so eine simple Transaktion mit irrelevanten Privatgeschichten zu verkomplizieren. In Wahrheit waren Patricia und er ein Paar gewesen – vor zwanzig Jahren. Das war schon verdammt lange her.
Und es schien ihm, als hätte er sie ewig nicht gesehen. Er hatte ihr geholfen, ihren Namen zu ändern, als sie nach dem Tode ihres Bruders in dieses Kaff in Idaho gezogen war. Aber die Fernbeziehung aufrecht zu erhalten war im Verlauf der Jahre immer schwieriger geworden, nicht zuletzt, weil Patricia wusste, dass Lynch niemals seine Frau und seine Kinder für sie verlassen würde. Es hatte ihn überrascht, dass sie ihn trotzdem mit ihrem Testament betraut hatte, aber irgendwie machte es auch Sinn. Schließlich war er sehr gewissenhaft in seinem Job, deutlich zuverlässiger als im Privaten.
Seine Sekretärin steckte den Kopf durch die Tür, um sich zu verabschieden, und als sie sich umdrehte, bewunderte Lynch die enge Passform ihres Rockes. Immer ein beunruhigendes Anzeichen, wie er aus der Vergangenheit gelernt hatte. Aber egal, wie groß die Versuchung werden würde, keine Techtelmechtel mehr mit Angestellten einzugehen, stand ganz oben auf seiner Prioritätenliste.
Lynch brachte seine abschweifenden Gedanken wieder unter Kontrolle und stand auf. Die restliche Arbeit konnte warten. Er war müde, und seine leidende Ehefrau wartete sicher schon lange Zuhause mit einem leckern Essen im Ofen und einem brauchbaren Bordeaux auf dem Tisch. Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, dankbar, dass er im Gegensatz zu seinem Vater noch das meiste davon besaß, und begab sich dann zur Tür, wo seine maßgeschneiderte Anzugjacke an der Garderobe hing.
Die Büroräume waren alle verlassen, als er auf seinem Kontrollgang die letzten Lichter löschte. Als er die Lobby erreichte, ging die Tür auf und zwei Männer traten ein. Lynch betrachtete sie, seinen Aktenkoffer schon in der Hand. Er bemerkte ihre billigen Anzüge und kantigen Gesichtszüge.
»Es tut mir leid, aber wir haben bereits geschlossen«, sagte er.
Der größere der beiden Männer, von der Anzahl grauer Haare auf dem Kopf vielleicht in einem ähnlichen Alter wie Lynch, schenkte ihm ein Lächeln, das die menschliche Wärme einer Tiefkühltruhe ausstrahlte.
»Michael Lynch?«, fragte er, und selbst diese wenigen Silben verströmten einen starken, osteuropäischen Akzent. Russisch, ging es Lynch durch den Kopf, bevor er antwortete.
»Das ist korrekt. Aber ich fürchte, Sie müssen trotzdem morgen wiederkommen.«
Der kleinere Mann bewegte sich unerwartet schnell und überwand den Abstand zwischen ihnen innerhalb eines Augenzwinkerns. Bevor Lynch Zeit hatte, den Faustschlag in seine Magengrube auch nur zu registrieren, wurde ihm bereits übel und der ganze Raum begann sich zu drehen. Dann brach er zusammen.
Als er wieder zu sich kam, war es dunkel. Es dauerte eine Weile, bis ihm klar wurde, dass er sich im Konferenzraum befand. Sein Magen schmerzte, als hätte ihn eine Lokomotive gerammt. Er versuchte, sich zu bewegen, musste jedoch feststellen, dass er gefesselt war. Links von sich hörte er ein Geräusch, und als er den Kopf drehte, sah er einen der Eindringlinge dort sitzen. Der Mann lehnte sich nach vorne und räusperte sich.
»Mister Lynch. Dies ist kein Raubüberfall. Ich bin hier, um Informationen von Ihnen zu erhalten. Wie Sie sich inzwischen denken können, bin ich bereit, alles zu tun, um diese zu bekommen.«
Der Akzent war definitiv russisch, die Sprechweise des Mannes war sehr kultiviert, aber trotzdem bedrohlich. Während Lynch unauffällig die Stärke seiner Fesseln prüfte, rechnete er im Kopf: Gegen 19:30 Uhr hatte er sich auf den Weg machen wollen, um 21:00 Uhr kamen normalerweise die Reinigungskräfte. Je nachdem, wie lange er ohnmächtig gewesen war, würde er sie also einfach hinhalten müssen …
Er schaute sein Gegenüber unsicher an. »Ich bin ein Anwalt. Wir haben kein Bargeld hier, abgesehen von einer Kasse mit ein bisschen Wechselgeld. Aber keine Aktien, keine Wertpapiere«, stotterte er.
»Vielleicht ist mein Englisch doch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Dies ist kein Raubüberfall.«
Lynch bemerkte die Narben auf seinem Gesicht, auch die Nase musste mehrmals gebrochen gewesen sein. Die Augen standen weit auseinander, die Wangenknochen waren hoch. Typisch slawische Gesichtszüge. »Dann verstehe ich das Ganze nicht.«
Der Mann verzog das Gesicht und schüttelte langsam den Kopf. »Dann muss ich Ihre Verwirrung der Tatsache zuschreiben, dass Sie das Bewusstsein verloren hatten. Für dieses Mal lasse ich es Ihnen durchgehen. Aber ich muss Sie warnen: Mein Partner hier ist weitaus weniger geduldig. Also, noch einmal. Ich möchte Sie nicht ausrauben, ich brauche Informationen.«
Erneut durchbohrte Lynch ein Gefühl von Angst. Diese Männer waren eindeutig hochgefährlich. Doch abgesehen von seiner Verzögerungstaktik sah er keine anderen Optionen.
»Informationen?«
»Genau. Sie betreuen eine Klientin namens Patricia Marshall. Oder sollte ich sagen, Patricia Ramsey?«
Lynch versuchte, seine Überraschung zu verbergen, aber es gelang ihm kaum.
Der Russe nickte. »Ich sehe, dieser Name bedeutet Ihnen etwas. Lassen Sie uns also auf weitere Spielchen verzichten, Mister Lynch. Ich weiß, dass Sie ihren Nachlass regeln. Ich brauche Informationen über sie. Alles was Sie wissen. Was sie vererbt hat, und an wen.«
»Ich … Patricia Marshall? Ich weiß nicht … an diesem Fall ist überhaupt nichts dran … eine ganz einfache Erbschaft … ich habe nur ihr Geschäft abgewickelt, ihre Wohnung und ihren Laden … was soll ich Ihnen da erzählen?«
Die Tür öffnete sich und der kürzere Mann kam mit einem Papierschneider und einer großen Schere herein, die Klingen glänzten im Licht des Flures. Er stellte die beiden Werkzeuge auf den Tisch.
»Mister Lynch, erlauben Sie, dass ich uns vorstelle. Ich bin Vadim, und das ist Sasha, den Sie bereits kennengelernt haben, wenn auch nicht unter den angenehmsten Umständen. Sasha ist ein Experte für Verhörtechniken. Nach zwanzig Jahren im sibirischen Strafvollzug ist er vielleicht sogar der Beste auf unserem Planeten. Sasha und ich haben schon Dinge erlebt, mit denen ich Ihre Seele nicht belasten wollen würde.« Er machte eine dramaturgische Pause, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. »Ich erwähne das nur, damit unsere Unterhaltung nicht unnötig unangenehm verläuft. Sie werden uns sagen, was wir wissen wollen, und zwar alles. Sie werden sogar darum betteln, uns Dinge zu beichten, die wir gar nicht wissen wollen. Ihre tiefsten Geheimnisse. Die Ihrer Klienten. Passwörter, Kontodaten, Verbrechen. Am Ende wird es vor uns keine Lügen mehr geben.«
Lynch verkniff sich jeglichen Kommentar, das Blut wich ihm aus dem Gesicht.
»Da, Sie werden reden«, fügte Sasha nachdrücklich hinzu.
»Das ist Ihre Chance, das Ganze für Sie einfach zu machen. Sagen Sie uns alles über das Testament. Fangen Sie damit an, wo sich die Akten befinden. Nachdem ich diese gelesen haben, werde ich genau wissen, was ich noch fragen muss.«