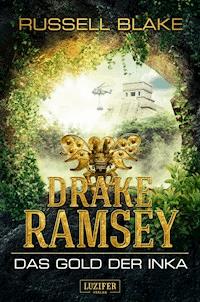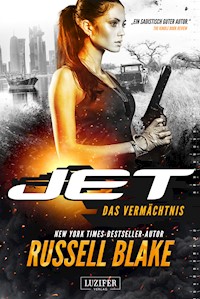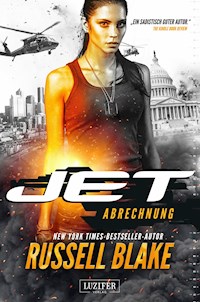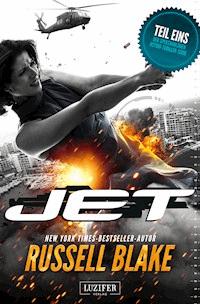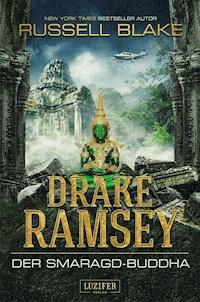
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Drake Ramsey
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Abenteurer Drake, Allie und Spencer sind zurück – und dieses Mal verschlägt es sie in die unwegsamen Dschungel von Myanmar. Ihr Ziel ist es, einen legendären Schatz rund um eine Jade-Statue aus dem Khmer-Reich zu finden. Gleichzeitig stehen sie aber auch noch im Dienst des CIA und sollen vor Ort das abgestürzte Flugzeug mit der Tochter eines US-Senatoren und deren Freund an Bord bergen. Das Ganze wäre natürlich zu einfach, wenn nicht noch ein paar rachsüchtige Chinesen, schießwütige Armeen und hinterhältige Drogenhändler auf den Plan treten würden, um den Glücksrittern das Leben schwer zu machen. Russell Blakes "Drake Ramsey"-Reihe holt die Abenteuer eines Indiana Jones in unsere Zeit – mit allen Zutaten, die das Genre braucht: mystische Schätze, exotische Schauplätze, grandiose Action und filmreife Wortgefechte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DRAKE RAMSEY
Der Smaragd-Buddha
Russell Blake
Copyright © 2016 by Russell Blake All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information, contact: [email protected].
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 350 Fifth Avenue. Suite 5300 New York, NY 10118 USA
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: EMERALD-BUDDHA Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Kalle Max Hofmann Lektorat: Johannes Laumann
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-304-6
Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1431 v. Chr., im Grenzgebiet von Burma und Laos
Vogelschreie hallten durch das abgelegene Tal, als der Dschungel zu einem neuen Tag erwachte. Zwanzig Khmer-Krieger verließen ihr Nachtlager am Ufer eines Flusses und spähten in den dichten Nebel, der von den nahegelegenen schroffen Felsformationen herabgestiegen war. Eine Gruppe müder Ochsen graste nur wenige Meter abseits des Wassers und an ihrer Seite saß ein hochrangiges Mitglied des königlichen Hofes auf einer schweren Holzkarre. Dunkle Ringe unter seinen Augen erinnerten an die vielen schlaflosen Stunden auf der langen Reise in diese unerforschte Wildnis.
Die Ladung des unförmigen Gefährts bestand aus zahlreichen Truhen, die die Reichtümer des Imperiums der Khmer beinhalteten – heilige Reliquien, goldene Kelche sowie Edelsteine von unermesslichem Wert. Doch der absolut größte Schatz war lediglich in eine Decke eingewickelt worden: Der legendäre Smaragd-Buddha, dessen kleinerer Bruder im thailändischen Königshaus verweilte, das sich momentan im Krieg mit den Khmer befand.
Seinem überlegenen Rivalen aus dem Süden hatte das Imperium der Khmer nicht viel entgegenzusetzen, bereits vor Wochen war der prächtige Tempel von Angkor Wat der Thai-Armee in die Hände gefallen. Doch schon als König Ponhea Yat von seinen Spionen die Kunde erhalten hatte, dass die feindlichen Soldaten auf dem Vormarsch waren, hatte er Chey, einem seiner engsten Vertrauten, den Auftrag gegeben, die nationalen Reichtümer in Sicherheit zu bringen.
Ein großer Mann in schwerer Rüstung näherte sich dem Wagen, seine narbigen Gesichtszüge in tiefe Falten gelegt. Sihanouk war einer der berüchtigtsten Krieger im ganzen Königreich, und es ging ihm ganz eindeutig gegen den Strich, den Geleitschutz für diese Operation zu stellen, während anderswo gegen die Eindringlinge gekämpft wurde. Es war nicht seine Idee gewesen, wie eine alte Frau im Dschungel herumzuirren, doch Befehle waren Befehle: Er sollte Chey, den Gesandten des Königs, tief in unbekanntes Gebiet eskortieren, bis sie ein geeignetes Versteck für den Schatz finden würden.
»Ich habe selten ein Tal gesehen, das abgeschiedener und besser versteckt ist, als dieses«, setzte Sihanouk an, »doch frage ich mich trotzdem, ob unser Schatz hier am Ende der Welt besser aufgehoben ist als zuhause, wo er von loyalen Kriegern verteidigt werden könnte.«
»Unsere Aufgabe war, einen geeigneten Ort für ein Versteck zu finden. Alles andere liegt außerhalb unserer Verantwortung«, entgegnete Chey.
»Bisher war uns das Schicksal gewogen«, sagte Sihanouk. »Hoffen wir nur, dass die verfluchten Eingeborenen uns in Ruhe lassen, bis unsere Arbeit vollendet ist.«
»Habe Zuversicht, dann wird sich alles zum Guten wenden!«
Sihanouk musterte Chey skeptisch. »Auch wenn ich deinen Optimismus begrüße, werde ich mein Schwert griffbereit halten.«
Es gab kaum Sympathie zwischen Chey, der von den Soldaten als windiger Opportunist betrachtet wurde, und Sihanouk, der sich seine Sporen im Kampf verdient hatte. Für den Krieger waren die Entscheidungen des Königs, wen er in seinen inneren Kreis aufnahm, immer wieder irritierend. Doch er hatte dem König nach dessen Belieben zu dienen, auch wenn das bedeutete, sich von Chey herumkommandieren zu lassen. Trotzdem gab ihm dieser schleimige Aal ein ungutes Gefühl und er fieberte dem Ende seiner Mission entgegen – denn dann könnte er sein Volk endlich wieder ehrenhaft verteidigen.
»Hast du schon eine bestimmte Stelle im Kopf?«, fragte Sihanouk.
Chey grinste ihn verschlagen an. »Ich habe da so eine Idee.«
»In dieser Nebelsuppe wird es schwierig, sich zu orientieren.«
»Der Schleier wird sich bald lüften. Die Männer sollen sich nützlich machen, während wir warten – schicke sie zum Fischen, damit wir etwas essen können. Nachdem wir unsere Bäuche gefüllt haben, werden wir die Suche nach einer geeigneten Stelle beginnen.«
Am frühen Vormittag hatte sich der Nebel verzogen und Chey führte Sihanouk den Fluss hinunter, auf der Suche nach einer geeigneten Höhle. Wie er es erwartet hatte, gab es einige davon, doch die Jahrmillionen währende Erosion des Kalksteines war sehr unregelmäßig verlaufen und die meisten der Höhlen waren für ihre Zwecke zu flach. Schließlich fanden sie eine perfekte Vertiefung mit einer sehr schmalen Öffnung, die vom Fluss aus nicht eingesehen werden konnte und die in ein größeres Gewölbe mit mehreren abzweigenden Kammern führte.
Ein Monat verging, in dem die Männer in langen Arbeitstagen den weichen Stein weiter aushöhlten, bis die Gewölbe ihren Ansprüchen genügten. Am letzten Morgen überwachte Chey persönlich, wie der Karren entladen und die Truhen in den Höhlen verstaut wurden. Der letzte Gegenstand, der seinen Weg in diesen neu angelegten Tempel fand, war der Smaragd-Buddha, der im Schein der Fackeln fast von selbst zu leuchten schien, während seine goldene Robe wie Morgentau im Sonnenlicht glänzte.
Am nächsten Morgen verwischten die Männer ihre Spuren. Sie zerlegten den Wagen und warfen die Holzteile in den Fluss, bevor sie sich an den Abmarsch machten. Chey bildete diesmal die Nachhut der Kolonne, statt sie zu leiten, denn seine Arbeit war getan: Er hatte einen sicheren Aufbewahrungsort für den Schatz gefunden.
Abends machten sie am Fuße des Berges rast, den sie auf dem Weg in das versteckte Tal hinabgestiegen waren. Nachdem Chey seinen Anteil des Fisches gegessen hatte, den sie als Proviant für den Rückweg eingepackt hatten, näherte er sich den versammelten Männern am Lagerfeuer und zog eine Karaffe aus seinem Beutel.
»Meine Freunde, ich beglückwünsche euch! Der König hat mich gebeten, diesen edlen Tropfen mit euch zu teilen – den feinsten Reisbrand der Khmer. Ich trinke auf jeden von euch und eure heldenhafte Tat!«
Chey brach das Sigel der Flasche und nahm einen langen Schluck, bevor er sie an Sihanouk weiterreichte, von wo aus sie ihre Runde durch die Reihen der Männer nahm. Jeder probierte das angenehm brennende Getränk in vollen Zügen und im Handumdrehen war das Gefäß leer. Chey entschuldigte sich und verzog sich in die Büsche, um seine Blase zu erleichtern. Er kehrte jedoch erst eine halbe Stunde später zurück, als das Feuer nur noch aus einigen glühenden Kohlen bestand, umringt von schlafenden Männern, denn das Betäubungsmittel hatte seinen Dienst getan. Chey hatte vorher ein Gegenmittel genommen.
Er trat an Sihanouk heran und zog das Schwert des Kriegers. Dann hielt er kurz inne und musterte die tödliche Klinge, bevor er sie ohne jegliche Skrupel in die Kehle ihres Besitzers rammte. Sihanouk bäumte sich kurz auf, dann zuckten seine Glieder einmal kurz und ein letztes, gedämpftes Röcheln erklang aus seiner Kehle, bevor er leblos zusammensackte. Chey wandte sich von der Leiche ab und wiederholte seine feige Tat, bis auch der letzte Mann sein Leben ausgehaucht hatte. Er ließ seinen Blick über die Armee der Toten schweifen und nickte anschließend zufrieden. Dann bemächtigte er sich Sihanouks Gürtel mit der daran befestigten Schwertscheide und legte ihn sich um die Hüften.
Chey ging zu dem Beutel mit Vorräten und prüfte dessen Gewicht. Er war schwer, aber wenn es sein musste, konnte er auf dem Weg Nahrungsmittel wegwerfen, die er nicht mehr tragen wollte. Doch im Zweifelsfall wäre es besser, zuviel mitzunehmen als zu wenig. Also schulterte er den Sack und machte sich im Mondlicht auf den Rückweg, den dunklen Pfad hinunter, der ihn in eine ungewisse Zukunft und zurück zu seinem König führen würde, der den Mord an seinen eigenen Männern befohlen hatte, um das Versteck der Schätze geheim zu halten.
Damit war Chey der Einzige, der die Wahrheit kannte, und er war ein Überlebenskünstler. Was auch immer in seiner Heimat auf ihn warten würde, seinem Schwur würde er Folge leisten und trotz aller Widrigkeiten dem König die genaue Position des Tempels mitteilen. Woraufhin er sicherlich fürstlich entlohnt werden würde.
Er musste es nur noch lebend dorthin schaffen.
Kapitel 1
Islamabad, Pakistan
Die Sterne glitzerten durch einen leichten Dunstschleier über dem Rawalsee. Der Verkehr tröpfelte nur noch vor sich hin und die Kakofonie schlecht gewarteter Motoren klang ab, während sich die Dunkelheit breitmachte. Stattdessen war die Luft jetzt vom Klang laut aufgedrehter Fernseher erfüllt, der durch die vielen offenen Fenster der Straße drang. Auch der Klang polyrhythmischer Musik war vielerorts zu hören, als in dem Vorort Bhara Kahu die Nacht hereinbrach. Hier lebten überwiegend Arbeiter, denn die Gegend war nur fünf Minuten von Islamabad entfernt und durch einen Highway, der sich am Rand des Sees entlang schlängelte, mit dem Industriezentrum verbunden.
Ein Müllfahrzeug rumpelte auf dem Weg zur örtlichen Müllkippe die staubige Straße hinunter. Ihm folgte ein streunender Hund, in dessen klagenden Augen ein Funke von Hoffnung auf ein paar Essenreste blitzte. Lichter tanzten hinter den mit Eisenstangen gesicherten Fenstern der kleinen Häuser mit hohen Mauern, die oben mit einem Überzug aus Glasscherben gegen aufdringlichen Besuch gesichert waren.
Vier Männer saßen vor einem winzigen Café an einem runden Glastisch, spielten Karten und rauchten extrastarke filterlose Zigaretten, deren schwerer Rauch sich träge in den Himmel erhob. Ein Junge, kaum älter als zehn Jahre, brachte ihnen ein emailliertes Tablett mit vier Tassen schwarzen Kaffees, der die Konsistenz von Rohöl besaß. Die Männer lachten über einen Scherz, prosteten sich zu und machten dann mit ihrem Glücksspiel weiter, wobei sie sich scherzhaft gegenseitig verfluchten, während sie Stapel von Münzen auf dem Tisch hin und her schoben.
Im Schritttempo näherte sich ein verbeulter Nissan-Kombi, dessen Scheiben so dunkel gefärbt waren, dass sie fast undurchsichtig waren. Vor dem Café kam der Wagen zum Stehen, und es war unübersehbar, dass die Männer in ihrem Tun erstarrten. Einer von ihnen griff unter sein weit geschnittenes Hemd, doch als das Beifahrerfenster des Wagens heruntergelassen wurde, entspannte er sich und winkte den Insassen zu.
Jack Rollins beobachtete diesen Vorgang durch sein Nachtsichtgerät. Er lag im zweiten Stock eines Hauses am Ende der Straße auf einem Tisch am Fenster, trug eine schwarze Sturmhaube sowie einen dazu passenden Overall, was ihn in dem dunklen Raum so gut wie unsichtbar werden ließ. Neben ihm lag eine Kalaschnikow AKM mit klappbarer Schulterstütze sowie einer Munitionstasche mit sechs Magazinen. Auf der anderen Seite ein Scharfschützengewehr des Kalibers 50 mit kompaktem Nachtsicht-Zielfernrohr. Die im Magazin befindlichen Explosivgeschosse konnten den Kopf eines Menschen noch aus einem Kilometer Entfernung in Sprühnebel verwandeln.
Er tippte seinen Ohrstöpsel an, um sich zu vergewissern, dass immer noch alles im grünen Bereich war. Das als positive Antwort erwartete Klicken kam eine Sekunde später. Doch das Ziel hatte sich nicht mehr gezeigt, seit er vom Isha Sallat aus der nahegelegenen Moschee zurückgekehrt war. Dies war das letzte Gebet des Tages, was die Gläubigen sicher bis zum Morgengrauen geleiten sollte. Jack hätte den Mann am liebsten direkt auf offener Straße erledigt, doch seine Befehle lauteten anders – und deswegen wartete er geduldig.
»Seht ihr irgendwas auf eurer Seite?«, murmelte er. Sofort erklang eine flüsternde Stimme in seinem Ohr. »Es hat sich nichts verändert. Das Licht im Haus ist noch an. Draußen sitzen ein paar Handlanger mit Sturmgewehren. AKs, natürlich.«
»Natürlich.« Die Gewehre vom Typ AK-47 gab es in der Punjab-Region Pakistans wie Sand am Meer. Das war ein Resultat der ewig andauernden Kämpfe im nahe gelegenen Afghanistan. Damit kannte sich Jack nur all zu gut aus, da er dort zwei Dienstzeiten hinter sich gebracht hatte. Die Afghanen waren verdammt harte Hunde und kannten kaum etwas anderes als den Krieg – denn die meisten von ihnen waren damit aufgewachsen, erst gegen die Russen und dann gegen die Amerikaner zu kämpfen.
Damit habe ich kein Problem, dachte Jack. Wir tun alle, was wir tun müssen, um zu überleben.
»Irgendwelche Aktivität in den anderen Häusern?«, fragte er.
»Negativ. Alles ruhig. Bis auf Saddam, natürlich. Der schläft nie.«
Saddam war der Spitzname, den sie dem Scharfschützen auf dem Dach des gegenüberliegenden Gebäudes gegeben hatten, Teil der Sicherheitsvorkehrungen von Jacks Ziel. Hamal Qureschi hieß der Mann. Eigentlich gehörte er noch zu den moderaten Stimmen unter denjenigen, die den Koran extremer interpretierten. Er war ein passionierter Gottesmann, der von vielen respektiert und gehört wurde. Aus diesem Grund waren seine Behauptungen, dass die neuesten, unorthodoxen Gruppierungen von Terroristen in Wahrheit Marionetten des Westens waren, höchst gefährlich. Für ihn selbst waren sie sogar zum Todesurteil geworden.
»Wahrscheinlich hält ihn sein schlechtes Gewissen vom Schlafen ab«, vermutete Jack. »Oder er träumt von den fünfundfünfzig Jungfrauen.«
»Ich glaube, es geht um zweiundsiebzig Jungfrauen.«
»Egal«. Jack sah auf die Uhr. »In zwanzig Minuten legen wir los. Sind die Blendgranaten bereit?«
»Na klar. Und in meinen Klamotten sehe ich aus wie Omar der Teppichhändler, deswegen werden sie nichts ahnen, bevor es zu spät ist.« Jacks Leute waren mit authentischer Kleidung ausgestattet worden, ganz wie es diese verdeckte Operation verlangte. Sie sollten als örtliche Gruppierung wahrgenommen werden, Terroristen, die nach dem Blut eines Landsmannes trachteten. Der Mord an Hamal Qureschi würde einen Aufschrei zur Folge haben und hoffentlich das Interesse an Verschwörungstheorien dämpfen. Ob das klappen würde, lag nicht in Jacks Ermessen. Er war nur der Handlanger, der die Drecksarbeit machen musste. Und seinen Job machte er wirklich gut.
»Alles klar. Lasst uns Funkstille halten, bis wir losschlagen. Es kann nicht mehr lange dauern. Bleibt wachsam!«
Jack beendete das Gespräch und sah zu, wie der demolierte Nissan davonrollte, wobei er eine schwarze Rauchwolke zurückließ. Schon seit drei Tagen waren Jack und seine Leute in diesem Kaff, um alles vorzubereiten – und nun war endlich ihre große Stunde gekommen. Das Warten war wirklich der härteste Teil an dem Job. Aus seiner Erfahrung wusste er, sobald die ersten Schüsse fielen, würde alles in Windeseile vorbei sein. Etwa zwei Minuten, für deren Vorbereitung hunderttausende Dollar in die Beschaffung von Informationen, Waffen, falschen Papieren und Bestechungsgeldern geflossen waren. Zwei Minuten, um den großen Qureschi und seine Wachen ins Jenseits zu befördern.
Die vier Kartenspieler waren bereits in seinem Plan vermerkt. Wenn sie es wagen sollten, Gegenwehr zu leisten, würde er sie ausschalten, ohne mit der Wimper zu zucken. Kollateralschäden waren schließlich bei so einer Mission nicht zu vermeiden. Berufsrisiko, dachte Jack und wünschte den Männern insgeheim, dass sie einfach beim ersten Anzeichen von Gefahr in Deckung gehen würden, statt dem Geistlichen zur Seite zu springen.
Das Satellitentelefon auf dem Tisch begann zu blinken, womit es einen eingehenden Anruf anzeigte. Es gab nur eine Person, die diese Nummer kannte, und Jack nahm blitzschnell ab.
»Abbruch. Ich wiederhole, Abbruch!«, tönte es aus der Leitung.
Jacks Augen verengten sich. »Warum?«
»Ihr seid aufgeflogen!«
»Aufgeflogen? Wie das denn?«
»Haut einfach ab! Es ist vorbei! Jemand hat vor einer Stunde alle Details ins Internet gestellt – wir haben es gerade erfahren. Die Uhr läuft! Du kannst davon ausgehen, dass die Pakistanis alles daran setzen werden, euch zu schnappen! Ihr müsst euer Bestes geben, um das zu verhindern!«
»Könnt ihr sie nicht ablenken?«
»Das machen wir schon, sonst wärt ihr längst tot! Aber wir können sie nicht mehr lange aufhalten. Verschwindet! Jetzt sofort!«
»Alles klar. Ich melde mich, wenn die Luft rein ist.«
Jack legte auf und dachte kurz nach, dann steckte er sich den Ohrstöpsel wieder ein und gab die Informationen an sein Team weiter. Am Ende des Häuserblocks sprang der Motor eines Autos an und der Wagen verschwand in die Nacht. Mehr musste Jack nicht wissen. Seine Jungs waren alle schon groß. Den Fluchtplan kannten sie auswendig und jeder von ihnen würde seine eigene Route nehmen, um das Land zu verlassen.
Ein Glück, dass er jede Mission genauestens durchplante und dabei höchst argwöhnisch war. Viele seiner Kollegen würden sich einfach an die Standardprozeduren halten, statt Geld und Zeit in einen Plan zu investieren, den nur sie selbst kannten. Aber Jack gehörte nicht dazu. Die Narben, die Kugeln und Schrapnelle an seinem Körper hinterlassen hatten, erinnerten ihn bei jeder Dusche daran, wie gefährlich sein Beruf war.
Er zerlegte in Windeseile das Barrett-Gewehr, das er extra auf schnelle Demontage optimiert hatte, und ließ es zusammen mit der AKM und den Magazinen in einem schwarzen Nylon-Seesack verschwinden. Als Letztes warf er das Nachtsichtgerät und die Sturmhaube hinein.
Zwanzig Sekunden später war er die Treppe hinuntergeeilt und näherte sich gerade dem Eingangstor, als er auch schon das unverkennbare Geräusch eines schweren Helikopters vernahm, der sich schnell näherte. So viel zu den Hinhaltetaktiken. Es würde eine verdammt knappe Nummer werden.
Er öffnete das Tor und hetzte den zerbröselnden Gehweg hinunter – der Anspruch, sich unauffällig zu benehmen, war dahin. Er musste die Gegend verlassen, bevor ein besonders gewissenhafter pakistanischer Polizeibeamter auf die Idee kam, das ganze Gebiet abriegeln zu lassen.
An der nächsten Ecke bog er in eine düstere Gasse ein, deren Straßenlaternen längst defekt waren, und joggte dann auf einen verbeulten Pick-up-Truck vom Typ Toyota Hilux zu. Er ließ sich hinter das Lenkrad gleiten und warf seine Tasche auf den Beifahrersitz. In der Fahrerkabine blieb es dunkel; die Glühlampe hatte er als Vorsichtsmaßnahme entfernt. Solche Kleinigkeiten konnten den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen, das wusste er genau.
Der Motor sprang mit einem Röcheln an und er legte den erste Gang ein. Nachdem er zwei Blocks hinter sich gelassen hatte, sah er im Rückspiegel zwei Hubschrauber mit gleißenden Suchscheinwerfern, die über die Dächer der Nachbarschaft tanzten, in der er sich eben noch aufgehalten hatte.
»Verdammt«, murmelte er und kämpfte gegen den Drang an, das Gaspedal durchzutreten. Wenn er Glück hatte, würde er es schaffen. Wenn nicht … tja. Er durfte jedenfalls nicht zulassen, dass er geschnappt wurde. Seine rechte Hand streifte über den Griff seiner Pistole und er verzog das Gesicht. Er hoffte wirklich, dass es nicht dazu kommen würde, aber es gab Schlimmeres als den Tod.
Sirenen heulten in der Ferne auf und er versuchte abzuschätzen, aus welcher Richtung sie kamen. Sobald die örtliche Polizei alarmiert war, würden seine Chancen immer weiter sinken. Jacks Gedanken kreisten um das Gespräch mit seinem Einsatzleiter. Jemand hatte Details von einer streng geheimen Operation ins Netz gestellt. Was hatte das zu bedeuten? Natürlich war ganz offensichtlich, dass sie infiltriert worden waren. Aber wie konnte das sein? Rein technisch war es absolut unmöglich.
Das Jaulen einer Sirene ganz in seiner Nähe bewies das Gegenteil. Ein Polizeitransporter bog um eine Ecke hinter ihm und raste auf ihn zu. Jack wog seine Optionen ab, während er das Fahrzeug im Außenspiegel näherkommen sah. Er war gerade im Begriff, eine Vollbremsung zu machen, als der Polizeiwagen mit quietschenden Reifen in eine Seitenstraße abbog.
»Ganz ruhig bleiben, Jack«, sagte er zu sich selbst. Auf einmal sehnte er sich nach einem Drink, obwohl er seit über zehn Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt hatte. Doch nun sah er ganz klar einen golden schimmernden Bourbon vor seinem geistigen Auge, roch das herrliche Aroma und spürte, wie die Flüssigkeit seine Kehle hinunterrann und sich ein wohlig-warmes Gefühl in seinem Körper ausbreitete. Alte Gewohnheit, dachte Jack und fuhr in gemäßigtem Tempo weiter, wobei er die Ohren spitzte, um weitere mögliche Verfolger rechtzeitig wahrzunehmen.
Als er den Stadtrand erreicht hatte, fiel sein Blick auf die Tankanzeige. Halbvoll, was bedeutete, dass er es noch locker nach Peshawar schaffen würde, wo er ein paar Tage untertauchen konnte, um sich dann nach Afghanistan abzusetzen. Es grenzte zwar an Selbstmord, hier in der Gegend nachts herumzufahren, aber er hatte keine Wahl.
So wenig Lust er auch dazu verspürte, als Nächstes musste er an einem Müllcontainer halten und seine Waffen wegwerfen. Denn die würden ihn verraten, und man musste es seinen Gegnern ja nicht zu leicht machen. Es war klar, dass sie auf ihn Jagd machen würden, aber die Waffen würden garantiert nie gefunden werden – denn auf dem Schwarzmarkt brachten sie einen stolzen Preis ein, der für einen Müllmann mehrere Monatslöhne bedeutete.
Mit einem letzten Kontrollblick auf die Straße hinter ihm kletterte er wieder in den Wagen und steuerte ihn nach Westen auf den Kyber-Pass zu. So würde ihm hoffentlich die Flucht gelingen.
Kapitel 2
24 Stunden später, Xishuangbanna, Yunnan-Provinz, China
Christine Whitfield schaute auf, als sich die Eingangstür der Wohnung ihres Freundes öffnete. Sie sah sofort, dass er aufgeregt war, und zwar nicht zu knapp. Seine normalerweise entspannten Gesichtszüge waren von Angst gezeichnet – eine Emotion, die auf dem faltenfreien Gesicht des Endzwanzigers deplatziert wirkte.
»Was ist los, Liu?«, fragte sie. »Ich dachte, du bist bis morgen in Guandu.«
»Wir müssen verschwinden«, sagte er knapp und schnappte sich seinen Laptop. »Jetzt sofort.«
»Was? Wieso?«
»Ich habe von einem Freund eine Warnung bekommen. Es ist etwas schiefgelaufen. Pack deinen Computer ein. Nimm alles mit. Unten wartet schon ein Taxi.«
»Aber wo gehen wir denn hin?«
»Nach Thailand. Dort können wir untertauchen. Zumindest lange genug, um herauszufinden, wie schlimm es ist. Aber ich gehe davon aus, dass der schlimmste Fall eingetreten ist.«
»Aber es ist mitten in der Nacht!«
»Kein Problem, ich habe auf dem Weg meinen Bruder angerufen. Er hat uns eine Privatmaschine besorgt.«
Sein Gesichtsausdruck überzeugte sie schließlich. Er wirkte todernst, seine Augen weit aufgerissen. Sie sprang auf. »Wer ist denn hinter dir her?«, fragte sie.
»MSS – das Ministerium der Staatssicherheit. Oder irgendein anderer Dienst. Ist ja eigentlich egal, welche Abkürzung es ist.«
»Und was wollen sie von dir?«
»Ich habe keine Ahnung.« Er hatte seinen Computer verstaut und hielt kurz inne, dann sah er sie mit festem Blick an. »Darum können wir uns später noch Gedanken machen. Aber wenn sie uns erwischen, sind wir erledigt.«
»Du hast den Chinesen aber doch nichts getan. Warum sollte der MSS dir dann nachstellen?«
»Da denken die sich einfach etwas aus. Du weißt doch, wie das hier läuft. Für die richtige Summe ist alles möglich.«
Sie schüttelte den Kopf. »Hast du mir etwas verschwiegen?«
»Darüber können wir im Flugzeug reden. Nimm mit, was du brauchst, und vergiss vor allem deinen Ausweis nicht.«
Fünf Minuten später waren sie auf dem Weg zum Flughafen. Der Taxifahrer war sichtlich desinteressiert an dem auffälligen Paar – eine blonde, westliche Frau mit einem Einheimischen. Sie sahen zu, wie die Gebäude vorbeiflogen, als das Taxi durch die leeren Straßen raste. Im Radio lief ein bekannter chinesischer Popsong, der wegen seines provokanten Textes für einigen Wirbel gesorgt hatte. Christine war wirklich versucht, Liu weiter auszufragen, aber ein Blick von ihm signalisierte ihr, damit zu warten. Sie vertraute ihm voll und ganz und war gewillt, ihm in dieser offensichtlich gefährlichen Situation blind zu folgen.
Das Hauptgebäude des Flughafens war bereits geschlossen und das riesige Terminal lag komplett im Dunklen, nur ein paar Sicherheitskräfte patrouillierten mit Taschenlampen auf und ab. Das Taxi bog in eine Auffahrt für Zulieferer ein und fuhr durch ein offenes Tor zu einem abgelegenen Ende des Rollfeldes, wo etwa ein halbes Dutzend Flugzeuge standen. In der hinterletzten Ecke stand eine uralte Cessna 172 mit angeschaltetem Licht im Cockpit. Als sie sich näherten, erkannten sie im Zwielicht einen dünnen chinesischen Mann, der am Leitwerk herumhantierte – den Piloten.
Das Taxi rollte vor und Liu und Christine stiegen aus. Auch der Fahrer verließ den Wagen und ging zum Kofferraum, wobei er sich eine Zigarette anzündete. Rauchen schien das liebste Hobby der Chinesen zu sein, hatte Christine das Gefühl, denn trotz der Gesundheitsrisiken erfreute es sich großer Beliebtheit. Der Fahrer öffnete den Kofferraum und sie schnappten sich ihre Taschen. Dann drückte Liu dem Mann ein Bündel Geldscheine in die Hand, was mit einem Lächeln und einer Verbeugung quittiert wurde. Anschließend stieg der Mann in seinen Wagen und fuhr davon.
»War das nicht ein Risiko, mit dem Taxi zu fahren?«, flüsterte Christine.
»Wir hatten keine Wahl, meinen Wagen konnten wir nicht benutzen. Den suchen sie garantiert schon.«
»Und du weißt wirklich nicht, warum der MSS hinter dir her sein könnte?«
»Doch. Aber im Moment kann ich nichts daran ändern.«
Sie blieb abrupt stehen. »Was hast du getan, Liu? Hat das was mit unserer Sache zu tun?«
»Höchstens indirekt, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich das Know-how ihrer Techniker unterschätzt.«
»Was meinst du damit?«
Er erklärte es ihr in ein paar knappen Sätzen, und als er damit fertig war, war alle Farbe aus ihrem Gesicht gewichen.
»Liu …«
»Wir können jetzt nichts mehr daran ändern, Christine. Aber verstehst du jetzt, warum wir hier weg müssen?«
»Das ist ja noch untertrieben! Wieso meinst du, dass wir in Thailand sicher sind?«
»Wir können dort untertauchen, Christine. Dort gibt es Zehntausende Möglichkeiten, sich zu verstecken.«
»Und was ist mit Geld? Was du hast, wird ja nicht ewig reichen!«
»Das ist unser geringstes Problem. In den ländlichen Gegenden Thailands können wir locker ein Jahr davon leben, in Kambodscha sogar noch länger.«
Sie sah ihn skeptisch an.
»Mach dir keine Sorgen. Geld kann ich besorgen.«
»Wir starten gleich auf einen geheimen Flug mitten in der Nacht und quer über das Goldene Dreieck, da soll ich mir keine Sorgen machen? Wie soll das gehen?«
Liu machte einen Schritt auf sie zu. »Bitte sei nicht so laut. Wir können nicht wissen, wie viel Englisch der Pilot versteht. Schließlich haben wir hier inzwischen genug von euren kapitalistischen Fernsehsendungen!«
Sie musste über diesen Scherz lächeln und erinnerte sich daran, warum sie sich in ihn verliebt hatte. Er war unglaublich schlau, gut aussehend, treu und auf eine leicht schlitzohrige Art sehr charmant. Für einen Chinesen war er mit einem Meter achtzig überdurchschnittlich groß, da er einer nordchinesischen Familie entstammte. Er trug die Haare lang und offen und kleidete sich fast ausschließlich in westlichen Designersachen. Mit neunundzwanzig sah er immer noch aus, als wäre er gerade erst volljährig geworden und sie wunderte sich immer wieder, wie brillant sein Geist war. Insgesamt eine sehr attraktive Mischung, dachte Christine.
Sie gingen auf das Flugzeug zu und Liu begrüßte den Piloten. Nach einem kurzen Austausch über abgelegene Ziele in Thailand und die Flugroute einigten sie sich auf Chiang Rai, das nahe der Grenze zu Laos und Myanmar in Nordthailand lag – weit abseits der Touristenströme. Der Pilot lud ihr Gepäck in den kleinen Stauraum, während Christine auf den Rücksitz kletterte und Liu auf dem Sitz des Kopiloten Platz nahm. Wenig später jaulte die Zündung auf und der Motor sprang an.
Der Pilot holte sich seine Starterlaubnis vom Tower und rollte dann zur Startbahn, wo er beschleunigte und sich bald in die Luft erhob. Turbulenzen schüttelten das Flugzeug auf seinem Aufstieg ordentlich durch und sie blieben auf einer Flughöhe von etwa dreitausend Metern.
Die Berge und der Dschungel unter ihnen waren pechschwarz, es waren keinerlei Anzeichen von Zivilisation zu sehen. Der Pilot änderte seinen Kurs, um ein paar düsteren Wolken am Horizont auszuweichen. Christine neigte sich nach vorn und schrie Liu ins Ohr: »Wie lange wird es dauern, bis wir da sind?«
Liu übersetzte die Frage und der Pilot zuckte mit den Schultern, wobei er auf den Geschwindigkeitsmesser tippte. »Vielleicht zwei Stunden, vielleicht mehr. Wir haben Gegenwind, also wahrscheinlich mehr.«
Liu übermittelte diese Informationen an Christine und wandte sich dann wieder dem Piloten zu: »Sind Sie oft in dieser Gegend unterwegs?«
Der Pilot antwortete vage: »Von Zeit zu Zeit.«
»Gibt es keine Probleme im Luftraum an der Grenze von China und Myanmar?«
Der Pilot schüttelte den Kopf. »Nein. Bei dieser Flughöhe wird niemand von uns Notiz nehmen. Die wenigen Menschen, die hier wohnen, sind tieffliegende Maschinen gewöhnt, wegen des Drogenhandels. Die Regierung zerstört ab und zu die illegalen Landebahnen, aber in nicht mal einer Woche tauchen neue auf. Das ist ein Spiel, was wohl ewig so weitergehen wird.«
»Anscheinend kennen Sie sich gut damit aus«, sagte Liu.
»So gut wie jeder andere Pilot hier. Wenn wir uns der Grenze nähern, werden wir auf etwa dreihundert Meter heruntergehen. Das ist die sicherste Methode, wenn man niemanden wissen lassen will, dass man kommt. Laos ist größtenteils unbewacht, aber Myanmar schickt ab und zu ein paar Hubschrauber in die Luft. Doch wie ich gehört habe, sind sie so pleite, dass sie keine Ersatzteile bezahlen können. Unsere Flugschneise wird außerdem überwiegend von Rebellen kontrolliert, von daher ist die Chance, dass hier nachts irgendjemand außer uns herumfliegt, so gut wie null.«
»Und was ist mit den Thailändern?«
»Oh, die haben uns garantiert auf dem Radar. Man muss nur auf dem Rollfeld den richtigen Leuten ein paar Baht in die Hand drücken, dann werden keinerlei Fragen gestellt. In Thailand gilt das Motto: Leben und leben lassen. Ich habe als Flugziel Chiang Kham angegeben, und werde dann einfach behaupten, ich hatte einen Motorschaden und musste deswegen in Chiang Rai landen. Das wird niemanden interessieren, sobald das Schmiergeld stimmt.«
»Und was ist mit dem Zoll?«
»Auch das ist nur eine Frage der Bezahlung. Kommt alles darauf an, wie wichtig es Ihnen ist, unter dem Radar zu bleiben.«
Liu starrte in die dunkle Nacht hinaus. »Am liebsten komplett unter dem Radar.«
»Dann halten Sie Ihre Brieftasche bereit. Alles ist möglich, aber das hat seinen Preis.« Der Pilot schwieg für einen Augenblick, dann fuhr er fort. »Wir überqueren gerade die Bergkette, an der die Grenze verläuft. In ein paar Minuten haben wir den chinesischen Luftraum verlassen und ich werde anfangen, langsam die Flughöhe zu reduzieren. Der höchste Gipfel liegt bei zweitausend Metern, also fliegen wir sogar jetzt schon verhältnismäßig tief.«
Das Flugzeug machte einen kleinen Satz, als es auf ein Luftloch stieß. Der Pilot schielte auf eine Unwetterfront, in der sich einzelne Blitze zeigten, und deutete in deren Richtung. »Darum sollten wir einen großen Bogen machen. Das kann ganz schnell ziemlich fies werden!«
»Und es ist kein Problem, wenn wir vom Kurs abweichen?«, fragte Liu.
»Dann kommen wir später an, aber haben Sie es eilig?«
»Die Hauptsache ist, dass wir sicher ankommen!«
Der Pilot ließ die Maschine sanft hinabgleiten, bis sie etwa dreihundert Meter von den Baumwipfeln entfernt war, die man in dem blassen Mondlicht gerade so ausmachen konnte. Unterbrochen wurde das Dunkelgrün nur von einigen Lichtungen sowie vereinzelten Felsspitzen.
Der Pilot drehte gerade an einem Regler, als eine laute Explosion das Flugzeug durchschüttelte. Die Windschutzscheibe splitterte, als sie von Metallteilen getroffen wurde und der Motoralarm heulte auf, als das Flugzeug in die Dunkelheit taumelte. Die Augen des Piloten weiteten sich vor Schreck, während er mit dem Steuerknüppel kämpfte, um die Maschine in eine ruhige Lage zu bringen.
Lius Hände schnellten an seine Stirn, wo Blut aus einer Schnittwunde lief. Seine Stimme ähnelte mehr einem schrillen Kreischen, als er sagte: »Oh mein Gott, was ist passiert?«
Der Pilot biss die Zähne zusammen und schrie: »Irgendwas im Motor ist explodiert, wir stürzen ab!«
»Nein …«, stammelte Liu, als er sah, wie Flammen aus dem Motorraum schlugen und schwarzer Rauch ihre Sicht vernebelte.
»Wir können noch ein Stück weit segeln, aber das wird eine harte Landung«, mahnte der Pilot, wobei er die Augen nicht von der Anzeige der Flughöhe ließ, die sich rasant verringerte. Christines Hände krallten sich in den Sitz, ihr Gesicht in grenzenloser Angst verkrampft.
»Siehst du irgendwas, wo wir sicher landen können?«, fragte Liu, als eine zweite Explosion das Flugzeug durchschüttelte und sie steil nach unten stürzten.
»Festhalten!«, schrie der Pilot und riss die Steuerung im letzten Moment herum, als er einen kleinen Flusslauf entdeckte.
Das letzte, was Christine hörte, war Lius entsetzter Aufschrei, als die Maschine in das felsige Flussbett stürzte, wobei der Aufprall das Cockpit innerhalb von Sekundenbruchteilen zerstörte.
Dann strömte Wasser in die Kabine.
Kapitel 3
Zwei Tage später in Malibu, Kalifornien
Drake saß auf seinem Longboard im sanft wogenden Wasser vor der Küste und wärmte sich in den Strahlen der Morgensonne, während er auf die nächste Gruppe von vielversprechenden Wellen wartete, die sich langsam dem Strand näherten. Er wischte sich eine Strähne widerspenstigen Haares aus dem Gesicht und schaute nach links, wo drei andere Surfer auf ihren Brettern lagen, deren Neoprenanzüge ihnen das Aussehen von wohlgenährten Seelöwen verliehen. In der Ferne gingen einige Fischkutter ihrem Tagesgeschäft nach und erwartungsfrohe Möwen umkreisten sie laut schreiend.
Drake lebte nun seit zweieinhalb Monaten direkt am Strand – also seit ihm vorgeschlagen wurde, sich die Ecke einmal anzuschauen. Direkt vom ersten Augenblick an hatte er sich in Malibu verliebt. Im Gegensatz zu Nordkalifornien, wo es einen guten Teil des Jahres regnete, hatte er hier bisher nur idyllische Tage aus endlosem Sonnenschein erlebt.
Er hatte ein Strandhäuschen mit zwei Zimmern gemietet, das ziemlich unauffällig wirkte, vor allem im Kontrast zu einigen der übertrieben protzigen Bauten in der Nachbarschaft. Die waren einfach nicht sein Stil, und trotz des massiven Reichtums, an den er quasi über Nacht gekommen war, fühlte er sich immer noch fremd zwischen all den Hollywood-Regisseuren und berühmten Schauspielern, die ebenfalls an diesem Stück Strand zuhause waren.
Seine Tage bestanden daraus, ab Sonnenaufgang zwei bis drei Stunden zu surfen, bis er erschöpft war. Dann gab es Frühstück, bestehend aus Rührei und einer Karaffe voller frisch ausgepresster Orangen, die er jeden Morgen bei einem Markt um die Ecke kaufte. Vor dem Mittagessen absolvierte er dann einen langsamen Fünfkilometerlauf am Wasser entlang. Die Nachmittage verbrachte er vor seinem Computer, wo er E-Mails beantwortete und nach verlorenen Zivilisationen oder Gerüchten verlorener Schätze forschte.
Durch sein Abenteuer im Amazonas hatte Drake nämlich Geschmack an diesen Themen gefunden. Da er jetzt sowieso ein gefeierter Schatzjäger war, dachte er sich, könnte er doch etwas Konstruktives mit seinem Ruf und dem ganzen Geld anfangen. Er hatte immer nur Verachtung für die Reality-TV-Stars gehabt, deren einziges Talent darin zu bestehen scheint, über abgebrochene Fingernägel oder den Stress mit Paparazzi zu jammern. Deswegen hatte er sich geschworen, sich von diesem menschlichen Bodensatz fernzuhalten. Stattdessen würde er das Erbe seines Vaters antreten und sich den Respekt verdienen, den er bisher eher durch Zufall erlangt hatte.
Sein aktuelles Forschungsobjekt war eine Inkastätte in Peru, auf die in einem Dokument hingewiesen wurde, das er in Paititi gefunden hatte. Er war dabei, eine Expedition zusammenzustellen, um danach zu suchen. Die Dringlichkeit bei dieser Aufgabe kam einerseits daher, dass ihm schlicht langweilig war – er wollte nicht zu viel seiner kostbaren Lebenszeit mit Nichtstun verbringen. Der wichtigere Grund war allerdings, dass er Allie endlich wiedersehen wollte. Ihr Treffen in Texas war nicht so verlaufen, wie er es sich erhofft hatte – die Trauer um ihren Vater sowie die vielen Aufgaben im Zusammenhang mit seiner Beerdigung und der Abwicklung seines Nachlasses hatten sie voll und ganz in Beschlag genommen. Nur wenige Tage, nachdem sie wieder die Zivilisation erreicht hatten, standen sofort diverse Fremde auf der Matte, die behaupteten, diverse per Handschlag besiegelte Geschäfte mit Jack am Laufen zu haben und deswegen offene Forderungen beglichen haben wollten. Dabei ging es um beachtliche Summen, zwar nicht nach Drakes neuen Maßstäben, doch es waren über zehn Millionen Dollar. Der in den Medien aufgeplusterte Reichtum von Allie tat sein übriges, dass die Parasiten aus allen Löchern gekrochen kamen und ein Stück vom Kuchen abhaben wollten.
Allie hatte Drake um Entschuldigung gebeten und gesagt, dass sie sich erst einmal allein um die Angelegenheiten ihres Vaters kümmern wollte. Doch dieses Unterfangen dauerte dann nicht Wochen, sondern Monate, und die paar wenigen Telefongespräche waren bei Weitem nicht ausreichend, um ihre besondere Verbindung aufrecht zu erhalten. Bei seinem letzten Besuch in Texas hatte sie ihn mit einer gewissen Unterkühlung begrüßt, aus der er nicht so richtig schlau geworden war. Sie war zwar der Meinung, es würde schon alles wieder werden, aber er war sich da nicht so sicher. Er hatte sich bereits überlegt, einen Flug zu nehmen und einfach bei ihr in der Nähe einzuziehen und dann vor Ort darauf zu warten, dass sie Zeit für ihn hätte. Doch diese Idee hatte er nach einer Konsultation mit Betty verworfen, die von der Sekretärin seines früheren Arbeitgebers zu seiner persönlichen Assistentin aufgestiegen war.
»Gib ihr etwas Zeit, Drake. Sie hat eine Menge mitgemacht«, hatte Betty gesagt.
»Ich weiß, ich war selbst dabei, falls du dich erinnerst.«
»Aber sie hat ihren Vater verloren! Das ist immer schwer, aber für manche noch schwerer als für andere.«
»Der ganze Gerichtsstress macht es sicher auch nicht besser«, hatte Drake hinzugefügt.
»Ich weiß, dass sie dir unheimlich wichtig ist, Drake, aber wenn man das große Ganze betrachtet, was sind dann schon ein paar Wochen mehr oder weniger? Wenn eine Lady sagt, dass sie noch Zeit braucht, dann gewähre sie ihr, sonst wird sie dich auf ewig hassen. Das ist mein Ratschlag.«
»Da hast du sicher recht. Aber ich will irgendetwas für sie tun!«
»Dann schicke ihr einen Strauß Rosen oder kaufe ihr eine Insel. Aber rücke ihr nicht auf die Pelle!«
Dieses Gespräch hatte vor einem Monat stattgefunden, und seitdem hatte er Allie nur drei Mal gesprochen. Das hatte er sich ganz anders vorgestellt. Doch sein Selbstmitleid wurde durch eine Stimme unterbrochen. »Das sieht nach einer guten Wellengruppe aus«, rief sein neuer Freund Seth aus ein paar Metern Entfernung.
»Cowabunga«, bestätigte Drake ihm mit dem Schlachtruf der Surfer und brachte sich in Position. Seth ließ sich von der ersten Welle davontragen, während Drake auf die nächste wartete und dafür belohnt wurde, denn er sah, wie sich eine noch viel größere Welle bildete. Wie ein Wilder paddelte er los und kam genau im richtigen Moment an. Er richtete sich auf und der Ritt begann. Obwohl der Spaß nur zehn Sekunden dauerte, fühlte Drake genau die gleiche Begeisterung wie damals im Norden, wo er auf seinem Kurzbrett allerdings einen Neopren-Vollanzug mit Kapuze hatte tragen müssen, um die Temperaturen bei Santa Cruz auszuhalten. Das wärmere Wasser hier half ihm, sich zu entspannen, und auch die Freundschaft der anderen Surfbegeisterten war etwas ganz anderes als das Konkurrenzdenken, dass er aus Huntington und Newport Beach kannte.
»Mir reicht's für heute, euch Jungs noch viel Spaß«, rief er. Die anderen paddelten schon wieder hinaus, während Drake sich gegen den Sog des zurückströmenden Wassers in Richtung des goldglänzenden Strandes aufmachte. Dort angekommen öffnete er den Reißverschluss seines Anzugs und lockerte das Oberteil, dann schnappte er sich sein Board und trottete auf seinen Bungalow zu. Schon nach diesen wenigen Monaten war er sich eigentlich sicher, dass er hierbleiben wollte, also überlegte er, ein Haus zu kaufen. Doch jedes Mal, wenn er sich online die Angebote anschaute, kam er sich vor wie der letzte Snob. Auch wenn er das Geld locker hatte, schienen ihm die Preise absolut astronomisch für eine reine Ansammlung verschiedener Zimmer. Es war doch einfach Wahnsinn, sieben bis zehn Millionen für nicht einmal zwanzig Meter Strandbreite zu zahlen, mit Nachbarhäusern, die links und rechts angeklatscht waren.
Als er sein holzverkleidetes Domizil erreichte, das gegen die umliegenden Gebäude nur briefmarkengroß wirkte, sah er einen blonden Haarschopf über den Zaun des Nachbargrundstücks lugen. Es folgte eine winkende Hand, die zu einer atemberaubend schönen, jungen Frau gehörte: Kyra, der Tochter eines Filmproduzenten, die im Hause ihres Vaters wohnte, um sich einen Namen in der Filmbranche aufzubauen. Mit ihren zwanzig Jahren war sie ein Produkt absoluter genetischer Perfektion und ihr bloßes Erscheinen würde wohl in allen Ländern der Welt ausreichen, um einen Verkehrsstillstand herbeizuführen. Drake fiel auf, dass ihr Bikini nicht viel mehr zu sein schien als eine Kordel. Offensichtlich hatte sie sich oben ohne gebräunt und kämpfte nun damit, ihr Oberteil wieder in die richtige Position zu bringen, was ihr jedoch nur teilweise gelang. Ob das Absicht oder ein Versehen war, konnte Drake nicht sagen.
»Hey Drake, du alter Surfer, machst ja eine gute Figur da draußen!«, rief sie mit ihrer melodiösen Stimme.
»Danke, Kyra. Wie läuft's bei dir?«
»Mein Agent hat mir noch ein paar Vorsprechen organisiert. Ich habe wirklich das Gefühl, meine große Stunde kommt bald!«
Drake strich sich verlegen die Haare nach hinten und versuchte, nicht auf ihre makellos gebräunte Haut zu starren oder sich in ihren strahlend blauen Augen zu verlieren. »Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe es! Für mich lief das Jahr bisher auch ganz gut.«
Sie schaute ihn an, wie eine Katze ein frisch geschlüpftes Küken mustern würde, wobei ihr Blick an seiner wohlgeformten Brust und den trainierten Oberarmen hängenblieb. »Das ist wohl die Untertreibung des Jahres!«
»Ich bin sicher, du wirst auch etwas leisten, das dich berühmt macht, Kyra. Es ist nur eine Frage der Zeit.«
Damit hatte er recht. Sie las Dialogzeilen mit der Überzeugungskraft eines Steines, auf den ein Gesicht gemalt war, aber die Verbindungen ihres Vaters würden sie früher oder später zum Star machen, da war er sicher.
»Für dich ist das leicht zu sagen. Du hast ja schon den Jackpot abgeräumt! Vielleicht solltest du ein Buch darüber schreiben … oder noch besser, eine Reality-Show, gleich hier am Strand!«
»Ich fürchte, so spannend ist mein Leben nicht, Kyra.«
»Ach, mach dir da mal keine Sorgen. Das ist doch alles inszeniert. Die denken sich irgendwelche Sachen aus und du spielst einfach mit. Hey, ich könnte doch auch mitmachen! Ich könnte die Schauspielerin sein, die Karriereprobleme hat! Das wäre der Wahnsinn! Lass mich ein paar Anrufe machen …«
»Danke, Kyra, aber ich bin hierher gezogen, um genau diesem Rummel zu entkommen!«
Sie schaute ihn bewundernd an. »Siehst du, du bist ein ganz besonderer Mensch! Jeder andere würde sich einschleimen ohne Ende, um eine eigene Sendung zu bekommen. Dir ist das alles ganz egal!«
»Wahrscheinlich sollte ich mal zum Arzt gehen«, scherzte Drake und grinste sie an. Sie reagierte mit einem Schmollmund und lächelte dann zurück.
»Komm doch nachher auf einen Margherita oder so etwas bei mir vorbei«, sagte sie mit unschuldigen Worten, wobei ihre Körpersprache keinen Zweifel daran ließ, was sie mit »so etwas« meinte.
»Super, danke … ich komme vielleicht darauf zurück«, sagte Drake, als er sich wieder seiner Haustür zuwandte, die er nie verschloss. Schließlich hortete er keine Reichtümer und er wusste, dass seine Nachbarn es ebenso machten – ein weiterer Beweis, dass Malibu sich stark von der echten Welt auf der anderen Seite des Hügels unterschied. Doch jetzt entdeckte er zwei Männer in Anzügen, die auf der anderen Seite der offenen Glastür seiner Terrasse standen und ihn mit überkreuzten Armen streng anschauten.
»Was zur Hölle…«
Der Größere von beiden trat nach vorn. »Mister Ramsey, entschuldigen Sie unser Eindringen, aber wir haben geklopft und die Tür war offen. Es wäre sicher besser, Sie würden abschließen«, sagte er, wobei seine Stimme so angenehm klang wie Fingernägel auf einer Schultafel. »Bitte, kommen Sie herein. Wir benötigen einen Augenblick Ihrer Zeit.«
»Und Sie sind …?«
»Jemand, mit dem Sie sich dringend unterhalten sollten«, sagte der andere Mann, der nach einem Seitenblick auf Kyra seine Stimme senkte. »Wir kommen aus Washington.«
»Drake? Ist alles in Ordnung?«, fragte Kyra und näherte sich seinem Haus, indem sie die Treppen von ihrer Veranda herunterkam.
Drake beobachtete die beiden Männer, die sich weiter in den Halbschatten seines Wohnzimmers zurückzogen, um nicht gesehen zu werden. Dann nickte er. »Ja. Aber wenn ich in zehn Minuten nicht wieder auftauche, ruf die Polizei!«
Kapitel 4
»Ich kann Ihnen versichern, das wird nicht nötig sein«, sagte der erste Mann, als Drake sein Surfbrett gegen das klapperige Holzgeländer lehnte. »Mein Name ist Collins, das ist Ross.«
Drake atmete tief durch und wandte sich den beiden Männern zu. »Was wollen Sie? Und wer gibt Ihnen das Recht, in mein Haus einzudringen?«
»Sie und mein Boss hatten vor ein paar Monaten ein Gespräch. Vielleicht erinnern Sie sich daran?«, sagte Collins und ignorierte damit Drakes Frage.
Drake nickte, wobei sich seine Stimmung deutlich verschlechterte. Er konnte sich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. »Klar. So etwas Unangenehmes vergisst man nicht so schnell.«
»Ich komme zur Sache. Wir haben ein Problem, bei dem wir Ihre Hilfe brauchen. Kommen Sie doch herein, damit wir darüber reden können.«
»Mir gefällt es hier draußen besser, wenn es Ihnen nichts ausmacht«, antwortete Drake.
»Ramsey, tun Sie uns einen Gefallen und regen Sie sich ab, okay?«, knurrte Ross. »Kommen Sie rein, nehmen Sie sich eine Limo oder was auch immer und hören Sie uns an. Dann gehen wir. Sie sind zu nichts verpflichtet.«
Drakes rechte Augenbraue hob sich. »Ich bin zu nichts verpflichtet?«
»Das haben Sie richtig gehört«, bestätigte Collins.
Drake seufzte, zog sich sein Neopren-Oberteil ab und drapierte es auf dem Geländer der Terrasse. »Dann fassen Sie sich kurz. Ich muss meine Sachen sauber machen.«
Drake betrat das Wohnzimmer nur in seinen Surfershorts bekleidet. Er warf kurz einen abwägenden Blick auf das Sofa, zuckte dann mit den Schultern und setzte sich, obwohl er die weißen Polster damit ordentlich durchnässte. Collins nahm in einem Sessel Platz, während Ross neben dem Esstisch stehen blieb.
Dann räusperte sich Collins. »Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Wir haben eine schwierige Situation und brauchen jemanden von Ihrem Format.«
»Von meinem … Format?«
»Genau. Sie sind ein berühmter Schatzsucher. Dadurch kommen Sie an Orte, die für unsere Agenten tabu sind.«
»Ihre Agenten«, plapperte Drake verwundert nach.
Collins nickte. »Vor zwei Tagen ist eine Privatmaschine irgendwo im Grenzgebiet von Laos und Myanmar abgestürzt. Die Thais hatten sie auf ihrem Radar, bis sie verschwunden ist. Es gab zu der Zeit ein Unwetter in dem Gebiet und wir befürchten das Schlimmste.«
»Das tut mir leid«, sagte Drake mit verwirrtem Gesichtsausdruck, »Aber was hat das mit mir zu tun?«
»In dem Flugzeug saß eine Frau namens Christine Whitfield. Sie ist die Tochter des Senators Arthur Whitfield. Vielleicht haben Sie von ihm gehört?«
Drake schüttelte den Kopf. »Ich interessiere mich nicht besonders für Politik.«
»Er ist der Kopf hinter vielen neuen Gesetzen und manche behaupten, er hätte ebenso viel Einfluss wie der Präsident«, sagte Ross.
Collins seufzte. »Der Senator ist sehr aufgebracht über das Verschwinden seiner Tochter, Drake. Er hat angefangen, Fäden zu ziehen. Eine Menge Fäden. Und einer dieser Fäden führte zum Chef unserer Organisation, der mit ihm befreundet ist. Der hat versprochen, ihm zu helfen. Und hier kommen Sie ins Spiel.«
»Ich verstehe es immer noch nicht.«
»Sie müssen sofort eine Expedition in das Gebiet zusammenstellen. Wir besorgen Ihnen die nötigen Genehmigungen, aber wir brauchen jemand Bekannten, um nach ihr zu suchen. Sonst bekommen wir niemals die Erlaubnis von den beteiligten Ländern.«
»Warum nicht? Ich dachte, Ihr Jungs regiert die ganze Welt?«
Collins lächelte zum ersten Mal, was einen beunruhigenden Effekt hatte. »Ich fürchte, auf Youtube werden unsere Möglichkeiten übertrieben. Wir sind vielleicht in der Lage, Aliens zu verstecken und eine neue Weltordnung zu planen, aber wir bekommen von der laotischen Regierung keine Erlaubnis, in ihrem Staatsgebiet herumzuschnüffeln. Die sind immer noch ein bisschen empfindlich wegen ein paar unschönen Vorkommnissen während des Vietnamkriegs.«
»Und vergessen Sie nicht Myanmar. Die hassen uns mehr als Iran und Nordkorea zusammen«, fügte Ross hinzu.
»Aber mich würden sie in ihrem Dschungel herumturnen lassen? Warum noch mal?«
»Verdammt, Drake, Sie sind berühmt! Im Moment sind Sie quasi weltbekannt! Natürlich würde man Sie nicht nach einem Flugzeug suchen lassen … weswegen Sie das auch nicht tun werden.«
»Wonach suche ich denn dann? Also, gesetzt den Fall, dass ich Interesse hätte?«, fragte Drake neugierig.
»Haben Sie jemals von dem Smaragd-Buddha des Khmer-Imperiums gehört?«, fragte Collins, wobei sich seine grauen Augen in die von Drake bohrten. Der schüttelte den Kopf.
»Dann googeln Sie das. Als die Thais in das Gebiet eingefallen sind, das heute Kambodscha ist, haben die Khmer den Legenden zufolge ihren größten Schatz außer Landes geschafft. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er sich in der Nähe der Grenze zwischen Laos und Myanmar befindet, wo auch das Flugzeug zum letzten Mal beobachtet wurde.«
»Die Khmer? Wer genau sind die Khmer? Ich habe nur mal den Begriff der Roten Khmer gehört.«
»Die haben den Namen von ihren Vorfahren übernommen. Diese Khmer waren einst das mächtigste Reich in der Region. Sie haben außergewöhnliche Tempel gebaut und sind heute noch berühmt für ihre fortschrittliche Zivilisation. Im Mittelalter waren sie quasi eine Supermacht und Angkor Wat ist die bekannteste ihrer Tempelanlagen. Sie haben für Jahrhunderte geherrscht, bis Thailand ihnen im fünfzehnten Jahrhundert die Butter vom Brot genommen hat.«
Drakes Augen verengten sich. »Woher wissen Sie, wo der Schatz ist?«
»Um ehrlich zu sein wissen wir es nicht ganz genau. Aber wir haben Grund zu der Annahme, das Gebiet einengen zu können.«
»Verstehe. Die Frage ist nur, wie?«
»Wenn Sie uns helfen, bekommen Sie ein Briefing mit streng geheimen Daten. Darunter befindet sich ein Interview mit einem Guerilla-Kommandanten, der im Vietnamkrieg gefangen genommen wurde. Er hatte sehr wertvolle Informationen, die einen begabten Schatzsucher wie Sie bestimmt zu dem versteckten Tempel führen werden, wo der Schatz versteckt ist.«
Drake schnaubte. »Denken Sie sich das gerade aus?«
Collins stand auf. »Mister Ramsey, wir haben nicht viel Zeit. Wie gesagt, es sind bereits achtundvierzig Stunden vergangen, seit das Flugzeug verschwunden ist. Whitfield ist verzweifelt, er braucht Antworten. Und falls irgendeine Chance besteht, dass seine Tochter noch lebt … nun ja, so oder so würden Sie Ihrem Land, meinem Chef und dem Senator einen riesigen Gefallen tun, den niemand vergessen wird. Es kann nie schaden, bei Menschen dieses Kalibers etwas gut zu haben.«
Drake dachte darüber nach. »Wie viel Zeit habe ich, um mich zu entscheiden?«
»Am besten wäre jetzt sofort.«
Drake schüttelte den Kopf. »Das geht nicht. Ich muss erst darüber nachdenken.«
»Dann denken Sie!«, bellte Ross.
»Mister Ramsey, die Sache ist ganz einfach«, sagte Collins mit besonnener Stimme. »Sie fliegen nach Thailand. Dort machen Sie eine Expedition in Begleitung von wem auch immer Sie wollen, sowie einem unserer Leute. Vielleicht finden Sie dort einen Schatz, der beweist, dass Paititi nicht nur ein Glückstreffer war. Gleichzeitig halten Sie Ihre Augen nach einem Flugzeug offen. Indem Sie dies tun, verdienen Sie sich den Dank einiger der mächtigsten Menschen in unserem Land. Das sind doch alles nur Vorteile!« Collins wartete kurz, um Drakes Reaktion einschätzen zu können. »Selbst wenn Ihnen das alles nichts bedeutet, denken Sie doch mal an die junge Frau! Wenn Sie noch lebt, ganz allein im Dschungel, dann wird das nicht sehr lange so bleiben. Sie sind der entscheidende Faktor in der Frage, ob sie überlebt oder stirbt. Sagen Sie mir bitte, Mister Ramsey, was haben Sie diese Woche noch vor, das wichtiger ist, als möglicherweise das Leben einer jungen Dame zu retten und gleichzeitig einen legendären Schatz zu heben?«
Drake leckte etwas verkrustetes Meersalz von seinen Lippen. »Ich muss das mit meinem Team besprechen.«
»Sie müssen morgen in der Luft sein. Wir müssen in der Zwischenzeit die behördliche Seite regeln und Ihnen die nötigen Genehmigungen besorgen.«
»Das ist eventuell zu knapp. Lassen Sie mich ein paar Anrufe machen und es herausfinden.« Drake stand auf. »Falls ich es überhaupt mache – gewähren Sie mir bitte zuerst etwas Spielraum, um mich zu entscheiden.«
»Ich hätte gern jetzt eine Antwort.«
»Ich hätte gern ein Einhorn, auf dem ich nach Fantasien reiten kann. Haben Sie eine Nummer, unter der ich Sie erreichen kann?«
»Wir spielen hier kein Spiel«, sagte Ross, wobei er einen Schritt auf Drake zumachte.
Collins erhob eine Hand, um Ross zurückzupfeifen, und angelte einen Stift aus seiner Tasche. Er schaute sich im Zimmer um und ging dann zum Frühstückstresen, wo er eine Nummer auf den Notizblock neben dem Telefon kritzelte. Er riss den Zettel ab und reichte ihn Drake. »Können Sie meine Schrift lesen?«
Drake las die Nummer vor. »Bitte geben Sie mir einen Moment, um das alles zu verdauen.«
Collins schüttelte frustriert den Kopf. »Wir haben keine Alternative, Mister Ramsey. Sie sind die einzige Hoffnung für den Senator und seine Tochter. Falls es Ihnen hilft, zu einer Entscheidung zu kommen, können wir ihn jetzt anrufen und Sie reden mit ihm. Vielleicht kann die Verzweiflung eines Vaters Sie umstimmen?«
»Das ist nicht nötig. Ich habe schon verstanden, was auf dem Spiel steht. Aber lassen Sie es mich durchdenken und Ihre Geschichte nachprüfen. Ich rufe Sie noch heute an und teile Ihnen meine Entscheidung mit. Mehr kann ich Ihnen nicht anbieten.«
Collins nickte. »Sorry, dass wir hier so hereingeplatzt sind.«
»Laufen Sie nicht gegen den Türrahmen …«, komplimentierte Drake die beiden hinaus, wobei er mit dem Zettel in der Hand neben der Couch stehen blieb, bis Ross die Tür zuzog.
Drake machte schnell ein paar große Schritte, verriegelte die Tür und begab sich dann zu seinem Computer. Er hatte gerade Christines Namen eingetippt, als Kyras Stimme ihn aus seinen Gedanken riss.
»Drake? Alles okay?«
Er drehte sich um und rief ihr zu: »Ja, Kyra, vielen Dank. Alles prima.«
»Okay. Denk an die Margarita!«
»Ich melde mich.«
Drake schaute sich die Suchergebnisse und dann das Facebook-Profil von Christine an. Das Bild zeigte eine attraktive junge Frau, die ihn intensiv anzustarren schien. Drake versuchte sich vorzustellen, wie es sich für ihren Vater anfühlen musste, nicht zu wissen, ob sie tot oder lebendig war, und dabei lief ihm ein kalter Schauer den Rücken hinunter.
Als Nächstes startete er eine Suche nach dem Smaragd-Buddha der Khmer und las sich ein paar Berichte durch, auch einen über die kleinere Ausgabe des Buddhas, die sich im königlichen Palast in Thailand befand. Dieses beeindruckende Stück Kunsthandwerk galt als heilige Reliquie für die Thailänder, die das Wohlergehen ihres Landes von diesem Kulturerbe abhängig machten. Deswegen gab es eine spezielle Zeremonie, in der der thailändische König die Statue zu jedem Wechsel der Jahreszeiten in ein goldenes Gewand hüllte.
Der Begriff »Smaragd-Buddha« war allerdings irreführend, denn er beschrieb nur die Farbe, nicht den Edelstein. Die Statue war aus grünem Jasper hergestellt worden, und Drake vermutete, dass das bei dem größeren Buddha ebenso war.
Der Legende zufolge war der königliche Schatz der Khmer in einem geheimen Tempel versteckt, dessen Aufenthaltsort seit sechshundert Jahren unbekannt war, da alle Aufzeichnungen in den vielen Kriegshandlungen der damaligen Zeit vernichtet worden waren. Schon viele Khmer hatten sich hoffnungsvoll zu Expeditionen aufgemacht, später dann auch Schatzjäger vieler Nationen, doch niemand hatte Erfolg. In den letzten hundert Jahren war der vermutete Fundort auch immer gefährlicher geworden, weil Kriege, Hungersnöte, Fluten, Stürme, Militärregierungen und Drogenhändler das Gebiet heimgesucht hatten. Dadurch waren weitere Expeditionen im Keim erstickt worden.
Drake studierte Christines Facebook-Seite und las ihre öffentlichen Postings, schaute sich ihre Selfies an und stieß dann auf ein Foto, das ihn versteinern ließ.
Er schaute sich das Foto sehr lange an, dann schüttelte er den Kopf und stieß einen kaum hörbaren Fluch aus – dann ging er zum Telefon, um herauszufinden, ob Allie dabei sein würde.
Für sich selbst hatte Drake seine Entscheidung bereits getroffen.
Er würde nach Thailand fliegen.
Kapitel 5
Peking, China
Zwei große Mannschaftswagen hielten vor einem sechsgeschossigen Gebäude aus Chrom und Glas, das sich am Stadtrand befand. Dahinter stoppte ein gepanzertes mobiles Einsatzzentrum, das mit Runflat-Reifen und Schießscharten ausgestattet war. Eine Truppe Polizisten in schweren Kampfanzügen sprang aus den Fahrzeugen und bildete zwei Züge auf dem Bürgersteig. Fußgänger stoppten und kehrten sofort um, denn egal, was hier vor sich ging, es sah gefährlich aus. Drei Männer in grellorangen Notwesten begannen, die Straße abzusperren und den Verkehr umzuleiten.
Ein schwarzer SUV hielt am Bordstein und die Männer nahmen Haltung an. Ein unauffälliger Herr in schwarzem Anzug verließ das Fahrzeug und ließ seinen Blick über die versammelten Beamten schweifen. Während noch weitere SUVs eintrafen, nickte er dem Anführer der Männer zu.
»Los geht’s«, sagte der kleine Mann.
Der Anführer nickte und bellte einen Befehl, woraufhin seine Leute ihre Waffen durchluden und sich bereitmachten, das Gebäude zu erstürmen.
***
Huang schaute missmutig auf sein Schreibtischtelefon und dann zurück auf den riesigen Stapel Papierkram, den er gerade durcharbeitete. Das schrille Klingeln war jedoch so aufdringlich wie die Stimme seiner oft wütenden Ehefrau, also ließ er seinen Stift fallen und griff nach dem Hörer.
»Ja?«
»Sir, eine Gruppe von Regierungsmitarbeitern ist auf dem Weg zu Ihnen nach oben. Es sind mindestens zwanzig Mann. Mit Waffen.« Es war der Sicherheitsmann in der Lobby des Gebäudes, dem Firmensitz von Moontech – der Technologiefirma, die Huang gegründet hatte, und die sich in der neuen Welt des globalen Kapitalismus sehr gut schlug, indem sie Zehntausende Webseiten hostete und unzählige Programme und Apps verkaufte.
»Wie bitte? Meinen Sie das ernst?«
»Absolut, Sir! Sie werden jeden Moment da sein!«
Huang stand erschrocken auf. Er führte seine Firma mit rein ehrlichen Mitteln und schmierte alle wichtigen Personen, um in Ruhe gelassen zu werden. Mit Raubkopien oder irgendwelchen anderen halbseidenen Machenschaften hatte seine Firma nichts zu tun, im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, von denen bereits einige dem starken Arm des Gesetzes zum Opfer gefallen waren. Doch Huang war schlicht und ergreifend sauber.
Als er an die Bürotür herantrat, sah er, wie eine Gruppe Polizisten mit Sturmgewehren durch den Flur liefen, angeführt von einem Mann mit verschlagenem Gesicht. Huangs Angestellte erstarrten bei diesem Anblick vor Schreck, niemand wagte auch nur eine Bewegung. Die Beamten verteilten sich und trieben die Mitarbeiter mit vorgehaltenen Waffen zusammen.
Huang trat im Flur dem kleingewachsenen Anführer entgegen, wobei er seine Hände auf die Hüften stützte. »Was hat das zu bedeuten?«
»Huang Qi?«, fragte der Beamte im Anzug.
»Der bin ich.«
»Sie sind verhaftet.« Der Mann wandte sich an die beiden Polizisten hinter ihm. »Handschellen!«
Huang war entsetzt. »Wieso das denn? Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen!«
»Das werden wir ja sehen.« Einer der Cops trat hinter Huang und fesselte ihm die Hände hinter dem Rücken.
»Das ist eine Frechheit«, sagte Huang. »Meine Firma ist für ihre Ehrlichkeit bekannt!«
»Sparen Sie sich die Worte. Wo befinden sich Ihre Server?«
Huang blinzelte, erstaunt über diese Frage. »Im … im Keller. Wieso?«
Der Beamte zog ein Mobiltelefon aus seiner Jacketttasche und tätigte einen Anruf, ohne Huang weiter zu beachten. »Schicken Sie die Techniker in den Keller. Halten Sie die Angestellten fest, bis wir alle verhört haben!«
Das Blut wich aus Huangs Gesicht. »Ich verstehe das nicht. Bitte. Warum tun Sie das? Alle unsere Genehmigungen sind in Ordnung, die Konten werden überwacht, wir …«
Die Hand des kleinen Mannes zischte mit der Geschwindigkeit eines Blitzes in Richtung von Huangs Gesicht und sein Kopf wurde durch die Wucht der Backpfeife zur Seite geworfen.
»Sie stellen hier nicht die Fragen, das ist mein Job!«, zischte der Beamte und seine gesenkte Tonlage war bedrohlicher, als wenn er geschrien hätte. »Bringen Sie ihn ins Hauptquartier!«
Huang schluckte seinen Stolz herunter. Er war gerade vor seinen ranghöchsten Angestellten geohrfeigt worden, doch er ließ es ohne Widerrede zu, dass man ihn zum Aufzug geleitete. Die Gesichtsausdrücke seiner Mitarbeiter sagten mehr als tausend Worte – es gab keinen Zweifel daran, wie ernst die Situation war. Er verstand nicht, wie er von einem Augenblick zum nächsten von einem führenden Mitglied der Gesellschaft zum Gefangenen werden konnte, aber er wusste, dass er ein riesiges Problem hatte. Allein die Tatsache, dass der Herr im Anzug ihm keinen Ausweis gezeigt hatte, deutete darauf hin, dass er unter dem Radar operierte. Und das bedeutete in China, dass er gefährlicher war als eine Giftschlange.