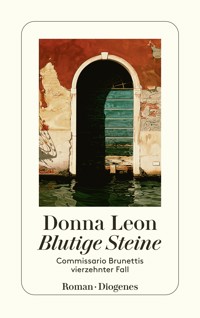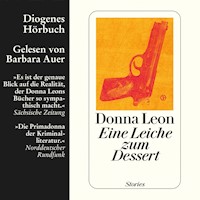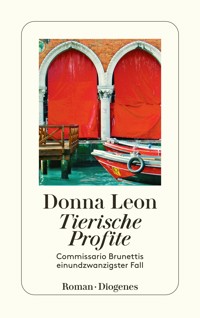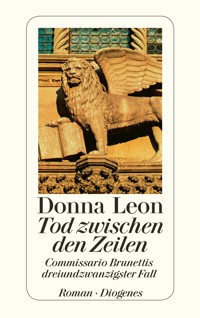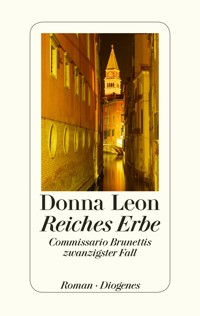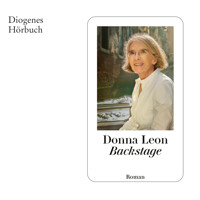10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Für Patta ermittelt Brunetti diesmal nur pro forma, doch Paola ist unerbittlich: Sie will wissen, was für ein Mensch der Tote war, der bei den Brunettis in der Nachbarschaft umgekommen ist. Dabei sieht alles – zunächst – nach einem Unfall aus. Niemand will etwas gewusst haben. Doch auch Nichtstun kann zum Verhängnis führen. Brunettis privatester Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Donna Leon
Das goldene Ei
Commissario Brunettiszweiundzwanzigster Fall
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Werner Schmitz
Titel des Originals: ›The Golden Egg‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 2014
im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Georg Friedrich Händel,
Giulio Cesare, 1. Akt
Covermotiv: Foto von Eduardo Sentchordi (Ausschnitt)
Copyright ©Eduardo Sentchordi
Für Frances Fyfield
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2020
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24336 9
ISBN E-Book 978 3 257 60414 6
[5] lasciate,
che al mio core, al mio bene
io porga almen gli ultimi baci. Ahi pene!
So lasst michmeinen Augenstern ans Herz noch drücken.
Einen Kuss, einen letzten. Welch eine Qual!
GIULIO CESARE
[7] 1
Es war ein ruhiger Abend daheim bei den Brunettis, man saß friedlich vereint beim Essen. An seinem Stammplatz Brunetti, sein Sohn Raffi neben ihm; Brunetti gegenüber seine Frau Paola, und neben ihr Tochter Chiara. Eine Platte fritto misto, angereichert mit Gemüse, insbesondere Karotten, Chiaras momentanen Favoriten, hatte die friedliche Stimmung eingeläutet; die Gesprächsthemen taten ihr keinen Abbruch. Schule, Arbeit, der neue Welpe eines Nachbarn, erster Labradoodle von Venedig; eins ging ins andere über in munterem Wechsel, auch wenn es immer irgendwie mit der Stadt zu tun hatte, in der sie lebten.
Als gebürtige Venezianer unterhielten sie sich dennoch auf Italienisch, nicht auf Veneziano. Brunetti und Paola hatten von Anfang an darauf vertraut, dass die Kinder den Dialekt ohnedies lernen würden, von Freunden und auf der Straße. Und so war es auch: Den Kindern ging Veneziano genauso mühelos über die Lippen wie ihrem Vater, der damit aufgewachsen war. Paola wiederum hatte den Dialekt – auch wenn sie das nicht an die große Glocke hängte – als Kind nicht von ihren Eltern, sondern nur bisweilen von den zahlreichen Dienstboten im Palazzo Falier aufgeschnappt, weshalb sie ihn weniger gut beherrschte als die anderen. Überhaupt nicht peinlich war es ihr hingegen, dass sie von ihrer Kinderfrau nahezu das Englisch einer Muttersprachlerin gelernt hatte und dass es ihr gelungen war, diese Sprache an ihre beiden Kinder weiterzugeben. Unterricht durch [8] einen Privatlehrer und Sommerferien in England taten ein Übriges.
Familien haben ähnlich wie Religionen Regeln und Rituale, mit denen Außenstehende wenig anfangen können. Auch sind ihnen Dinge wichtig, die von Mitgliedern anderer Gruppen nicht im gleichen Maße geschätzt werden. Wenn den Brunettis etwas heilig war – während Religion für sie eher ein leeres Ritual bedeutete –, dann war es die Sprache. Wortspiele und Witze, Kreuzworträtsel und Reihumgeschichten bedeuteten ihnen ebenso viel wie Kommunion und Firmung den Katholiken. Verstöße gegen die Grammatik mochten als lässliche Sünden durchgehen; ungelenke Ausdrucksweise hingegen galt als Todsünde. Die Kinder wären nie auf die Idee gekommen, diesen Glauben in Frage zu stellen; vielmehr strebten sie nach den höheren Weihen.
So stellte denn Chiara, kaum waren die Teller abgeräumt, von denen sie den Fenchelsalat mit Orangen gegessen hatten, ihr Wasserglas mit Nachdruck auf den Tisch und sagte: »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.«
»Clorindas und Giuseppes Blicke trafen sich, und sie sahen im Glück vereint auf ihr Baby hinab«, steigerte Paola mit viel Gefühl in der Stimme den Einsatz.
Raffi warf seiner Mutter und Schwester einen Blick zu, legte den Kopf schief, fixierte das Gemälde an der Wand gegenüber und erklärte dann: »Und so geschah es. Die Radikalkur versetzte selbst die Ärzte, die sie durchführten, in Erstaunen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit kam ein Mann mit einem Baby nieder.«
Brunetti ließ sich nicht lumpen: »Bevor er in den [9] Kreißsaal musste, brachte Giuseppe noch heraus: ›Sie bedeutet mir nichts, meine Liebe. Du bist die wahre Mutter meines Kindes.‹«
Chiara, die den Beiträgen der anderen mit wachsendem Interesse gelauscht hatte, nahm den Faden auf: »Nur eine felsenfeste Ehe konnte derlei Prüfungen trotzen, aber Clorinda und Giuseppe einte eine Liebe, die über alle Begriffe ging und jedes Hindernis überwand. Für einen Augenblick jedoch wankte Clorinda in ihrem Glauben. ›Ausgerechnet mit Kimberley? Meiner Busenfreundin?‹«
Damit gab sie den Ball an Paola zurück, die mit der Stimme eines unbeteiligten Erzählers erklärte: »Um das Fundament der Wahrhaftigkeit, auf dem ihre Ehe gründete, nicht zu erschüttern, kam Giuseppe nicht umhin zu gestehen, dass sein Kinderwunsch ihn zum Äußersten getrieben hatte. ›Es hatte nichts zu bedeuten, meine Liebe. Ich habe es für uns getan.‹«
»›Du Scheusal‹, schluchzte Clorinda, ›mich so zu verraten! Und was ist mit meiner Liebe? Was ist mit meiner Ehre?‹« Dies war Raffis zweiter Beitrag, den er mit den Worten schloss: »›Und noch dazu mit meiner besten Freundin.‹«
Fasziniert von dieser Vorlage, meldete Chiara sich außer der Reihe: »Er senkte beschämt den Kopf und sagte: ›Wollte Gott, es wäre nicht Kimberleys Kind.‹«
Paola schlug, um Aufmerksamkeit heischend, mit der Hand auf den Tisch und rief: »›Aber das ist unmöglich. Die Ärzte haben doch gesagt, Kinder seien uns verwehrt.‹«
Verdrossen, weil er übergangen worden war – und auch noch von seiner Frau –, strengte Brunetti sich besonders an, [10] wie ein schwangerer Mann zu sprechen: »›Und doch: Ich trage ein Kind unter dem Herzen, Clorinda.‹«
Dann trat Stille ein, und alle überlegten fieberhaft, ob sie irgendetwas Haarsträubendes draufsetzen konnten, um Klischee und Melodram noch zu steigern. Als klar war, dass niemand dem mehr etwas hinzuzufügen hatte, stand Paola auf und sagte: »Zum Nachtisch gibt’s Ricotta-Zitronenkuchen.«
Als die Eltern später noch beim Kaffee im Wohnzimmer beisammensaßen, fragte Paola: »Weißt du noch, wie Raffi zum ersten Mal mit Sara hier war und sie uns alle für verrückt gehalten hat?«
»Kluges Mädchen«, meinte Brunetti nur. »Gute Menschenkenntnis.«
»Hör auf, Guido; sie war wirklich schockiert.«
»Im Lauf der Jahre hat sie sich an uns gewöhnt.«
»Das kann man wohl sagen«, räumte Paola ein und lehnte sich auf dem Sofa zurück.
Brunetti nahm Paola die leere Tasse ab und stellte sie auf den Sofatisch. »Spricht da die künftige Großmutter aus dir?«, fragte er.
Sie fuhr auf und knuffte ihn. »Sag so was nicht einmal im Scherz.«
»Möchtest du etwa nicht Großmutter werden?«, stellte Brunetti sich dumm.
»Ich möchte Großmutter eines Kindes sein, dessen Eltern einen Universitätsabschluss und Arbeit haben«, antwortete Paola plötzlich ernst.
»Ist das so wichtig?«, fragte Brunetti ebenso ernst zurück.
[11] »Wir haben immerhin beides, oder?«, wich sie aus.
»Üblicherweise beantwortet man Fragen mit Antworten, nicht mit weiteren Fragen«, bemerkte er, stand auf und ging in die Küche, wobei er nicht vergaß, die beiden Tassen mitzunehmen.
Wenige Minuten später kam er mit zwei Gläsern und einer Flasche Calvados zurück. Er setzte sich neben Paola und schenkte ein. Dann reichte er ihr ein Glas und nahm einen Schluck aus seinem.
»Wenn sie einen Abschluss und Arbeit haben, sind sie zwangsläufig älter, wenn Kinder kommen. Vielleicht auch klüger«, sagte Paola.
»Waren wir das?«, fragte Brunetti.
Sie überging die Frage. »Mit einer anständigen Ausbildung wissen sie mehr, und das könnte hilfreich sein.«
»Und die Arbeit?«
»Die ist nicht so wichtig. Raffi ist klug, er dürfte keine Schwierigkeiten haben, etwas zu finden.«
»Er ist klug, und er hat gute Beziehungen«, stellte Brunetti klar, auch wenn er Paola Macht und Reichtum ihrer Familie nicht unter die Nase reiben wollte.
»Gewiss«, räumte sie ein. »Aber Klugheit ist wichtiger.«
Brunetti sah das auch so und begnügte sich mit einem Nicken sowie einem weiteren Schlückchen Calvados. »Neulich hat Raffi mir erzählt, dass er Mikrobiologie studieren will.«
Paola stutzte. »Ich weiß nicht einmal, worum genau es da geht«, sagte sie und lächelte ihn an. »Ist dir das schon mal aufgefallen, Guido, all diese Begriffe, die wir täglich im Munde führen: Mikrobiologie, Physik, Astrophysik, Maschinenbau. [12] Wir reden davon, wir kennen sogar Leute, die auf diesen Gebieten arbeiten, aber ich könnte nicht erklären, was die genau machen. Du?«
Er schüttelte den Kopf. »Bei den alten Disziplinen ist das ganz anders – Literatur, Philosophie, Geschichte, Astronomie, Mathematik – da weiß man, was sie tun, oder zumindest, worum es geht. Historiker versuchen herauszufinden, was in der Vergangenheit geschehen ist, und dann versuchen sie herauszufinden, warum.« Er nahm sein Glas und drehte es versonnen zwischen den Handflächen wie ein Indianer, der Feuer macht. »Bei Mikrobiologie kann ich mir höchstens vorstellen, dass man sich mit kleinen Lebewesen beschäftigt. Mit Zellen.«
»Und darüber hinaus?«
»Weiß der Himmel«, sagte Brunetti.
»Was würdest du studieren, wenn du noch einmal von vorn anfangen müsstest? Wieder Jura?«
»Zum Vergnügen, oder um einen Job zu bekommen?«, fragte er.
»Hast du Jura studiert, um einen Job zu bekommen?«
Diesmal ging Brunetti darüber hinweg, dass sie eine Frage mit einer Frage beantwortet hatte. »Nein. Ich habe Jura aus Interesse studiert, und erst später wurde mir klar, dass ich bei der Polizei arbeiten wollte.«
»Und wenn du nur zum Vergnügen studieren könntest?«
»Altphilologie«, antwortete er, ohne zu zögern.
»Was, wenn Raffi sich hierfür entscheiden würde?«
Brunetti überlegte. »Es würde mich freuen«, sagte er schließlich. »Die meisten Kinder unserer Freunde sind arbeitslos, egal, was sie studiert haben, also könnte er ebenso [13] gut aus Spaß an der Sache studieren und nicht im Hinblick auf irgendeinen Job.«
»Und wo sollte er studieren?«, fragte Paola, ganz Mutter.
»Nicht hier.«
»Hier in Venedig oder hier in Italien?«
»Hier in Italien«, sagte Brunetti, auch wenn er sich dies selbst nicht gerne sagen hörte.
Sie warfen sich einen Blick zu, schicksalsergeben: Kinder werden erwachsen und ziehen in die weite Welt hinaus. Wenn mitten in der Nacht das Telefon klingelte, würden sie nicht mehr in ihr Zimmer laufen können, um sich mit eigenen Augen zu vergewissern, dass sie da waren. Ob sie schliefen oder wach waren und mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lasen; ob sie träumten oder schmollten, ob sie gut oder schlecht gelaunt waren: Nichts davon war wichtig außer der Gewissheit, dass sie da waren, in Sicherheit, zu Hause.
Was für Kindsköpfe Eltern doch sind. Da braucht nur nachts das Telefon zu läuten, und schon geraten sie in Panik und bekommen weiche Knie. Egal, ob der Anrufer sich als betrunkener Freund herausstellt, der sich über seine Frau beklagt, oder als die Questura, weil in der Stadt ein Verbrechen begangen wurde und Brunetti der diensthabende Kommissar ist. Selbst ein Anruf, der mit einer aufrichtigen Bitte um Entschuldigung endet, weil jemand sich zu dieser späten Stunde verwählt hatte, kostet diese Geiseln des Glücks den letzten Nerv.
Wie würde es ihnen bloß ergehen, wenn eins ihrer Kinder in einer fremden Stadt in einem fremden Land lebte? Sie waren tapfer, Guido Brunetti und Paola Falier, und sie hatten sich oft über den Hang der Italiener zum Melodrama [14] lustig gemacht, und doch wollten sie sich jetzt am liebsten reumütig Asche aufs Haupt streuen bei dem bloßen Gedanken, dass ihr Sohn sein Studium in einer anderen Stadt aufnehmen könnte.
Paola schmiegte sich in den Arm ihres Mannes und legte ihm eine Hand auf den Oberschenkel. »Wir werden niemals aufhören, uns Sorgen um sie zu machen, stimmt’s?«, sagte sie.
»Alles andere wäre unnatürlich«, meinte Brunetti lächelnd.
»Ist das ein Trost?«
»Vermutlich nicht«, meinte Brunetti. Schließlich fügte er hinzu: »Dass wir uns Sorgen machen, ist das Beste an uns.«
»An uns beiden oder an uns Menschen?«
»An uns Menschen«, sagte Brunetti. »Und auch an uns beiden.« Dann, weil Feierlichkeit nichts war, was sie lange durchhalten konnten, meinte er: »Wenn er Klempner werden möchte, könnte er hier in Venedig in die Lehre gehen und weiter zu Hause wohnen.«
Sie beugte sich vor und nahm die Flasche. »Ich glaube, ich werde mich hiermit trösten«, sagte sie und schenkte sich noch ein Glas ein.
[15] 2
Auf dem Weg zur Questura dachte Brunetti nicht an die Sprachspiele vom Vorabend, und er nahm auch den frischen Herbsttag kaum wahr; seine Gedanken kreisten um weniger erfreuliche Dinge. Kurz vor Feierabend hatte ihn gestern sein unmittelbarer Vorgesetzter, Vice-Questore Giuseppe Patta, per E-Mail wissen lassen, dass er ihn am nächsten Morgen zu sprechen wünsche. Selbstredend hatte Patta kein Wort darüber verloren, worum es gehen sollte: Diese Geheimniskrämerei war Teil seiner Überraschungstaktik, auch wenn seine Sekretärin, Signorina Elettra Zorzi, ihm mit ihrem tiefverwurzelten Gerechtigkeitssinn jedes Mal einen Strich durch die Rechnung machte und den Mitarbeitern, die sie ins Büro ihres Vorgesetzten einließ, vorher alles Nötige mitteilte.
Und als Brunetti sie einmal darauf ansprach, hatte sie nur gemeint, den Christen im Kolosseum habe man auch gesagt, hinter welchem Tor die Löwen lauern.
An diesem Morgen lagen sie offenbar bei den Vigili Urbani auf der Lauer, jener Polizei ohne Waffen, die dafür zu sorgen hatte, dass die städtischen Anordnungen eingehalten wurden. »Es geht um das Areal vor diesem Maskengeschäft auf dem Campo San Barnaba«, erklärte Elettra, nachdem sie und Brunetti sich höflich begrüßt hatten. »Einer der anderen Ladenbesitzer auf dem campo hat sich beschwert. Alle müssen Gebühren zahlen, damit sie ihre Tische nach draußen stellen und den Platz zum Verkaufen nutzen können, [16] außer die vom Maskengeschäft, und die anderen meinen, dafür kann es nur eine Erklärung geben.«
Brunetti ging oft über den campo, und tatsächlich, wenn er ihn jetzt mit seinem inneren Auge vor sich sah, fiel ihm auf, dass der Platz vor besagtem Laden im Lauf der Jahre zusehends von Tischen überwuchert worden war, auf denen die in China fabrizierten Masken zum Verkauf feilgeboten wurden. Doch weil das die Polizei nichts anging, sondern nur die Vigili, hatte Brunetti nicht weiter darauf geachtet. Wenn das Wegsehen der Vigili weniger kostete als die Standgebühren – welcher Kaufmann konnte da nein sagen?
»Aber wieso interessiert er sich für so etwas?«, fragte Brunetti und wies mit einer knappen Kopfbewegung auf Pattas Tür.
»Er hat gestern Nachmittag einen Anruf bekommen; kurz danach kam er heraus und bat mich, Ihnen eine E-Mail zu schicken.«
»Wer hat ihn angerufen?«
»Der Bürgermeister.«
»Sieh an«, sagte Brunetti leise.
»Sieh an«, stimmte sie ein.
»Und es ging um diesen Laden?«, fragte er.
»Ich verfolge Verbindungen…«, begann sie und wechselte mühelos in eine kühlere Stimmlage, um den Satz zu beenden, »in seinem Büro und erwartet Sie, Commissario.«
Bei Patta, das wusste Brunetti, konnte man des Guten nie zu viel tun, und so sagte er mit entschiedenem – wenngleich geheucheltem – Eifer: »Ich habe soeben die Mail gesehen und bin sofort hergekommen.«
Worauf die Tür zu Pattas Büro von innen vollends [17] aufgestoßen wurde und der Vice-Questore erschien. Brunetti dachte oft, in einer Oper würde man den Auftritt dieses Mannes mit einem Fanfarenstoß ankündigen. So stattlich, so nobel in seiner Haltung, so makellos gekleidet: Er rang einem Bewunderung ab – wie eine feinziselierte Urne. Heute trug Patta, dem Beginn der kühleren Jahreszeit entsprechend, einen grauen Kaschmiranzug, und zwar von so elegantem Schnitt, dass, hätten sie gewusst, was aus ihrer Wolle einmal werden sollte, ganze Scharen seltener und vom Aussterben bedrohter Kaschmirziegen sich darum geprügelt hätten, als Erste geschoren zu werden. Ein blendend weißes Baumwollhemd unterstrich die anhaltende Bräune in seinem Gesicht.
An manchen Tagen konnte Brunetti sich kaum die Bemerkung verkneifen, was für ein schöner Mann Patta doch sei. Aber mit Rücksicht darauf, wie angespannt die Beziehung zwischen ihm und seinem Vorgesetzten ohnehin schon war und wie sehr Patta dazu neigte, alles Mögliche misszuverstehen, begnügte er sich mit einem Lächeln und einem freundlichen »Guten Morgen, Vice-Questore«.
Betont gleichgültig wandte Signorina Elettra sich wieder ihrem Computer zu, der ihre Aufmerksamkeit weit mehr erforderte als das Gespräch der beiden. Es schien geradezu, als sei sie kleiner geworden, eine Taktik, die Brunetti mit Bewunderung und Neid erfüllte.
Patta ging ins Büro zurück, wobei er Brunetti über die Schulter zuwarf: »Kommen Sie rein.«
Brunetti hatte im Lauf der Jahre ein dickes Fell entwickelt und ließ sich auch jetzt nicht von Pattas Gebaren aus der Ruhe bringen. Ungenierte Missachtung, keinerlei [18] Respekt vor Mitmenschen, die er als untergeordnet betrachtete: Dergleichen konnte Brunetti nicht mehr schrecken. Übergriffe oder die Androhung von Übergriffen, das hätte ihn vielleicht noch gekränkt oder geärgert, aber solange Patta nicht aktiv wurde und es bei passiver Respektlosigkeit beließ, blieb Brunetti gelassen.
»Setzen Sie sich«, sagte Patta und nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. Er schlug die Beine übereinander, doch dann fielen ihm offenbar die Bügelfalten wieder ein, und er machte das gleich wieder rückgängig. Der Vice-Questore sah in das unbeteiligte Gesicht seines Untergebenen und fragte: »Sie wissen, worum es geht?«
»Nein, Signore«, sagte Brunetti betont ahnungslos.
»Eine wichtige Angelegenheit«, sagte Patta und wandte den Blick ab. »Der Sohn des Bürgermeisters.«
Brunetti verkniff sich die Frage, wie man den Sohn des Bürgermeisters, der als ziemlich unbegabter Anwalt galt, für wichtig halten könne. Stattdessen gab er sich Mühe, den Offenbarungen des Vice-Questore mit neugieriger Miene entgegenzusehen, und begnügte sich mit einem neutralen Nicken.
Wieder schlug Patta die Beine übereinander. »Genau genommen geht es ihm um einen Gefallen für die Verlobte seines Sohns. Das Mädchen – die junge Frau – besitzt ein Geschäft. Na ja, sie besitzt es zur Hälfte. Sie hat einen Partner. Und der Partner hat etwas getan, das rechtlich vielleicht nicht ganz zulässig sein könnte.« Patta unterbrach sich, entweder um Luft zu holen, oder um sich zu überlegen, wie man sich von »rechtlich nicht ganz zulässig« zur Bestechung eines städtischen Beamten hinüberhangeln konnte. Brunetti [19] hielt sich bedeckt und wartete ab, welchen Kurs Patta einschlagen würde.
Der Vice-Questore wählte den Pfad der Tugend oder zumindest das, was er darunter verstand. »Der Partner hat die Vigili über einen längeren Zeitraum dazu bewogen, die Verkaufstische vor dem Laden zu ignorieren.« Patta verstummte, nachdem er mit dem Wort »bewogen« seinen Vorrat an Aufrichtigkeit aufgebraucht hatte.
»Wo ist dieses Geschäft?«, fragte Brunetti.
»Auf dem Campo San Barnaba. Der Maskenladen.«
Brunetti schloss die Augen und tat so, als krame er in seinem Gedächtnis. »Neben dem teuren Käseladen?«
Patta fuhr auf, als habe er Brunetti bei dem Versuch erwischt, ihm seine Brieftasche zu stehlen. »Woher wissen Sie das?«, herrschte er ihn an.
Doch Brunetti ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Ich wohne in der Nähe, Signore, und komme oft über den campo«, erklärte er mit gelassenem Lächeln. Da Patta schwieg, fuhr er fort: »Aber ich verstehe nicht recht, was Sie damit zu tun haben, Signore.«
Patta räusperte sich. »Wie gesagt, es ist ihr Partner, der an die Vigili herangetreten ist, und dass er sie dazu veranlasst haben könnte, die Tische vor dem Laden zu ignorieren, ist dieser jungen Frau erst jetzt klargeworden.«
Angesichts von Brunettis leerer Miene ergänzte Patta: »Möglicherweise verfügen sie nicht über alle nötigen Genehmigungen zum Aufstellen dieser Tische.«
Bei Ausdrücken wie »veranlasst« und »möglicherweise« fragte sich Brunetti, zu welchen Methoden er greifen musste, damit Patta das Wort »Bestechung« in den Mund nahm. [20] Pattas Hand über eine Flamme halten? Drohen, ihm ein Ohr abzureißen? Und wollte Patta nicht mal endlich den Namen dieses Partners nennen?
»Sie haben doch Freunde, die dort arbeiten?«, fragte der Vice-Questore.
»Wo, Signore?«, fragte Brunetti, unsicher, ob Patta die für die Genehmigungen zuständige Dienststelle meinte und, falls ja, warum der Bürgermeister nicht einfach selbst die paar Meter im Rathaus zurücklegte und die schmutzige Arbeit für seinen Sohn erledigte.
»Bei den Vigili natürlich«, sagte Patta etwas ungehalten. »Das sind alles Venezianer, also müssen Sie die kennen.« Auch wenn Patta schon länger als zehn Jahre in Venedig arbeitete, sah er sich immer noch als Sizilianer, und es gab keinen in der Questura, der ihm da widersprochen hätte.
»Einige von ihnen kenne ich, Dottore«, sagte Brunetti. Plötzlich war er der Unterhaltung müde. »Was soll ich tun?«
Patta beugte sich vor und antwortete leise: »Sprechen Sie mit ihnen.«
Brunetti nickte in der Hoffnung, Patta durch Schweigen weitere Informationen zu entlocken.
Sein Vorgesetzter kam anscheinend von selbst darauf, dass seine Anweisungen nicht allzu präzise waren. »Finden Sie heraus, ob die beteiligten Vigili vertrauenswürdig sind.«
»Ah«, gestattete Brunetti sich zu sagen, ohne sich seine Belustigung über Pattas Wortwahl anmerken zu lassen. Vertrauenswürdig? Nicht zu verraten, dass sie vom Geschäftspartner der zukünftigen Schwiegertochter des Bürgermeisters Bestechungsgelder angenommen hatten? Vertrauenswürdig? Offenbar bemerkte Patta nicht, dass diese Frage viel eher auf [21] den Bürgermeister, dessen Sohn oder die Verlobte seines Sohns hätte Anwendung finden sollen.
Schweigen senkte sich über den Raum. Eine Minute verging, viel Zeit, wenn zwei Männer sich gegenübersitzen. Brunetti fühlte Trotz in sich aufsteigen: Wenn Patta etwas von ihm wollte, sollte er ihn offen darum bitten.
Irgendwie musste sich das Patta mitgeteilt haben, denn schließlich sagte er: »Ich will wissen, ob die Gefahr besteht, dass dies an die Öffentlichkeit gelangt, ob folglich dieses Mädchen ihn in Schwierigkeiten bringen könnte.« Er rutschte auf seinem Stuhl herum und fügte hinzu: »Wir leben in unsicheren Zeiten.«
Das also war es: Das Mädchen könnte den Bürgermeister – der sich in einem Jahr zur Wiederwahl stellen wollte – in Schwierigkeiten bringen. Es ging nicht um die Gesetze, es ging um eine weiße Weste und Wahlchancen. In einem Land, wo niemand ohne Sünde war, fürchtete jeder den ersten Stein, zumal wenn die Hand, die ihn warf, in einem Uniformärmel steckte. Wenn dies erst einriss, war der nächste Stein aus Richtung der Guardia di Finanza nicht weit.
»Aber wie soll ich das herausfinden?«, erkundigte Brunetti sich höflich, als hätte er sich das nicht längst zurechtgelegt.
»Sie sind Venezianer, Himmel noch mal. Sie können mit diesen Leuten reden. Die vertrauen Ihnen.« Dann beiseitegesprochen wie auf der Bühne: »Ihr haltet doch wie Pech und Schwefel zusammen, ihr Venezianer. Ihr regelt so was untereinander, und auf eure Weise.«
Und das, dachte Brunetti, von einem Sizilianer. »Ich werde sehen, was ich tun kann«, sagte er und erhob sich.
[22] Als Brunetti über die Schwelle kam, zog Signorina Elettra fragend eine Augenbraue hoch. Brunetti tat es ihr nach, mit beiden Brauen, und bedeutete ihr mit einer kreiselnden Handbewegung, gelegentlich zu ihm nach oben zu kommen. Und während Elettra weiterhin unverwandt ihren Bildschirm anstarrte, verließ Brunetti den Raum.
Er sah im Bereitschaftsraum vorbei und bat Pucetti, mit nach oben zu kommen. Nachdem der junge Polizist vor Brunettis Schreibtisch Platz genommen hatte, begann der Commissario: »Haben Sie viel mit den Vigili zu tun?«
Er beobachtete, wie Pucetti den Grund für diese Frage zu erforschen suchte, und das gefiel ihm. »Mein Cousin Sandro ist einer, Signore. Und sein Vater war einer, bis zu seiner Pensionierung.«
»Stehen Sie den beiden nahe?«, fragte Brunetti.
»Sie gehören zur Familie, Signore«, sagte Pucetti.
»Vertraut genug, dass Sie sich bei ihnen wegen möglicher Bestechung umhören könnten?«
»Sandro ja«, sagte Pucetti nach einigem Zögern, »mein Onkel nein.«
»Weil Sie ihn nicht fragen können«, hakte Brunetti nach, »oder weil er es Ihnen nicht sagen würde?«
»Von beidem etwas, Signore. Aber vor allem, weil er es mir nicht sagen würde.«
»Wie lange war er bei den Vigili?«
»Vierzig Jahre, Signore. Bis zum Schluss.«
»Dann sind Sie also eine Polizistenfamilie?«, fragte Brunetti schmunzelnd.
»So könnte man es nennen, Dottore. Sandros Bruder Luca ist bei der Guardia Costiera.«
[23] »Sonst noch jemand?«
»Nein, Signore.« Lächelnd fügte Pucetti hinzu: »Meine Mutter hat einen Deutschen Schäferhund. Zählt das auch?«
»Eher nicht. Es sei denn, er ist zum Aufspüren von Bomben oder Drogen ausgebildet.«
Pucettis Lächeln wurde breiter. »Ich fürchte, er kann nur Futter aufspüren, Dottore.« Dann fragte er: »Was möchten Sie über die Vigili wissen, Signore?«
»Es geht um das Maskengeschäft am Campo San Barnaba. Um die Tische vor diesem Laden. Wie ich höre, haben die Vigili sich nie darum gekümmert.«
Pucetti sah weg, zweifellos auf der Suche nach dem Laden auf seinem inneren Stadtplan. Dann sah er wieder Brunetti an. »Ich werde Sandro fragen, Signore.«
Brunetti dankte Pucetti und schickte ihn in den Bereitschaftsraum zurück. Mit einem Blick auf die Uhr stellte er fest, dass es längst Zeit für einen Kaffee in der Bar an der Brücke war. Mit Signorina Elettra konnte er nachher immer noch reden.
[24] 3
Um nicht weiter über Pattas Ansinnen zu brüten, ging Brunetti nach unten und fragte Vianello, ob er auf einen Kaffee mitkommen wolle. Der Ispettore klappte sofort die Akte zu, in der er gelesen hatte, und kam mit. Seite an Seite spazierten sie die riva entlang, wobei sie immer wieder entgegenkommenden Passanten ausweichen mussten. Vianello erzählte von seinem Urlaub, den er auf November verschoben hatte und jetzt zu organisieren versuchte.
In der Bar begrüßten sie Sergio, den Besitzer, der nur noch wenige Tage in der Woche dort arbeitete. Sie bestellten zwei Kaffee an der Theke; während sie warteten, zog Vianello eine Broschüre aus der Tasche und klappte sie vor Brunetti auf. Der sah einen breiten Streifen weißen Sand, die üblichen Palmen darüber und in der Ferne die ebenso weißen Strände kleiner Inseln.
»Wo ist das?«, fragte Brunetti und wies auf die Palmen.
»Das sind die Seychellen«, antwortete Vianello, gerade als Sergio ihnen den Kaffee brachte. Vianello riss ein Tütchen Zucker auf und schüttete den Inhalt in seine Tasse. »Nadia möchte dort hin.«
»Du klingst wenig begeistert«, sagte Brunetti, während er seinen Kaffee umrührte.
»Stimmt.«
»Aber du hast den hier«, sagte Brunetti, leckte seinen Löffel ab und klopfte damit auf den Prospekt.
»Den hat Nadia besorgt«, stellte Vianello klar.
[25] »Und du hast ihn bei dir.«
Vianello nahm einen Schluck Kaffee, schwenkte die Tasse zweimal herum und trank aus. Er stellte die Tasse auf den Unterteller und sagte: »Ich habe ihn bei mir, aber ich habe auch die Quittung für das Hotel in Umbrien bei mir, das wir für die ersten zwei Novemberwochen reserviert haben.«
»Kannst du die Reservierung rückgängig machen?«, fragte Brunetti.
Vianello zuckte die Schultern. »Wahrscheinlich. Nadia ist mit dem Besitzer zur Schule gegangen, und er weiß, wie verrückt meine Dienstzeiten sein können. Aber ich wollte, dass die Kinder es sehen.«
»Gibt’s da einen bestimmten Grund?«, fragte Brunetti.
»Das Hotel ist ein richtiger Bauernhof. Nicht so einer, wo sie einen Esel herumstehen haben und Äpfel verkaufen, mit denen man ihn füttern kann«, sagte Vianello verächtlich. »Die haben Kühe und Schafe und Hühner, all die Tiere, von denen meine Kinder glauben, dass es sie nur im Fernsehen gibt.«
»Na komm, Lorenzo«, lächelte Brunetti, »dafür sind sie doch schon ein wenig zu alt.«
Vianello grinste. »Ich weiß. Aber die Tiere könnten genauso gut nur im Fernsehen existieren. Woher sollen Stadtkinder über Tiere Bescheid wissen oder darüber, wie man ein Feld bestellt?«
»Du hältst das für wichtig?«, fragte Brunetti.
»Und ob«, sagte Vianello vielleicht etwas zu heftig. »Überall wird uns doch erzählt, wir müssten Achtung vor der Natur haben, aber wenn Kinder sie nie zu sehen bekommen, wie sollen sie dann Achtung vor ihr haben? Denen setzt das Fernsehen doch nur Flausen in den Kopf.«
[26] »Das scheint mir die Aufgabe des Fernsehens zu sein«, bemerkte Brunetti.
»Was?«
»Den Leuten Flausen in den Kopf zu setzen.« Er wechselte das Thema. »Also, was wirst du nun machen?« Er kannte Vianellos Frau und war überrascht über ihr Fernweh. »Bist du sicher, dass Nadia wirklich auf die Seychellen will?«
Vianello bat Sergio um ein Glas Leitungswasser und antwortete erst, als der Barmann es vor ihn hinstellte: »Sie hat den Prospekt mitgebracht und gesagt, es wäre wunderbar, mal aus der Kälte fortzukommen.« Er trank das Glas aus und stellte es wieder hin. »Hört sich das nicht ziemlich eindeutig an?«, fragte er, ohne Brunetti dabei anzusehen.
»Wirst du mir den wahren Grund verraten?«, fragte Brunetti, nicht nur zu Vianellos Überraschung, sondern womöglich auch zu seiner eigenen. »Warum du nicht willst?« Er kam Vianellos Protest zuvor: »Ich weiß, ich weiß, die Kinder sollen die Natur kennenlernen.«
Vianello nahm sein Glas und wunderte sich, dass es leer war. Er legte zwei Euro auf die Theke und wandte sich zum Gehen.
Sie schlenderten zur Questura zurück. Brunetti, zufrieden damit, dass er die Frage gestellt hatte, ließ seinem Freund Zeit für die Antwort. Ein Boot tuckerte vorbei, im Bug ein braungesprenkelter Hund, der vor Freude am Fahrtwind bellte.
»Wir sollten so etwas nicht tun«, sagte Vianello schließlich.
[27] »Was denn?«
»So weit reisen«, sagte Vianello. »Nur um im Sand zu liegen und aufs Meer zu schauen, meine ich.« Das Gebell wurde leiser, und Vianello sprach weiter. »Wenn du als Neurochirurg irgendwohin musst, um ein Leben zu retten, dann nimm ein Flugzeug, und flieg hin. Aber nicht, um am Strand zu liegen. Das ist nicht richtig.« Und dann fiel ihm noch ein: »Außerdem ist Sonne ungesund.«
Sie gingen ein Stück weiter.
»Richtig für einen Umweltschützer?«, fragte Brunetti, der Vianellos Eifer einen kleinen Dämpfer versetzen wollte.
»Ja«, gab Vianello zu.
Brunetti blieb stehen. Er legte die Unterarme auf das Metallgeländer am Kanal und sah zum schiefen Turm der griechischen Kirche hinüber. Wieder erschien von rechts ein Boot, fuhr an ihnen vorbei, dann an der Questura und drehte schließlich ab.
Während er dem Boot nachsah, dachte Brunetti über Vianellos Gebrauch des Wortes »richtig« nach. Das Boot war ziemlich klein und hatte offenbar keine Fracht an Bord, also fuhr der Mann vermutlich nur zum Vergnügen nach Castello, um dort mit Freunden zu trinken und Karten zu spielen. Wie jedes noch so kleine Motorboot hinterließ auch dieses eine Ölspur im Wasser und trug so zur weiteren Verschmutzung und letztlich zum Tod der laguna bei. Wäre der Ausflug dieses Mannes nach Vianellos Wertesystem als »nicht richtig« einzustufen, oder musste dabei auch die Größenordnung berücksichtigt werden? Oder, wie Vianello gesagt hatte, die Notwendigkeit? Wie viel können wir tun, ehe es falsch wird?
[28] Die Priester, erinnerte er sich, hatten ihm und seinen Freunden beigebracht, Völlerei sei eine Todsünde, aber was genau darunter zu verstehen sei, hatte Brunetti nie begriffen. Das heißt, natürlich war ihm klar, dass es »zu viel essen« bedeutete, aber er hatte nie verstanden, wo dieses »zu viel« anfing. Wie konnte es unrecht sein, die Mutter um eine zweite Portion ihrer sarde in saor zu bitten? Ab welcher Sardine wurde das Vergnügen zur Sünde? Dieses unlösbare Rätsel hatte den jungen Brunetti auf die Vermutung gebracht, für Priester sei Genuss schlechthin mit Sünde gleichbedeutend, und damit war die Sache für ihn erledigt.
»Nun?«, fragte Vianello, als das Boot verschwunden war und Brunetti immer noch nichts gesagt hatte.
»Ich finde, ihr solltet nach Umbrien fahren.«
»Und meine Begründung dafür?«, fragte Vianello.
»Die ist vollkommen berechtigt«, antwortete Brunetti, indem er sich vom Geländer abstieß und Richtung Questura ging.
Vianello blieb zurück; als er keine Schritte hörte, blieb Brunetti stehen, drehte sich nach Vianello um und hob fragend das Kinn.
»Findest du es berechtigt, oder stimmst du mir zu?«, wollte Vianello wissen.
»Ich finde es berechtigt, und ich stimme dir zu«, sagte Brunetti, ging zu Vianello zurück und klopfte ihm auf die Schulter. »Ich weiß zwar nicht, was der Planet oder das Universum davon haben könnte…«, fing er an, brach dann aber ab.
»Aber?«, fragte Vianello.
»Aber wenn ihr nicht auf die Seychellen fliegt, vermeidet ihr etwas Schädliches, und das ist eine gute Sache.«
[29] Vianello lächelte: »So habe ich das noch nicht gesehen. Ich wusste nur, dass es nicht richtig ist.« Und dann: »Außerdem wollte ich immer schon mal lernen, wie man eine Kuh melkt.«
Brunetti blieb abrupt stehen. Er sah Vianello prüfend an. Schließlich sagte er: »Du meinst das wirklich ernst, ja?«
»Ja, sicher«, sagte Vianello.
Brunetti wandte sich wieder in die Richtung der Questura und bemerkte über die Schulter: »Du hast den Kaffee bezahlt, also werde ich Signorina Elettra nicht verraten, was du gesagt hast.«
[30] 4
Da Brunetti sowieso an ihrem Büro vorbeimusste, beschloss er, Signorina Elettra den Weg zu sich hinauf zu ersparen; außerdem konnte er es nicht erwarten, etwas über die Hintergründe von Pattas Ansinnen zu erfahren. Er nahm sich vor, Wort zu halten und ihr nichts von Vianellos bukolischen Träumereien zu erzählen.
Sie begrüßte ihn mit einem entspannten Lächeln. Offenbar führte der Vice-Questore seinen Kampf gegen das Verbrechen momentan außer Haus.
»Was haben Sie über den Sohn des Bürgermeisters gefunden?«, fragte Brunetti, sicher, dass sie Erkundigungen angestellt hatte.
Sie strich sich eine verirrte Strähne aus der Stirn, drehte den Monitor in seine Blickrichtung und wies auf das abgebildete Formular. »Wie Sie sehen, hat er acht Jahre gebraucht, sein Studium zu beenden, und weitere drei bis zum Abschluss der staatlichen Prüfungen.«
»Und jetzt?«, fragte Brunetti.
»Arbeitet er in der Anwaltskanzlei eines Freundes seines Vaters.«
Sie sprang zu einem anderen Dokument und zeigte darauf. »Er hat auch einen Job als Regionalberater.«
»Was macht er da?«, fragte Brunetti, aber dann bedachte er, dass es sich um ein politisches Amt handelte, und korrigierte sich: »Was wäre seine Funktion?«
»Er fungiert als Verbindungsmann zwischen Studenten [31] und dem Regionalamt für Sport.« Ihr Tonfall war so offiziell, als sei sie von Ärzte ohne Grenzen.
»Was bedeutet das?«, fragte Brunetti mit echter Neugier.
Sie tippte etwas ein und drückte auf Enter: Ein neues Dokument erschien auf dem Bildschirm. Oben stand der Name des jungen Mannes, darunter eine Reihe Zahlen.
»Und was ist das?«, fragte Brunetti.
»Das Gehalt, das ihm die Regionalverwaltung vorigen Monat auf sein Konto überwiesen hat.« Sie drehte den Bildschirm noch weiter in Brunettis Richtung.
Das Grundgehalt des jungen Mannes betrug viertausendvierhundert Euro monatlich; dazu kamen ein Pauschalbetrag von neunhundert Euro für Bürokosten und neunzehnhundert für eine Sekretärin.
»Haben Sie den Namen der Sekretärin?«, fragte Brunetti.
»Lucia Ravagni«, antwortete Signorina Elettra.
»Ist sie rein zufällig Mitinhaberin eines Geschäfts am Campo San Barnaba?«, fragte er, als sei dies eine plötzliche Eingebung.
»Ja.«
»Wenn er Anwalt ist und sie ein Geschäft betreibt – wann haben die beiden dann Zeit, als Regionalberater und Sekretärin zu fungieren? Und wo?«, fragte Brunetti.
»Den beiden ist ein Büro in den Uffici Regionali zugeteilt.«
»›Zugeteilt‹?«
»Ein Freund von mir, der dort im zweiten Stock arbeitet – das Büro der beiden ist im ersten –, hat mir erzählt, dass sie sich nur selten blicken lassen.«
»Zweifellos, weil sie von Sportereignissen in Beschlag genommen werden«, meinte Brunetti.
[32] »Oder von Studenten«, ergänzte sie so unbeschwert, wie sie auf die vielen Absurditäten des Lebens zu reagieren pflegte. Dann aber fragte sie plötzlich ernst: »Warum nehmen wir das hin? Warum lassen wir diese Leute ihre Freunde und Ehefrauen und Kinder mit Jobs versorgen und gehen nicht mit Knüppeln auf sie los?«
Brunetti entschloss sich, wie er es immer häufiger tat, ihren Ausbruch ernst zu nehmen. »Vermutlich deshalb, weil wir tolerant sind und Verständnis für menschliche Schwächen haben. Und weil für die meisten von uns die einzigen Menschen, denen wir voll und ganz vertrauen, unsere Familien sind und wir nachfühlen können, wenn es anderen ähnlich ergeht.«
»Vertrauen Sie Ihrer Familie?«, fragte Elettra ungewohnt neugierig.
»Ja.«
»Jedem Einzelnen?«
»Mehr als dem Staat und den meisten seiner Vertreter.« Dann, um zu verhindern, dass er – oder vielleicht sie beide – zu persönlich wurde, erklärte Brunetti: »Ich möchte Sie bitten, so viel wie möglich über die beiden herauszufinden.«
»Ich werde mich umhören«, antwortete sie.
Im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass Signorina Elettra offiziell keine Polizeiarbeit machte und keinen Amtseid abgelegt hatte und daher von polizeilichen Ermittlungen eigentlich gar nichts wissen durfte, sagte Brunetti: »Der Bürgermeister verlangt von Patta, dafür zu sorgen, dass nichts von den Schmiergeldern, die der Geschäftspartner seiner Schwiegertochter an die Vigili gezahlt hat, ruchbar wird.«
[33] Sie drückte eine Taste, und der Bildschirm wurde schwarz. Müßig drehte sie ihn wieder zu sich her, ohne den Blick von Brunetti abzuwenden. »Möchte wissen, was da dahintersteckt.«
»Sie sagen es.«
Als staune sie selbst über ihre Erkenntnis, sagte sie: »Es hat etwas so Bestechendes wie ein logisch richtiger Schluss, wie gierig ich darauf bin, mich in die Arbeit zu stürzen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich wünsche Politikern Unheil an den Hals. Der Bürgermeister ist Politiker. Also wünsche ich dem Bürgermeister Unheil an den Hals.« Sie strahlte geradezu. »Das hat doch etwas Zwingendes, oder?«, fragte sie.
»Von der Logik her ist das hieb- und stichfest«, sagte Brunetti, der dieses Fach als Student geliebt hatte. Dann ernst: »Aber hier geht es um Gefühle, nicht um Fakten, also bin ich mir nicht sicher, ob die Logik Anwendung findet. Oder als Beweismittel taugt.«
Nüchtern gab sie zurück: »Aber am Tatbestand besteht kein Zweifel, Dottore: weder an der ersten Prämisse noch an der zweiten, und ganz bestimmt nicht an der Schlussfolgerung.« Dann leichthin: »Sie hören von mir, wenn ich was gefunden habe.«
Was steckt dahinter. Was steckt dahinter. Was steckt dahinter, fragte sich Brunetti, während er die Stufen zu seinem Büro hinaufging. Und auf den letzten Stufen: Dahinter, dahinter, dahinter. Warum machte sich der Bürgermeister Patta zum Handlanger, um die Sache zu vertuschen? Je mehr Leuten man sagt, sie sollen etwas nicht ausplaudern, desto [34] größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Sache sich herumspricht. Oder glaubte der Bürgermeister, wie so viele seiner Kollegen, über alle Regeln des menschlichen Miteinanders erhaben zu sein? Warum sonst unterhielten sich Politiker nach wie vor selbstherrlich am Handy über ihre Verbrechen und Verfehlungen, wo sie doch längst mitbekommen haben müssten, dass alle möglichen staatlichen Organe mithörten? Warum verhandelten sie am Telefon über Bestechungssummen? Warum gaben sie Prostituierten Tausende von Euro und behaupteten, wenn sie erwischt wurden, sie hätten die Frauen mit dem Geld vor dem Abgleiten in die Prostitution bewahren wollen? Für wie dumm halten die uns? Wie sehr verachten sie uns?
Aber nicht alle Politiker konnten so sein. Sonst, dachte Brunetti, blieben einem anständigen Bürger nur zwei Möglichkeiten: Auswandern oder Selbstmord.
Das Telefon klingelte, als er in sein Büro kam. In der Annahme, es sei Patta, der unvermutet in die Questura zurückgekommen war, meldete er sich mit seinem Namen.
»Erinnerst du dich an den Jungen, der nicht sprechen kann?«, fragte Paola. »Den von der chemischen Reinigung?«
In Gedanken noch bei Patta und Politikern, bekam Brunetti nur heraus: »Was?«
»Der Junge, der in der chemischen Reinigung gearbeitet hat. Der Taube.« Er hörte an ihrer Stimme, dass sie durcheinander war, brauchte aber einen Moment, sich an den Jungen zu erinnern, der manchmal im Hinterzimmer des Ladens zu sehen war, wo er Sachen faltete oder untätig herumstand und mit dem Kopf wackelte, während sein Blick dem Bügeleisen folgte, das Hemden und Kleider wieder in Form brachte. [35] Über seine seltsame Motorik hinaus wusste Brunetti kaum etwas von dem Jungen.
»Ja«, sagte er schließlich. »Warum?«
»Er ist tot«, sagte Paola traurig, schränkte dann aber ein: »Jedenfalls erzählt man sich das in der Nachbarschaft.«
»Was ist passiert?«, fragte Brunetti und überlegte, was für ein Unheil, womöglich in Zusammenhang mit seiner Taubheit, dem Jungen widerfahren sein mochte. Viele Lieferanten, die ihre Metallkarren durch die Stadt schoben, scheuchten die Fußgänger mit lauten Rufen aus dem Weg: Vielleicht hatte einer den Jungen, der nichts hören konnte, über den Haufen gerannt und zerquetscht. Oder eine Brückentreppe hinuntergestoßen, oder ins Wasser.
»Beim Kaffee in der Bar erzählte jemand, er habe heute früh ein Rettungsboot vorm Haus gesehen; später seien sie mit so einem Plastikbehälter rausgekommen. Der Mann wusste, in dem Haus wohnt dieser taube Junge, und fragte nach. Aber man sagte ihm nur, es sei jemand aus der ersten Etage, männlich.« Schließlich fragte sie: »Da drin werden doch Tote transportiert, oder?«
Brunetti, der diese Behälter nur zu gut kannte, bestätigte das.
Nach langem Schweigen sagte Paola: »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Die Bemerkung verwirrte Brunetti. Wenn der Junge tot war, konnte weder sie noch sonst jemand etwas tun. »Ich verstehe nicht.«
»Seine Familie. Was ich für die tun kann.«
»Kennst du die Familie überhaupt?«
»Sind das nicht die Leute von der Reinigung?«
[36] Kaum begann Brunetti sich zu ärgern, dass man ihm die Zeit stahl, schämte er sich auch schon. Sollte er seiner Frau übertriebenes Mitleid vorwerfen? »Ich weiß nicht. Habe nie darauf geachtet.«
»Es kann nicht anders sein«, sagte Paola. »Als Mitarbeiter war er kaum zu gebrauchen. Ich habe immer gedacht, er ist der Sohn der Inhaberin, oder vielleicht von der Frau, die hinten am Bügeleisen steht. Kein anderer hätte ihn eingestellt.« Und dann sagte sie noch: »Obwohl ich ihn schon lange nicht mehr dort gesehen habe. Was mag da nur passiert sein?«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte Brunetti. »Fragen kann man wohl nicht?«
»Nein. Nein.«
»Vielleicht den Zeitungsverkäufer?«
»Du weißt, dass ich den nicht ansprechen kann«, sagte Paola.
Vor vier Jahren waren Paola und der Zeitungshändler heftig aneinandergeraten, nachdem sie ihn gefragt hatte, warum er eine gewisse Zeitung verkaufe, und er geantwortet hatte, er tue das, weil die Leute danach verlangen. Paola, die sich in solchen Dingen bekanntermaßen nicht zu mäßigen wusste, hatte gekontert, ob er mit derselben Entschuldigung auch Drogen verkaufen würde, dann hatte sie das Geld für ihre Zeitungen hingelegt und war gegangen.
Als sie Brunetti beim Abendessen davon erzählte, hatte der sie darüber aufgeklärt, dass der Sohn dieses Mannes vor einigen Jahren an einer Überdosis gestorben war, was ihr Tränen der Scham in die Augen trieb. Am nächsten Tag war sie hingegangen, um sich zu entschuldigen, aber der Mann [37] hatte ihr den Rücken zugedreht und weiter ein Zeitungspaket aufgeschnürt. Seitdem musste Brunetti die Zeitung holen.
»Kannst nicht du am Kiosk fragen? Oder sonst jemanden in der Nachbarschaft?«, fragte sie.
Bevor er einwilligte, wollte Brunetti wissen: »Ist das bei dir Neugier oder Anteilnahme?«
»Anteilnahme«, erwiderte sie prompt. »Er war so eine Jammergestalt. Ich weiß nicht mal, seit wann ich ihn kenne. Ihn auf der Straße bemerkt habe. Oder in diesem Hinterzimmer, wo er Kleider gefaltet oder den anderen bei der Arbeit zugesehen hat. Und wie furchtbar traurig er immer gewirkt hat.«
Brunetti sah wieder die eigenartige Motorik des Jungen vor sich, die seltsamen Kopfbewegungen, die darauf schließen ließen, dass er außer seiner Taubheit noch ernstere Probleme hatte, die ihn von der Welt abschnitten.
»Hat sonst noch was nicht gestimmt mit ihm?«, fragte er.
»Wie meinst du das? Reicht es nicht, taubstumm zu sein?«
»Stumm war er auch?«
»Hast du ihn jemals sprechen hören?«
»Nein«, räumte Brunetti ein. »Wie gesagt, ich habe ihn kaum beachtet.«
Paola seufzte. »Ich fürchte, genau das werden die meisten sagen. Ist das nicht schrecklich?«
»Allerdings.«
»O mein Gott«, begann Paola wieder. »Ich weiß nicht mal seinen Namen, falls ich mich nach ihm erkundigen will. Er ist bloß der Junge, der nicht spricht. Nicht gesprochen hat.«
[38] »Ich denke, die Leute werden wissen, wen du meinst.«
»Davon rede ich nicht, Guido«, sagte sie – Worte, die gewöhnlich in wütendem Ton ausgestoßen wurden, jetzt aber nur traurig klangen. »Das ist ja das Schreckliche. Überleg mal, wie alt er gewesen sein muss. Fünfunddreißig? Vierzig? Älter? Und wir alle haben ihn immer nur der Junge genannt.« Und dann: »Der Junge, der nicht spricht.«
»Ich frage unten mal nach, ob die was wissen«, versprach Brunetti. »Und im Krankenhaus.«