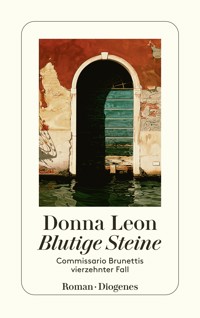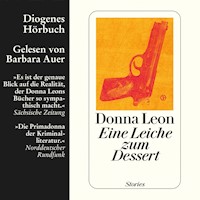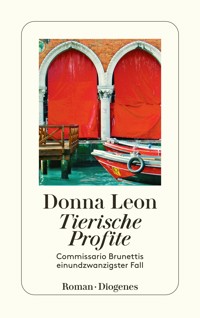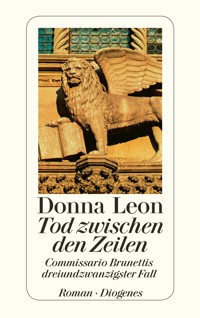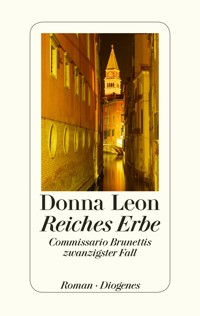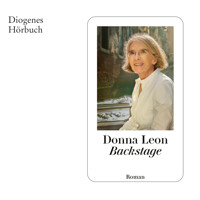11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Samstagabend auf dem Campo Santa Margherita. Nach einem Drink lassen sich zwei Touristinnen von ein paar Einheimischen zu einer Spritztour in die Lagune verführen. In der Dunkelheit rammt das Boot einen Pfahl, und die Amerikanerinnen enden bewusstlos auf dem Steg des Ospedale. Warum alarmierten ihre Begleiter nicht die Notaufnahme, wenn alles nur ein Unfall war? Je hartnäckiger Brunetti ermittelt, desto näher kommt er einem Monstrum, vor dem sich selbst die Mafia fürchtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Donna Leon
Flüchtiges Begehren
Commissario Brunettis dreißigster Fall
Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz
Diogenes
Für Romilly McAlpine
The depths have covered them:
they sank into the bottom as a stone.
Die Tiefe deckte sie,
sie sanken hinab zum Abgrund wie ein Stein.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL,
ISRAEL IN ÄGYPTEN
1
Brunetti schlief aus. Gegen neun drehte er den Kopf nach rechts und öffnete ein Auge, sah auf die Uhr und schloss das Auge wieder, nur noch ein Weilchen liegen bleiben. Als er das nächste Mal auf die Uhr sah, war es halb zehn. Er streckte den linken Arm nach Paola aus, ertastete aber nur noch die längst erkaltete Delle, die seine Frau hinterlassen hatte.
Er drehte sich zur Seite, kam dann ins Sitzen, ruhte kurz von der Anstrengung aus und schlug endlich beide Augen auf. Man sah immer noch diesen braunen Fleck an der Zimmerdecke rechts über dem Fenster, der aussah wie ein kleiner Oktopus, wo vor einigen Monaten Wasser eingedrungen war. Je nach Lichteinfall wechselte er die Farbe, manchmal auch die Form, nur die sieben Tentakel blieben.
Brunetti hatte Paola versprochen, den Fleck zu überstreichen, doch immer war er in Eile, oder es war Abend, und er wollte so spät nicht mehr auf die Leiter, oder er hatte keine Schuhe an und fand es zu riskant, in Socken hochzuklettern. An diesem Morgen störte auch ihn der Fleck, und ihm fiel der Mann ein, der gelegentlich kleinere Arbeiten für sie verrichtete: Den würde er bitten, das endlich zu erledigen.
Oder könnte Raffi nicht – statt vor dem Computer zu sitzen oder mit seiner Freundin zu telefonieren – den Pinsel schwingen und sich ausnahmsweise mal bei seinen Eltern nützlich machen? Brunetti schob Groll und Selbstmitleid beiseite, als ihm die drei Gläser Grappa wieder einfielen, die er am Vorabend getrunken hatte und die womöglich für seine wehleidige Verfassung verantwortlich waren.
Einmal im Jahr traf er sich mit ein paar Schulkameraden vom liceo zum Essen in einem Restaurant an der Riva del Vin, wo der diensteifrige Inhaber ihnen jedes Mal denselben Ecktisch mit Blick auf den Kanal reservierte, so auch gestern.
Ihre Schar von ursprünglich dreißig war im Lauf der Jahre auf zehn geschrumpft. Einige waren der Unbequemlichkeiten des Lebens in Venedig überdrüssig geworden und anderswo hingezogen; andere hatten bessere Arbeit in anderen Gegenden Italiens oder Europas gefunden, manche waren krank und zwei gestorben.
Zu dem Treffen gestern erschienen neben Brunetti auch die drei anderen langjährigen Organisatoren. Luca Ippodrino war gekommen, der die Trattoria seines Vaters dank simpler Tricks in ein weltberühmtes Restaurant verwandelt hatte: Die Speisekarte war noch dieselbe wie vor dreißig Jahren, nur wurde das, was seine Mutter früher für die Bootsleute am Rialto gekocht hatte, nun auf Porzellantellern in viel kleineren Portionen hübsch dekoriert serviert – zu astronomischen Preisen. Insbesondere während der Biennale und des Filmfestivals war Luca auf Monate ausgebucht.
Auch Franca Righi war da gewesen, Brunettis erste Freundin, die in Rom Physik studiert hatte und jetzt dort unterrichtete. Sie hatte Brunetti immer in Biologie und Physik geholfen und erzählte ihm bei ihren Treffen mit Genugtuung, welche Lehrsätze, die sie damals gepaukt hatten, mittlerweile widerlegt und durch neue ersetzt worden waren.
Und schließlich Matteo Lunghi, ein Gynäkologe, den seine Frau wegen eines wesentlich jüngeren Mannes verlassen hatte. Den ganzen Abend lang hatten sie den frisch Geschiedenen aufmuntern müssen.
Die übrigen sechs waren mehr oder weniger erfolgreich – beziehungsweise zufrieden. Jedenfalls taten sie so vor den Gefährten ihrer Jugendzeit, mit denen sie so viele Ansichten teilten – nicht zuletzt das Gefühl dafür, was sich schickte.
Doch darüber wollte Brunetti jetzt lieber nicht nachdenken; er warf die Decke zurück, ging ins Bad und stieg unter die Dusche.
Das heiße Wasser weckte seine Lebensgeister, und er duschte nach Herzenslust, da niemand da war, der gegen die Wasserverschwendung hätte protestieren können. Wieder im Schlafzimmer, hängte er das Handtuch über eine Stuhllehne und begann sich anzukleiden. Er wählte einen dunkelgrauen Zweiteiler, den er seit dem Winter nicht mehr getragen hatte. Der Kaschmiranzug war für einen Spottpreis zu haben gewesen, als der Herrenausstatter am Campo San Luca vor zwei Jahren schließen musste. Seltsam, dachte er, während er den Knopf ins Knopfloch zwängte: Am Anfang hatte ihm die Hose besser gepasst. Vielleicht war sie in der Reinigung irgendwie eingegangen; bestimmt würde sie im Lauf des Tages wieder weiter.
Er setzte sich auf den Stuhl, zog dunkle Socken und schwarze Schuhe an, die er vor Jahren in Mailand erstanden hatte und die sich seitdem so perfekt an seine Fußform angepasst hatten, dass er jedes Mal genüsslich hineinschlüpfte.
Gestern war es warm gewesen, wunderbares Spätherbstwetter, also verzichtete er auf eine Weste und nahm lediglich das Jackett. In der Küche fand sich kein Zettel von Paola. Es war Montag, da kam sie erst am späten Nachmittag nach Hause, nachdem sie stundenlang in ihrem Büro an der Universität gesessen hatte, vorgeblich, um für die Doktoranden da zu sein, die sie betreute. Tatsächlich kam aber nur selten jemand vorbei, und sie konnte in aller Ruhe lesen oder ihre Seminare vorbereiten. So viel zum Leben der Gelehrten, dachte Brunetti.
Auf dem Weg zur Questura kehrte Brunetti bei Rizzardini ein, bestellte Kaffee und eine Brioche. Zum Abschluss trank er noch einen zweiten Kaffee und ein Glas Mineralwasser. Von Koffein und Zucker beflügelt, brach er um halb elf zum Rialto auf und durchquerte das Zentrum just um die Zeit, da die Einwohner vom Markt heimkehrten und durch Touristen, die sich für venezianischer als die Venezianer hielten, ersetzt wurden, auf der Jagd nach Prosecco oder un’ombra.
Zwanzig Minuten später bog er auf die riva zur Questura ein und betrachtete die gesäuberte und restaurierte Fassade von San Lorenzo auf der anderen Seite des Kanals, keine Kirche mehr, sondern mittlerweile offenbar eine Galerie, die sich für die Rettung der Meere engagierte. Die jahrzehntealte Tafel, auf der der Beginn der endlosen Renovierung vermerkt gewesen war, war ebenso verschwunden wie das von Anwohnern gezimmerte Katzendomizil, das dort seit Urzeiten gestanden hatte.
In der Eingangshalle der Questura sichtete der Commissario seinen Vorgesetzten, Vice-Questore Giuseppe Patta. Instinktiv zückte Brunetti sein telefonino und beugte sich darüber. Er nickte dem Beamten, der ihm die Glastür aufhielt, zwar zu, blieb jedoch, ungeduldig mit seinem Handy hantierend, draußen stehen und meinte schließlich gereizt: »Haben wir hier unten auch keinen Empfang, Graziano?«
Dem Wachhabenden war klar, dass Brunetti zwei Stunden zu spät zur Arbeit erschien und dass der Vice-Questore selten gut auf Brunetti zu sprechen war. »Der Empfang ist schon den ganzen Morgen schlecht, Signore«, sagte er mit einer ausladenden Handbewegung. »Hatten Sie dort hinten einen?«
Brunetti schüttelte den Kopf. »Da ist es auch nicht besser. Macht mich wahnsinnig, diese …« Er brach mitten im Satz ab, als Patta auf ihn zukam. »Guten Morgen, Vice-Questore«, grüßte er und fügte, mit dem Handy wedelnd, dienstbeflissen hinzu: »Versuchen Sie es gar nicht erst da draußen, Dottore. Keine Chance. Nichts funktioniert.«
Er steckte das Handy wieder ein und wies auf die Treppe. »Ich probiere es noch einmal mit meinem Bürotelefon, vielleicht funktioniert das inzwischen wieder.«
Völlig verwirrt, fragte Patta: »Stimmt was nicht, Brunetti?« Pattas Tonfall glich bemerkenswert Brunettis eigenem, wenn seine Kinder ihm früher weismachen wollten, sie hätten ihre Hausaufgaben bereits erledigt.
Wie ein Ankläger, der einem Pressefotografen das Tatwerkzeug präsentiert, hielt der Commissario sein Handy hoch: »Kein Empfang.«
Aus den Augenwinkeln sah er Graziano zustimmend nicken, als habe der Wachhabende mitbekommen, wie Brunetti vergeblich zu telefonieren versucht hatte.
Brunetti nicht weiter beachtend, fragte Patta den Beamten: »Wo bleibt Foa?«
»Er sollte in drei Minuten hier sein, Vice-Questore«, versicherte Graziano mit einem Blick auf seine Uhr; irgendwie gewann er an Format, wenn er mit Patta sprach. Wie herbeigezaubert bog in diesem Augenblick das Polizeiboot in den Kanal ein, glitt an der Kirche vorbei, unter der Brücke hindurch und hielt an der Anlegestelle neben den drei Männern.
Ohne einen Gruß wandte Patta sich dem Boot zu, das ihn mit leise schnurrendem Motor erwartete. Foa warf ein Tau, sprang aufs Pflaster, salutierte und streckte den Arm aus, als gelte es, eine Horde aufdringlicher Reporter abzuwehren. Patta, der alles im Umkreis von einem Meter um sich herum auf sich selbst bezog, benutzte Foas Unterarm als Stütze beim Einsteigen.
Mit einem Lächeln in Richtung seiner Kollegen löste Foa die Leine, sprang über die Bootswand und landete vor dem Steuer. Der Motor brauste auf, das Boot machte eine Spitzkehre und verschwand in der Richtung, aus der es gekommen war.
2
Auf der Treppe zu seinem Büro ging Brunetti seine Geschichte mit dem angeblich schlechten Handyempfang nicht aus dem Kopf. Die Questura war an allen Ecken und Enden nicht in Schuss, Brunettis Erfindung also durchaus glaubwürdig. Die Heizung war ein Witz, pustete im Winter nur schwach mal hier, mal da im Gebäude. Eine Klimaanlage gab es nur in wenigen privilegierten Büroräumen. Die Stromversorgung funktionierte zwar einigermaßen, aber gelegentliche Spannungsspitzen hatten bereits mehrere Computer und einen Drucker zerstört. Die Belegschaft war mittlerweile so leidgeprüft, dass hin und wieder explodierende Glühbirnen nur noch als Vorspiel für das Feuerwerk zu Redentore betrachtet wurden. Auch die sanitären Einrichtungen zickten hin und wieder; das Dach war an zwei Stellen undicht, und die meisten Fenster ließen sich schließen, manche aber nicht öffnen.
Brunetti überlegte, ob er nicht selbst diesem Gebäude glich, hier ein Zipperlein, da ein kleiner Defekt, aber dann gingen ihm die Vergleiche aus. Er nahm die Hand vom Geländer und richtete sich beim Treppensteigen gerader auf.
Oben im Büro warf er die am Campo Santa Marina gekaufte Zeitung auf den Schreibtisch. Er fand es unangenehm warm und öffnete ein Fenster. Die Aussicht, das musste er zugeben, hatte sich verbessert, seit man die Kirche frisch herausgeputzt und das altersschwache Katzendomizil entfernt hatte. Aber die Katzen fehlten ihm doch.
Er nahm sein Handy aus der Tasche und wählte Paolas Nummer. Sie meldete sich erst nach mehrmaligem Läuten: »Sì?« Weiter nichts.
»Ah«, rief Brunetti und erklärte dann mit tiefer Stimme: »Was hört mein Herz für Töne, beglückt von …«
»Was gibt es, Guido?«, unterbrach sie ihn, und dann erklärend: »Ich spreche gerade mit einem meiner Studenten.«
Brunetti hatte sich eigentlich nur erkundigen wollen, was es zum Abendessen geben würde; jetzt sagte er: »Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich dich liebe.«
»Besten Dank«, meinte sie und hängte ein, bevor er zu weiteren Ergüssen ansetzen konnte.
Brunetti schielte nach der Zeitung – mit Sicherheit interessanter als die ungelesenen Rapporte auf seinem Schreibtisch, berichtete sie doch über die Ereignisse in der Welt jenseits des Ponte della Libertà. Wie oft hielt er seinen Kindern ihren Mangel an Neugier vor, nicht nur, was ihr Heimatland betraf, sondern auch darüber hinaus. Wie sollten sie zu verantwortungsvollen Bürgern heranreifen, ohne über ihre Staatsvertreter und Gesetze Bescheid zu wissen sowie die Allianzen, die uns mit Europa und anderen Ländern verbanden?
Noch bevor er den Gazzettino aufschlug, hatte Brunetti eine Eloge auf den Patriotismus entworfen, auf die selbst Cicero stolz gewesen wäre. Die narratio fiel ihm nicht schwer: Seine Kinder interessierten sich nicht für die Politik ihres Landes. Die refutatio war ein Leichtes: Mühelos könnte er die Behauptung vom Tisch fegen, Italien sei eine bloße Marionette von Deutschland und Frankreich. Nach der peroratio, in der er sie beschwor, ihre Verantwortung als Staatsbürger wahrzunehmen, wollte er gerade zum Schluss kommen, als sein Blick auf die Schlagzeile fiel: »Morta la moglie strangolata: Una settimana di agonia.« Also war sie gestorben, die junge Frau, die ihr heroinsüchtiger Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte – nach einer Woche Todeskampf, die Ärmste. Sie hinterließ ein Kind. Wie so oft in solchen Fällen hatten sie kurz vor der Scheidung gestanden. Nun ja.
Dann eine kurze Meldung über zwei junge Amerikanerinnen, die man am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf dem Steg vor der Notaufnahme des Ospedale Civile bewusstlos vorgefunden hatte. Der Artikel nannte ihre Namen. Dann hieß es nur noch, eine der beiden hätte einen gebrochenen Arm gehabt.
Unaufhaltsam wanderte sein Blick zu dem Artikel darunter: Da ging es um die Durchsuchung eines ehemaligen Schweinezuchtbetriebs bei Bassano, wo man bereits die sterblichen Überreste der zwei Ehefrauen des früheren Besitzers – der inzwischen eines natürlichen Todes gestorben war – entdeckt hatte. Und jetzt gab es Reste, die auf eine dritte Frau hinwiesen, die nach Aussage von Nachbarn eine Zeitlang dort gelebt hatte, dann aber plötzlich verschwunden sei.
Es war das Wort »Reste«, das Brunetti aus dem Büro hinaus und die Treppe hinunter ins Freie jagte. Er hielt auf die Bar zu, getrieben allein von dem Wunsch, all das hinter sich zu lassen.
Bamba Diome, der senegalesische Barmann, hatte seinen Arbeitgeber hinter dem Tresen abgelöst. Brunetti brachte nur ein wortloses Nicken zustande. Er sah nach links, die drei Nischen waren besetzt. Umso besser, sagte er sich, schließlich war er nur hier, um kurz aufzutanken. Er studierte die Glasvitrine mit den tramezzini: Die hatte Sergio gemacht, der sie immer noch zu Dreiecken schnitt, während Bamba Rechtecke bevorzugte. Vielleicht eins mit Ei und Tomate? Bamba kam zu ihm und wischte kurz über den Tresen.
»Wasser, Dottore?«
Brunetti nickte. »Und eins mit Tomate und Ei.« Den vor ihm liegenden Gazzettino schob er beiseite. Bamba, dem dies nicht entging, sagte: »Schrecklich, nicht wahr, Dottore?«, und stellte ihm ein Glas Wasser und das tramezzino hin.
»Ja. Schrecklich«, bestätigte Brunetti, auch wenn er nicht wusste, welchen Artikel der Barmann meinte. Bamba sah nach den Nischen, wo jemand die Hand hob, und glitt diensteifrig hinter der Theke hervor.
Brunetti nahm einen Bissen, legte das tramezzino auf den Teller zurück und trank einen Schluck Wasser. Wenn dies mein tägliches Mittagessen sein müsste, dachte er, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Das war kein Essen, nur Treibstoff. Gut waren sie ja, diese tramezzini, aber das änderte nichts daran, dass es bloß tramezzini waren. Wo sollte es hinführen, wenn wir ein Sandwich als Nahrung akzeptierten?
Brunetti, studierter Jurist, hatte sich immer auch für Geschichte interessiert, und Bücher über die Geschichte der Neuzeit hatten ihn gelehrt, wie Diktaturen sich oft aus Kleinigkeiten entwickeln: einschränken, wer welche Arbeit machen darf, wer wen heiraten, wer wo leben darf. Mit der Zeit wachsen diese Auflagen sich aus, und bald dürfen manche Leute gar nicht mehr arbeiten oder heiraten oder – am Ende – leben. Er verwarf den Gedanken als völlig übertrieben. Der Weg zur Hölle war nicht mit tramezzini gepflastert.
Er ging zur Kasse. Bamba bongte den Betrag und reichte ihm die Quittung. Drei Euro fünfzig. Brunetti gab ihm einen Fünfeuroschein und wandte sich zum Gehen, ehe der Barmann ihm herausgeben konnte.
Auf dem Rückweg zur Questura horchte Brunetti in sich hinein, ob seine Lebensgeister sich regten.
Die Sonne schwächelte bereits und schaffte es nicht mehr über die Gebäude zu seiner Linken. Endlich kommt das Wetter zur Vernunft, dachte Brunetti, bald wird es Zeit für risotto di zucca. In ein paar Wochen könnten Paola und er in die Giardini gehen und die Verfärbung genießen. Früher saßen sie oft im Parco Savorgnan, aber seit ein Sturm drei seiner Lieblingsbäume umgeworfen hatte, zog es Brunetti nicht mehr dorthin, auch wenn er somit auf das Gebäck bei Dal Mas verzichten musste. Schließlich gab es auch noch die Farbenpracht in den Giardini Reali: Die waren kürzlich wieder hergerichtet worden und lockten zudem mit einem wunderbaren Café, wo man ungestört einfach nur sitzen und lesen konnte.
Was immer an Nährstoffen in dem tramezzino gesteckt haben mochte, zu spüren war davon nichts, keine neuen Kräfte, die seine innere Unruhe hätten vertreiben können.
Unten an der Treppe blieb er vor der Korktafel an der Wand stehen. Der Innenminister, las Brunetti, äußere sich besorgt, dass zu viele Leute ihre Dienstwagen für außerdienstliche Zwecke nutzten.
»Wie schockierend«, brummte Brunetti. »Vor allem hier bei uns.«
Seine gedämpfte Stimmung vom Vorabend hatte ihn immer noch im Griff. Schuld daran war vielleicht auch das Gespräch mit zwei alten Freunden, die vorzeitig in Rente gegangen waren und nun kein anderes Thema mehr kannten als die süßen Streiche ihrer Enkel.
Hier unten war niemand, auch auf der Treppe rührte sich nichts, in der Ferne klingelte ein Telefon und verstummte plötzlich. Beschämt über seine Trägheit und Pflichtvergessenheit gab er sich einen Ruck und rief Signorina Elettra in ihrem nur wenige Meter entfernten Büro an. Er müsse dringend gehen, sagte er, einer seiner Informanten wolle ihn unbedingt sofort sprechen.
Zum Glück hatten die zwei, die ihm gelegentlich Informationen zugespielt hatten, als er sie dann anrief, tatsächlich Zeit und erklärten sich zu einem Treffen bereit. Beide lebten zwar in Venedig, trafen sich aber nie dort mit ihm aus Furcht, jemand könne sie mit dem stadtbekannten Polizisten sehen; und so verabredete er sich mit dem einen in Marghera und mit dem anderen in Mogliano.
Die Treffen liefen nicht besonders. Es kam zu Differenzen wegen der Bezahlung. Der Erste hatte keine neuen Informationen und verlangte dennoch einen Monatslohn. Brunetti lehnte kategorisch ab – sonst würde der Mann nächstens auch noch Weihnachtsgeld fordern.
Der Zweite war ein Einbrecher, der seine Berufung – aber nicht seine Beziehungen – nach der Geburt seines ersten Kindes aufgegeben und einen Job als Lieferant von Milch und Milchprodukten angenommen hatte. Er traf sich mit Brunetti während der Arbeit und gab ihm den Namen des Zwischenhändlers, der die Sonnenbrillen vertickte, die regelmäßig beim Hersteller im Veneto verschwanden. Brunetti erklärte, da er selbst mit dieser Information nichts anfangen und sie lediglich an einen Freund in der Questura von Belluno weiterleiten könne, halte er fünfzig Euro für angemessen. Der Mann zuckte verlegen grinsend die Schultern, also gab Brunetti ihm einen Zehner obendrauf, worauf das Grinsen breiter wurde. Er dankte Brunetti, stieg in seinen weißen Lieferwagen, und das war’s.
Den Abend verbrachte Brunetti mit seiner Familie. Beim gemeinsamen Essen hörte er der Unterhaltung nur zu und konzentrierte sich auf die Speisen. Dann ging er mit einem kleinen Glas Grappa auf die Terrasse, nippte daran und betrachtete den Turm von San Marco. Als um zehn eine Glocke schlug, trug er sein Glas hinein und fand, es sei allmählich Schlafenszeit.
Obwohl er den ganzen Tag so gut wie nichts getan hatte, fühlte er sich wie zerschlagen, und die wehmütige Stimmung, in die ihn der Abend mit seinen alten Klassenkameraden versetzt hatte, hing ihm immer noch nach. Im Flur blieb er vor Paolas Arbeitszimmer stehen. In ihre Lektüre vertieft, hatte sie ihn nicht kommen hören, aber der Radar jahrzehntelanger Vertrautheit ließ sie aufblicken, und ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Ihm wurde warm ums Herz. »Ich gehe jetzt zu Bett«, sagte er.
Sie klappte ihr Buch zu und erhob sich. »Was für eine großartige Idee«, erwiderte sie.
3
Am nächsten Morgen traf Brunetti noch später in der Questura ein. Als Erstes ging er zu Signorina Elettra, die ihren Stuhl zurückgeschoben hatte und in irgendwelchen Papieren blätterte. Der Bildschirm ihres Computers war dunkel. Bei seinem Eintreten blickte sie auf.
»Störe ich, Signorina?«
»Aber nein, Commissario«, sagte Signorina Elettra lächelnd. »Ich sehe mir gerade etwas an, das Sie interessieren könnte.« Sie wies auf die Papiere. »Es geht um diese jungen Frauen in der laguna.« Er gab durch ein Nicken zu verstehen, dass er von dem Vorfall wusste, erwähnte aber nicht den Gazzettino.
»Eben kam Claudias Bericht. Sie hatte Dienst in dieser Nacht und den Anruf entgegengenommen.« Signorina Elettra hielt ihm die Papiere hin. »Werfen Sie mal einen Blick darauf?« Ihr Ton machte klar, dies war keine Frage, sondern eine Aufforderung.
Sie schob die Papiere in einen Umschlag. Brunetti dankte, ging damit in sein Büro und begann zu lesen.
Kurz nach drei Uhr morgens in der Nacht zum Sonntag hatte ein Wachmann des Ospedale Civile auf dem Steg vor der Notaufnahme an der Rückseite des Gebäudes eine Zigarette geraucht und dabei die zwei jungen Frauen verletzt und bewusstlos auf den Planken der Anlegestelle entdeckt. Er holte sofort Hilfe, und die Frauen wurden auf Rollbahren in die Notaufnahme gebracht.
Brunetti sah sich die Fotos an, die man auf der Station gemacht hatte, und erschrak. Eine der beiden war offenbar zusammengeschlagen worden. Ihre Nase war nach rechts abgeknickt, über dem linken Auge klaffte eine blutige Platzwunde. Die ganze linke Gesichtshälfte war geschwollen.
Das Gesicht des zweiten Opfers zeigte keine Spuren von Gewalt. Dem Bericht zufolge wiesen beide Frauen keine Abwehrverletzungen an den Händen auf, jedoch war der linke Arm des zweiten Opfers zweifach gebrochen.
Die Kleidung der beiden, Jeans und Pullover, war so durchnässt, als hätten sie im Wasser gelegen. Die eine hatte ihren linken Turnschuh verloren. Beide trugen nichts bei sich, was auf ihre Identität hätte schließen lassen können.
Laut beigefügtem ärztlichem Protokoll hatte man sie, immer noch bewusstlos, gründlich untersucht, um etwaige weitere Verletzungen festzustellen. Hinweise auf Geschlechtsverkehr in den vergangenen Stunden wurden nicht gefunden.
Die junge Frau mit der gebrochenen Nase wurde nach einem Hirn-Scan in die Unfallchirurgie des Krankenhauses in Mestre verlegt. Jetzt wurde auch die Polizei eingeschaltet. Der diensthabende Beamte rief Commissario Griffoni an, und die ließ sich von einem Polizeiboot zum Ospedale Civile bringen.
Griffonis Bericht zufolge lag die Frau mit dem gebrochenen Arm auf einem Rollbett im Krankenhausflur und flehte sie auf Englisch und unter Tränen an, etwas gegen die Schmerzen zu bekommen. Griffoni eilte zum Schwesternzimmer, zeigte ihre Dienstmarke und verlangte den zuständigen Arzt zu sprechen. Nachdem sie ihm die Meinung gesagt hatte, kam endlich Schwung in die Sache, man brachte die junge Frau in ein Behandlungszimmer, gab ihr eine Spritze und versorgte ihren Arm.
Ein Zimmer wurde gefunden, und Griffoni, die im Flur gewartet hatte, brachte sie in einem Rollstuhl eigenhändig hinein. Eine Schwester half der jungen Frau ins Bett. Griffoni setzte sich ans Fußende und versicherte der Patientin, sie werde ihr nicht von der Seite weichen. Es dauerte nicht lange, dann war die junge Frau eingeschlafen. Als um sechs Uhr früh die ersten Servierwagen im Flur klapperten, wachte sie auf und sah sich benommen um.
Griffoni erkundigte sich nach ihrem Namen und dem ihrer Begleiterin. JoJo Peterson, war die Antwort; und ihre Freundin heiße Lucy Watson. Aber dann wurde sie ganz aufgeregt und fragte, wo Lucy sei, und was überhaupt passiert sei. Griffoni erklärte, Lucy müsse operiert werden, und beruhigte JoJo mit der Behauptung, alles werde gut. Darauf erzählte ihr die junge Frau, Lucys Eltern arbeiteten für die amerikanische Botschaft in Rom. Sie selbst kenne Lucy vom Studium her und sei mit ihr hier aus den Staaten zu Besuch. Dann schlief JoJo wieder ein: Nicht einmal durch den Höllenlärm der Frühstücksausgabe ließ sie sich stören.
Griffoni schrieb, man habe über die Botschaft mit Lucy Watsons Eltern Kontakt aufgenommen; ihr Vater arbeite dort in der Personalabteilung, seine Frau als Dolmetscherin.
Das Telefon auf Brunettis Schreibtisch klingelte, im Display die Nummer von Griffonis Anschluss.
»Ja?«, meldete er sich.
»Kommst du mal rauf?«
»Drei Minuten«, sagte er und hängte ein.
Griffoni stand im Korridor – nicht etwa, weil sie es kaum erwarten konnte, Brunetti zu sehen, sondern nur, weil ihr Büro so klein war. Ihr eigener Stuhl stand praktisch auf der Schwelle, und hinter dem Schreibtisch war gerade noch Platz für einen Besucherstuhl. Dann kam schon die Wand.
»Erzähl«, sagte er zur Begrüßung, ging ihr voraus und setzte sich.
Sie wies auf den leeren Bildschirm ihres Computers. »Das Krankenhaus hat an jedem Eingang eine Kamera, auch hinten am Steg vor der Notaufnahme, wo man die beiden gefunden hat.« Sie schaltete den Bildschirm an und drehte ihn zu Brunetti hin, der zunächst einmal gar nichts erkannte.
Er beugte sich vor, das Kinn in die Hand gestützt, sah genauer hin und bemerkte längliche Streifen, dahinter war alles schwarz. Griffoni drückte eine Taste, worauf die Szene fast wie unter Flutlicht aufgehellt wurde. Die Streifen entpuppten sich als Holzplanken, das Dunkle dahinter war Wasser.
»Sind das die Aufnahmen der Kamera?«, fragte Brunetti.
Griffoni nickte. »Die Aufzeichnung ist vor einer halben Stunde gekommen. Ich konnte sie mir erst einmal ansehen.«
Es war ein Stummfilm, was ihn irritierte, denn vollkommen still ist die laguna nie; immer hört man, wenn auch noch so leise, Wasser plätschern. Da sich vorerst nichts tat, sah Brunetti unten am Bildschirm nach der Nummer der telecamera und der Uhrzeit: 2:57.
Plötzlich erbebte die Anlegestelle. Brunetti klammerte sich unwillkürlich an die Tischplatte. Ein Kopf ohne Körper erschien ruckelnd über dem Rand des Stegs.
Dann griffen zwei Hände nach der Leiter, und ein Mann stieg langsam hinauf, ganz vorsichtig. Er hielt den Blick auf seine Füße gesenkt, als fürchte er abzustürzen. Oben angekommen, sah er sich um, dann sprach er mit jemandem unter ihm. Eine Hand erschien und reichte ihm ein Tau, das der Erste bedächtig, aber durchaus routiniert vertäute.
Die obere Hälfte der zweiten Person, Schultern und Kopf eines Mannes mit Wollmütze, war einen Augenblick lang zu sehen, dann verschwand sie wieder und kam mit einer kleinen Frau in den Armen zurück. Er stemmte sie hoch, legte sie auf den Rand des Stegs und schob sie mit beiden Händen etwas weiter zur Mitte hin.
Wieder duckte er sich weg, nur um ein Stück weiter rechts mit einer zweiten Frau in den Armen aufzutauchen. Genau wie die erste legte er sie ab und schob sie auf den Steg.
Er rief dem Mann oben etwas zu, drehte sich um und zeigte auf etwas außerhalb des Bildausschnitts. Der Mann oben schüttelte den Kopf; was er sagte, veranlasste den Mann mit der Mütze, die Leiter hochzuklettern. Der andere machte eine abwehrende Bewegung, trat ihm entgegen und legte ihm die Hand auf den Arm. Der Mann mit der Mütze riss sich los und ging auf die Kamera zu, verschwand aus dem Bild, war kurz darauf wieder zur Stelle, schob sich an dem anderen vorbei zur Leiter, sagte etwas und stieg dort hinunter, wo ihr Boot liegen musste. Der andere warf das Tau hinunter und stieg dann, langsam, ebenfalls rückwärts die Leiter herab. Zurück blieben nur die zwei Frauen auf dem Steg.
Dann wurde der Bildschirm schwarz. Brunetti hatte die Aufzeichnung so angespannt verfolgt, dass er zusammenzuckte, als Griffoni sagte: »Die Kamera ist bewegungsempfindlich, solange sich nichts tut, bleibt sie ausgeschaltet.«
Um 3:05 Uhr erschien ein Mann mit gesenktem Kopf, nahm eine Zigarette aus einem Päckchen und ein Feuerzeug aus der Tasche. Er wandte sich ab, wie um die Flamme gegen den Wind zu schützen, zündete die Zigarette an, richtete sich auf und nahm einen tiefen Zug. Plötzlich erstarrte er, die Zigarette fiel ihm aus der Hand, dann hastete er mit drei Schritten zu den reglos vor ihm liegenden Gestalten hin. Er ging in die Knie, tastete nach dem Puls am Hals der ersten, dann der zweiten, sprang auf und verschwand in die Richtung, aus der er gekommen war.
Wieder wurde das Bild schwarz. Fast unmittelbar darauf wimmelte es von weiß Bekittelten, die mit atemberaubender Geschwindigkeit die Frauen auf Tragen legten und wegtrugen. Ende der Aufzeichnung.
»Wie lange hat es gebraucht, bis sie da waren?«, fragte Brunetti.
»Zwei Minuten und vierzig Sekunden. Die Zeit läuft unten am Bildschirm mit.«
»Ich werde nie mehr schlecht über das Krankenhaus reden«, sagte Brunetti. »Ich habe das Foto von ihrem Gesicht gesehen. Wer tut so etwas?«
Griffoni zuckte die Schultern. »Ich würde jetzt gern ins Krankenhaus zurück und sehen, was ich herausfinden kann.«
Brunetti fragte spontan: »Soll ich mitkommen?«
»Ist das kein Umweg für dich?«, fragte Griffoni. Das war kein Ja, aber sicher auch kein Nein.
»Eigentlich nicht, wenn ich den Weg über den Campo Santa Marina nehme«, antwortete er.
Sie betrachtete ihre Handfläche, und die schien die Sache zu entscheiden. »Wir könnten jetzt gleich aufbrechen. Ich habe nichts zu tun, und der Vice-Questore ist den ganzen Tag außer Haus.« Sie kam seiner Frage zuvor: »Foa hat mir erzählt, Patta sei zu einer Veranstaltung einer dieser ausländischen Stiftungen eingeladen, die sich den Erhalt der Serenissima auf die Fahne geschrieben hat.«
Brunetti kannte derlei Einrichtungen, zweifelte aber am Gelingen ihrer Mission. »Nun ja«, sagte er, »sie besuchen teure Restaurants, und das verschafft immerhin ein paar Leuten ihr täglich Brot.«
Als könne sie seine Gedanken lesen, reagierte Griffoni mit jenem speziellen Lächeln, das nur die obere Hälfte ihres Gesichts erhellte. Ihre Lippen waren zusammengepresst, ihre Augen hingegen funkelten vergnügt über die Absurdität des Ganzen. »Sie geben ein Charity-Dinner für Gutbetuchte, denen man erklären will, dass die Stadt unbedingt bewahrt werden muss«, sagte sie.
»Wovor?«, fragte Brunetti, der unwillkürlich an die Luftverschmutzung durch die eingeflogenen Gäste dachte.
»Ich vermute, das wird heute Abend enthüllt«, antwortete Griffoni.
»Aber woher weiß Foa davon?«, fragte Brunetti.
»Er soll den Vice-Questore zu dem Treffen und anschließend nach Hause chauffieren.«
Brunetti erinnerte sich an den Aushang, in dem vor der Zweckentfremdung von Dienstwagen gewarnt wurde. Patta konnte nichts passieren: Von Booten war nicht die Rede. Mit einem bitteren Lächeln erhob Brunetti sich und erklärte: »Komm, Claudia. Ich begleite dich zum Krankenhaus.«
Jetzt lächelte sie über das ganze Gesicht.
4
Als sie aus der Questura ins Freie traten, war jede Spur von Wärme aus der Luft gewichen. Griffoni ging als gebürtige Neapolitanerin niemals ohne wenigstens eine zusätzliche Kleidungsschicht aus dem Haus. Heute trug sie eine karamellfarbene Wildlederjacke über dem Arm, die in Brunettis Augen weitaus attraktiver aussah als das Sandwich, das er tags zuvor gegessen hatte.
»Hast du die in Neapel gekauft?«, fragte er, während sie in die Jacke schlüpfte und den Reißverschluss zur Hälfte schloss.
»Ja.«
»Sieht gut aus. Leider passt sie mir nicht, sonst würde ich dich niederschlagen und sie selbst anziehen«, scherzte Brunetti.
»Zu viel Zeit mit Kriminellen verbracht, würde ich meinen«, gab sie zurück. »Mein Onkel hat einen Laden.«
Brunetti warf den Kopf zurück und lachte schallend.
Unsicher, ob sie gekränkt sein sollte oder nicht, fragte Griffoni: »Was ist?«
»Ein Freund von mir – vielleicht sogar mein bester – ist Neapolitaner, und der hat, sowie mir irgendetwas gefällt, immer einen Onkel, eine Tante oder einen Cousin, der es mir zufällig beschaffen kann. Zu einem sehr guten Preis.«
»Sachen, die vom Lieferwagen gefallen sind?«, fragte Griffoni.
Wieder prustete Brunetti. Als er sich gefangen hatte, sagte er: »Das hat er tatsächlich mal behauptet. Damals wollte mein Sohn ein Paar weiße Tennisschuhe mit dem Autogramm irgendeines amerikanischen Tennisspielers oder Basketballstars, wochenlang lag er uns damit in den Ohren. Ich erwähnte das, als wir mit Giulio über unsere Kinder sprachen, und er fragte wie nebenbei nach Raffis Schuhgröße. Einen Tag später traf ein Päckchen von UPS ein, und Giulio schrieb dazu, die seien von einem Lastwagen gefallen«, schloss er lachend.
»Und ihr habt sie behalten? Ich meine, dein Sohn hat sie behalten?«
»Selbstverständlich«, sagte Brunetti. »Wenn ich sie zurückgeschickt hätte, wäre Giulio für den Rest des Jahres beleidigt gewesen.«
Sie gingen in einträchtigem Schweigen weiter. Schließlich meinte Griffoni: »Na ja, er ist Neapolitaner.«
»Und?«
»Wie sonst sollte er auf eine solche Kränkung reagieren?«
Brunetti blieb stehen und sah sie an. »Kennst du ihn etwa?«
»Wen?«
»Giulio. Giulio D’Alessio. Meinen Freund.«
Griffoni fragte zögernd: »Heißt sein Vater Filippo?«
Brunetti starrte sie entgeistert an. »Ja«, sagte er.
»Mein Vater kennt ihn. Den Vater, meine ich.«
Brunetti hielt sich beide Ohren zu und drehte sich auf der Stelle. »Mein Gott«, stöhnte er. »Eine Verschwörung. Ich bin von ihnen umzingelt.«
»Von Neapolitanern?«, fragte sie und legte ihm beschwichtigend eine Hand auf den Arm.
Er drehte sich zu ihr um. »Nein«, sagte er. »Von Freunden.«
Griffoni schob ihn sanft von sich weg. »Was bist du für ein Kindskopf, Guido.« Genau dasselbe sagte auch Paola immer, wenn seine Phantasie über die Stränge schlug, doch das sagte er Griffoni wohlweislich nicht, sondern wurde wieder ernst: »Erzähl mir, was du sonst noch erfahren hast.«
Sie zog einen dunkelbraunen Seidenschal aus ihrer Handtasche und schlang ihn sich um den Hals. »Ich kann nicht begreifen, wie du dieses Wetter aushältst«, meinte sie, als habe Brunetti die Kälte bestellt. Und als erinnere sie das an etwas: »Die zwei wurden am Samstagabend auf dem Campo Santa Margherita gesehen. Die Zeugin, ein junges Mädchen, erinnert sich, weil eine der beiden sich Lucy nannte und dieser Name in einem Lieblingssong ihrer Mutter vorkommt.«
»Ist das alles?«, fragte Brunetti. Andere mussten sie doch auch gesehen haben. Irgendwer – im Hotel, im B&B oder Freunde, bei denen sie wohnten – musste doch bemerkt haben, dass sie verschwunden waren oder jedenfalls nicht in ihren Betten geschlafen hatten.
»Die Zeugin sagt, die beiden hätten sich mit zwei Männern unterhalten, dann habe sie aber Freunde getroffen und das nicht weiter mitverfolgt. Die Amerikanerinnen seien ihr erst heute früh wieder eingefallen, als sie den Namen Lucy im Gazzettino sah.« Die Schlagzeile hatte Brunetti auch gesehen: »Lucy und JoJo. Wer sind sie?«
Brunetti wollte gerade fragen, ob Griffoni Neuigkeiten über die andere junge Frau im Krankenhaus in Mestre habe, doch da bogen sie bereits in die Barbaria delle Tole ein und steuerten auf das Ospedale Civile zu.
Die Seitenwand der Basilica erschien zu ihrer Rechten, und schon standen sie auf dem Campo. Vor ihnen ragte das Ospedale auf, und während sie quer über den Platz zu dessen Eingang gingen, rückte auch die Fassade von SS Giovanni e Paolo näher. Griffoni verlangsamte ihre Schritte und sah von einem Gebäude zum anderen, als sollte sie einem davon einen Preis verleihen und könnte sich nicht entscheiden. Für gewöhnlich war diese Basilica – in ihrer unvergleichlichen Majestät – Brunettis Lieblingskirche in der Stadt; manchmal aber auch, er wusste selbst nicht, warum, San Nicolò dei Mendicoli, und früher, als er ein Mädchen gekannt hatte, das dort in der Nähe wohnte, Santa Maria dei Miracoli, bis er des Mädchens und damit auch der Kirche überdrüssig geworden war.
Er bot Griffoni gar nicht erst an, sie zur Befragung der Frau zu begleiten. Schließlich waren es Männer gewesen, die sie in diesem Zustand vor dem Krankenhaus abgeladen hatten. Er wünschte Griffoni viel Glück, verabschiedete sich und ging nach Hause.
Dort war noch niemand, also machte Brunetti sich einen Teller Oliven zurecht, schenkte sich ein Glas gekühlten Falanghina ein, trug beides ins Wohnzimmer, setzte sich und trank erst einmal einen Schluck.
Vergrößerte Fotos der zwei Männer aus dem Krankenhausvideo waren nicht nur an alle Polizeibeamten in Venedig, sondern auch an die Guardia Costiera, die Carabinieri und die Guardia di Finanza geschickt worden. Brunetti schätzte die beiden auf wenig mehr als zwanzig Jahre. Viel mehr ließ sich den Fotos nicht entnehmen.
Von dem Boot, mit dem die beiden angeliefert worden waren, war nichts zu erkennen, schließlich war die Überwachungskamera für die großen Sanitätsboote gedacht. Man hatte einzig die zwei Männer hastig ihre Last abladen und ebenso schnell wieder verschwinden sehen.
Brunetti nippte an dem Wein, aß ein paar Oliven und legte die Kerne auf den Tellerrand. Er lehnte sich zurück, trank noch einen kleinen Schluck und stellte das Glas auf den Tisch. Nachdenklich klopfte er die Daumen aneinander, was ihn an die Fingerspiele erinnerte, die er und sein Bruder als Kinder gespielt hatten. Bei einem davon formte man die Hände zu einer Kirche, deren Tor sich öffnen ließ: Das konnte er noch. Bei einem anderen musste man die Hände irgendwie so zusammenfügen, dass man so tun konnte, als ob das erste Glied des Daumens abgetrennt sei. Als seine Kinder klein waren, hatte er sie damit immer wieder begeistert, aber jetzt wollte ihm das kleine Kunststück einfach nicht mehr gelingen. Er verschränkte die Hände wieder und hielt sie still.
Campo Santa Margherita. Samstagabend. Solange es nicht regnete, kamen dort an Sommerabenden regelmäßig Hunderte von Schülern und Studenten zusammen. Schwatzen, trinken, von einer Gruppe zur anderen gehen, Freunde treffen oder neue Freundschaften schließen. In seiner Jugend war es nicht anders gewesen. Nur ohne Drogen und mit weniger Alkohol.
Die zwei jungen Frauen hatten laut der Zeugin mit zwei Männern gesprochen, und ein paar Stunden später wurden sie von zwei Männern vor dem Krankenhaus abgeladen. Kein Hinweis auf sexuelle Aktivitäten, kein Hinweis darauf, dass eine der beiden sich gegen einen Angriff gewehrt hatte.
»Was stimmt hier nicht?«, murmelte Brunetti. Er dachte an ein Buch, das Paola ihm jahrelang ans Herz gelegt hatte: Drei Männer in einem Boot. Er hatte es schließlich gelesen, es aber ganz und gar nicht gemocht. Jetzt ging es um lediglich zwei Männer in einem Boot, aber wer waren sie, und überhaupt, was hatten sie um drei Uhr morgens in einem Boot zu suchen? Und woher wussten sie, wo sie die zwei Frauen hinbringen, abladen oder loswerden konnten, je nachdem, wie ihr Verhalten zu interpretieren war? Wenn das Boot ihnen gehörte, waren sie mit der laguna vertraut, mussten aber nicht unbedingt Venezianer sein. Andererseits dürften nur Venezianer die Anlegestelle des Ospedale kennen. Wenn sie die Mädchen auf dem Campo Santa Margherita kennengelernt hatten, waren es womöglich Studenten. Wenn es ihnen gelungen war, mit den Mädchen ins Gespräch zu kommen, mussten sie ein wenig Englisch gekonnt haben, was darauf schließen ließ, aber noch nicht bestätigte, dass es sich in der Tat um Studenten handelte.
Er rief sich ins Gedächtnis, wie die Männer die zwei bewusstlosen Amerikanerinnen auf dem Steg abgelegt hatten: Einer stieg vorsichtig die Leiter hoch, vertäute das Boot und sah dann dabei zu, wie der andere sie nacheinander aus dem Boot hob und auf die Planken legte. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, ins Boot zurückzuklettern und dem anderen zu helfen? Und worum war es in dem kurzen Wortwechsel gegangen? Was passte hier nicht ins Bild?
Er nahm noch einen Schluck Wein und ein paar Oliven, dann griff er zum Telefon und rief Griffoni an.
»Bist du noch im Ospedale?«
»Sì.«
»Bei der Amerikanerin?«
»Sì.«
»Kann sie sich an irgendwas erinnern?«
»Warte mal kurz«, meinte Griffoni, und er glaubte, einen Stuhl scharren zu hören. Sie hielt die Sprechmuschel zu und sagte etwas. Dann hörte er Schritte in einer längeren Pause. »Sie waren auf einem Campo mit vielen Studenten«, meldete Griffoni sich zurück. »Von der Zeugin wissen wir, es war der Campo Santa Margherita. Dort haben sie zwei Jungen getroffen, die sie zu einer Rundfahrt eingeladen haben.«
»Rundfahrt?«
»Die beiden hatten ein Boot, und sie sagt, die Männer hätten einen netten Eindruck gemacht, deshalb seien sie mitgegangen.« Griffoni verstummte, doch Brunetti drängte nicht.
»Das Boot war in der Nähe einer Brücke geparkt, wie sie sich ausdrückte.«
Er kannte die Brücke am Ende des Campo Santa Margherita, mit einer riva auf der anderen Seite.
»Sie sagt, anfangs war es sehr aufregend. Sie fuhren auf einem großen Kanal, mit großen Häusern links und rechts. Dann kamen sie an ein paar Kirchen vorbei, und plötzlich merkte sie, dass sie auf offenem Wasser waren.«
»Und?«
»Sie fand das unheimlich, weil es dort außerhalb der Stadt stockfinster war. Die einzigen Lichter waren weit weg, und sie hatten keine Ahnung, wo sie waren. Plötzlich, sagt sie, habe das Boot stark beschleunigt, der Bug sei wie wild auf das Wasser geklatscht, und die Jungen hätten gerufen und laut gelacht.« Dann fiel Griffoni noch ein: »Und da bekam sie es mit der Angst zu tun, sagt sie. Das Boot hüpfte so sehr, dass sie sich am Sitz festhalten musste.«
»Und wie ging es weiter?«
»Ab da kann sie sich an nichts mehr erinnern. Kurz davor, das wusste sie noch, wurde ihr schlecht, und sie schrie die Jungen an, sie sollten langsamer fahren. Und dann war sie im Krankenhaus, weiß aber nicht, wie sie dort hingekommen ist.«
»Und die jungen Männer?«, fragte Brunetti.
»Die haben ihnen erzählt, sie seien Venezianer. Das heißt, einer von ihnen. Sie sagt, er sprach ziemlich gut Englisch. Der andere hat nicht viel gesprochen, nur Italienisch.«
»Hat sie ihre Namen erfahren?«
»Der Englisch gesprochen hat, heißt angeblich Phil. Der Name des anderen fing mit M an – Mario, Michele, sie weiß es nicht mehr.«
»Sonst noch etwas?«
»Einer der beiden, sagt sie, hatte ein Tattoo am linken Handgelenk: schwarz und irgendwie geometrisch, wie ein Armband.«
»So wie tausend andere«, sagte Brunetti. »Erinnert sie sich, wie sie nass geworden ist?«
Griffoni stöhnte. »Mehr weiß sie wirklich nicht mehr, Guido.«
»Was sagen die Ärzte?«
»Dass die Erinnerung zurückkommen könnte, aber erst nach und nach. Oder auch gar nicht. Irgendeine Kopfverletzung haben sie nicht finden können, also vermuten sie, es liegt bloß am Schock, an der Kälte, an den Schmerzen von dem Armbruch oder an der Angst, die sie ausgestanden hat.«
Bevor Brunetti noch etwas fragen konnte, erklärte Griffoni: »Man ruft mich. Ich muss wieder rein«, und legte auf.
Brunetti blieb allein mit seinen Olivenkernen, einem leeren Glas und immer noch keiner klaren Vorstellung von dem, was da am Samstagabend passiert war. Er dachte an die junge Frau mit dem zerschundenen Gesicht: Wie konnte ein Chirurg, der sie nie zuvor gesehen hatte, ihr Gesicht wiederherstellen? Dass sie wieder so aussah wie vorher?
Er ließ diese sinnlosen Spekulationen und konzentrierte sich auf die Fakten. Die zwei Männer waren Venezianer, sie hatten Zugang zu einem Boot, arbeiteten vielleicht sogar damit. Brunetti hatte keine Ahnung, wie viele Männer und Frauen in der Stadt auf die eine oder andere Weise mit Booten zu tun hatten. Hunderte? Oder noch viel mehr? Wie in den Zeiten, als die Serenissima Herrscherin der Meere gewesen war, blieb die Arbeit oft über Generationen hinweg in der Familie, und wie alle, die ständig ihr Leben aufs Spiel setzen, hielten die Bootsleute zusammen wie Pech und Schwefel.
Brunetti brachte das Glas und den Teller mit den Olivenkernen in die Küche und stellte beides neben die Spüle. Dann holte er sich in Paolas Arbeitszimmer etwas zu lesen, bis die Familie zum Essen nach Hause kam.
5
Am nächsten Morgen erhielt Brunetti eine von Signorina Elettra weitergeleitete Mail der Carabinieri mit den Namen der zwei Männer, die die jungen Frauen vor dem Krankenhaus abgelegt hatten. Marcello Vio, wohnhaft auf der Giudecca, Filiberto Duso in Dorsoduro. Der Name »Duso« weckte in Brunetti irgendeine positive Erinnerung, aber er las erst einmal weiter.