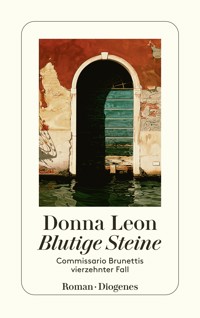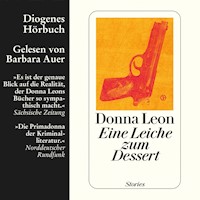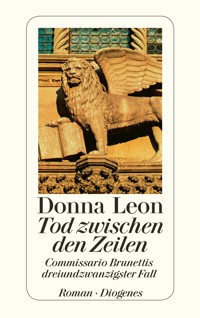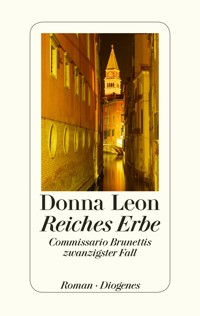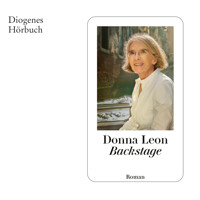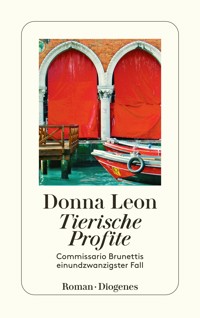
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Ein toter Mann, der von niemandem vermisst wird, weder von den Venezianern noch von Touristen. Und ein teurer Lederschuh am Fuß dieser Leiche. Brunetti muss all seine Menschenkenntnis aufbieten und sein ganzes Kombinationstalent, um diesen Fall zu lösen, der ihn bis aufs Festland nach Mestre führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Donna Leon
Tierische Profite
Commissario Brunettis einundzwanzigster Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel des Originals: ›Beastly Things‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 2013
im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Georg Friedrich Händel,
Giulio Cesare, 1. Akt, 9. Szene
Die Zitate von Marc Aurel aus:
Marcus Aurelius Antoninus,
Betrachtungen über seine eigensten
Angelegenheiten, aus dem Griechischen
übertragen von J. G. Schultheß,
Zürich 1779
Umschlagfoto von Silke Bremer (Ausschnitt)
Copyright © Silke Bremer
Für Fabio Moretti
und Umberto Branchini
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24302 4 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60309 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Va tacito e nascosto, quand’avido è di preda, l’astuto cacciator. E chi è mal far disposto, non brama che si veda l’inganno del suo cor.
Auf listig leisen Sohlen schleicht sich der Jäger an, die Beute sich zu holen. Wer Böses führt im Schilde, bemüht sich zu verbergen des Herzens Niedertracht.
GIULIO CESARE
[7] 1
Der Mann lag reglos da, so reglos wie ein Stück Fleisch auf dem Schlachtertisch, reglos wie der Tod selbst. Im Raum war es kalt, und doch war er, von Kopf und Hals abgesehen, nur mit einem dünnen Laken zugedeckt. Seine Brust war übermäßig nach oben gewölbt, als habe man ihm eine Stütze unter den Rücken geschoben. Wäre diese weiße Gestalt eine schneebedeckte Bergkette und der Betrachter ein müder Wanderer, der am Ende eines langen Tages dort noch hinübermüsste, so würde er doch lieber den weiten Umweg über die Knöchel nehmen. Der Aufstieg über die Brust wäre zu steil, und wer konnte wissen, welche Schwierigkeiten einen beim Abstieg auf der anderen Seite erwarteten?
Von der Seite fiel die unnatürliche Wölbung der Brust ins Auge; von oben – stünde der Wanderer jetzt auf einem Gipfel und könnte auf den Mann hinabsehen – war es der Hals, der einen sonderbaren Eindruck machte. Der Hals, oder vielleicht genauer: dass er keinen hatte. Tatsächlich war sein Hals ein breiter Pfeiler, der von den Ohren abwärts senkrecht in die Schultern überging. Keine Verengung, keine Einbuchtung; der Hals war so breit wie der Kopf.
Auffällig war auch die Nase, die im Profil kaum noch in Erscheinung trat. Sie war eingedrückt und schief; die Haut mit Kratzern und winzigen Kerben übersät. Auch die rechte Wange war zerkratzt und blutunterlaufen. Das ganze Gesicht war aufgedunsen, weiß und schwammig. Von oben war das Fleisch unterhalb der Wangenknochen tief [8] eingefallen. Sein Gesicht war nicht nur totenbleich. Dieser Mann hatte sein Leben in geschlossenen Räumen verbracht.
Der Mann hatte dunkles Haar und einen Kinnbart, der wahrscheinlich den Hals kaschieren sollte, aber so ein Hals ließ sich keine Sekunde verbergen. Der Bart fiel zwar ins Auge, aber dann bemerkte man auch sofort die Absicht, denn er wuchs über die Kieferlinie hinaus, als wüsste er nicht, wo er aufhören solle. Von hier oben aus schien er sich sogar über den Hals und seine Seitenpartien ergossen zu haben, ein Eindruck, den die allmählich weißer werdenden Bartausläufer noch verstärkten.
Die Ohren waren überraschend zierlich, fast wie die einer Frau. Ohrringe hätten nicht mal fehl am Platz gewirkt, wäre da nicht der Bart gewesen. Unter dem linken Ohr, unmittelbar hinter dem Bartansatz, verlief im Winkel von dreißig Grad eine rosa Narbe. Etwa drei Zentimeter lang und breit wie ein Bleistift; die Haut war uneben, als sei derjenige, der sie genäht hatte, in Eile gewesen, oder nachlässig, als komme es bei einem Mann nicht so darauf an.
Es war kalt im Raum, zu hören war nur das mühsame Keuchen der Klimaanlage. Der mächtige Brustkorb des Mannes hob und senkte sich nicht, er fröstelte auch nicht in dieser Kälte. Er lag da, nackt unter seinem Laken, die Augen geschlossen. Er wartete auf nichts, denn über das Warten war er ebenso hinaus wie darüber, pünktlich oder zu spät zu kommen. Fast könnte man sagen, der Mann war einfach nur. Aber das wäre nicht richtig, denn er war nicht mehr.
Zwei weitere Gestalten lagen ähnlich zugedeckt in dem Raum, näher an den Wänden: Der Bärtige lag in der Mitte. Wenn jemand, der immer lügt, erklärt, er sei ein Lügner, sagt [9] er dann die Wahrheit? Wenn niemand in einem Zimmer am Leben ist, ist dann niemand im Raum?
Eine Tür am anderen Ende wurde geöffnet und von einem großen schlanken Mann in einem weißen Laborkittel aufgehalten. Er ließ einem anderen Mann den Vortritt und dann erst die Tür hinter sich los; langsam glitt sie zu und schloss sich mit einem in dem kalten Raum deutlich vernehmbaren Schmatzen.
»Er liegt da drüben«, sagte Dottor Rizzardi und ging Guido Brunetti, Commissario di Polizia der Stadt Venedig, voraus. Brunetti hielt wie der imaginäre Wanderer inne und betrachtete den weiß bedeckten Bergkamm, den der Körper bildete. Rizzardi trat an den Tisch, auf dem der Tote lag.
»Er bekam drei Stiche ins Kreuz, mit einer schmalen Klinge, keine zwei Zentimeter breit, würde ich sagen. Und der Täter wusste genau, was er tat, oder er hatte großes Glück. An seinem linken Arm sind zwei kleine Druckstellen«, sagte Rizzardi und blieb neben der Leiche stehen. »Und er hat Wasser in der Lunge«, ergänzte er. »Demnach lebte er noch, als er in den Kanal gelangte. Aber der Mörder hat eine Hauptvene erwischt: Er hatte keine Chance. Er ist binnen Minuten verblutet.« Grimmig fügte er hinzu: »Bevor er ertrinken konnte.« Der Pathologe kam Brunettis Frage zuvor: »Tatzeit gestern Nacht, irgendwann nach Mitternacht, würde ich sagen. Genauer geht’s nicht, weil er im Wasser gelegen hat.«
Brunetti, immer noch auf halbem Weg zwischen Tisch und Tür, sah von einem zum anderen. »Was ist mit seinem Gesicht passiert?«, fragte er. Der Tote war so entstellt, dass es schwierig würde, ihn auf einem Foto wiederzuerkennen – [10] beziehungsweise es nur schon schwierig wäre, sich ein Foto dieses zerschlagenen, aufgedunsenen Gesichts überhaupt anzusehen.
»Ich vermute, er ist nach vorn gestürzt, als auf ihn eingestochen wurde. Wahrscheinlich war er so überrumpelt, dass er den Sturz nicht einmal mit den Händen abfangen konnte.«
»Kannst du ein Foto machen?«, wollte Brunetti wissen, der sich fragte, ob Rizzardi die Verletzungen wenigstens zum Teil kaschieren konnte.
»Du willst Leuten diesen Anblick zumuten?« Die Antwort gefiel Brunetti nicht, auch wenn es eine ehrliche Antwort war. Nach kurzem Überlegen fügte der Pathologe hinzu: »Versuchen kann ich’s ja.«
Brunetti fragte: »Und weiter?«
»Ich würde sagen, er ist Ende vierzig, einigermaßen gesund, arbeitet nicht mit den Händen, aber das ist auch schon alles.«
»Was ist mit seinem merkwürdigen Körperbau?«, fragte Brunetti und trat näher.
»Du meinst seine Brust?«, fragte Rizzardi.
»Und den Hals.« Brunetti wies darauf.
»Das nennt man Madelung-Syndrom«, erklärte Rizzardi. »Ich habe davon gelesen und im Studium davon gehört, aber gesehen habe ich es noch nie. Nur auf Abbildungen.«
»Kennt man die Ursache?«, fragte Brunetti, jetzt dicht neben dem Toten.
Rizzardi zuckte die Schultern. »Nicht dass ich wüsste.« Als könne er eine solche Antwort nicht mit seiner Berufsehre vereinbaren, fügte er rasch hinzu: »Häufig spielt Alkoholismus eine Rolle oder Drogenkonsum, aber nicht in diesem [11] Fall. Er war kein Trinker, absolut nicht, und Hinweise auf Drogenkonsum habe ich auch nicht festgestellt.« Nach einer Pause fuhr er fort: »Gott sei Dank bekommen das nur die wenigsten Alkoholiker, aber die meisten Männer, die es bekommen – und es sind fast immer Männer –, sind Alkoholiker. Auch wenn die Zusammenhänge nicht geklärt sind.«
Rizzardi trat näher und zeigte auf eine besonders dicke Stelle im Nacken; für Brunetti sah es fast wie ein kleiner Höcker aus. Bevor er nachfragen konnte, fuhr Rizzardi fort: »Das ist Fettgewebe. Das Fett sammelt sich dort an«, er wies auf den Höcker. »Und dort auch.« Er zeigte auf die Wölbung unter dem weißen Tuch, wo am Körper einer Frau die Brüste gewesen wären.
»Es beginnt zwischen dreißig und fünfzig und konzentriert sich auf die obere Körperhälfte.«
»Du meinst, es wächst einfach so?«, fragte Brunetti, der sich das vorzustellen versuchte.
»Ganz recht. Manchmal auch an den Oberschenkeln. In seinem Fall nur an Hals und Brust.« Er schwieg nachdenklich und fügte dann hinzu: »Am Ende sehen sie aus wie Fässer, die armen Kerle.«
»Gibt’s das oft?«, fragte Brunetti.
»Nein, durchaus nicht. Soweit ich weiß, sind in der Literatur nur ein paar hundert Fälle erwähnt.« Er hob die Schultern. »Wir wissen im Grunde nur sehr wenig darüber.«
»Sonst noch etwas?«
»Er wurde über eine rauhe Oberfläche geschleift«, sagte der Pathologe, indem er Brunetti ans untere Ende des Tischs führte und das Laken anhob. Er wies auf die aufgeschürfte Ferse des Toten. »Am Kreuz sieht es ähnlich aus.«
[12] »Das heißt?«, fragte Brunetti.
»Jemand hat ihn unter den Schultern gepackt und über den Boden gezogen, würde ich sagen. Kein grobkörniges Material in den Wunden, also dürfte es sich um einen nackten Steinfußboden gehandelt haben.« Zur Verdeutlichung fügte Rizzardi hinzu: »Er trug nur einen Schuh, einen Slipper. Der andere ist vermutlich abgestreift worden.«
Brunetti ging zum Kopf des Toten und sah auf das bärtige Gesicht hinab. »Hat er helle Augen?«, fragte er.
Rizzardi konnte seine Verblüffung nicht verbergen. »Blau. Woher weißt du das?«
»Ich hab’s nicht gewusst«, antwortete Brunetti.
»Wie kommst du dann auf die Frage?«
»Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen«, sagte Brunetti. Er sah sich den Mann genau an, das Gesicht, den Bart, den mächtigen Nacken. Aber er kam nicht drauf; nur bei den Augen war er sich sicher.
»Wenn du ihn schon mal gesehen hast, müsstest du dich an ihn erinnern.« In Anbetracht der Statur des Mannes leuchtete diese Bemerkung Rizzardis ein.
Brunetti nickte. »Ich weiß, aber mir will partout nichts einfallen.« Dass seine Erinnerung ihn bei etwas so Ungewöhnlichem wie der Erscheinung dieses Mannes im Stich ließ, beunruhigte Brunetti mehr, als er zugeben wollte. Hatte er ihn auf einem Foto gesehen, in einer Verbrecherkartei, in einer Zeitschrift, in einem Buch? Vor einigen Jahren hatte er in Lombrosos abscheulichem Buch geblättert: Erinnerte ihn dieser Mann vielleicht nur an die dort abgedruckten Konterfeis »geborener Verbrecher«?
Aber die Lombroso-Porträts waren in Schwarzweiß [13] gewesen: Hätte man da helle und dunkle Augen unterscheiden können? Brunetti forschte in seinem Gedächtnis nach dem Bild, das dort gespeichert sein musste, und starrte hilfesuchend die Wand an. Aber es kam nichts, keine Erinnerung an einen Mann mit blauen Augen, weder an diesen noch an irgendeinen anderen.
Stattdessen stieg ungerufen und äußerst beklemmend das Bild seiner Mutter in ihm auf, wie sie zusammengesunken im Sessel saß und ihn mit leeren Augen anstarrte, die ihn nicht mehr erkannten.
»Guido?«, hörte er jemanden sagen und blickte, als er aufsah, in Rizzardis vertrautes Gesicht.
»Alles in Ordnung?«
Brunetti zwang sich zu einem Lächeln. »Ja«, sagte er, »ich versuche nur, mich zu erinnern, wo ich ihn gesehen haben könnte.«
»Denk eine Weile nicht daran, dann kommt es meist von selbst«, schlug Rizzardi vor. »Passiert mir ständig. Wenn mir irgendein Name nicht einfällt, gehe ich das Alphabet durch – A, B, C –, und wenn ich auf den Anfangsbuchstaben stoße, ist der Name plötzlich wieder da.«
»Ist daran das Alter schuld?«, fragte Brunetti betont gleichgültig.
»Das will ich doch hoffen«, antwortete Rizzardi leichthin. »Während des Studiums hatte ich ein erstaunliches Gedächtnis – ohne ist das gar nicht zu schaffen: Alle diese Knochen, diese Nerven, die Muskeln…«
»Die Krankheiten«, ergänzte Brunetti.
»Ja, die auch. Allein sämtliche einzelnen Teile hiervon zu behalten«, sagte der Pathologe und strich mit den [14] Handrücken an seinem Körper hinunter, »ist schon eine großartige Leistung.« Und nachdenklicher: »Aber was sich da drinnen abspielt, das ist ein Wunder.«
»Ein Wunder?«, fragte Brunetti.
»Sozusagen«, meinte Rizzardi. »Etwas Wunderbares.« Er sah Brunetti an und ergänzte nachdenklich, wie es nur unter Freunden möglich ist: »Findest du nicht auch, dass die alltäglichsten Dinge, die wir tun – ein Glas hochheben, die Schuhe schnüren, ein Liedchen pfeifen –, kleine Wunder sind?«
»Warum tust du dann, was du tust?« Brunetti war selbst von seiner Frage überrascht.
»Was meinst du damit?«, fragte Rizzardi. »Ich verstehe nicht.«
»Dich Menschen widmen, nachdem die Wunder vorbei sind.« Brunetti wusste nicht, wie er es sonst sagen sollte.
Rizzardi überlegte lange, bevor er antwortete. »So habe ich das noch nie betrachtet.« Er senkte den Blick auf seine Hände, drehte sie um und studierte die Handflächen. »Vielleicht, weil meine Tätigkeit mir verdeutlicht, wie das alles funktioniert – das, was die Wunder möglich macht.«
Als sei er plötzlich verunsichert, presste Rizzardi die Hände zusammen und sagte: »Nach Auskunft der Männer, die ihn gebracht haben, hatte er keine Papiere bei sich. Keinen Ausweis. Nichts.«
»Und seine Kleidung?«
Rizzardi zuckte die Achseln. »Die Toten kommen unbekleidet hier rein. Deine Leute müssen die Sachen ins Labor gebracht haben.«
Brunettis Brummen klang nach Zustimmung, Verständnis oder vielleicht auch einem Dank. »Ich geh gleich rüber [15] und seh mal nach. Angeblich haben sie ihn gegen sechs gefunden.«
Rizzardi schüttelte den Kopf. »Davon weiß ich nichts, nur dass er heute der Erste war.«
Überrascht – schließlich waren sie in Venedig – fragte Brunetti: »Wie viele sind denn noch gekommen?«
Rizzardi wies mit dem Kinn auf die zwei verdeckten Gestalten am anderen Ende des Raums. »Die zwei alten Leute da.«
»Wie alt?«
»Der Sohn sagt, sein Vater war dreiundneunzig, seine Mutter neunzig.«
»Was ist passiert?«, fragte Brunetti. Er hatte am Morgen die Zeitungen gelesen, aber da war von diesen beiden Todesfällen nicht die Rede gewesen.
»Einer der beiden hat gestern Abend Kaffee gemacht. Der Topf stand noch in der Spüle. Die Flamme war erloschen, aber das Gas strömte noch aus.« Rizzardi fügte hinzu: »Es war ein alter Herd, einer, den man mit einem Streichholz zündet.«
Bevor Brunetti etwas dazu sagen konnte, fuhr der Pathologe fort: »Der Nachbar über ihnen hat Gasgeruch bemerkt und die Feuerwehr angerufen, und als die kam, war die Wohnung voller Gas. Die beiden lagen tot auf dem Bett. Die Kaffeetassen standen neben ihnen.«
In Brunettis Schweigen hinein bemerkte Rizzardi: »Ein Glück, dass nicht das ganze Haus explodiert ist.«
»Ungewöhnlich, im Bett Kaffee zu trinken«, sagte Brunetti.
Rizzardi bedachte seinen Freund mit einem wachsamen [16] Blick. »Sie hatte Alzheimer, und er hatte nicht das Geld, sie anderswo unterzubringen. Und der Sohn«, erklärte er, »hat drei Kinder und lebt in einer Zweizimmerwohnung in Mogliano.«
Brunetti schwieg.
»Der Sohn hat mir erzählt«, fuhr Rizzardi fort, »sein Vater habe gesagt, er könne nicht mehr für sie sorgen, jedenfalls nicht so, wie er es gern täte.«
»Gesagt?«
»Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Darin steht, er wolle nicht, dass die Leute denken, er leide an Gedächtnisschwund und habe vergessen, das Gas abzustellen.« Rizzardi wandte sich von den Toten ab und ging zur Tür. »Er bekam eine Pension von fünfhundertzwölf Euro, sie eine von fünfhundertacht.« Düster fügte er hinzu: »Ihre Miete betrug siebenhundertfünfzig.«
»Verstehe«, erklärte Brunetti nur.
Rizzardi öffnete die Tür, und sie traten in den Flur des Krankenhauses.
[17] 2
Sie gingen in einträchtigem Schweigen den Flur hinunter; Brunetti hing noch dem Schicksal seiner Mutter nach, während gleichzeitig Rizzardis Bemerkung über das Wunder des menschlichen Körpers in ihm widerhallte. Nun, Rizzardi musste es wissen, schließlich hatte er tagtäglich damit zu tun.
Er dachte an den Abschiedsbrief des alten Manns für seinen Sohn, erschütternde Sätze, die etwas aussprachen, das Brunetti so unerträglich schien, dass er es nicht zu benennen wagte. Es handelte sich um eine bewusste Entscheidung gegen das Leben, die der alte Mann für sich und seine Frau getroffen hatte. Davor hatte er beiden noch einen Kaffee gemacht. Brunetti verbannte mit großer Willensanstrengung den Gedanken an das Zimmer, in dem die alten Leute ihren Kaffee getrunken hatten, und an das unerbittliche Schicksal, das ihnen von dort nur noch den Weg in den Kühlraum gelassen hatte, wo er sie hatte liegen sehen.
Er wandte sich Rizzardi zu und fragte: »Meinst du, dieses Marlung-Syndrom – falls er deswegen in Behandlung war – kann mir bei seiner Identifizierung helfen?«
»Madelung«, korrigierte Rizzardi automatisch und erklärte: »Du könntest eine offizielle Anfrage an alle Kliniken mit Spezialabteilungen für Erbkrankheiten richten.« Er überlegte. »Vorausgesetzt, er ist deswegen mal im Krankenhaus gewesen.«
Brunetti dachte an den Mann auf dem Tisch zurück und [18] fragte: »Aber wäre das denn möglich? Dass er deswegen nicht in Behandlung war? Mit so einem Hals?«
Rizzardi, der schon die Klinke zu seinem Büro in der Hand hatte, drehte sich zu Brunetti um und sagte: »Guido, überall laufen Leute mit solch auffallenden Krankheitssymptomen herum, dass jedem Arzt, der sie sieht, die Haare zu Berge stehen.«
»Und?«, fragte Brunetti.
»Und diese Leute sagen sich, das ist nichts weiter, das gibt sich wieder, nur nicht so genau hinsehen. Der Husten wird sich schon bessern, die Blutung aufhören, das Ding am Bein von allein verschwinden.«
»Und?«
»Und manchmal kommt es so, und manchmal nicht.«
»Und wenn nicht?«, fragte Brunetti.
»Dann landen sie bei mir«, sagte Rizzardi grimmig. Er schüttelte sich, als wollte er wie Brunetti gewisse Gedanken verscheuchen, und fügte hinzu: »Ich habe eine Kollegin in Padua, die sich mit Madelung auskennen dürfte: Die rufe ich an. Dorthin würde jemand aus dem Veneto vermutlich am ehesten gehen.«
Und wenn er nicht aus dem Veneto ist?, fragte sich Brunetti, sprach es aber nicht aus. Stattdessen dankte er dem Pathologen und fragte, ob Rizzardi auf einen Kaffee in die Bar mitkommen wolle.
»Nein, danke. Mein Tisch ist wie deiner voller Papiere und Berichte, und ich habe vor, den Rest des Vormittags mit Lesen und Schreiben zu vergeuden.«
Brunetti quittierte das mit einem Nicken und machte sich auf den Weg zum Haupteingang des Krankenhauses. Er war [19] sein Leben lang gesund gewesen, aber das half ihm auch nichts gegen die Einflüsterungen seiner Phantasie; nur allzu oft entdeckte er die Symptome eingebildeter Krankheiten an sich. Paola war die Einzige, der er je davon erzählt hatte, wenngleich seine Mutter, als sie dazu noch imstande war, es gewusst oder zumindest geahnt hatte. Paola war sich über die Absurdität seiner Befürchtungen im Klaren: Ängste wäre zu viel gesagt, denn letztlich glaubte er selber nie ganz, dass er wirklich krank war.
Mit Banalitäten wie Herzleiden oder Grippe gab seine Phantasie sich nicht ab, sie bevorzugte West-Nil-Fieber oder Hirnhautentzündung. Oder Malaria. Diabetes, zwar in seiner Familie unbekannt, befiel ihn häufig. Im Grunde wusste er, dass diese Krankheiten als Blitzableiter dienten, um nur ja nicht in jeder noch so vorübergehenden Gedächtnisstörung ein erstes Anzeichen dafür zu sehen, wovor er sich wirklich fürchtete. Besser, eine Nacht lang den bizarren Symptomen des Dengue-Fiebers nachzuspüren, als in Panik zu geraten, wenn ihm die Nummer von Vianellos telefonino nicht gleich einfiel.
Brunetti konzentrierte sich auf den Mann mit dem Stiernacken: So nannte er ihn vorläufig. Blaue Augen – das hatte er gewusst, und die einzige Erklärung dafür war, dass er ihn selbst oder ein Foto von ihm schon mal gesehen hatte.
Die Gedanken auf Autopilot, schlug Brunetti den Weg zur Questura ein. Während er den Rio di S. Giovanni überquerte, suchte er das Wasser nach Spuren der Algen ab, die in den letzten Jahren immer weiter in die Stadt vorgedrungen waren. Ein Blick auf den Stadtplan in seinem Kopf sagte ihm, dass sie, wenn es so weit war, den Rio dei Greci [20] heraufkommen würden. Von dem Zeug schwappte mehr als genug an die Riva degli Schiavoni: Es brauchte keine besonders starke Flut, um die Algen in die Eingeweide der Stadt zu drücken.
Und dann sah er die aufdringlichen Schwaden mit der steigenden Flut auf sich zuströmen. Er erinnerte sich an die plattnasigen Baggerboote, die vor einem Jahrzehnt in der laguna herumtuckerten und sich an den riesigen Algenteppichen gütlich taten. Wo waren sie hin, was taten sie jetzt, diese seltsamen, lächerlich mickrigen, aber ach so nützlich gefräßigen Boote? Als er vorige Woche über den Eisenbahndamm nach Venedig fuhr, hatte er links und rechts gewaltige Algeninseln treiben sehen. Boote umfuhren sie; Vögel mieden sie; nichts konnte darunter überleben. Fiel das sonst niemandem auf, oder wurde erwartet, dass alle die Augen davor verschlossen? Oder war die Zuständigkeit für die Gewässer der laguna auf konkurrierende Behörden verteilt – Stadt, Region, Provinz, Magistrato alle Acque –, deren Zuständigkeiten so fest ineinander verkeilt waren, dass sie sich nicht mehr rühren konnten?
Brunettis Gedanken schweiften im Gehen, wohin sie wollten. Wenn er früher Leuten begegnet war, die er schon mal gesehen hatte, hatte er sie gelegentlich wiedererkannt, ohne sich zu erinnern, wer genau sie waren. Oft gesellte sich zu diesem Wiedererkennen der äußeren Erscheinung die Erinnerung an eine emotionale Aura – er fand keinen besseren Ausdruck dafür. Er wusste, dass sie ihm sympathisch oder unsympathisch waren, auch wenn die Gründe für dieses Gefühl ihm ebenso wie ihre Namen längst entfallen waren.
Der Anblick des Mannes mit dem Hals – er musste [21] aufhören, ihn so zu nennen – hatte Brunetti beunruhigt, denn mit der Erinnerung an seine Augenfarbe hatte sich keine Aura eingestellt, nur so etwas wie der Wunsch, ihm zu helfen. Aber so kam er nicht weiter. Der Ort, an dem er den Mann soeben gesehen hatte, ließ keinen Zweifel daran, dass entweder jemand ihm nicht geholfen hatte oder aber er selbst sich nicht zu helfen gewusst hatte. Doch was seinen Beschützerinstinkt geweckt hatte – sein Anblick oder das Gefühl, ihn zu kennen –, das ließ sich nicht mehr rekonstruieren.
Immer noch in Gedanken, gelangte er in die Questura und nahm die Treppe zu seinem Büro. Auf dem letzten Absatz machte er kehrt und ging in den Bereitschaftsraum. Pucetti saß am Computer, den Blick auf den Bildschirm geheftet, während seine Finger über die Tasten flogen. Brunetti blieb in der Tür stehen. Pucetti hätte sich ebenso gut auf einem anderen Planeten befinden können, so wenig nahm er seine Umgebung wahr.
Brunetti beobachtete, wie Pucetti sich verkrampfte und immer heftiger atmete. Der junge Polizist begann vor sich hin zu murmeln, vielleicht sprach er auch mit dem Computer. Und plötzlich entspannte sich erst seine Miene, dann sein Körper. Er nahm die Hände von der Tastatur, starrte noch kurz den Bildschirm an, dann hob er die rechte Hand und stach mit ausgestrecktem Zeigefinger auf eine Taste – wie ein Jazzpianist, der den letzten Ton anschlägt und weiß, jetzt gerät das Publikum in Ekstase.
Pucettis Hand sprang von den Tasten zurück und blieb selbstvergessen neben seinem Ohr in der Luft hängen, sein Blick verharrte auf dem Bildschirm. Was immer er dort sah, ließ ihn aufspringen und beide Arme nach oben reißen wie [22] siegreiche Athleten auf den Sportseiten der Zeitung. »Hab ich dich erwischt, du Schwein!«, rief der junge Polizist, wozu er wild mit den Fäusten fuchtelte und mit dem Oberkörper vor und zurück schwankte. Es war nicht direkt ein Kriegstanz, aber fast. Alvise und Riverre, die auf der anderen Seite des Raum beieinanderstanden, drehten sich verdutzt nach dem Lärm um.
Brunetti kam ein paar Schritte näher. »Was haben Sie getan, Pucetti?«, fragte er. »Wen haben Sie erwischt?«
Mit vor Schadenfreude und Triumph strahlender Miene, die ihn zehn Jahre jünger machte, drehte Pucetti sich zu seinem Vorgesetzten um. »Diese Schweine am Flughafen«, sagte er und unterlegte diese Auskunft mit zwei schnellen Kinnhaken über seinem Kopf.
»Die von der Gepäckabfertigung?«, fragte Brunetti überflüssigerweise. Er hatte selbst fast ein Jahrzehnt lang gegen diese Kofferdiebe ermittelt und immer wieder welche festgenommen.
»Sì.« Pucetti stieß ein wildes Triumphgeschrei aus und machte einen kleinen Luftsprung.
Alvise und Riverre rückten fasziniert näher.
»Wie haben Sie das angestellt?«, fragte Brunetti.
Pucetti riss sich zusammen, stand stramm und ließ die Hände sinken. »Ich habe mir…«, meldete er aufgeregt, dämpfte aber beim Anblick der beiden Kollegen die Stimme, »Informationen über diese Leute besorgt, Commissario.«
Alle Begeisterung war aus Pucettis Gebaren verschwunden; Brunetti verstand den Wink und reagierte betont gleichgültig. »Schön für Sie. Erzählen Sie mir gelegentlich davon.« Dann bat er Alvise: »Könnten Sie mal kurz in mein Büro [23] raufkommen?« Er hatte keine Ahnung, was er dem begriffsstutzigen Alvise sagen sollte, wollte aber die zwei Polizisten von Pucetti ablenken.
Alvise salutierte und warf Riverre einen Blick zu, der nicht frei von Selbstgefälligkeit war. »Riverre«, sagte Brunetti, »könnten Sie zur Wache unten am Eingang gehen und fragen, ob ein Paket für mich gekommen ist?« Und um gleichzeitig der Antwort zuvorzukommen, fügte er hinzu: »Wenn es nicht gekommen ist, brauchen Sie mir das nicht zu melden. Dann kommt es morgen.«
Riverre übernahm derlei Aufgaben dienstbeflissen, und solange sie einfach waren und deutlich genug erklärt wurden, bewältigte er sie im Allgemeinen auch. Er salutierte und wandte sich zur Tür, und Brunetti bedauerte, dass ihm nichts eingefallen war, womit er die beiden zusammen hätte hinausschicken können. »Kommen Sie, Alvise«, sagte er.
Während Brunetti Alvise zur Tür bugsierte, setzte Pucetti sich wieder an den Computer und drückte ein paar Tasten; Brunetti sah den Bildschirm dunkel werden.
[24] 3
Brunetti fand es auf verquere Weise passend, mit Alvise nach oben zu gehen, da jedes Gespräch mit ihm dem Erklimmen eines steilen Bergs ähnelte. Er versuchte sich neben dem langsamer gehenden Polizisten zu halten, um nicht noch überlegener zu wirken. »Ich wollte Sie fragen«, improvisierte Brunetti, als sie oben angekommen waren, »wie Sie die Stimmung unter den Männern beurteilen.«
»Stimmung, Commissario?«, fragte Alvise mit gespannter Wissbegierde. Zum Zeichen seiner Kooperationsbereitschaft lächelte er nervös: Sobald er verstanden hätte, würde er etwas sagen.
»Ob sie sich hier im Haus und mit ihrer Arbeit wohl fühlen«, sagte Brunetti, so unsicher wie Alvise, was er mit »Stimmung« meinen könnte.
Alvise hielt tapfer sein Lächeln aufrecht.
»Da Sie viele der Männer schon lange kennen, nahm ich an, Sie könnten mit ihnen gesprochen haben.«
»Worüber, Commissario?«
Brunetti fragte sich, ob jemand, der ganz bei Sinnen war, Alvise jemals etwas anvertrauen oder dessen Meinung einholen würde. »Oder vielleicht ist Ihnen etwas zu Ohren gekommen.« Kaum hatte Brunetti das ausgesprochen, kam ihm der Gedanke, Alvise könnte sich ausgehorcht fühlen, auch wenn das bei Alvise ebenso unwahrscheinlich war, wie dass er den Hintersinn einer Bemerkung erkannt hätte.
Alvise blieb vor Brunettis Tür stehen und fragte: »Sie [25] meinen, ob es ihnen in der Questura gefällt, Commissario?«
Brunetti lächelte duldsam. »Ja, so kann man es ausdrücken, Alvise.«
»Ich glaube, manchen ja und manchen nein, Commissario«, erklärte er vage und fügte hastig hinzu: »Ich bin einer von denen, denen es hier gefällt. Darauf können Sie sich verlassen.«
Immer noch lächelnd, sagte Brunetti: »Oh, das habe ich nie bezweifelt: Ich war nur neugierig wegen der anderen und hatte gehofft, Sie könnten mir weiterhelfen.«
Alvise lief rot an und fragte unsicher: »Sie möchten bestimmt nicht, dass ich den anderen davon erzähle?«
»Nein, das lassen Sie mal lieber«, antwortete Brunetti; Alvise musste damit gerechnet haben, denn ihm war keine Enttäuschung anzumerken. Erleichtert fragte Brunetti: »Sonst noch etwas, Alvise?«
Der Polizist schob die Hände in die Hosentaschen, senkte den Blick auf seine Schuhe, als stünde die Frage, die er stellen wollte, dort geschrieben, sah zu Brunetti auf und sagte: »Dürfte ich es meiner Frau erzählen, Commissario? Dass Sie mich gefragt haben?«, wobei er das »mich« unbewusst betonte.
Am liebsten hätte Brunetti seinem Untergebenen einen Arm um die Schultern gelegt. »Selbstverständlich, Alvise. Ich weiß doch, dass ich ihr genauso vertrauen kann wie Ihnen.«
»Oh, noch viel mehr, Commissario«, sprach Alvise unfreiwillig ein wahres Wort. Dann eifrig: »Ist es ein großes Paket, Signore?«
[26] Brunetti verstand nicht gleich und wiederholte nur: »Paket?«
»Das Sie erwarten, Signore. Wenn es sehr groß ist, kann ich Riverre helfen, es nach oben zu bringen.«
»Ah, natürlich«, sagte Brunetti und kam sich vor wie der Kapitän der Schulfußballmannschaft, dem ein Erstklässler bei den Sit-ups die Knöchel halten will. »Nein, danke, Alvise«, erklärte er hastig. »Ich weiß Ihr großzügiges Angebot zu schätzen, es ist nur ein Umschlag mit ein paar Akten.«
»Gut, Commissario. Aber ich wollte doch lieber fragen. Falls es was Großes gewesen wäre. Was Schweres, meine ich.«
»Nochmals danke«, sagte Brunetti und klinkte seine Bürotür auf.
Der Anblick eines Computers auf seinem Schreibtisch vertrieb auf der Stelle alle Sorgen um Alvise und dessen Empfindlichkeiten. Er bewegte sich mit einer Mischung aus Beklommenheit und Neugier darauf zu. Man hatte ihm nichts gesagt: Sein Antrag auf einen eigenen Computer lag so lange zurück, dass Brunetti ihn längst vergessen und auch die Hoffnung aufgegeben hatte, dem könnte eines Tages stattgegeben werden.
Auf dem Bildschirm stand die Anweisung: »Bitte ein Passwort wählen und mit ›Enter‹ bestätigen. Zum Speichern des Passwortes drücken Sie zweimal auf ›Enter‹.« Brunetti setzte sich, las die Anweisungen noch einmal und dachte über ihre Bedeutung nach. Signorina Elettra – wer sonst – hatte das arrangiert, hatte zweifellos alles auf den Computer geladen, was er brauchte, und ein System eingerichtet, in das niemand von außen eindringen konnte. Er überlegte: Früher oder später würde er Rat brauchen, dann nämlich, wenn er sich in [27] eine Sackgasse manövriert hätte, aus der er allein nicht mehr herauskäme. Und nur sie, die hinter all dem steckte, würde ihm helfen können. Ob sie sein Passwort brauchte, um ein von ihm angerichtetes Chaos zu entwirren, wusste er nicht.
Und es war ihm egal. Er drückte einmal auf ›Enter‹, und dann erneut.
Der Bildschirm flackerte. Falls er erwartet hatte, dort werde nun eine lobende Bestätigung von ihr erscheinen, so wurde er enttäuscht: Es kamen nur die üblichen Icons der Programme, die ihm zur Verfügung standen. Er öffnete seine E-Mail-Konten, sowohl das amtliche der Questura als auch sein persönliches. Im ersten gab es nichts Interessantes; das zweite war leer. Er tippte Signorina Elettras Büroadresse ein, dann das Wort »Grazie« und schickte es ungezeichnet ab. Er wartete auf das Ping, das den Eingang ihrer Antwort anzeigen würde, aber das blieb aus.
Brunetti, stolz darauf, dass er ohne groß nachzudenken ein zweites Mal auf ›Enter‹ gedrückt hatte, fand es verstörend, wie sehr die Technik auf die Gefühle der Menschen übergegriffen hatte: Jemandem sein Passwort anzuvertrauen hatte heutzutage einen ähnlichen Stellenwert, wie jemandem sein Herz zu öffnen. Oder zumindest seinen Briefkasten. Oder sein Bankkonto. Er kannte Paolas Passwort, vergaß es aber ständig und hatte es sich daher in seinem Adressbuch unter »James« notiert: »madamemerle«, ohne Großbuchstaben, alles in einem Wort, eine befremdliche Wahl.
Er ging ins Internet und staunte über die Geschwindigkeit der Verbindung. Bald würde er sich daran gewöhnen, wenig später würde sie ihm langsam erscheinen.
Kaum hatte er den Namen der Krankheit korrekt [28] eingegeben, Madelung, erschien eine Reihe von Artikeln in Italienisch und Englisch. Er klickte auf Ersteres und kämpfte sich die nächsten zwanzig Minuten beharrlich durch Symptome und Therapievorschläge, ohne viel mehr zu erfahren als das, was Rizzardi ihm bereits gesagt hatte. Fast ausschließlich Männer, fast ausschließlich Trinker, fast immer unheilbar; besonders häufiges Auftreten der Krankheit in Italien.
Er machte den Computer aus und widmete sich erst mal Dringenderem: Er rief im Bereitschaftsraum an und bat Pucetti heraufzukommen. Als der junge Mann eintrat, wies Brunetti auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch.
Während Pucetti Platz nahm, schielte er immer wieder nach Brunettis Computer. Sein Blick sprang zwischen seinem Vorgesetzten und dem Computer hin und her, als habe er Schwierigkeiten, das eine mit dem anderen in Einklang zu bringen. Brunetti verkniff es sich, grinsend zu bemerken, wenn Pucetti seine Hausaufgaben gemacht und aufgeräumt habe, dürfe er auch mal damit spielen. Stattdessen sagte er: »Berichten Sie.«
Pucetti kam direkt zur Sache. »Der, den wir schon dreimal verhaftet haben – Buffaldi –, hat in den letzten zwei Jahren zwei Kreuzfahrten erster Klasse gemacht. In dem Parkhaus am Piazzale Roma steht sein neues Auto. Und seine Frau hat voriges Jahr eine neue Wohnung gekauft: ausgewiesener Preis 250000Euro, tatsächlicher Wert 350000.« Pucetti zählte das an den Fingern auf, dann legte er die Hände gefaltet in den Schoß, zum Zeichen, dass er nichts mehr zu sagen hatte.
»Wie sind Sie an diese Informationen gelangt?«, fragte Brunetti.
Der Jüngere sah auf seine gefalteten Hände nieder. »Ich habe mich mit seiner finanziellen Situation beschäftigt.«
[29] »Das habe ich mir schon gedacht, Pucetti«, sagte Brunetti ruhig. »Aber wie haben Sie Zugang zu diesen Informationen bekommen?«
»Ganz allein, Signore«, sagte Pucetti mit fester Stimme. »Sie hat mir nicht geholfen. Kein bisschen.«
Brunetti seufzte auf. Wenn ein erfahrener Safeknacker seinem Schüler die Fingerkuppen feilt, um sie empfindlicher zu machen, oder ihm beibringt, wie man ein Schloss aufbringt – wer ist dann schuld, wenn der Safe aufgebrochen wird? Oder wenn er, Brunetti, mit seinem Einbrecherwerkzeug eine Tür aufmachte – trug dann der Dieb, der ihm das beigebracht hatte, womöglich eine Teilschuld? Und da Brunetti diese Kunst an Vianello weitergegeben hatte – wie verteilte sich die Schuld, wenn es um die Türen ging, die der Ispettore knackte?
»Es ist bewundernswert, wie Sie Signorina Elettra in Schutz nehmen, Pucetti, und Ihr Geschick ist der beste Beweis, bei wem Sie in die Lehre gegangen sind.« Er verkniff sich ein Lächeln. »Aber ich hatte mit meiner Frage etwas Praktischeres im Sinn: Was haben Sie geknackt, und welche Informationen haben Sie gestohlen?«
Brunetti beobachtete, wie Pucetti gegen seinen Stolz und seine Verwirrung ob des scheinbaren Missfallens seines Vorgesetzten ankämpfte. »Seine Kreditkartenunterlagen, Commissario.«
»Und die Wohnung?«, hakte Brunetti nach, da man Wohnungen schließlich nicht mit der Kreditkarte zu bezahlen pflegte.
»Ich habe den Notar ermittelt, der den Kauf abgewickelt hat.«
[30] Brunetti verkniff sich jede ironische Anmerkung.
»Und ich kenne jemanden, der in der Kanzlei arbeitet«, fügte Pucetti hinzu.
»Wer ist das?«
»Das möchte ich lieber nicht sagen«, antwortete Pucetti mit gesenktem Blick.
»Bewundernswerte Bescheidenheit«, sagte Brunetti. »Und diese Person hat den Preisunterschied bestätigt?«
Pucetti blickte auf. »Nicht den genauen Betrag, Signore, aber sie sagte, als der Kauf mit dem Notar besprochen wurde, hätte niemand ein Geheimnis daraus gemacht, dass der wahre Wert mindestens hunderttausend Euro über dem Kaufwert liege.«
»Verstehe.« Brunetti ließ ein wenig Zeit verstreichen; Pucetti schielte zweimal zu dem Computer hinüber, als wolle er sich das Modell und die Maße merken. »Und wohin führt uns das?«
Pucetti war kaum zu bremsen. »Reicht das nicht, um die Ermittlungen wiederaufzunehmen? Mit seiner Arbeit verdient er etwa fünfzehnhundert Euro im Monat. Wo also hat er das viele Geld her? Er wurde gefilmt, wie er Koffer geöffnet und Sachen herausgenommen hat: Schmuck, Kameras, Computer.« Er brach ab, als sei nicht er es, der Fragen zu beantworten habe.
»Die Videoaufzeichnungen wurden im letzten Prozess nicht als Beweismaterial zugelassen, das wissen Sie, Pucetti, und noch leben wir nicht in einem Land, wo der bloße Besitz von großen Mengen Geld als Beweis dafür gilt, dass es gestohlen wurde.« Brunetti sprach so gelassen wie der Verteidiger, der die Gepäckabfertiger beim letzten Mal vor [31] Gericht vertreten hatte. »Womöglich hat er im Lotto gewonnen oder seine Frau. Womöglich hat er das Geld von irgendwelchen Angehörigen geliehen. Womöglich hat er es auf der Straße gefunden.«
»Aber Sie wissen doch, dass dem nicht so ist«, wandte Pucetti ein. »Sie wissen, was er macht, was diese ganze Bande macht.«
»Was ich weiß und was ein Kläger vor Gericht beweisen kann, sind zwei ganz verschiedene Dinge, Pucetti«, sagte Brunetti mit leichtem Tadel in der Stimme. »Und ich rate Ihnen dringend, das nicht außer Acht zu lassen.« Er sah den jungen Mann zum Protest anheben und hob die Stimme. »Des Weiteren sollten Sie so schnell und so gründlich wie möglich alle Spuren verwischen, die Sie bei Ihren Recherchen zu Signor Buffaldis Finanzen hinterlassen haben könnten.« Er kam dem Einwand Pucettis zuvor: »Wenn es Ihnen gelungen ist, da hineinzukommen, könnte es jemand anderem gelingen, Ihnen das nachzuweisen, und damit wäre Signor Buffaldi für alle Zeiten unangreifbar.«
»Er ist auch jetzt schon ziemlich unangreifbar, nicht wahr?«, sagte Pucetti mit kaum verhohlenem Zorn.
Brunetti sprang darauf an. Ein junger Hitzkopf, der sich einbildete, er könne die Welt verändern: Genau so einer war Brunetti vor ein paar Jahrzehnten selbst gewesen, frisch in den Polizeidienst aufgenommen und versessen darauf, für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Erinnerung holte Brunetti auf den Teppich zurück. »Pucetti«, sagte er, »wir haben uns an das Rechtssystem zu halten, wie es nun einmal ist. Es zu kritisieren ist ebenso sinnlos, wie es zu idealisieren. Sie wissen so gut wie ich, wie eingeschränkt unsere Befugnisse sind.«
[32] Da konnte Pucetti nicht mehr an sich halten: »Aber was ist mit ihr? Wenn sie etwas ermittelt, verwenden Sie das doch.« Wieder spürte Brunetti den Eifer des jungen Polizisten.
»Pucetti, ich habe Sie beobachtet, als ich Ihnen riet, Ihre Spuren zu verwischen: Sie wissen, dass Sie welche hinterlassen haben. Wenn Sie die nicht löschen können, bitten Sie Signorina Elettra, Ihnen dabei zu helfen. Ich möchte nicht, dass dieser Fall noch komplizierter wird, als er ohnehin schon ist.«
»Aber wenn Sie das nicht verwenden…«, fuhr Pucetti auf.
Brunetti brachte ihn mit einem eindringlichen Blick zum Schweigen. »Die Informationen liegen mir vor, Pucetti. Und zwar schon lange, nämlich seit sie die Kreuzfahrten gebucht und das Auto und das Haus gekauft haben. Also gehen Sie jetzt, und verwischen Sie Ihre Spuren, und kommen Sie nie mehr auf die Idee, so etwas ohne mein Wissen und ohne meine Erlaubnis zu unternehmen.«
»Wo ist denn der Unterschied zwischen meinen und ihren Informationen?«, fragte Pucetti wissbegierig, ohne jeden Sarkasmus.
Wie sehr konnte man ihm vertrauen? Wie konnte man ihn davon abhalten, sie alle in juristische Schwierigkeiten zu bringen, und ihn gleichwohl ermutigen, auch mal ein Risiko einzugehen? »Im Gegensatz zu Ihnen hinterlässt sie keine Spuren.«
Brunetti griff nach dem Telefon und wählte Signorina Elettras Nummer. Als sie abnahm, sagte er: »Signorina, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Könnten Sie so lange in mein Büro kommen? Pucetti hat etwas an seinen Recherchen zu [33] korrigieren, und vielleicht können Sie ihm dabei helfen.« Er hörte ihr zu und sagte dann: »Natürlich warte ich, bis Sie hier sind.« Er legte auf, stellte sich ans Fenster und wartete.
[34] 4
Brunetti, der an diesem Vormittag schon drei Tassen Kaffee getrunken hatte, verzichtete auf einen weiteren und ging nach unten ins Labor, um sich bei Bocchese nach Neuigkeiten über den Mann zu erkundigen, den man am Morgen gefunden hatte. Beim Eintreten sah er im Hintergrund zwei Techniker an einem langen Tisch; der eine trug Plastikhandschuhe und nahm nacheinander Gegenstände aus einer Pappschachtel, die der andere offenbar auf einer Liste abhakte. Der mit den Handschuhen machte plötzlich einen Schritt nach links, so dass Brunetti die Sicht auf die Gegenstände versperrt wurde.
Bocchese saß am Schreibtisch in der Ecke über ein Blatt Papier gebeugt und schien eine Zeichnung anzufertigen. Der Laborchef hob nicht den Kopf, als Schritte sich näherten; Brunetti bemerkte, dass die kahle Stelle auf Boccheses Kopf in den letzten Monaten größer geworden war. In seinem unförmigen weißen Kittel hätte man Bocchese ohne weiteres für einen Mönch in einem mittelalterlichen Kloster halten können. Brunetti ließ diesen Gedanken fallen, als er die Zeichnung sah: keine verschlungene Initiale in einem Bibeltext, sondern eine schmale Klinge.
»Ist das die Tatwaffe?«, fragte Brunetti.
Bocchese hielt den Bleistift schräg und schraffierte die Unterseite der Klinge. »Wie Rizzardi sie in seinem Bericht beschreibt«, sagte er und hielt das Blatt hoch, so dass er und Brunetti es betrachten konnten. »Knapp zwanzig Zentimeter [35] lang, zum Griff hin vier Zentimeter breit.« Und mit ruppiger Expertise: »Also ein normales Messer, keins, das er zusammenklappen und in die Tasche stecken konnte. In der Küche gefunden, würde ich sagen.«
»Die Spitze?«, fragte Brunetti.
»Sehr schmal. Aber das ist ja wohl bei den meisten Messern so. Durchschnittliche Breite etwa zwei Zentimeter.« Er klopfte mit dem Radiergummi am Ende des Bleistifts auf die Zeichnung. Dann fügte er ein paar Striche hinzu, so dass die dolchartige Spitze deutlicher hervortrat. »Dem Bericht zufolge weist das Gewebe am Ende der Einstiche Kratzspuren auf – wahrscheinlich beim Hinausziehen der Klinge entstanden«, erklärte er. »Die Einstiche waren nach oben hin geweitet, aber das ist bei Messerverletzungen immer so.« Wieder klopfte er mit dem Radiergummi auf die Zeichnung. »Nach so einem Ding suchen wir.«
»Sie haben keinen Griff gezeichnet«, sagte Brunetti.
»Natürlich nicht«, sagte Bocchese und legte die Zeichnung auf den Tisch. »Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, was für eine Form der gehabt haben könnte.«
»Macht es was, das nicht zu wissen?«, fragte Brunetti.
»Sie meinen, wenn man bestimmen will, um was für ein Messer es sich handelt?«
»Ja. Das meinte ich.«
Bocchese legte eine Hand auf das Papier, neben das breite Ende der Klinge, als wolle er den nicht vorhandenen Griff packen. »Länge mindestens zehn Zentimeter«, sagte er, »wie die meisten Griffe.« Dann überraschte er Brunetti mit dem überflüssigen Zusatz: »Sogar die von Kartoffelschälern.«
Er zog die Hand weg und sah zum ersten Mal zu Brunetti [36] auf. »Zehn Zentimeter sind das Mindeste, wenn es gut in der Hand liegen soll. Warum fragen Sie?«
»Weil so ein sperriges Ding – die Klinge zwanzig, der Griff zehn Zentimeter lang – doch schwer zu transportieren sein dürfte.«
»In eine Zeitung eingeschlagen, in einer Computertasche, in einer Aktentasche; es würde sogar in einen Schnellhefter passen, wenn man es schräg hineinlegt«, sagte Bocchese. »Spielt das eine Rolle?«
»Man läuft nicht grundlos mit einem so großen Messer herum. Und man muss sich überlegen, wie man es unauffällig transportieren kann.«
»Und das deutet auf Vorsatz hin?«
»Offenbar. Schließlich wurde er nicht in der Küche oder in der Werkstatt oder sonstwo getötet, wo zufällig ein Messer herumliegen könnte, oder?«
Bocchese zuckte die Schultern.
»Was soll das heißen?«, fragte Brunetti, lehnte sich gegen den Tisch und verschränkte die Arme.
»Wir wissen nicht, wo es passiert ist. Laut Ambulanzbericht wurde er im Rio del Malpaga gefunden, gleich hinter dem Giustinian-Krankenhaus. Rizzardi sagt, er hatte Wasser in der Lunge, also könnte man ihn überall getötet und in einen Kanal geworfen haben, von wo er dann dorthin getrieben ist.« Bocchese entdeckte eine unsichtbare Unvollkommenheit in der Zeichnung, nahm den Bleistift und trug von der Mitte der Klinge aufwärts noch eine dünne Linie ein.
»Gar nicht so einfach«, sagte Brunetti.
»Was?«
»Eine Leiche in einen Kanal zu werfen.«
[37] »Von einem Boot aus könnte es einfacher sein«, meinte Bocchese.
»Dann hat man Blutspuren im Boot.«
»Fische bluten auch.«
»Und Fischerboote haben Motoren, und nach acht Uhr abends sind keine Motoren mehr erlaubt.«
»Für Taxis schon«, erklärte Bocchese.
»Kein Mensch nimmt ein Taxi, um eine Leiche ins Wasser zu werfen«, knurrte Brunetti, der mit Boccheses Art vertraut war.
Umgehend kam die Replik: »Dann eben ein Boot ohne Motor.«
»Oder eine Wassertür unten am Haus.«
»Wenn man keine neugierigen Nachbarn hat.«
»Ein stiller Kanal, ein Haus ohne Nachbarn, ob neugierig oder nicht«, sagte Brunetti und begann den Stadtplan in seinem Kopf abzusuchen. »Rizzardi meint, es war nach Mitternacht.«
»Vorsichtiger Mann, der Dottore.«
»Gefunden um sechs«, sagte Brunetti.
»›Nach Mitternacht‹«, sagte Bocchese. »Also jedenfalls nicht Punkt Mitternacht.«
»Wo genau hinter dem Giustinian wurde er gefunden?«, erkundigte sich Brunetti nach der ersten Koordinate auf seinem Stadtplan.
»Am Ende der Calle Dogolin.«
Brunetti brummte bestätigend, starrte die Wand hinter Bocchese an und machte sich auf einen unmöglichen Rundweg, sprang, ausgehend von diesem einen Punkt, über Kanäle von einer Sackgasse in die andere und versuchte, allerdings [38] vergeblich, sich die Gebäude ins Gedächtnis zu rufen, die über Türen und Treppen direkt hinunter ins Wasser verfügten.
Schließlich sagte Bocchese: »Fragen Sie lieber Foa nach den Flutzeiten. Der kennt sich aus.«
Daran hatte Brunetti auch schon gedacht. »Ja. Das werde ich tun.« Dann fragte er: »Kann ich mir seine Sachen ansehen?«
»Natürlich. Die müssten inzwischen trocken sein«, sagte Bocchese. Er ging ihm voraus an dem Tisch vorbei, an dem die zwei Männer immer noch die Gegenstände aus der Schachtel katalogisierten, und öffnete linker Hand die Tür zu einem Lagerraum. Darin schlugen Brunetti Hitze und ein unangenehmer, penetranter Geruch entgegen: eine Mischung aus Moder und fauligem Unrat.
An einem Wäscheständer hingen ordentlich gefaltet ein Hemd, eine Hose, Unterwäsche und ein Paar Strümpfe. Brunetti bückte sich darüber, sah aber nichts Besonderes. Darunter stand ein einzelner Schuh: braun, etwa Brunettis Größe. Auf einem kleinen Tisch lagen ein goldener Ehering, eine Uhr mit Stretcharmband aus Metall, ein paar Münzen und ein Schlüsselbund.
Brunetti nahm die Schlüssel, ohne groß zu fragen, ob er sie anfassen durfte. Vier davon sahen aus wie gewöhnliche Türschlüssel, ein weiterer war wesentlich kleiner, und auf dem letzten prangte das unverkennbare VW