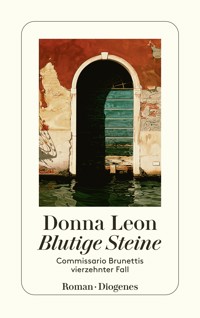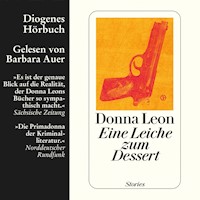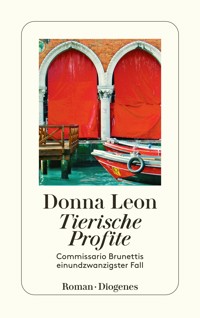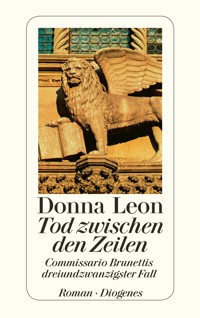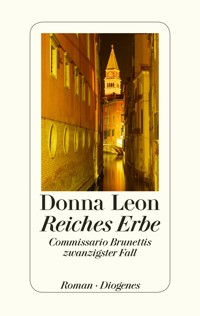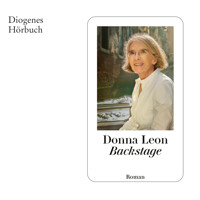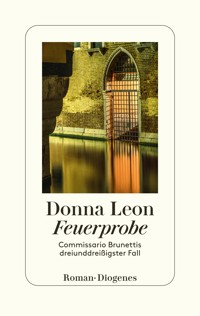
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Scherben auf der Piazza San Marco. Zwei Kinderbanden sind aneinandergeraten, mitten in der Nacht. Während Commissario Griffoni mit weiblichem Gespür herauszubekommen versucht, wie ein Teenager in den Sog eines Flashmobs geraten konnte, nutzt Brunetti seine eigenen Connections. Ja sogar Vice-Questore Patta ist zu allem bereit, um sich und seine Leute vor Vorkommnissen zu schützen, die zumal in einer Touristenstadt wie Venedig nicht willkommen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Donna Leon
Feuerprobe
Commissario Brunettis dreiunddreißigster Fall
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Werner Schmitz
Diogenes
Für Christine Stemmermann
Seht, wie rast der Flammen Glut,
Hört den Schrei der Angst und Wut!
Georg Friedrich Händel, Joshua, II, 29
1
Meist ließen die Beiträge auf Instagram keine Rückschlüsse auf die Zahl der Beteiligten oder einen bestimmten Treffpunkt zu, doch heute Abend hatten sie sich auf die Fondamenta della Misericordia geeinigt – da beschwerte sich jemand aus Castello, das sei ihm zu weit, warum nicht lieber Santa Giustina? Ein anderer meinte, das lohne den Aufwand nicht, warum nicht gleich die Piazzetta dei Leoncini? Die sei näher, und was sie dort veranstalteten, bliebe nicht unbemerkt.
Keine zehn Minuten später stürmten zwei Babygangs auf die Piazzetta, die eine aus der Calle de la Canonica, die andere vom Uhrturm her. Schon prallten sie aufeinander, lautlos bis auf ab und an ein Stöhnen und das Geräusch, das eine Faust macht, wenn sie auf eine Schulter prallt oder gegen einen Kopf. Rasch verschmolzen die Jungen zu einem Knäuel aus Körperteilen, stürzten, sanken auf die Knie, wurden umgestoßen, kamen wieder hoch, landeten einen Treffer auf einem Nacken und schlugen, wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggeschlagen wurde, der Länge nach aufs Pflaster.
Eine Gang war größer als gewöhnlich: Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten zwölf Personen, davon sechs Unbekannte. Die zweite Gang bestand aus zehn Jungen, von denen einer mit einer Eisenstange ein Schaufenster eingeschlagen hatte, um sich jetzt zusammen mit zwei anderen die Taschen mit Brillengestellen vollzustopfen.
Pech nur, dass das Hin und Her über den Treffpunkt und den besten Weg dorthin sowie die prahlerischen Posts, die sie absetzten, so viel Zeit gekostet hatten, dass die Gangs gerade beim Schichtwechsel der Polizei auf der Piazza San Marco eintrafen. So hörte eine doppelte Mannschaft in der Wache neben dem Caffè Florian die Rufe aus Richtung Basilica, und fünf Polizisten stürmten auf die Piazza, um zu sehen, was los war.
Hinzu kam, dass zwei weitere Polizisten – auf Sonderstreife von elf Uhr abends bis fünf Uhr morgens, eine Maßnahme, die nachts für Sicherheit in der Stadt sorgen sollte – in dem Moment die Piazza überquerten. Die Jungen – viele ohnedies bereits zu der schmerzlichen Erkenntnis gelangt, dass die ausgeteilten und eingesteckten Schläge kein Vergleich waren zu einer Partie Basketball – sahen sich plötzlich wehrlos sieben Ordnungshütern gegenüber.
Beim Anblick der mit Schlagstöcken und Pistolen im Gürtel bewaffneten Polizisten wich ihr Kampfgeist kaltem Angstschweiß. Obwohl zahlenmäßig eigentlich in der Übermacht, platzte die Seifenblase ihres Heldenmuts angesichts der Waffen der Polizisten. Der Jüngste machte sich in die Hose, ein anderer verbarg das Gesicht in den Händen, ein Dritter hockte sich auf einen Stapel passarelle, die für das nächste acqua alta bereitlagen.
Den Polizisten entging nicht, welchen Schreck sie den Jungen einjagten, und so setzten sie eine strenge Miene auf und trieben die Knaben wie Cowboys ihre Herde mit knappen Kommandos zur Wache. Wobei zwei der Jungen statt der Kuhfladen eine Spur aus eilig abgeworfenen Brillengestellen hinterließen.
Macaluso, der Sergente, der das Geschehen von der Eingangstreppe der Wache aus verfolgt hatte, ging hinein, nahm einen Packen Formulare aus der Schreibtischschublade und legte ein Dutzend Stifte bereit.
Als die ersten Jungen eintrafen, zeigte er darauf: »Nehmt jeder ein Blatt und einen Stift, füllt alles aus und gebt es mir, wenn ihr fertig seid.«
Der kleinste Junge meldete sich: »Bitte, Signore, darf ich telefonieren?« Er war den Tränen nah. Doch der Polizist, der selbst drei Kinder hatte, stand auf und brüllte »Silenzio« und erklärte, als Ruhe eingekehrt war: »Nein, du darfst jetzt nicht telefonieren. Erst wird das Formular ausgefüllt. Dann steht jedem von euch ein Anruf zu.« Ein Junge in der hinteren Reihe nahm sein Handy aus der Tasche und begann zu tippen.
»Andolfatto, nimm ihm das Handy ab«, befahl der Sergente, und der Polizist entriss es dem Jungen, bevor er es wegstecken konnte.
»Das ist mein …«, weiter kam er nicht, denn sein Gegenüber bedachte ihn mit einem so eisigen Blick, dass dem Jungen die Worte im Mund gefroren. Andolfatto warf das Handy lässig vorne auf den Schreibtisch.
Ein anderer Junge versuchte hinter vorgehaltener Hand eine Botschaft einzutippen, doch das Display seines Handys spiegelte sich in der Brille seines Nachbarn. Der Sergente sah das Flackern und stand auf. Das Handy verschwand. Macaluso griff nach dem Papierkorb neben seinem Tisch und kippte den Inhalt auf den Boden. Zerrissene Formulare, gebrauchte Kleenex, drei oder vier zerknüllte Stadtpläne von Venedig und sechs oder sieben Kaffeebecher aus Pappe. Nach einem prüfenden Blick in den Korb baute sich der Sergente vor den Jungen auf.
»Alle mal herhören. Zwei von euch haben Mist gebaut. Jetzt müsst ihr alle dafür büßen.« Er drückte dem erstbesten Jungen den Papierkorb in die Arme. »Euer Freund sammelt hier hinein eure Handys ein.« Lautes Stöhnen ertönte, dann ein entrüstetes »Aber …«
Wie eine Schlange zischte der Sergente auf einen etwa Fünfzehnjährigen zu, der größer und deutlich kräftiger gebaut war als er. »Wolltest du was sagen, Kleiner?«, fragte er tonlos. »Kannst es wohl nicht erwarten, Mama und Papa anzurufen, wie? Ihr werdet das von meinem Telefon aus tun müssen, einer nach dem anderen.« Und zum Rest der Jungen: »Wenn euch das nicht passt, beschwert euch bei euren Kollegen.«
Damit ging er hinter seinen Schreibtisch zurück.
Als der Junge mit dem Papierkorb die Runde gemacht hatte, nahm er unaufgefordert sein eigenes Handy aus der Jackentasche und legte es vorsichtig zu den anderen.
»Sind das alle?«, fragte der Sergente.
»Ja, Signore.«
»Wie viele?«
»Zweiundzwanzig, Signore«, sagte der Junge und senkte den Kopf. Leiser fügte er hinzu: »Galvani hatte zwei.« Der Sergente musterte den Jungen und bemerkte erst jetzt dessen Furcht, sich Vorwürfe einzuhandeln.
Er beugte sich über den Schreibtisch und flüsterte grinsend, sodass nur der Junge es hören konnte: »Meinst du, er ist schizophren?« Als der andere nicht reagierte, fügte er hinzu: »Weil er zwei Telefone braucht?«
Der Junge verstand nicht gleich, dann aber unterdrückte er ein Lächeln und sagte: »Ja, Signore.«
Von hinten meldete sich eine Stimme: »Signore?«
»Ja?«
»Gibt es hier eine Toilette?«
Ein paar Jungen kicherten.
»Und wenn ich euch sage«, erwiderte der Sergente, »die ist für alle außer Betrieb, die herumgegackert haben, und dass es noch einige Stunden dauern wird, bis man euch hier abholt – vergeht euch dann das Lachen?«
Er wandte sich dem Jungen zu, der die Frage gestellt hatte: »Am Ende des Flurs, rechts.«
Macaluso sammelte die ausgefüllten Formulare ein, sortierte sie alphabetisch und begann mit den Anrufen; er stellte sich jeweils mit Rang und Namen vor, erklärte, der Sohn sei in Polizeigewahrsam und müsse in der Wache an der Piazza San Marco abgeholt werden. Einige Eltern reagierten entsetzt, andere wütend, wiederum andere erschrocken; einige protestierten, aber da Macaluso keine weiteren Auskünfte gab, erklärten sich alle schließlich bereit zu kommen. Mittlerweile hatten die Jungen sämtliche Stühle besetzt, etliche lagerten auf dem Boden. Nachdem Macaluso die Eltern angerufen hatte – nur einmal nahm niemand ab –, rief der Sergente in der Questura an und bat, den Commissario mit Nachtdienst zu kontaktieren, dann trug er Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum und Adresse der Jungen in den Computer ein.
Commissario Claudia Griffoni, Diensthabende in dieser Nacht, traf elf Minuten vor zwei in der Wache ein. Sie trug eine beige Hose, Sneaker, eine beige Wildlederjacke und einen roten Kaschmirschal. Der Sergente stand auf, als sie eintrat, salutierte aber nicht. »Das hier sind die Mitglieder der Gangs«, sagte er knapp. »Sie waren auf der Piazzetta.«
Ihr Blick glitt über die schläfrige Schar.
Zwei hoben den Kopf, taxierten Griffoni, einer ließ ein Pfeifen ertönen.
Commissario Griffoni musterte die beiden gelangweilt, wandte sich an den Sergente und erklärte trocken: »Paragraf 341b Strafgesetzbuch: Beleidigung eines Beamten in Ausübung seiner Pflicht. Rufschädigung. In der Öffentlichkeit verübt …«, sie legte eine Kunstpause ein und wies über die versammelte Schar, »… kann dies mit einer Haftstrafe von sechs Monaten bis drei Jahren belegt werden.«
Griffoni hielt eine Hand an die Stirn, wie jemand, der bei grellem Tageslicht etwas in der Ferne zu erkennen versucht. »Junger Mann«, sagte sie zu dem, der gepfiffen hatte, »was gibt es?«
»Nichts.«
»Nichts? Nichts, und weiter? Mein Name ist Claudia Griffoni, und ich bin Commissario bei der venezianischen Polizei.«
Der Junge kapierte nicht, was sie ihm damit sagen wollte.
Nachdem sie vergeblich auf eine Antwort gewartet hatte, erklärte sie: »Dann frage ich meinerseits nach dem Namen.«
»Alessandro Berti.«
»Und, Signor Berti, wie heiße ich?«
»Claudia Griffoni.«
»Haben Sie vielleicht etwas vergessen, Signor Berti?«
Es widerstrebte ihm, sich zu beugen, doch Griffoni war entschlossen, notfalls die ganze Nacht auszuharren.
»Commissario Griffoni«, sagte er.
Sie lächelte, wenn auch nur schwach.
Nach einer Weile trafen die ersten Eltern ein. Griffoni überließ es dem Sergente, deren Personalien zu überprüfen, Fragen zu beantworten und den Papierkram zu erledigen. Am Ende musste jeder Junge sein Handy eigenhändig aus dem Papierkorb heraussuchen.
Vier Uhr war schon lange vorbei, als schließlich alle Jungen, bis auf einen, von den fassungslosen bis gleichgültigen Eltern abgeholt worden waren. Einige Mütter schienen in Sorge über das, was ihr Sohn getan hatte beziehungsweise was gegen ihn vorlag; andere wirkten nicht überrascht.
Als nur noch einer übrig war, gab Griffoni ihm das letzte Handy und fragte, ob er es noch einmal bei seinen Eltern versuchen wolle und wie er heiße.
»Orlando Monforte, Dottoressa«, antwortete der Junge und erzählte, er wohne in Castello bei seinem Vater. Er streckte ihr das Handy entgegen und erklärte, sein Vater schalte seins um elf Uhr abends aus. »Er kann nicht rangehen«, sagte er kleinlaut. Und mit einem Blick in die Runde: »Kann ich nicht hierbleiben, Dottoressa?«
Er war klein, kleiner als Griffoni, doch seine breiten Schultern schienen nur darauf zu warten, dass der Rest seines schmächtigen Körpers es ihnen nachtat und ihn groß und stark werden ließ. Er hatte braune Augen, eine kurze Nase, eng anliegende Ohren: ein Alltagsgesicht, wäre da nicht sein wacher, neugieriger Blick. Er erinnerte sie an ihren Neffen Antonio.
»Und auf dem Fußboden schlafen?«, fragte Griffoni.
»Auf einem Stuhl. Jetzt sind ja genügend frei«, sagte er. Das Lächeln machte ihn noch jünger, fast zu einem Kind, und irgendwie zerbrechlicher.
Sein Formular lag als letztes auf dem Schreibtisch. Griffoni sah es sich an. »Stimmt die Adresse? Castello 3165?«
»Ja, Commissario.«
»An der Salizada San Francesco, nicht weit von La Beppa?«, nannte sie ein Geschäft im tiefsten Castello, wo es alles Erdenkliche, von Eisenwaren über Schuhe, Hemden und Pullover bis hin zur Unterwäsche, zu kaufen gab.
»Woher wissen Sie, wo das ist?«, fragte er. »Wir sind die Einzigen, die dorthin gehen.«
»Wir?«, fragte sie.
»Die Leute aus dem Viertel.« Als Griffoni nichts sagte, erklärte er: »Ich war nur überrascht, dass Sie das kennen, weil Sie nicht aus unserem Viertel sind.«
»Warum sagst du das?«
»Mit Verlaub, Commissario, nicht mit Ihrem Akzent.« Er bückte sich und schnürte seine Sneaker.
»Heißt das, nur Venezianer leben in Venedig?«
»Das wäre wunderbar, nicht wahr?«, sagte er mit der Überzeugung, dass jeder ihm zustimmen würde.
»Ich lebe hier, und ich bin keine Venezianerin.«
Lächelnd, um sie auf den Scherz vorzubereiten, sagte er: »Was Sie nicht sagen«, und dann mit winziger Verzögerung: »Commissario.«
Sie lachte. »Hast du einen Schlüssel?«
»Ja, Dottoressa.«
Griffoni fragte den Sergente, der im Gazzettino von gestern las und nicht zugehört hatte: »Meinen Sie, ich könnte mich an Eltern statt um ihn kümmern, Sergente?«
Er ließ die Zeitung sinken und sah zwischen ihr und dem Jungen hin und her. Offenbar kam er zu dem Schluss, dass keiner von ihnen für den anderen eine ernsthafte Gefahr darstellte. »Falls das heißt, Sie möchten ihn nach Hause bringen, Commissario, halte ich das für eine gute Idee«, sagte er, indem er eine Hand von der Zeitung löste und auf die Wache wies. »Das ist kein Ort, an dem ein junger Mann wie er die Nacht verbringen sollte.«
Sie fragte den Jungen: »Bist du einverstanden, Orlando?«
»Ja, Dottoressa. Ich stimme dem Sergente zu: Das ist eine gute Idee.«
Und schon traten sie auf die jetzt fast menschenleere Piazza hinaus; nur zwei Müllmänner fegten gemächlich das Pflaster.
Griffoni sah auf die Uhr: Irgendwie war es 5 Uhr 32 geworden. Dienstag, er würde also zur Schule müssen. »Wann fängt deine erste Stunde an?«
»Um acht.«
»Dann hast du noch Zeit, nach Hause zu gehen. Was wird dein Vater sagen, wenn du so spät heimkommst?«
Leichthin, als interessiere ihn das Thema nicht weiter, sagte Orlando: »Er wird noch schlafen.« Großspurig fügte er hinzu: »Ich kann nach Hause kommen, wann ich will.«
Überrascht und besorgt zugleich, fragte sie: »Gefällt dir das?«
Orlando schob die Hände in die Taschen seiner Jeans und beriet sich mit seinen Füßen. Als er zu einer Entscheidung gelangt war, sah er zu ihr auf und sagte: »Nicht besonders, nein. Es wäre schön, wenn er sich mehr um mich kümmern würde.«
»Ist das der Grund …« Weiter kam sie nicht, denn Orlando war schon die drei Stufen hinuntergesprungen und ein Stück weit nach rechts vorausgelaufen. Er drehte sich um und beschrieb mit dem Arm einen weiten Bogen, der sie einlud, ihm zu folgen.
2
Während er in der kühlen Morgenluft auf Griffoni wartete, lief der Junge auf der Stelle und pumpte mit den Armen. Als sie die Stufen herunterkam, suchte er ihren Blick. Sie merkte das, beachtete ihn aber nicht weiter, sondern ging mitten über die Piazza. Er stürmte auf sie zu, umkurvte die langsam Schlendernde im letzten Augenblick, sprintete dann am anderen Ende der Piazza um ein paar Säulen herum und kam wieder auf sie zu gerannt.
Diesmal wurde er langsamer und blieb schließlich neben ihr stehen. Wie nach einem Wettlauf stützte er weit vorgebeugt die Hände auf die Knie und japste nach Luft.
Nahtlos ihre Unterhaltung fortsetzend, meinte Griffoni: »Als ich neu war in Venedig, war ich mehrmals die Woche zu so früher Stunde hier.«
Immer noch keuchend, den Blick aufs Pflaster geheftet, fragte er: »Warum?«
»Warum was?«, fragte sie und schaute ihn an. Von ihrem Blick ermutigt, richtete er sich auf.
»Warum sind Sie hergekommen?«
Sie starrte ihn an, und erst nach einer Weile fragte sie: »Hast du deine Augen in der Polizeiwache gelassen?«
Er schlang die Arme um sich, fröstelnd in der Morgenkälte. Er trug Jeans und Jeansjacke, darunter nur ein T-Shirt.
»Auch Fremden fällt sie auf, musst du wissen«, sagte Griffoni gut gelaunt, als sei Schönheit ein Reichtum, der großzügig verschenkt würde. Sie zuckte mit den Schultern und ging weiter Richtung Ponte della Paglia und Castello. Es gab einen kürzeren Weg, doch Griffoni bevorzugte die freie Sicht über die endlose Weite des Bacinos.
Sie ging in ihrem normalen Tempo, alles und jeden im Blick, der auf sie zukäme. Und sollte sie sich vergewissern wollen, was hinter ihr vor sich ging, so gab es genug Schönes zu sehen, um zu rechtfertigen, dass sie sich umwandte. Der Junge hielt sich, wie sie an seinen Schritten hörte, links hinter ihr, sodass ihr Blick ungehindert über das Bacino schweifen konnte.
»Mich hat nur die frühe Stunde gewundert. Nicht, dass Sie hierherkommen. Jeder, der Augen im Kopf hat, möchte das sehen«, sagte er mit leisem Nachdruck, als sollte sie nur ja keinen falschen Eindruck von ihm bekommen.
»Ich bin so in aller Herrgottsfrüh hin, weil ich dann noch ungestört sein konnte.«
Er lachte befreit, warf – typisch für sein Alter – plötzlich alle Schüchternheit über Bord und lief wieder voraus. Unterdessen war es heller geworden, auch wenn die Sonne sich noch nicht blicken ließ, wärmer hingegen nicht. Es war einer dieser Frühlingstage, an denen die Sonne, erschöpft von der Anstrengung der letzten Tage, bis zum Mittag in den Federn blieb.
Vor der nächsten Brücke hielt Griffoni unter dem Sottoportego vor einer Bar. Sie wusste, die öffnete für die Leute, die um sechs zur Arbeit unterwegs waren. Sie bat den Barmann um zwei Kaffee, nachdem der Junge genickt hatte. Dann wies sie mit dem Kinn auf die Brioches in der Plastikvitrine, sagte »Due« und korrigierte schnell zu »Tre«. Während der Barmann den Kaffee machte, deutete er mit dem Kopf auf einen kleinen runden Tisch im Hintergrund. »Da ist es wärmer«, sagte er und ließ zwei Espresso heraus.
Die Wärme tat beiden gut. Der Junge hatte seinen Kaffee und die zwei Brioches bereits verdrückt, noch bevor Griffonis Tasse leer war. Sie schob ihm ihren Teller hin und bat den Barmann um eine vierte Brioche. Der kam und stellte sie vor Griffoni, und auch die schob sie Orlando hin. Beide bestellten noch einen Kaffee, und während sie ihn tranken, sprachen sie darüber, wie kalt es draußen noch sei und wann es wohl endlich richtig Frühling werde, dies und das, Hauptsache, sie konnten noch etwas länger in ihrer warmen Ecke sitzen bleiben. Der Barmann ignorierte sie.
Ein paar Leute kamen herein, beachteten die beiden nicht weiter und tranken ihren Kaffee, ohne zu prüfen, wie heiß er war, so sehr hatten sie ihn nötig. Zwei alte Männer, einer dick und einer dünn, bestellten Fernet-Branca mit Grappa und kippten ihn hinunter, als halte nur er sie am Leben.
Als die Männer gegangen waren, erhob sich Griffoni, kam dem Jungen mit Bezahlen zuvor, und sie traten hinaus. Frisch gestärkt fanden sie die riva gar nicht mehr so unwirtlich, jedenfalls warm genug, um Seite an Seite ein Weilchen am Ufer zu sitzen und schweigend aufs Wasser zu schauen. Ab und zu wiesen sie einander stumm auf etwas hin, indem sie sich mit dem Ellbogen anstießen.
Zeit verging, und irgendwann nahm Griffoni ihren Schal ab und gab ihn Orlando, der zu zittern begonnen hatte. Der wies das Angebot zurück, doch sie wickelte ihm den Schal um den Hals und machte sich gleich wieder auf den Weg, hatte plötzlich nur noch Augen für die Ankunft eines Vaporettos, etwas, das sie schon Hunderte Male beobachtet hatte.
Griffoni beschleunigte ihre Schritte und eilte weiter bis zur dritten Brücke, wo Orlando sie schließlich einholte, den Schal um den Hals, die Enden vorn in seine Jacke gesteckt. Das Rot stand ihm gut, besonders jetzt, da auch sein Gesicht Farbe bekommen hatte.
Unterdessen tauchten die ersten Fußgänger auf, mehr Männer als Frauen, ein Drittel davon mit Hunden. Boote vom Lido brachten Touristen, die sich auf ihren iPhones anschauten, wie Venedig aussah. Die Souvenirhändler schoben die fahrbaren Verkaufsstände zu ihren Standplätzen und breiteten ihre Ware aus. Auf abgezäunten Flächen hinter ihnen lagerte Baumaterial für Reparaturarbeiten an der riva; die Arbeiter würden nicht vor acht Uhr anfangen.
»In welche Klasse gehst du?«, fragte Griffoni.
»Zweites Jahr auf der Oberschule.«
»Irgendein Fach, das sich lohnt?«
Die Frage überraschte ihn. »Nur Mathe«, sagte er nach einigem Nachdenken.
Griffoni blieb abrupt stehen. »Mathe?« Orlando nickte, und sie fragte: »Warum?«
Ohne zu zögern antwortete er: »Weil es so klar ist.«
Sie riss sich vom Anblick San Giorgios los, sah Orlando an und fragte: »Wie meinst du das?«
Vielleicht hatte ihn noch nie jemand danach gefragt, auf alle Fälle wirkte er überrumpelt. Er sah zu San Lazzaro hinaus: Vielleicht wussten die Mönche auf der Insel eine Erklärung? Er schob die Hände in die Taschen, wippte auf den Zehen und meinte schließlich: »Mathe ist anders als Geschichte, italienische Literatur, Religion oder all die anderen Fächer. Mathe ist einfach da. Man stellt eine Frage, und Mathe gibt die Antwort. Mathe, das sind Regeln, und die ändern sich nicht, egal wie sehr man dich anfleht oder dir Druck macht, das zu erwidern, was ein anderer gern hätte.« Er wippte noch ein paarmal auf und ab, dann hatte er genug und ließ es sein.
»Wahrscheinlich der Grund, warum ich Mathe nie besonders leiden konnte«, sagte Griffoni und fügte mit rauer Stimme in einigermaßen verständlichem Napolitano hinzu: »Wir haben was gegen Regeln.«
Er fuhr ruckartig zu ihr herum und sah sie lange an. »Sind Sie sicher, dass Sie für die Polizei arbeiten?«
»Jetzt kann ich sagen, was ich will. Meine Schicht ist seit sechs Uhr vorbei.«
Ab einem bestimmten Punkt forderte sie ihn auf, die Führung zu übernehmen, weil er sich in der Gegend besser auskannte und schneller nach Hause finden würde. Zwei calli später bog er nach links ein, weg vom Wasser. Wo entlang sie gingen interessierte Griffoni weniger als die Leichtigkeit, mit der Orlando sich durch die Massen schlängelte, die ihnen mittlerweile entgegenkamen, Arbeiter auf dem Weg zu den Vaporetti, welche sie zum Bahnhof oder zu den Bussen am Piazzale Roma und von dort aufs Festland zur Arbeit brachten.
Sie hatte gelesen, noch vor fünfzig Jahren hatte Venedig fast 150000 Einwohner: Heute war ein Drittel davon übrig. Es gab kaum Arbeit, es gab kaum Arbeit, es gab kaum Arbeit. So einfach war das. Also setzten die einen für den Tag auf die terraferma über, während andere vom Festland zum Arbeiten in die Altstadt kamen. Viele von Griffonis Kollegen wohnten in Dolo, Noale, Quarto d’Altino, Mestre, Marghera, jenen Satellitenstädten, die das Land in einen einzigen Parkplatz verwandelt hatten.
Sinnlos, jetzt darüber nachzudenken, schließlich hatten Orlando und seine Generation nie ein anderes Venedig gekannt als das, in dem sie aufgewachsen waren. Außerdem war Griffoni selbst erst nach Orlandos Geburt zum Arbeiten nach Venedig gekommen – frühere Besuche als Touristin zählten nicht. Also kannte sie keine gute alte Zeit und hatte kein Recht, sich über die Touristen zu beschweren.
In diese Gedanken versunken, war sie immer langsamer geworden – und hatte Orlando dabei aus den Augen verloren. Sie ging schneller, gelangte auf einen kleinen campo, von dem drei verschiedene calli abzweigten, und wusste nicht mehr weiter. An einer Ecke war ein Metzger, ihm gegenüber ein Schmuckgeschäft. An der nächsten Ecke eine Bar. Oder besser gesagt mehr als das, es gab dort auch Pizzastücke auf die Hand, die man am Tresen verzehren und dazu Bier oder Wein aus Plastikbechern trinken konnte – falls man sich nicht an einen winzigen Tisch setzen und die Speisekarte studieren wollte.
Dann entdeckte sie an einer der Ecken eine weiße Straßentafel: Salizada S. Francesco. Sie sah auf dem Foto nach, das sie von Orlandos Formular gemacht hatte: »Castello 3165«, fast als sei Orlando ein Paket, das es abzuliefern galt; sie sah sich um: Noch waren die Nummern um sie herum tiefer. Doch was sollte sie mit dieser Zahl anfangen? Sinnlos. Hoffnungslos. Kein Mensch durchschaute das System, höchstens vielleicht die postini, und die auch nur, wenn sie die Route seit vielen Jahren gingen und dahintergekommen waren, wie verschlungen die Hausnummern aufeinanderfolgten. Castello 3165 musste nicht der unmittelbare Nachbar von Castello 3164 oder Castello 3166 sein. Es konnte am Ende der calle liegen, um die Ecke, drei oder vier Häuser weiter. Wie lange lebte sie jetzt schon in Venedig? Niemand hatte sie je nach ihrer Hausnummer gefragt, so wie sie selbst keine Hausnummer von anderen kannte.
Als sie den Blick von der Straßentafel abwandte, entdeckte sie plötzlich ihren Schal, der aus Orlandos Kragen heraushing. Der Junge stand am Tresen und aß ein dicht mit Fleisch und Gemüse belegtes Stück Pizza. Sie ging hinein. Fünf Männerköpfe drehten sich nach ihr um, als sie sich neben ihn stellte und sagte: »Ah, da bist du ja.«
»Darf ich Ihnen etwas anbieten, Dottoressa?«, fragte er. Offenbar hielt er es für klüger, sie nicht mit »Commissario« anzureden. Auch achtete er darauf, sie weiterhin zu siezen.
»Das ist sehr freundlich«, antwortete sie, »aber Pizza zum Frühstück ist nichts für mich.«
Einer der fünf Männer an der Bar, der ein Stück Pizza mit Salami und Zwiebeln aß und sein Bier schon halb ausgetrunken hatte, sagte: »Orlando isst zu jeder Tageszeit alles, was er kriegen kann.«
Ein anderer klopfte dem Jungen so kräftig auf die Schulter, dass Griffoni davon zu Boden gegangen wäre. »Wohnt in dem Haus gleich da drüben«, sagte er und zeigte auf eine Tür linkerhand. »Wir Nachbarn achten darauf, dass er pünktlich zur Schule geht und genug zu essen bekommt.«
Orlando wandte den Blick ab, doch als daraufhin der Spiegel sein Bild zurückwarf, schaute er schnell zu Boden. Sie legte ihm eine Hand auf den Arm und sagte in die Runde: »Und Sie alle hier haben in seinem Alter nur wie die Vögelchen gegessen.«
Der Mann mit der Pizza nahm die Hand vor den Mund und begann zu husten. Sein Nachbar schlug ihm auf den Rücken, bis er sich beruhigt hatte, griff dann nach seinem Plastikbecher, prostete Griffoni anerkennend zu und leerte sein restliches Bier in einem Zug.
Grinsend verkündete er: »Gut gegeben, Signora. Uns allen die Hammelbeine lang gezogen.« Er sah sie sich genauer an und schien überhaupt nichts Seltsames daran zu finden, dass diese Frau hier bei ihnen an der Theke stand. »Sie sind nicht zufällig Lehrerin, Signora?«
»Dottoressa«, korrigierte Orlando ihn hastig.
»Natürlich. Dottoressa.«
»Ach, du liebe Zeit«, murmelte Griffoni verlegen. »Hätte nicht gedacht, dass man mir das so sehr anmerkt.« Sie tauschte einen Blick mit Orlando. »Ja, das bin ich. Orlandos Mathematiklehrerin.« Dann setzte sie eine strenge Miene auf: »Vergiss deine Hausaufgaben nicht, Orlando.« Sie sah lächelnd in die Runde, verabschiedete sich, ging hinaus und überließ dem Jungen alles Weitere.
3
Auch wenn Griffoni an diesem Tag dienstfrei hatte, musste sie in die Questura zurück und einen Bericht verfassen; vorher aber leistete sie sich noch eine Runde »Orientierungsflug«, ein Spiel, das sie vor Jahren erfunden hatte, zwei Wochen nachdem sie in ihre Mietwohnung in Venedig eingezogen war. Eines Morgens Ende Oktober hatte sie früh um halb sechs die Wohnung verlassen und dabei ihren Stadtplan, den sie sich in der zweiten Woche zugelegt hatte, mit Absicht liegen gelassen, weil sie es leid war, sich ständig zu verlaufen.
Die Hausnummer ihrer Wohnung half nicht weiter, nur dass sie in Dorsoduro lag, eine Brücke hinter »Tonolo«. Diese Pasticceria leistete ihr so gute Dienste wie ein Leuchtturm. Sie brauchte nur ihren berühmten Namen zu nennen, egal wie weit sie vom Weg abgekommen war, und jeder Venezianer konnte ihr erklären, wie sie nach Hause kam. Ihren eigenen Ermittlungen nach hatte die Pasticceria ihren Ruf zu Recht: Kaffee und Kuchen dort waren fantastisch und zählten zum Besten, was die Stadt zu bieten hatte.
Sie musste nur den Campo Santa Margherita überqueren und dem Kanal an Santa Maria dei Carmini entlang folgen, und schon wusste sie nicht mehr, wo sie war. Das Orientierungstraining begann zwanzig Minuten später: Nun hieß es kehrtmachen und ohne fremde Hilfe nach Hause finden. Einen Monat lang hatte sie an ihren freien Vormittagen »verlaufen« gespielt und war dabei bisweilen schwer in die Irre gegangen. Und doch hatte sie nie nach dem Weg gefragt und Rat nur angenommen, wenn sie von alten Frauen mit Spazierstöcken kam, deren ganzes Glück es war, einer anderen Frau zu helfen, die nicht mehr weiterwusste.
An einem jener Morgen war sie genau hier in der Salizada San Francesco gestrandet und hatte sich vorgestellt, sie sei eine venezianische Hausfrau auf der Suche nach Küchenutensilien: Knoblauchpressen, Parmesanreiben, Korkenzieher, Einfülltrichter. All das lag hier immer noch im Schaufenster, doch sie selbst wusste mittlerweile genau, wo sie war. Unwillkürlich wandte sie sich nach links, dann nach rechts, überquerte die Brücke und gleich noch eine, ging geradeaus weiter Richtung Krankenhaus und kehrte bei Rosa Salva ein, das bereits geöffnet hatte.
Dort genehmigte sie sich einen weiteren Kaffee, und auch die Brioche hatte sie für sich. An den Jungen dachte sie kaum noch, als sie den Weg zur Questura antrat, dem sie so kundig folgte wie ein Ureinwohner Amerikas den Hufspuren eines Hirschs.
Kurz nach acht saß sie bereits in ihrem Büro, schrieb ihren Bericht über die Ereignisse der Nacht und erwähnte tunlichst, dass sie einen auf der Wache zurückgebliebenen Jungen nach Hause begleitet hatte. Sie fügte das Foto von seinem Formular als Beleg an und verwies ansonsten für die Personalien der Beteiligten auf den Bericht des Aufsicht führenden Sergente.
Als der Pförtner Griffoni eine halbe Stunde später meldete, Commissario Brunetti sei vor Kurzem eingetroffen, ging sie geradewegs nach unten und klopfte bei ihm an.
Sie hörte ein »Avanti« und trat ein. Brunetti stand, auf beide Arme gestützt, weit vorgebeugt am Fenster und spähte zu dem verlassenen Garten auf der anderen Seite des Kanals hinüber.
»Was machst du da, Guido?«, fragte sie.
Er lehnte sich zurück und schloss das Fenster. »Wollte nach den Blumen sehen«, sagte er und klopfte sich den Staub von den Händen.
»Blühen sie schon?«
»Gestern waren jede Menge Knospen zu sehen. Hat mich neugierig gemacht.«
»Das ändert alles, nicht wahr?«, meinte Griffoni. »Wenn sie zu blühen anfangen.«
»Der Frühling«, bekräftigte Brunetti ohne nachzudenken, »gibt mir immer das Gefühl, oder die Hoffnung, dass wir noch einmal eine Chance bekommen.«
»Eine Chance wofür?«, fragte Griffoni und machte es sich auf ihrem Besucherstuhl bequem.
Brunetti nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und schob einige Papiere, sein Notizbuch und die aktuelle Ausgabe des Gazzettino beiseite. »Würdest du lachen, wenn ich sage: eine Chance, dass es besser wird?«
»Besser womit?«
»Oh, ich weiß nicht. Mit den kaputten Leuten, mit denen wir es zu tun haben, und all dem Schlechten, das wir zu sehen bekommen.«
Griffoni überlegte sich die Antwort sehr genau. »Nein, ich würde nicht lachen.« Brunetti wartete auf das unvermeidliche »Aber«, und sie enttäuschte ihn nicht. »Aber Blumen und Blüten bringen die Leute nicht dazu, sich anders zu verhalten als sonst.«
»Spielst du auf diese Jungen letzte Nacht an?«, fragte er und zeigte auf ein paar ausgedruckte Seiten auf seinem Schreibtisch.
»Die sind ein gutes Beispiel.«
»Was denkst du über das Ganze?«, fragte Brunetti.
»Ich war vor Ort. Und sie haben mir Angst gemacht.«
»Warum? Wodurch?«
»Wären da nicht zwei bewaffnete Polizisten gewesen, beziehungsweise drei«, korrigierte sie sich, als ihr die eigene Pistole wieder einfiel, »hätte sonst was passieren können, wenn wir die Nerven verloren hätten.«
»Findest du nicht, du übertreibst, Claudia?«
»Mag sein«, gab sie lächelnd zu. »Aber die Situation hätte außer Kontrolle geraten können. Sie waren vollgepumpt mit Testosteron: Man konnte es förmlich riechen.«
»Zum Glück ist nichts passiert«, sagte Brunetti und legte eine Hand auf den Ausdruck, als handle es sich um einen Talisman und nicht um ein amtliches Protokoll. »Ist dein Bericht schon fertig?«
»Ja. Geschrieben, geprüft und abgeschickt.«
»Ich habe den von Macaluso gelesen«, erklärte Brunetti. »Er und Andolfatto hatten Dienst, er hat ihn sofort im Anschluss verfasst und mir geschickt, nachdem die Eltern ihre Söhne abgeholt hatten.« Er fügte hinzu: »Offenbar hat er die Jungen einen Kopf kürzer gemacht, bevor du gekommen bist.«
»Körperlich?«, fragte sie bestürzt.
»Nein, natürlich nicht. Er hat ihnen ihre Grenzen aufgezeigt, was sie tun und nicht tun dürfen, sagen und nicht sagen dürfen.«
»Und?«
»Und da wurden sie brav wie die Lämmchen. So jedenfalls hat er es dargestellt.«
Griffoni nickte. »Wie macht er das?«
»Er hat mir mal erzählt, er schaut viel amerikanische Kriminalfilme aus den Vierziger- und Fünfzigerjahren. Die mit den harten Jungs.«
»Oh, mein Gott«, rief sie. »Wenn ich das gewusst hätte, bevor ich mich zu diesem Workshop angemeldet habe.«
»Welchem?«, fragte Brunetti.
»Den in Parma.«
»Wie man mit Leuten während der ersten Vernehmung umgeht?«
»Ebendiesen«, sagte sie und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. Was wie ein Lachen angefangen hatte, verwandelte sich in ein Schnauben, als sie erzählte: »Da wurde uns eingeschärft, wir müssten die Rechte der Festgenommenen respektieren und dürften unter keinen Umständen, weder in Worten noch in Taten, Kritik an ihrem Verhalten durchscheinen lassen.«
Brunetti fiel dazu nichts ein. Er wechselte das Thema. »Lass uns auf letzte Nacht zurückkommen. Erzähl mir, was geschehen ist.«
»Das müsste alles im Bericht des Sergente stehen«, sagte sie und wies darauf.
»Ich möchte es von dir hören.«
Ihr rechter Mundwinkel zuckte ungeduldig, dann aber fing sie an: »Es waren zweiundzwanzig, alle aus der Stadt. Gelangweilt nach dem Abendessen. Nichts Spannendes im Fernsehen. Warum also nicht ein bisschen Randale und vielleicht noch etwas mitgehen lassen, falls sich die Gelegenheit ergibt?«
»Bestimmt ist alles, was sie ausgeheckt haben, auf ihren Handys oder in der Cloud gespeichert«, sagte Brunetti, während er die Augen verdrehte angesichts dieses Leichtsinns. »Ein durchdachter Plan?«
»Nein, natürlich nicht.« Sie klopfte sich auf die Oberschenkel und stöhnte: »Die sind hoffnungslos.« Zunehmend lauter und mit stärkerem Akzent fuhr sie fort: »Die sind mit ihren Handys verwachsen und können keine fünf Schritte ohne machen. Und trotzdem schreiben sie rückhaltlos, was ihnen gerade einfällt«, meinte sie und schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Was sollen sie denn deiner Meinung nach lernen?«
Sie hob eine Hand und ließ sie schnell wieder sinken, bevor sie sich verselbstständigte. Angesichts von Brunettis reservierter Miene erklärte sie: »Guido, du kennst mich lange genug, um zu wissen, dass ich nicht hysterisch bin.« Er nickte. »Also glaub mir bitte, wenn ich sage, dass ich vor dieser Meute Angst hatte.« Erst nach einer längeren Pause erklärte sie: »Ich bin eine Frau. Frauen nehmen Aggressivität anders wahr. Du denkst vielleicht, du weißt, wie das ist. Aber du fühlst es nicht, nicht so, wie es Frauen empfinden.«
Er nickte, entweder zustimmend oder zum Zeichen, dass er sie gehört hatte. Schließlich sagte er: »Also gut, in Gruppen sind wir gefährlich.«
Sie sank auf ihrem Stuhl zurück und sagte kopfschüttelnd: »Das ist das erste Mal, dass ein Mann das mir gegenüber zugibt.«
»Junge Männer geben es zu«, sagte Brunetti.
Sie lächelte und nickte. »Aber sie verstehen es nicht, nicht richtig.«
»Und ältere Männer?«, fragte Brunetti.
Griffonis Lächeln wurde breiter. »Die verstehen es. Aber sie geben es nicht zu.«
Brunettis Lippen umzuckte ein Lächeln. »Ich weiß auch nicht, warum wir – Männer – fast immer, wenn es auf etwas zu reagieren gilt, Gewalt als mögliche Antwort nicht ausschließen.«
Griffoni hörte gespannt zu.
»Am schlimmsten ist es mit der häuslichen Gewalt«, fuhr er fort. »Als ob in unseren Köpfen – Männerköpfen – zu wenig Platz ist für ein Nebeneinander von Liebe und Wut. Wenn ein Baby nicht aufhört zu schreien oder eine Frau sagt, er trinke zu viel, geht sofort die Liebe über Bord, und die Wut übernimmt das Kommando.«
»Nicht immer«, warf Griffoni ein.
»Ich weiß. Trotzdem landet kaum je eine Frau in der Questura, weil sie ihrem Kind oder ihrem Partner etwas angetan hat.«
Griffoni rutschte nervös auf ihrem Stuhl herum, als hätte der etwas dagegen, dass sie weiter sitzen blieb. »Können wir über etwas anderes reden?«, fragte sie.
»Worüber denn?«
»Warum ein kluger, anständiger Fünfzehnjähriger sich mit dieser Meute herumgetrieben hat.«
»Du sprichst von demjenigen, den du unbedacht nach Hause gebracht hast?« Bevor sie protestieren konnte, erklärte er: »Macaluso erwähnt das in seinem Bericht.«
»Ja«, sagte sie. »Ich auch. Mitsamt der Erklärung, dass sein Vater nicht kontaktiert werden konnte. Von unbedacht kann also keine Rede sein.«
»Die Sache ist so schon kompliziert genug.«
»Was verbirgt sich hinter deinem Ton?«
»Nicht ›was‹, sondern ›wer‹«, antwortete Brunetti.
»Oh, oh. Das klingt nach Ärger.«
»Gut möglich«, sagte Brunetti.
»Sag schon.«
»Richter im Ruhestand Alfonso Berti.«
Griffonis Augen verengten sich, während sie angestrengt überlegte, wo ihr der Name schon einmal begegnet war, dann sprach ihr Gesicht Bände.
»Der Junge, der nach mir gepfiffen hat. Der hieß Berti.« Sie schüttelte so bekümmert den Kopf wie jemand, der erfährt, dass die Vase, die er im Antiquitätengeschäft umgestoßen hat, aus dem alten Konstantinopel stammt.
»Sein Großvater ist als ein sehr unangenehmer Mensch bekannt.«
»Was heißt das für mich?«
»Das kommt vermutlich ganz auf deinen Bericht an. Ist er da drin?«, fragte Brunetti und zeigte auf seinen Computer.
»Ich habe ihn heute früh geschrieben. Wie du weißt, darf keiner der Beteiligten beim Namen genannt werden.«
Er nickte.
Mit einem Wink in Richtung Computer schloss Griffoni die Augen und stützte den Kopf gegen die Stuhllehne. »Wie meine Putzfrau nie müde wird, mir zu versichern«, wandte sie sich an den untätigen Deckenventilator, »›Siamo nelle mani del Signore.‹ Wenn du also nichts dagegen hast, rühr ich mich nicht von der Stelle und gebe mich in Gottes Hände.«
Brunetti holte die Online-Ausgabe des Gazzettino auf den Bildschirm.
Über den Vorfall auf dem Markusplatz stand lediglich etwas ganz am Ende des »Venezia«-Teils, gleich neben einem Artikel über die Schließung einer Tierklinik, »ein schwerer Schlag sowohl für die vierbeinigen als auch die zweibeinigen Einwohner des Lidos«. Zu San Marco hieß es, auf der Piazza sei etwa ein Dutzend junger Leute uneins gewesen über die jüngste Leistung des örtlichen Fußballvereins. Es sei zu lautstarken Diskussionen gekommen, bis Beamte der Polizeiwache die Jungen nach Hause geschickt und so den Frieden auf der Piazza wiederhergestellt hätten.
Brunetti überlegte, wer hinter dieser Schönfärberei stecken könnte. Nur Einmischung von oben vermochte jeden Hinweis auf die Gefährlichkeit der Gangs aus dem Artikel zu verbannen. Ansonsten stürzte sich der Gazzettino auf jede noch so kleine Straftat und plusterte sie auf, bis das Blut nur so spritzte. Ein Handgemenge auf der Piazza San Marco hätte es bis in die Spalten der New York Times schaffen können, so aber war es sang- und klanglos untergegangen.
War es möglich, dass der jüngste femminicidio in Spinea, nicht weit von Mestre, den Artikel ans Ende des Lokalteils verdrängt hatte? Für die tägliche Ration Blut war gesorgt: Mit dreizehn Messerstichen hatte der Mann seine Ehefrau getötet, bevor er zur Carabinieri-Wache gefahren war und sich gestellt hatte.
Ansonsten konnte nur ein einflussreicher Verwandter eines der beteiligten Jungen einen Gefallen bei einem Mitarbeiter der Zeitung eingefordert haben. Und da kam eigentlich nur Berti, der Richter im Ruhestand, infrage, von dem ein Anruf genügte.
Brunetti drehte sich zu seiner Kollegin um, die immer noch mit dem Deckenventilator zu sprechen schien.
»Mag sein, dass wir alle in Gottes Händen sind«, sagte er. »Du aber bist wohl leider auch in denen von Euer Ehren, Alfonso Berti.« Damit wandte er sich wieder dem Computer zu.
4
»Hier ist das Ganze nur mit wenigen Worten erwähnt«, erklärte Brunetti, während er die Online-Ausgabe des Gazzettino wieder schloss. »Wann genau hast du deinen Bericht eingereicht?«
»Vor neun, er muss längst dort zu finden sein«, sagte Griffoni und zeigte auf seinen Computer.
Brunetti wählte sich murrend in das interne System der Questura ein und öffnete die Rubrik »Ruhestörung«. Binnen Sekunden hatte er Griffonis Bericht auf dem Bildschirm und las von ihrem »Bestreben, den Tatverdächtigen die Bedeutung des Gesetzes sowie die Notwendigkeit, ihm jeden Respekt zu zollen, begreiflich zu machen«. Sie sei allen zur Befragung auf die Wache gebrachten jungen Männern »mit demselben Respekt begegnet« und stets darauf bedacht gewesen, sie mit »Signore« und ihrem Nachnamen anzureden. Die jungen Männer ihrerseits seien ebenso höflich zu ihr gewesen.
Sowie sie Griffonis Amtsbefugnis erkannt hatten, hätten die jungen Männer samt und sonders die vom Gesetz geforderten Maßnahmen willig befolgt. Erfreut über die Benachrichtigung ihrer Eltern, die sich so des Wohlergehens ihrer Söhne vergewissern konnten, seien sie durch die Erziehungsberechtigten von der Wache abgeholt und nach Hause gebracht worden. Der Vater eines der Jungen sei jedoch nicht erreichbar gewesen. Darum habe Dottoressa Commissario Claudia Griffoni nach Rücksprache mit dem diensthabenden Beamten den Jungen an Eltern statt nach Hause begleitet, wo fünf Nachbarn ihn in Empfang genommen und Dottoressa Commissario Claudia Griffoni versichert hätten, sie würden dafür sorgen, dass er in die Obhut seines Vaters gelange, der wiederum dafür sorgen werde, dass sein Sohn rechtzeitig in die Schule komme.
Kaum hatte Brunetti den Bericht fertig gelesen, sagte er voller Bewunderung, ja beinahe ehrfürchtig: »Oh, was bist du doch für eine Schlange! Du bist Richter Berti noch nie begegnet, aber hast schon einmal vorsorglich Zucker in den Tank jedes Kriegsgeräts geschüttet, das er gegen dich ins Feld hätte schicken können. Womöglich zählt der alte Mistkerl jetzt sogar zu deinen Bewunderern.«
Griffoni setzte sich aufrecht, streckte die verschränkten Hände über den Kopf, schwenkte sie ein paarmal hin und her und ließ sie wieder sinken. »Immer redest du um den heißen Brei herum, Guido. Sag doch einfach klipp und klar, dass du den Richter a.D. nicht ausstehen kannst.« Plötzlich wieder ernst, fügte sie hinzu: »Sein Enkel hat nach mir gepfiffen, als ich reingekommen bin.«
Brunetti lag schon auf der Zunge, dies sei verständlich bei ihrem Aussehen, doch da er fürchtete, dieses plumpe Kompliment könnte ihr in den falschen Hals geraten, fragte er nur: »Gepfiffen?«
»Ja, wie dieses Hinterherpfeifen in Filmen. Also habe ich ihm eine Lektion in Sachen höfliche Anrede erteilt.«
»Er war bestimmt beeindruckt.«
»Erst nachdem ich ihn auf den Paragrafen betreffend mangelnden Respekt gegenüber Beamten in Ausübung ihrer Pflicht hingewiesen habe.«
»Verstehe«, sagte Brunetti. »Ich hatte mich schon gewundert, worauf du in deinem Bericht hinauswolltest. Mit all diesen Verbeugungen und Kratzfüßen vor dem Gesetz.«
»Das sieht mir gar nicht ähnlich, stimmt’s?«
»Bist du die anderen auch so hart angegangen?«
»Nein. Sowie sie begriffen hatten, dass Macaluso, Andolfatto und ich keine Scherze machten, verließ sie der Mut … Nein, das ist das falsche Wort. Mut besitzt keiner von denen; sie brauchen eine Gang um sich herum, und dann ist es kein Mut, nur Testosteron. Jedenfalls haben sie sich beruhigt. Einige sind sogar eingeschlafen, während sie darauf warteten, dass sie abgeholt wurden.«
»Möchtest du über die Eltern reden?«
»Nein. Sie waren einfach nur in Sorge um ihre Kinder. Sie müssen wohl erst einmal verdauen, was der kleine Giovanni so getrieben hat, wenn er angeblich bei einem Freund war und seine Latein-Hausaufgaben machte.«
Nachdenklich fuhr sie fort: »Einige Elternpaare waren völlig schockiert, als sei eine Welt für sie zusammengebrochen. Andere schienen einzig darüber verärgert, dass man sie aus dem Bett geklingelt hatte.« Nach einer Weile fügte sie hinzu: »Drei Frauen sind allein gekommen.«
»Und der Junge, den du nach Hause gebracht hast?«
Griffoni lächelte. »Netter Bursche.« Und bevor Brunetti etwas entgegnen konnte: »Nein, wirklich, Guido.« Griffoni überlegte, wie sie ihr Urteil begründen könnte, und ihr fiel nur ein, dass er höflich und intelligent war und einen Sinn hatte für Humor. Es war ihr sehr unangenehm, als sie erkannte, dass genau diese Eigenschaften einmal ihre Anforderungen an einen Liebhaber gewesen waren.
Sie ruderte zurück. »Vielleicht auch nur, wenn ich ihn mit den anderen vergleiche.«
»Als was erscheint er dir dann?«, fragte Brunetti.
»Als der Prinz im Märchen.« Sie ließ das wirken und fügte dann hinzu: »Natürlich war die Konkurrenz nicht gerade groß.«
Unruhig rutschte sie auf ihrem Stuhl herum und wechselte das Thema. »Warum tun sie das?«, fragte sie. »Manche von den Eltern waren richtiggehend verstört. Entweder weil sie wirklich keine Ahnung gehabt hatten, oder weil sie es nicht hatten wahrhaben wollen. Doch der eine oder andere muss etwas gewusst haben. Und wenn man den Verdacht hat, der eigene Sohn treibt sich rum und schlägt andere Jungen zusammen, dann tut man doch etwas dagegen, Herrgott noch mal.«