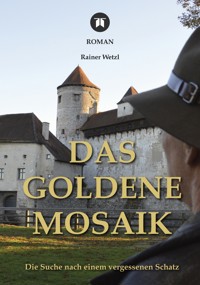
9,99 €
Mehr erfahren.
In seiner Jugend hat Tom Raumoser in einem Patrizierhaus ein altes Schriftstück gefunden, mit dem er zunächst wenig anfangen konnte. Jahre später berichtet er als Redakteur über Entdeckungen mittelalterlicher Fresken auf der Burghauser Burg und entdeckt einen Zusammenhang mit diesem Dokument, das ein Pfarrer im 16. Jahrhundert verfasst hat. Der war Finanzfachmann des Bischofs wurde erstochen aufgefunden, sein Vermächtnis nie gefunden. Zusammen mit seinem Freund Frank und der Geschichtsstudentin Eva versucht Raumoser, diesen historischen Schatz zu finden. Doch auch Ganoven gehen auf die Jagd nach den Reichtümern, und die wollen eines: Geld. Dafür gehen sie auch über Leichen. In München und im Vatikan ergeben sich neue Aspekte, die Kunst wird zu einem unerwarteten Helfer, und die alte Klosteranlage Raitenhaslach gibt einige Geheimnisse preis. Unter anderem wurde dort im Zweiten Weltkrieg auch Raubkunst gelagert. Raumoser ist wild entschlossen, das Mosaik zusammenzufügen. Wenn er nur nicht so ein Träumer wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
RAINER WETZL
Das
goldene Mosaik
Das Buch:
Tom Raumoser ist Redakteur in der alten Herzogstadt Burghausen. In seiner Jugend hat er ein altes Stück Papier mit einer seltsamen Schrift in einem Neuöttinger Patrizierhaus gefunden, das durch Entdeckungen auf der Burg eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Zusammen mit seinem Freund Frank und der Geschichtsstudentin Eva versucht Tom Raumoser zu ergründen, welche Wahrheit sich hinter den Funden und dem Vermächtnis eines Regensburger Pfarrers aus dem 16. Jahrhundert verbergen könnte. Bald wird den Dreien klar, es könnte einen verborgenen Schatz geben. Den zu finden, erweist sich aber als äußerst schwierig. Denn auch andere gehen auf die Jagd nach Reichtümern, und diese Leute wollen Kasse machen und kämpfen mit harten Bandagen. In der Burg findet Raumoser ein eingemauertes Skelett, in Raitenhaslach werden Aufzeichnungen über Bodenschätze im Kaukasus aus der Kriegszeit entdeckt. Wo aber ist der Schatz des Pfarrers? Raumoser wird zudem von seinem Chef ausgebremst, auch die Polizei sitzt ihm im Nacken. Doch er ist wild entschlossen, die Mosaiksteine zu finden und zum großen Ganzen zusammenzusetzen. Viele Überraschungen und Wendungen begleiten die Handlung, Gedanken über das Wesen von Wahrheit und Welt, aber auch humorvolle Begebenheiten. Die Handlung selbst spielt in den Nuller Jahren des neuen Jahrtausends.
Die Schatzsuche ist zugleich eine Suche nach der Wahrheit, nach historischen Wurzeln, nach dem, woraus die Welt besteht und was Wissenschaftler und Religionen aus ihr gemacht haben. Gute und böse Charaktere belauern sich. Fakten und Fantasie verbinden sich zu einer spannenden Melange. Und mit dieser Mischung will der Autor vor allem eines: Ihnen beim Lesen Freude bereiten.
Rainer Wetzl
Der Autor:
Rainer Wetzl stammt aus Neuötting und war über Jahrzehnte Lokalredakteur der Passauer Neuen Presse, unter anderem in Simbach am Inn, Eggenfelden und zuletzt in Burghausen. Ein Leben lang genaue Recherche und Wiedergabe der Realität. Als Ruheständler hat er nun endlich die Muße, auch seine „fantastische Seite“ zur Geltung zu bringen und seinen Gedanken freien Lauf lassen zu können. In dem Buch verknüpft er historische Fakten mit einer frei erfundenen Handlung, die wiederum auf einer Reihe realer Wurzeln fußt. Fantasie und Realität vermengen sich so zu einer spannenden Geschichte. Die handelnden Personen sind frei erfunden.
RAINER WETZL
Das goldene Mosaik
Die Suche nach einem vergessenen Schatz
ROMAN
Gewidmet allen,
die nach der Wahrheit suchen,
auf dass sie fündig werden.
© 2024
Rainer Wetzl
Herausgeber, Autor:
Rainer Wetzl
Lektorat, Fotos:
Benilda Wetzl
Coverdesign, Satz & Layout:
Werbestudio Schmitzberger, 84489 Burghausen
Hardcover:
ISBN: 978-3-384-34514-1
Paperback:
ISBN: 978-3-384-34513-4
e-Book:
ISBN: 978-3-384-34515-8
Titelseite:
Burghauser Burg
Rückseite:
Klosterkirche Raitenhaslach
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Das goldene Mosaik
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog
Epilog
Das goldene Mosaik
Cover
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
Back Cover
Prolog
Das Licht im Kreisel
Hochsommer in einem Hinterhof einer norditalienischen Kleinstadt: An einer Wäscheleine hängen Handtücher, von einer fleißigen Hand aneinandergereiht wie Zinnsoldaten, die in eine Schlacht ziehen. Die Sonne hat ihren höchsten Punkt verlassen. Die Mittagsruhe geht zu Ende, aus den umliegenden Häusern dringen Geräusche, die eine zunehmende Geschäftigkeit verraten. Die Männer der nahegelegenen Baustelle haben ihre Schaufeln wieder zur Hand genommen. Aus dem Gewirr von Mauervorsprüngen und verbauten Giebeln dringen helle Kinderstimmen, die innerhalb weniger Augenblicke auch auf dem Hof den Ton angeben. Während die Sonne langsam dem Horizont zustrebt, ist die Luft in Bewegung geraten. Vom Tor, das zur Straße hinführt, dringt eine sanfte Brise zwischen die Häuserreihen. Die Handtücher an der Leine fangen an zu baumeln. Der Wind treibt sein Spiel mit ihnen, lässt sie sanft hin- und zurückschwingen. Der Luftzug ist angenehm erfrischend. Ich spüre ihn durch mein Leinensacko dringen. Es ist der Hauch des Lebens. Nach all den schlimmen Erfahrungen der letzten Wochen erwacht in mir zum ersten Mal wieder ein angenehmes Lebensgefühl.
Eine füllige Mama hat soeben das Haus unmittelbar vor mir verlassen. Mit einem Wäschekorb unter ihrem fleischigen Arm tritt sie behäbig zu den Handtüchern und nimmt sie noch langsamer von der Leine. Es scheint sie sichtlich anzustrengen. Indes gilt ihr nur mein zweiter Blick. Aus meinen Gedanken haben mich zwei kleine Jungen gerissen, die laut schreiend unmittelbar hinter der Madrone aus dem Haus gerannt sind. Sie stürmen mit etwas Farbigem in der Hand zu einer kleinen Betonfläche seitlich von mir. Schon kniet einer auf dem Beton und bringt seinen Kreisel in Bewegung. Es gelingt ihm aber nur im Ansatz, den Fingern des Kleinen fehlt noch das dafür nötige Feingefühl. Sein Spielkamerad stellt sich noch ungeschickter an. Tollpatschig gleiten seine Finger über den Holzgriff. Dennoch lacht er, freut sich über jeden Versuch und schreit dabei seinem Freund zu: Guarda Enrico.
Nun haben die beiden mich ins Visier genommen. Schon haben sie ihre anfängliche Schüchternheit dem Fremden gegenüber verloren und sprechen mich an. Ich verstehe nur Brocken. Aber Kinder haben bekanntlich ihre eigene Sprache. Der, den der andere Knirps Enrico nannte, kommt zu mir her und nimmt meine Hand. An seinen Gesten erkenne ich, was er will. Warum nicht? denke ich und stehe von der Bank auf, wo ich lange genug gesessen bin. Der kleine Mann führt mich zu seinem Gefährten und drückt mir seinen Kreisel in die Hand. An dem Holzgriff befindet sich eine hölzerne Scheibe, die in grellen Farben bemalt ist. Da ist ein himmelblaues Dreieck in der Mitte zu sehen, umringt von roten Linien. Gelbe Segmente und grüne Vierecke gruppieren sich am Außenrand. Jeder Pinselstrich ist zu erkennen, feinsäuberlich getrennt liegen Farben und Muster vor dem Auge. Schon zupft mich Enrico am Arm. Ich folge der Aufforderung, nehme den Griff zwischen Daumen und Mittelfinger der rechten Hand und lasse nach einem schnellen Ruck los. Und schon rotiert der Kreisel am Boden, vermengen sich die ursprünglich getrennten Linien und Schattierungen zu einem neuen Farbenmuster. Gebannt verfolgen die beiden Kinder, wie ihr Spielzeug über den Boden wirbelt und sich dabei verändert. Als der Kreisel ausgelaufen ist, bringe ich ihn erneut zum Rotieren. Irgendetwas scheint auch mich zu faszinieren. Plötzlich schießt es mir durch den Kopf. Der Kreisel wird für das Auge ein anderer, wenn er sich bewegt - er bekommt eine neue Identität, obwohl er im Grund der Gleiche geblieben ist. Und ist es mit dem Leben nicht ebenso. Die Einzelheiten, die Wünsche und Sorgen eines Menschen, gleichen sie nicht den Mustern auf dem Kreisel in meiner Hand. Wenn alles schön vor einem liegt, kommt der Wind des Lebens und verändert alles. Oder übertragen ausgedrückt: Wenn man eine Stadt und ihre Bewohner oberflächlich betrachtet, sieht man sie nur verfälscht – genau wie den sich bewegenden Kreisel. Um den Dingen auf den Grund zu kommen, muss man genau hinsehen, sezieren und die einzelnen Muster bloßlegen, die in ihrer Gesamtheit ein ineinanderfließendes und mitunter verwirrendes Bild ergeben.
Dieser Gedanke war es, der mich in Italien darauf brachte, dieses Buch zu schreiben. Es soll Ihnen neben der Lesefreude auch eine Hilfe sein, die Zeit und ihre Menschen besser zu verstehen. Die Handlung ist frei erfunden, sie spielt in den Nuller Jahren des neuen Jahrtausends. Dabei werden geschichtliche Fakten oder der Fund von Kartenmaterial aus der Kriegszeit fantasievoll ergänzt. Ein nicht realer Pfarrer des 16. Jahrhunderts wird im Nachhinein zum Leben erweckt. Ebenso der Fantasie entsprungen sind die handelnden Personen und deren Charaktereigenschaften. Aber gewesen sein könnte das alles schon so.
Kapitel 1
Schmerzhaftes Erwachen
Ein luzides Grün – das ist das erste, was ich zu sehen glaube. Transparent wie das Türkis des Meeres an Stellen, wo das Wasser in seichten Buchten zwischen Felsen hin und her treibt. Ich öffne meine halbgeschlossenen Augen etwas mehr. Der Blaucharakter der Farbe nimmt zu und zugleich der Druck im Schädel. Aber trotz dieses Drucks steigt Freude in mir hoch, denn dieses Blau ist mir vertraut. Nun kommt es auf mich zu, ich spüre feuchte Lippen auf meiner linken Wange. Instinktiv hebe ich den linken Arm, um dieser Zuneigung zu begegnen. Aber ich komme nicht weit. Der Arm steckt in einer Hülle und ist mit einer Schlinge an den Körper fixiert, was den Bewegungsradius erheblich einschränkt. Wo bin ich nur? Habe offenbar geschlafen. Das Erwachen ist wie aus einem Nichts. Denn ich habe weder gut noch schlecht geträumt, rein gar nichts. Jetzt liege ich in einem Bett, die Gedanken suchen noch einander, hüpfen isoliert für sich umher, finden einfach nicht zusammen. Alles ist verworren, ich bin gefangen in einem mosaikartigen Labyrinth, in dem die Steine nicht zusammenwollen. In diesem Chaos geben mir Noras wasserblaue Augen Halt, ja sind geradezu eine Wohltat. Und ihre Lippen zu spüren ist schön. Sie fragt mich irgendetwas, ich höre sie, verstehe aber nichts. Nora gibt auf, quält mich nicht länger, drückt mir einen weiteren Kuss auf die Wange und streicht mit einer Hand zärtlich über mein Gesicht. Ein Gefühl der Wärme steigt in mir auf. Nora erfasst die Hand meines rechten und frei beweglichen Arms. Ich spüre meinen Puls schlagen, geborgen in ihren Händen, das ist so schön. Alle anderen Gedanken werden unwichtig. Ich weiß ohnehin nicht, warum ich hier liege, was passiert ist. Mein Körper entspannt sich, Müdigkeit überkommt mich. Die eben noch scharfen Konturen verwischen, ich gleite in ein flirrendes Nichts.
Als ich eine gefühlte Minute später wach werde, ist Nora weg. Durchs Fenster sehe ich, es ist bereits dunkel geworden. Dabei bin ich doch am Morgen losgegangen. Wo sind die Stunden dazwischen?
„Sie haben Glück gehabt“, sagt die Krankenschwester am nächsten Morgen und blickt mich mitfühlend an. „Wie ist es mit dem Schmerz?“, fragt sie.
„Ich gebe Ihnen gerne noch etwas mehr vom Mittel.“
Ich nicke und sie drückt eine Spritze in den Infusionsbeutel.
„Ihr linker Unterarm ist gebrochen und Sie haben eine Kopfverletzung. Die Polizei möchte Sie möglichst bald befragen. Sind sie dazu schon in der Lage, denn melde ich das in der Ettstraße?“
Wieder nicke ich, weil mich Sprechen einfach anstrengt. Ein zweifelnder Blick streift über mich hinweg.
„Ich denke, morgen reicht auch noch“ höre ich sie sagen.
Nach und nach nehme ich mein Umfeld wahr. Ich bin der einzige im Raum, den Luxus eines Einzelzimmers hatte ich noch nie. Erste Erinnerungen tauchen aus der Versenkung. Ich war doch eben noch im Staatsarchiv an der Ludwigstraße, um mehr über diesen Michael Bräu zu erfahren. Ach nein, das war ja schon gestern. Ein ganzer Tag ist seither vergangen. Viel habe ich nicht herausbekommen über den Pfarrer aus Regensburg. Aber ein paar Aufzeichnungen konnte ich machen und durfte zudem ein Schriftstück kopieren, aus dem hervorging, dass Michael Bräu nicht nur Seelsorger in der alten bayerischen Hauptstadt an der Donau war, sondern auch in Kontakt zu den Zisterziensern stand, die in Raitenhaslach an der Salzach ein majestätisches Kloster betrieben. Ich muss wissen, was ihn mit den Kuttenträgern von der Salzach verband und mehr über seinen Tod herausfinden. Es ist noch nichts Konkretes, das mir durch den Kopf gehen würde. Dazu ist mein ramponiertes Gehirn noch nicht in der Lage. Aber eine Ahnung steigt in mir hoch. Die Welt beginnt sich leicht zu drehen, Farbbänder geraten ineinander, das Bett scheint mit mir hin- und herzuschwingen. Ein dunkler Schatten nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Ich kann nicht ausweichen. Ein Windstoß wirft mich um. Aus dem Schatten treten zwei dunkle Augen. Hände grapschen an mir herum. Dann sehe ich weitere Gesichter über mir. Ein rot gekleideter Mann spricht mit einem anderen in Weiß und schon schwingt das Bett wieder mit mir. Ja es scheint sogar zu fahren, biegt um Kurven, wird langsamer und wieder schneller. Dann sehe ich erneut Noras blaue Augen, aber jetzt weniger mitfühlend als bohrend. Endlich entspannt sich die Lage. Das Blau ihrer Augen wird zum weiten Meer, über dem ich auf einem Felsen sitze und der Brandung zuschaue. Sirenen stimmen verführerische Gesänge an, ein Tümmler bäumt sich im Wasser auf und taucht dann mit einer eleganten Drehung in die Tiefe.
„Haben Sie gut geschlafen?“ reißt mich eine wenig nach einer Frage klingende durchdringende Frauenstimme aus meinen Träumen. Die Krankenschwester hat keinen Sinn für mein Schlafbedürfnis. Mit einem feuchtkalten Lappen tupft sie in meinem Gesicht herum, reicht mir wortlos eine Flasche zum Pinkeln. Ich werde geblutdruckt und thermometerisiert.
„Vielleicht dürfen Sie heute schon aufstehen, das entscheidet dann der Arzt“, ruft mir die Schwester noch zu, und schon bin ich wieder allein, und der Brummschädel von gestern meldet sich zurück. Aber wenn ich ruhig liege, sind die Schmerzen erträglich. Weniger erträglich ist die allmähliche Rückkehr der Erinnerung. Dieser Typ mit der auffälligen Sonnenbrille hat mich niedergeschlagen. Es ging alles so schnell. Er hatte etwas in der Hand und holte damit aus. Den Schlag konnte ich halbwegs abwehren, dabei ist wohl der Arm zu Bruch gegangen. Danach machte es Bumm und meine Erinnerung reißt ab. Sie setzt erst wieder ein, als ich umringt bin von Leuten, die auf mich blicken. Ich lag also am Boden. Dann kamen Sanitäter und packten mich ein. Jetzt bin ich in einer Klinik, weiß noch nicht mal wo.
Das ändert sich, als der Klinikbetrieb anläuft und der Pfleger kommt. Ich liege im Klinikum München-Großhadern, erfahre ich. Zudem kündigt mir der Pfleger für heute Nachmittag den Besuch von Polizeibeamten an.
Davor sucht mich noch der Oberarzt auf oder eher heim.
„Was machen sie nur für Sachen“, fährt er mich an und lässt seinen Kopf vom Boden zur Decke und wieder zurück kreisen.
„Ich habe doch gar nichts gemacht, vielmehr war ich der Leidtragende, mit dem etwas gemacht wurde“, antworte ich ihm und versuche dem Kreisverkehr seines Kopfes zu folgen.
Meine Antwort scheint er überhört zu haben, beginnt zu dozieren: „Der Radius ist gebrochen, aber der ist nicht so wichtig.“ Er grinst: „Da hängt ja nur die Hand dran. Die Elle ist heil geblieben, die Bänder sind es wohl auch. Die Bruchkanten haben sich allerdings etwas verschoben, das ist nicht schön.“
Dann klärt er mich mit der Miene des versierten Kenners auf: „Wir machen uns Sorgen um Ihren Kopf. Denn bei Nerven und noch dazu empfindsamen Menschen weiß man nie.“
Woher will der Weißkittel wissen, ob ich empfindsam bin. Hat er das aus meinen Blutwerten gelesen?
„Ich bin ein harter Brocken“, antworte ich ihm trocken auf die Frage, wie es mir gehe. Ärzte fragen das immer gern und überhören ebenso gern die Antworten.
Dann das wirklich Wichtige: „Der Arm muss noch operiert werden, die Bruchkanten werden mit einem Draht gesichert, damit der Knochen richtig zusammenwächst. Wenn der Kopf mitspielt, können Sie voraussichtlich ein oder zwei Tage danach die Klinik wieder verlassen. Sie haben eine Gehirnerschütterung, sollten noch zwei Wochen liegen bleiben und nicht arbeiten.“
Das wird den Schuster freuen. Er ist mein Chef und wird wenig erbaut sein, zwei Wochen auf mich verzichten zu müssen. Weil er nicht gern selbst mit dem Fußvolk spricht, kann ich mir sein Gelaber ersparen und rufe die Fuchs an. Die Sekretärin der Chefredaktion hat ein großes Herz.
„O je, Sie haben eine Gehirnerschütterung. Hängen Sie lieber noch eine Woche dran und kurieren sich richtig aus“, rät sie mir. „Herr Schuster wird schon einen Ersatz finden, ich sondiere gleich, wer für Sie einspringen könnte“.
Das wäre geschafft. Ich muss unbedingt auch Frank und Eva Bescheid geben. Frank ist ein alter Freund aus Jugendzeiten, der mir bei unserer Schatzsuche hilft. Ihm kann ich voll vertrauen, bei Eva dagegen bin ich mir nicht ganz sicher.
„Sie sind Herr Raumoser?“, fragt mich ein etwa 40-jähriger Mann. Er sieht gar nicht aus wie ein typischer Polizeibeamter. Aber seine Dienstmarke weist ihn als solchen aus. Er ist lässig gekleidet, mit Cord-Jeans und Fleece-Pulli und setzt sich auf einen Stuhl, den er an mein Bett schiebt. Auffällig an ihm ist eine riesige mit einem veritablen Höcker gesegnete Nase. Ein guter Riecher kann ihm vielleicht bei der Arbeit helfen, denke ich, als der Mann schon seine erste Frage stellt.
„Haben Sie den Täter gesehen?“ will er zunächst wissen.
„Gesehen trifft es nicht so recht, es ging ja so schnell. Ich erinnere mich nur an ein Gesicht mit verspiegelter Sonnenbrille und an dunkle Haare. Flink wie er war, dürfte der Mann höchstens 30 Jahre alt sein. Er hatte etwas in der Hand und schlug auf mich ein. Ich versuchte noch, den Schlag abzuwehren. Dann hat er mich aber anscheinend doch erwischt, denn ab da setzt meine Erinnerung aus.“ „Das deckt sich mit unseren Erkenntnissen“, sagt der Kripomann und teilt mir mit, was die Überwachungskameras in der U-Bahnhaltestelle am Marienplatz aufgezeichnet haben.
„Es waren zwei Täter. Der eine kam schräg von hinten auf Sie zu. Vermutlich hatte er einen Schlagstock in seinem Mantel versteckt. Die Aufzeichnung zeigt nicht, wie er ihn herauszog. Aber mit zwei, drei Schritten war er bei Ihnen und holte aus. Man sieht Ihre Abwehrbewegung. Dann verpasste Ihnen der Mann einen zweiten Schlag auf den Kopf und rannte davon. Die Verwirrung, das Durcheinander nutzte ein zweiter Täter. Er trat wie ein Helfer auf Sie zu, durchsuchte Sie kurz. Das dauerte allenfalls zehn Sekunden. Dann lief auch er weg, noch bevor Umstehende Verdacht schöpfen konnten. Wir gehen davon aus, dass Sie Opfer einer Bande aus Südosteuropa geworden sind. Was ist Ihnen gestohlen worden, was haben die Täter erbeutet?“
„Das ist ja der Hammer, es waren also zwei Leute, die mich überfallen haben“, sage ich und liege mit offenem Mund im Bett.
„Ja und was ist ihnen gestohlen worden?“, fragt der Beamte nochmals nach.
Mein Hirn ist noch durcheinander, jetzt ja keinen Fehler machen, sonst sitzt mir auch noch die Polizei im Genick.
„Mir fehlen zwei Fünfziger Scheine, die ich in meiner Innentasche im Jackett hatte“, antworte ich, nachdem mir der Mann die Jacke ans Bett gebracht hat.
Das Gesicht mit der markanten Nase entspannt sich.
„Bei Journalisten weiß man ja nie. Aber ich dachte gleich, dass es sich um einen Raubüberfall handelt“, gibt er mir zu verstehen.
Der Fall wird also für die Polizei zwar kaum aufzuklären, aber relativ einfach abzuarbeiten sein. Täter vom Balkan sind nur begrenzte Zeit im Land, danach zumeist unauffindbar. Und ein Raubüberfall wirft keine weiteren Fragen auf. Der Kripobeamte schreibt meine Angaben auf, ich unterzeichne das Protokoll, und damit kann die Strafverfolgung beginnen. Spätestens in einigen Monaten wird dann der Fall zu den Akten gelegt und alles hat wieder seine schöne Ordnung.
Ich bin wieder allein. Der Kripomann hat meine Erinnerung aktiviert. Es waren also zwei Täter. Und ich kann mir keinen Reim darauf machen, warum sie mich niedergeschlagen und durchsucht haben. Wenn ich ruhig liege, habe ich nur geringe Schmerzen, der Denkapparat funktioniert schon wieder einigermaßen. Ein klassischer Raubüberfall war das ganz sicher nicht, sonst wäre meine Geldbörse weg. Auch Uhr und Handy sind noch da. In meinem Jackett hatte ich kein Geld, dafür aber die Kopie aus dem Staatsarchiv und dazu einige von mir angefügte Anmerkungen und ein paar Zettel mit unwichtigen Notizen. Andererseits verstehe ich nicht, warum sie mein Handy nicht gemopst haben. Aber vielleicht fehlte ihnen dazu wirklich die Zeit. Und noch ein Gedanke kommt aus der Versenkung nach oben. Warum haben mich die beiden ausgerechnet in der U-Bahn-Haltestelle am Marienplatz überfallen, wo es dort doch Überwachungsgeräte und viele Leute gibt. Irgendwo auf der Straße wäre die Gefahr erkannt und vielleicht sogar gefasst zu werden, viel geringer gewesen.
„Die haben Dich sicher beobachtet und verfolgt und wollten Dir vielleicht einen Denkzettel verpassen oder eine Warnung zukommen lassen“, ist Frank überzeugt.
Drei Stunden später ist mein alter Freund in der Klinik. Die dunkle Schokolade, die er mitgebracht hat, vertilgen wir beide gleich bis auf einen kleinen Rest. Frank weiß eben, was ich mag und nebenbei profitiert er auch, weil wir in Sachen Schokoladen denselben Geschmack haben: Je dunkler und bitterer, umso lieber.
„Ist Dir denn vorher überhaupt nichts aufgefallen. Wenn es Ihnen tatsächlich um das Papier ging, dann waren die mit Sicherheit schon hinter Dir her, als Du ins Staatsarchiv bist. Du bist beschattet worden und hast offenbar nichts gemerkt. Du bist immer noch der verträumte Einfaltspinsel, der den Mädels die Sternbilder erklärt. Vielleicht haben sie es aber auch sehr geschickt angestellt. Dann waren das Profis. In beiden Fällen ist das keine gute Perspektive“, kommentiert Frank.
Nun wären für mein Ego die Profis natürlich die bessere Variante. Aber ich verdächtige auch meinen einstigen Arbeitskollegen Chris Malevsky als Drahtzieher hinter dem Anschlag. Er hat mitbekommen, dass ich an einer heißen Geschichte dran bin. Doch es geht mir nicht in meinen malträtierten Kopf, warum dieser zwei Schläger beauftragen sollte. So viel Aufwand, um einem anderen eine Geschichte abzujagen, das erkennt selbst mein angeschlagenes Gehirn als absurd. Wie auch immer, ich finde keine Antwort. So bitte ich meinen Freund Frank Kreiker, er solle Malevsky auf die Finger sehen, zumindest so lange, bis ich auch aus der Klinik entlassen bin.
Am nächsten Tag hat sich der Nebel in meinem Kopf noch mehr gelichtet. Der Magen knurrt, aber ich bekomme nichts zu essen, da heute der Arm operiert wird. Im OP-Vorraum rede ich wie ein Wasserfall, erzähle kuriose Dinge und mache Witzchen. Jeder hat halt so seine Art, wenn er aufgeregt ist. Dann kommt der Schlaf. Als ich wieder erwache, ist zwar der Kopf noch einige Zeit matschig, aber sonst fühle ich mich ganz gut. Der Arm ist geschient, zwickt ein bisschen, aber Schmerzen sind das nicht. Die folgende Nacht schlafe ich besonders lang und überraschend gut.
Am Morgen schmeckt mir selbst der hochgetunte Krankenhaus-Muckefuck und sogar dem Blutdruckmessen kann ich mit einem Lächeln begegnen. Alles bestens, ich möchte bloß schnell wieder hier raus. Vielleicht ist meine Stimmung auch deshalb so gut, weil sich Nora angekündigt hat. Ich sehe so gern in ihre türkisblauen Augen, in dieses Meer von Empfindsamkeit und Wärme. Nora ist eine Traumfrau. Aber sie wirkt auch hilfsbedürftig. Am liebsten würde ich sie gleich in den Arm nehmen. Aber das geht ja nicht, weil einer kaputt ist - reißt mich die logische linke Gehirnhälfte aus den Träumen ihres rechten Pendants. Ich bleibe deshalb auch im Bett liegen, als meine Traumfrau eintrifft, oder vielmehr einschwebt. Ihr Gang ist weich und federnd, sie wäre sicher auch eine gute Tänzerin. Und schon beugt sie sich, das Blau ihrer Augen kommt auf mich zu, ich spüre ihre feuchten Lippen auf meinem Gesicht. Gekleidet in ein weinrotes Kleid sieht sie umwerfend aus. Ihre Brüste drängen nach vorn, berühren meinem Körper, und schon fängt der kleine Tom unter der Bettdecke zu wachsen an. Wie peinlich, hoffentlich bemerkt sie nicht, wie sich die Bettdecke hebt.
Aber es war ohnehin nur ein Intermezzo, die linke Gehirnhälfte meldet sich zurück und unterbricht. „Nora, pass bitte auf Dich auf. Ich bin überfallen worden. Wenn Unbekannte an Deiner Tür klingeln, mach besser nicht auf.“
„Das wäre in der Tat blöd“, antwortet sie. Aber richtig erschrocken, wie ich befürchtete, ist sie zum Glück nicht. Vermutlich ist ihr die Gefahr nicht wirklich bewusst. Sie zwingt sich sogar zu einem Lächeln.
„Ich kann ja nicht gleich die Polizei rufen, wenn ein Unbekannter an meiner Tür steht.“
„Aber Du darfst auf keinen Fall die Tür öffnen, wenn einer Fremder draußen ist.“
„Ja gut, das kann ich schon versprechen.“
„Es waren südländisch aussehende Täter, aber keine normalen Ganoven, wie ich die Polizei habe glauben lassen. Sei vorsichtig und ruf mich sofort an, sollte so ein Typ an Deiner Wohnung klingeln.“
„Hast Du im Staatsarchiv etwas herausgefunden?“ will Nora wissen.
„Michael Bräu hat die Inquisition überstanden, weil er schlau und lieber kein Held war und widerrufen hat, was ihm die Dominikaner als Ketzerei ausgelegt hatten. So bissen die Hunde des Herrn bei ihm auf Granit. Aber einige Fragen in dem Verfahren gingen auch in eine andere Richtung. Im Verhör wurde Michael Bräu offensichtlich nach Dingen gefragt, die der Herrlichkeit Gottes dienen und die er der Mutter Kirche nicht vorenthalten dürfe. Ich bin zwar kein Historiker und nicht so bewandert, damalige Formulierungen richtig zu verstehen. Aber eines ist schon klar: Da ging es um Wertgegenstände, auf die die Kirche scharf war. Kurzum: Ich glaube, Michael Bräu ist deshalb 1559 in einer Seitengasse nicht weit weg vom Regensburger Dom ermordet worden.“
Nicht zu viel reden, mahnt mich die linke Gehirnhälfte erneut und die rechte steuert die Erkenntnis bei, dass ich damit Nora in Gefahr bringen könnte.
„Ich will Dir helfen, so gut ich kann, aber wir brauchen dazu einen Ansatz, worum es bei den Wertgegenständen geht und vor allem, wo wir sie suchen müssen“, betont Nora und drückt ihre Brüste erneut gegen meinen Körper.
„Halte mich bitte auf dem Laufenden, ich sorge mich um Dich“, sagt sie, nachdem ihre Hand mitfühlend sanft über meinen geschienten Arm geglitten ist und ihre Lippen einmal mehr meine Haut elektrisiert haben.
Wieder allein. Aber nicht lange. Frank ruft an und hat Neuigkeiten. Malevsky war an dem Tag des Überfalls tatsächlich in München. Einige Tage vorher hatte er einige seiner ehemaligen und meiner jetzigen Kollegen zu einer Sause zu sich nach Schliersee geladen.
„Deine Kollegin Martina Schönlein war dort. Sie erinnert sich auch an einen Typen mit schwarzem Haar, auf den die Täterbeschreibung passen könnte. Malevsky sei kein einziges böses Wort über Dich oder andere Redakteure über die Lippen gekommen.“
„Er versucht, ein neues Netzwerk oder sollte ich besser sagen neue Seilschaften aufzubauen“, kommentiere ich und füge glich meine Schlussfolgerung hinzu: „Wird ihm aber nicht gelingen. Denn Malevsky kann sich nicht beherrschen, hat sich nicht im Griff. Auf Dauer verprellt er jeden Informanten.“
Zwei Tage später erteilen mir die Ärzte den Passierschein aus ihrem Reich. Frank holt mich ab. In diesen beiden Tagen hat er noch einiges zusammengetragen und sein Oberstübchen angestrengt.
„Wir kommen hier nicht weiter“, so seine Schlussfolgerung. „Wir müssen an die Quellen und herausfinden, wonach genau die Dominikaner im Inquisitionsprozess gefragt haben. Vielleicht finden wir eine Spur, die uns zu dem Schatz führt“, so die Hoffnung Franks. Der Prozess war in Trient, wo gleichzeitig das Konzil tagte.
„Denkst Du, es gibt dazu Unterlagen“, frage ich.
Die Antwort: „Ganz sicher“.
„Und wo?“
„Im Vatikan, mein Freund. Wir müssen nach Rom.“
Kapitel 2
Erste Spuren des Labyrinths
Vier Monate vor dem Überfall:
Zur Zeit ihrer Erbauung galt sie als die stärkste Festung der Welt. Herzog Georg, genannt der Reiche, konnte sich Ende des 15. Jahrhunderts den Ausbau der ein Kilometer langen Burganlage auf dem von der Salzach gegrabenen Höhenrücken leisten, weil der Salzhandel die Städte an Inn und Salzach wohlhabend machte und damit auch den Herzog. Nicht ohne Grund blickte die weniger betuchte Münchner Verwandtschaft innerhalb der bayerischen Wittelsbacher neidvoll auf den Herzog von Landshut und Burghausen. Als der in jungen Jahren die polnische Königstocher Hedwig heiratete und es mit ihr bei der Landshuter Hochzeit so richtig krachen ließ, gratulierten zwar auch die Münchner Vettern wie es sich gehört, wünschten ihm indes insgeheim den Bankrott. Doch nichts davon geschah: Das Land blühte unter seiner Herrschaft noch mehr als vorher, der Reichtum wuchs weiter. Doch nicht nur wegen der Gier der Verwandtschaft hatte Georg Angst um sein Geld. Die aus dem Morgenland eindringenden Türken hatten das Abendland in Bedrängnis gebracht. Der Untergang Konstantinopels im Jahr 1453 erschütterte die Herrscherhäuser vom Atlantik bis in die Weiten Russlands. Georg fürchtete vor allem die Mauer brechenden Kanonen der Türken. Seine Antwort auf diese Bedrohung war der Ausbau der Burghauser Burg. Die Vorhöfe der eigentlichen Hauptburg ließ er stark befestigen. Denn von drei steil abfallenden Seiten war die Burg ohnehin gut geschützt. Die offene Flanke war die Nordseite. Die Burg wurde mit diesen Vorbauten schon unter Georgs Vorgängern immer länger und wuchs zu ihrer heutigen Größe von 1051 Metern heran.
Und nun, 500 Jahre später, lädt die Bayerische Schlösserverwaltung zu einer herbstlichen Pressekonferenz in den Dürnitz genannten Festsaal der Hauptburg. Dabei geht es nicht um den Reichtum unter Georgs Zeiten und auch nicht darum, dass die Stadt es tunlichst vermeidet, von der längsten Burg der Welt zu sprechen, obwohl das im Guinness-Buch so festgehalten ist. Ein schlauer Hotelier hat den Eintrag veranlasst und sich vertraglich die Namensrechte gesichert. Seither preist die Stadt ihre „weltlängste“ Burg an: verquere Sprache – dafür kostenfrei. Die Pressekonferenz indes hat ein ganz anderes Thema. Schon in der Einladung dazu stand etwas von einem außergewöhnlichen Fund, der die Fachwelt begeistert. Gerade als ich die Treppe zur Dürnitz hochsteige, stupst mich von hinten jemand an, und eine bekannte Stimme stichelt.
„Der neugierige Lokalreporter auch vor Ort.“
Blitzschnell drehe ich mich um und sehe in die wachen Augen einer jungen Frau, die mir bestens bekannt ist. Sie ist leger in einen weiten Mantel gehüllt und trägt eine Wollmütze auf dem Kopf, die sie im nächsten Moment abnimmt und ihren dunkelbraunen Locken den Freiraum gibt, den sie sich selbst ebenso gern nimmt. Eva Plum hat vor einem halben Jahr ein Praktikum in meiner Redaktion abgeleistet. Sie arbeitet genau, analysiert bestens und ist eine Perfektionistin. Aber sie hat auch einen Dickkopf. Eva studiert an der Uni München Geschichte.
„Was machst Du hier, was treibt Dich in die Provinz?“ frage ich.
„Ich bin jetzt im fünften Semester und habe als Schwerpunkt Geschichte des Mittelalters gewählt. Der Fund hier fällt genau in mein Wissensgebiet. Außerdem ist der Weg kurz. Ich wohne ja weiter hier, kann ich mir eine Wohnung in der Großstadt nicht leisten, pendle deshalb“ antwortet Eva.
„Dann könnten wir uns ja öfter mal sehen und Du könntest auch Aufträge für die Redaktion übernehmen“.
Eva geht darauf nicht ein, belässt es bei einem freundlichen Nicken. Seit an Seit gehen wir rein in die Dürnitz. Die mächtigen Mauern des Saals fordern Ehrfurcht ein, durch die gotischen Spitzbogenfenster dringt gerade so viel Licht, dass man ausreichend sehen kann und die Halle in ein mythisches Flair getaucht scheint, gerade so, als ob hinter einem Pfeiler Herzogin Hedwig höchstpersönlich jeden Moment hervortreten könnte.
Der Präsident der Schlösserverwaltung scheint dieses Ambiente zu genießen. Als er die Pressekonferenz eröffnet, spricht er wie ein herzoglicher Herold betont langsam und in getragenem Ton:
„Wie Sie alle wissen, bereiten wir die Burg für die Teilnahme an der Landesgartenschau vor. Neben den Arbeiten in den Burghöfen haben wir zudem ein Forschungsprogramm zur Geschichte dieser Burganlage gestartet. Die jetzige Burg ist ja ein Werk des ausgehenden Mittelalters. Die Anlage selbst ist älter. Schon im 11. Jahrhundert haben Grafen von Burghausen hier eine Burg aus Stein errichtet, davor gab es vermutlich Bauten aus Holz. Bei Grabungen in diesem Gebäude haben sich die geschichtlichen Quellen nun auch im Stein bestätigt. Genau unter uns, in den Räumen unter dem Saal haben wir Mauerreste gefunden, die aufgrund ihrer Bauweise ins 11. und frühe 12. Jahrhundert datiert werden. Wir gehen gleich gemeinsam dorthin, sie können gerne Fotos machen. Diese alten Mauern werden wir konservieren und unseren Besuchern zugänglich machen.“
Der Präsident macht eine Pause, trinkt einen Schluck Wasser. Aller Augen sind auf ihn gerichtet. Er scheint diesen Moment zu genießen, nimmt sich Zeit. Endlich spricht er weiter und lässt die Katze aus dem Sack:
„Das besonders Schöne: Die Mauern waren über Jahrhunderte von Luft und Feuchtigkeit abgeschnitten. Wir konnten an einer Stelle Fresken aus dem Mittelalter sichern. Turnierreiter und andere Ritter sind darauf zu sehen. Das ist ein kultureller Schatz, dessen Bedeutung derzeit noch gar nicht abzuschätzen ist. Wir brauchen dazu noch weitere Untersuchungen. Aber dieser besondere Fund ist noch gar nicht alles. Wie Sie zudem schon wissen, wollen wir auch den Zwinger der Hauptburg den Besuchern zugänglich machen. Der Zwinger war die letzte Sicherheit zur Verteidigung der Burg. Hätten Feinde jemals die Mauern gestürmt, was ja nie geschah, so wären sie, eingekeilt zwischen Mauer und Burg in diesem Zwinger den Geschossen der Verteidiger schutzlos ausgesetzt gewesen. In diesem Zwinger haben wir ebenfalls für eine Burg Besonderes entdeckt. Sie kennen von Domen wie Regensburg die vielen kleinen Ungeheuer und Dämonen, die an den Dächern angebracht sind und die bauliche Funktion haben, Regenwasser weg von den Mauern nach unten abfließen zu lassen. Was sie genau bedeuten, darüber ist sich die Forschung nicht ganz einig. Aber Konsens ist, dass die schrecklichen Figuren Dämonen und böse Geister abhalten und die Kirche vor ihnen schützen sollen. Solche Figuren sind typisch für gotische Kathedralen. Auf weltlichen Bauten kommen sie eigentlich nicht vor. Eigentlich deshalb, weil wir bei den zum Zwinger hin entwässernden Rinnen der Burg nun ebenfalls solche Figuren, wenn auch in kleinerer Form, gefunden haben. Sie sind wohl einst in Vergessenheit geraten, danach stark verwittert und nicht mehr als solche erkannt worden.“
Der Präsident zeigt Bilder von den Mauerfunden und den Wasserspeiern und erläutert Details. Eva notiert aufmerksam mit. Und ich habe die Aufmachergeschichte für morgen nun quasi schon im Kopf. Fotos der Wasserspeier habe ich auf CD bekommen. Aber ich brauche noch ein Foto mit dem Präsidenten am besten vor dem Mauerfund mit den Fresken und muss deshalb auf die Führung warten. Endlich ist es so weit. Wir steigen über Steinstufen nach unten. Hinter einer abgerissenen Wand aus dem 20. Jahrhundert ist eine Vormauerung und dahinter wiederum altes Mauerwerk zu Tage getreten. Ganz zart sind darauf einige Fresken zu erkennen. Wie der Präsident erläutert, werden hier nun die Restauratoren Arbeit bekommen. Ich knipse den Präsidenten vor zwei Turnierreitern, die mit gesenkten Lanzen aufeinander zureiten. Danach mache ich noch einige weitere Bilder und eile zurück in die Redaktion, um die Geschichte zu schreiben. Für danach habe ich mich noch mit Eva auf ein Bier verabredet.
Schnell hacke ich den Artikel in die Tasten, nach einer halben Stunde stehen die gut hundert Zeilen. Mindestens ebenso lang dauert es, bis das Drumherum fertig ist – die Bilder auswählen, die Beschriftungen vornehmen und den Feinschliff am Layout mit Titel und Zwischentiteln. Auf meinem Foto sind die Fresken leider nur vage zu erkennen. Die Schlösserverwaltung hat dagegen zwecks optischer Verbesserung den Restauratoren schon vorweggegriffen und die Farben per Computer verstärkt. Ein solches Foto muss unbedingt mit ins Blatt, ebenso eine trotz Verwitterung eindrucksvolle Chimäre vom Burgdach. Das Mischwesen, ein wenig Panther, etwas Hund und Schuppen wie ein Drache ist real zwar nur ein Zwerg, im Bild aber wirkt es imposant wie ein Riese. Längst bin ich auch mit den Online-Meldungen und der Seitenkorrektur fertig.
Bis Eva kommt, sehe ich mir einige Bilder der CD noch genauer an. Ein Fresko fällt mir auf. Zunächst weiß ich nicht warum. Es zeigt ein Pferd, auf dem zwei Ritter mit langen Schilden sitzen und Lanzen in der Rechten halten. Gerade als Eva eintritt, fällt mir ein, warum mir dieses Fresko so vertraut erscheint. Ein solches Bild in Öl hängt bei meinem Vater. Er war einst der Liebling der kinderlosen Thilde Bellmann, in deren Haus die Familie meines Vaters lebte. Frau Bellmann schenkte meinem Vater dieses Bild, als die Familie das Haus verließ. Als Kind hatte er die Ritter immer mit großer Neugier betrachtet. Das Geschenk sollte für ihn eine Erinnerung an eine unbeschwerte Kindheit und eine liebe alte Dame sein.
„Gehen wir doch einfach ins Kino-Cafe rüber“, schlage ich Eva vor. Dort erzählt sie mir mehr über das Studium.
„Ich arbeite mich gerade in Heraldik und in die Genealogie wichtiger Adelsgeschlechter ein und lerne, mit direkten Quellen, also Urkunden und anderen Schriftstücken, zu arbeiten.“
„Das mag im Einzelfall ja spannend sein, aber mir erscheint das etwas blutleer, ich würde schnell ungeduldig“, unterbreche ich sie und komme auf die Ungeheuer und Fresken der Burg zu sprechen. „Die sind doch viel anschaulicher. Ich muss immer ein Bild vor mir haben. Wenn ich die Turnierreiter sehe, dann entsteht in meinem Gehirn ein Bild vom Mittelalter, von hart gesottenen Recken, die weder Feind noch Teufel fürchten und dann doch dem Minnegesang verfallen und sich für die Dame ihres Herzens schlagen.“
Eva schmunzelt:
„Du bist halt ein Träumer. Ein solches Mittelalter hat es nie gegeben, das ist nur Poesie. Die Welt damals war sozial streng gegliedert. Jeder hatte seinen Stand auszufüllen. Der Bauer musste Geistlichkeit und Adel ernähren. Der Adel hatte die Aufgabe, Land und Leute zu schützen. Tatsächlich aber ging es vor allem darum, den Besitz zu mehren. Viele blutige Fehden entstanden, weil eine solche Vermehrung immer auf Kosten eines anderen ging. Und die Kirche lieferte die Ideologie, dass eine Welt mit dem Adel oben und den leibeigenen Bauern unten die gottgewollte Ordnung sei. Nebenbei profitierte der Klerus auch ganz direkt. Die auf den Armutsprediger Jesus von Nazareth zurückgehende Religion wurde reich und Eckstein der Macht. Die Kirche ließ sich gern von großen und kleinen Herrschern beschenken, entwickelte sich zum größten Grundbesitzer im Reich.“
„Aber die Kirche hatte auch gute Seiten“, werfe ich ein. „Ohne sie und die Religion wären Kriege und Kampf um materielle Vorteile noch viel blutiger verlaufen. Und vor allem: Die Kirche bot dem einfachen Volk die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Sie förderte junge kluge Köpfe und gab ihnen Stellen als Priester. Nur so konnten Bauernkinder der harten Fronarbeit entkommen.“
„Das stimmt nicht ganz“, unterbricht mich Eva.
„Bischöfe und Äbte waren immer adelig. Aufstiegsmöglichkeiten boten zudem auch die Städte.“
„Kehren wir zurück zum Bild, das ich mir so gern mache“, beende ich unseren kleinen geschichtlichen Diskurs:
„Wie findest Du die Fresken?“
Eva lacht auf.
„Die haben ja reichlich nachgeholfen. An den Mauern sind doch nur Umrisse und vage Farbreste zu sehen. Auf der CD gibt es zwar den Hinweis, die Bilder seien ‚zwecks besserer Anschaulichkeit’ bearbeitet. Aber ganz koscher erscheint mir das nicht. Die Schlösserverwaltung hätte besser das Ergebnis der Restaurierung abgewartet als zwecks besserer Vermarktung eine virtuelle Realität zu schaffen, die am Ende vielleicht anders aussieht und vor allem bewertet wird.“
„Das mag schon sein“ antworte ich, „aber ich seh’ das nicht so eng, bin froh um diese aufgepeppten Bilder. Sonst hätte ich dem Leser optisch außer den von Wind und Regen zerfressenen Dämonen am Dach nichts bieten können. Diese Fotos aber wecken Interesse und Neugier. Und die Schlösserverwaltung ist ja auch ein staatliches Unternehmen, das Besucher anlocken und Einnahmen generieren will. Da leistet die optische Nachhilfe einen guten Zweck.“
„Du meinst, der Zweck heiligt die Mittel.“
Evas Züge werden strenger, sie starrt mich an, ihre Stimme wird lauter:
„Du hörst Dich schon an wie ein Politiker. Genau das ist doch der große Irrtum. Der Zweck kann nie die Mittel heiligen. Unrecht bleibt Unrecht, egal wie man es kaschiert oder rechtfertigen will. Überleg nur, wie viele Menschen ihr Leben lassen mussten, weil sie zufällig oder ungewollt zwischen die Fronten geraten sind.“
„Das schon, aber Gewalt richtig eingesetzt kann auch Gutes bewirken. Stell Dir nur vor, die Franzosen hätten auf Hitlers Rheinlandbesetzung militärisch geantwortet. Zu dieser Zeit bestanden die deutschen Armeen erst auf dem Papier. Die Nazis hätten eine Niederlage kassiert, vielleicht wäre sogar Hitler gestürzt worden und so der Welt viel erspart geblieben.“
Eva lässt diesen Vergleich nicht gelten.
„Da ging es doch um einen Vertragsbruch. England und Frankreich wollten den Frieden retten, was nicht gelingen kann, wenn die andere Seite auf Krieg setzt. Ich sag Dir ein anderes Beispiel, an dem besser klar wird, was ich meine. Nach der Zerstörung des Dorfes My Lai im Vietnamkrieg mit Ermordung der Bewohner sagte ein US-Soldat: ,Wir mussten sie töten, um sie zu retten.’ Mit Retten meinte er vor dem Kommunismus. Das ist die absolute Perversion des Denkens. Und wenn ich überlege, wozu Menschen fähig sind, ich sage nur Srebrenica mit den 8000 Ermordeten, dann gilt meine Aussage, der Zweck dürfe nie die Mittel heiligen, umso mehr.“
Evas Gesicht hat eine leicht gerötete Farbe angenommen, sie hat sich in Rage geredet. Ihr Blick richtet sich erneut auf mich:
„Gerade weil wir Menschen zur Gewalt neigen, muss diese begrenzt und kontrolliert werden. Und da seid Ihr Journalisten in der Pflicht. Ihr müsst für die Wahrheit kämpfen, für Transparenz und für mündige Bürger, die resistent sind gegenüber Lug und Trug in den sozialen Medien. Und ihr müsst die Narzissten und Diktatoren und all die anderen Scharlatane dieser Welt entlarven, damit ihnen die Leute nicht auf den Leim gehen.“
Ich schüttle den Kopf:
„Eva, komm wieder runter. Du hast ja grundsätzlich Recht, aber wenn ich auf den Ausgangspunkt unserer Diskussion zurückkomme, dann hast Du aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Es ging doch nur darum, ob die Schlösserverwaltung ihre Fotos aufpeppen soll oder nicht. Da hast du jetzt doch deutlich überzogen.“
Eva bemüht sich um ein Lächeln, gibt aber nicht klein bei:
„Wie heißt es so schön: Wehret den Anfängen.“
Kapitel 3
Ein schwarzes Loch
Beim abendlichen Rotwein läuft Frank immer zu großer Form auf. Vor allem dann, wenn es sich um ein gelungenes Cuvée der Trauben Cabernet und Shiraz handelt. Franks Fantasie bekommt dann geradezu einen Kick. In Verbindung mit dunkler Schokolade haben wir schon zig Mal die Welt und unser Dasein diskutiert und dabei immer wieder neue Aspekte gesucht und gefunden. Unsere Freundschaft besteht ja schon seit der Jugend, als wir gemeinsam mit Kumpels Fußball gespielt haben. Zu Studienzeiten hatten wir eine gemeinsame Wohnung. Ich schmökerte damals gern in seinen medizinischen Büchern und er las gern in meiner Sammlung aus Literatur und Sprachwissenschaft. Diesem wechselseitigen Gedankenaustausch zwischen wissenschaftlicher und sprachlicher Logik haben wir bis heute die Treue gehalten. Frank arbeitet als Neurologe in einer Klinik, hat viele Querschnittsgelähmte betreut und ihnen neuen Lebensmut vermittelt. Das kostet ihn aber enorm Kraft, und deshalb genießt er die Auszeit von Beruf und Familie, in denen er die Gedanken schweifen lassen kann. An diesem nebligen Herbstabend will er mit mir einmal mehr über das Grundsätzliche sprechen, über das, was wir unter Realität und Fiktion verstehen. Und er haut mir gleich einen Satz hin, der eine finale Erkenntnis beinhaltet, der zu widersprechen schwerfällt. „Wir haben Atommodelle, wissen aus Beobachtung und Erfahrung wie Atome mit anderen reagieren, haben es sogar fertiggebracht, mit der Spaltung und Fusion von Atomkernen Bomben zu bauen, mit denen wir uns ausrotten können – aber noch immer kann keiner die Frage beantworten, was ein Atom wirklich ist.“
„Das ist unfair“, antworte ich, Du weißt genau, ich kann Dir nicht widersprechen. Atomkerne sind so klein, bilden ja selbst das Licht, deshalb kann es kein Mikroskop, keine Vergrößerung geben, um sie jemals sehen zu können. Sie werden immer nur indirekt erkennbar gemacht. Und was wir nicht wirklich sehen können, können wir auch nicht verstehen.“
„Das ist richtig“, räumt Frank ein und lässt einen Schluck Wein lange im Munde kreisen, ehe er genussvoll schluckt. „Aber wir tun so, als wäre uns völlig klar, was Materie ist und was sie im Innersten zusammenhält. Genau das ist eine Illusion. Atome nehmen Raum ein, aber ob sie selbst räumlich sind, das bezweifle ich. Wie könnte es sonst sein, dass gemäß der Theorie der Schwarzen Löcher die Materie hinter dem Ereignishorizont in eine Singularität fällt, die keinerlei Ausdehnung mehr hat, quasi punktförmig ist. Die Kosmologen gehen ja sogar davon aus, dass die gesamte Materie des Universums einst in einem solch punktförmigen Gebilde konzentriert war und daraus Raum und Zeit entstanden und die Existenz der Welt begann.“
„Ach Frank“, sag’ ich, „die Wissenschaftler rechnen aus der jetzigen Ausdehnung des Weltalls zurück und schließen daraus auf einen explosionsartigen Beginn. Sie rechnen dir sogar vor, wie in der ersten Sekunde der Welt alle wesentlichen Entscheidungen eigentlich schon gelaufen sind und unsere Erde, das Leben und wir als denkende Wesen dann eine zwangsläufige Folge dieser ersten Sekunde sind. Das ist mir gelinde gesagt zu gewagt. Klarer ausgedrückt, halte ich derlei Aussagen für Unfug.“
„Nein, nein“, unterbricht mich Frank. Die Welt lässt sich genau aus dem Zusammenwirken der vier Grundkräfte erklären. Und die Spekulation der Kosmologen ist doch, dass die Welt entstanden ist, als sich diese zunächst in einer Einheit verbundenen Kräfte aufspalteten, mit abnehmender Temperatur sozusagen die Symmetrie zu Bruch ging, Kräfte wie die Elektrizität entstanden und damit Protonen, Neutronen und Elektronen, quasi als Kondenswasser des abkühlenden Superdampfs. Realität ist nur die Energie, die Teilchen selbst sind eine menschliche Fiktion, die wir brauchen, um das Geschehen verstehen zu können.“
„Frank, Du steigerst Dich da in etwas rein, ich glaube genau andersrum wird ein Schuh daraus. Die Energie mag ja die wahre Realität sein. Aber was aus ihr entsteht ist für mich mehr als Fiktion. Das große Wunder ist doch, was daraus geworden ist – zunächst nur Wasserstoff und Helium, dann in den Sternen die übrige Materie und damit die Voraussetzung zur Entstehung von Wesen wie wir, die hier bei einem Glas Wein über ihre eigene Existenz reden können. Und ich halte mich schon für sehr existent und nicht nur für eine Fiktion.“
„Da hast du ja Recht“, gesteht mir Frank zu und schiebt sich ein Stück Schokolade in den Mund. Ich genieße diese Schokolade ja auch und betrachte sie als durchaus existent. Aber wir müssen auch hinter das Offensichtliche blicken, den Dingen auf den Grund gehen. Und da sagt mir der Verstand: Schokolade ist eine der schönsten Fiktionen, die uns die Natur geschenkt hat. Der wahre Kern dahinter ist aber ebenfalls nichts anderes als Energie, die bewirkt, dass Teilchen, also kondensierte Energie, miteinander reagieren und mir meine Nervenzellen sagen: Das schmeckt verdammt gut.“
Dann wechseln wir das Thema. Ich erzähle Frank von den Fresken und Monstern auf der Burg. Er ist etwas skeptisch.
„Ist das alles schon fachlich untersucht worden. Heute nimmt sich doch keiner mehr die Zeit, erst einen Sachverhalt zu prüfen.“
„Die Leute wollen halt informiert werden. Du kannst solche Funde nicht zurückhalten, bis alles untersucht ist. Das sickert durch, die Schlösserverwaltung würde als inkompetent erscheinen, würde sie nicht sofort reagieren und informieren.“
Franks Sicht der Dinge ist auch hier eine andere. Dass Menschen neugierig sind und diese Neugier bedient sein will, das mag er nicht wahrhaben. Was wir aber beide unisono wahrnehmen: die Flasche Wein und damit auch unser Nachtgespräch neigt sich ihrem Ende zu.
Ein gerüsteter Ritter sprengt auf mich zu. Ich sehe doch, er ist real, senkt beim Näherkommen bedrohlich seine Lanze in Richtung meiner Brust. Wie angewurzelt stehe ich frei nahe einem Baum, kann mich nur mühsam bewegen. Dann gelingt mir doch noch ein schneller Schritt zur Seite hinter den Baum, der mir Schutz vor der drohenden eisernen Spitze der ritterlichen Lanze bietet. Der Reiter wendet und galoppiert nun von der anderen Seite auf mich zu. Ich schaffe es nicht mehr hinter den Baum. Aber im letzten Moment erkenne ich einen langen Schild auf dem Boden vor mir. Ich reiße ihn hoch und kann den Lanzenstoß damit abfangen.
Dann reibe ich mir die Augen, sehe mich in ein Halbdunkel getaucht. Ganz dunkel ist es nicht, weil der Vollmond hinter Wolken hervorgetreten ist. Sein Licht dringt durch die Vorhänge. War alles nur Illusion. Ein Traum und doch wirkte der sehr real. Unser Gehirn schafft sich ja seine eigene Realität. Zu der gehört, dass ich mir ein Glas Wasser einschenke, weil das Gehirn Durst meldet. Nach ein paar Schluck ist der gestillt, schon taucht der rettende Schild aus dem Traum noch einmal vor meinem geistigen Auge auf. Ich erinnere mich an das Ölbild, das mein Vater aus dem Bellmann-Haus hat und mir wird nach diesem Traum bewusst, wie ähnlich es einem der Fresken auf der Burg ist.
Der Traum hat zudem die Erinnerung an eine alte Begebenheit wachgerufen, die auch mich mit dem Bellmann-Haus verbindet. Dieses alte Patrizierhaus am Stadtplatz Neuötting hat eine große Geschichte. Hier lebte eine einflussreiche Händlerfamilie. Thilde Bellmann war die Letzte ihres Geschlechts. Vom einträglichen Handel früherer Jahrhunderte war nur noch ein Großhandel mit Kohlen und Brennstoffen geblieben, der wiederum immer mehr an Bedeutung einbüßte, weil dafür erstens ein Haus am Stadtplatz ein zunehmend ungünstiger Standort war und zweitens die agilere Konkurrenz Thilde Bellmann schwer zusetzte. Thilde Bellmann wurde von der Zeit überrollt, sie war eine Patrizierin, aber keine Geschäftsfrau. Die alte Dame verkaufte das Haus weit unter Wert, lebte danach in bescheidenen Verhältnissen und starb wenig später. Einige Jahre nach ihrem Tod betrat ich dieses Gebäude. Als ich zu studieren anfing, wollte ich vorab erst ein bisschen Geld verdienen. Da kam es gerade recht, als mein Onkel nicht genügend Mitarbeiter für seinen Malerbetrieb finden konnte. Ich heuerte an und arbeitete mich ein. Als Ungelernter durfte ich zwar nur die Arbeiten machen, die keiner gern tun wollte. Alte Fensterstöcke abschleifen, Lackreste entfernen und alte Tapeten von Wänden kratzen - das war meine wenig erbauliche Welt, die mir aber ein erstes Einkommen sicherte und das Studium ermöglichte. Als ich bei meinem Onkel die ersten Erfahrungen in Farbenkunde sammelte, kam ich wie bereits erwähnt auch ins Bellmann- Haus, und konnte der Versuchung nicht widerstehen. Eines Abends blieb ich unter dem Vorwand, eine Arbeit unbedingt noch fertig zu machen etwas länger. Als ich dann allein war, ging ich die Treppe zum zweiten Stock nach oben. In der Tat: eine Trittstufe knarzte. Jetzt wo alles still im leeren Haus war, hörte ich es ganz deutlich. Der Puls stieg, ich spürte mein Herz schlagen. Mein Vater hatte mir von einer alten Geschichte erzählt, die er für eine Fantasiegeburt hielt, die aber einen wahren Kern haben könnte. Demnach war in der Treppe ein Schatz aus alten bayerischen Dukaten versteckt und zwar unter einer knarzenden Stufe.
Noch gut erinnere ich mich an das damals folgende Geschehen im Bellmann-Haus: Ich taste das Holz ab. Von außen unterscheidet sich diese Stufe nicht von den anderen. Wenn es hier tatsächlich einen Hohlraum mit einem Versteck darunter gibt, dann muss es auch einen Zugang geben, der es ermöglicht, die Trittstufe zu entfernen. Ich kann doch nicht mit der Axt loslegen, das gäbe am nächsten Morgen einen riesen Wirbel und vermutlich eine Befragung durch die Polizei. Aber die Stufe sitzt fest. Ich ziehe und drücke in alle Richtungen, ohne Erfolg. Allmählich schwindet mir der Glaube, hier etwas bewegen zu können, ich bin nahe am Aufgeben. Da fällt mir auf: eine Stufe hat ja zwei Teile, die waagrechte Trittstufe, auf der man geht und ein senkrecht stehendes Brett, das die jeweilige Stufe nach hinten zur nächsthöheren abschließt. Und als ich an diesem Brett herumfummle, glaube ich eine leichte Beweglichkeit zu erkennen. Es sitzt nicht ganz stramm, scheint, wie der Handwerker sagt, ein kleines Spiel zu haben. Ich drücke und ziehe erneut, ohne Ergebnis. Das wäre denn auch zu einfach. Ginge es so leicht, hätte doch die Putzfrau schon längst ein solches Versteck gefunden. Nein, es muss einen Trick geben, geht es mir durch den Kopf. Aber den kenne ich leider nicht. Meine Augen helfen mir weiter. Eine kleine kaum sichtbare Abschabung ist am Treppengeländer zu sehen und zwar genau an der Innenseite der Sprosse in Höhe des Bretts. Wenn ich hier einen Hebel ansetze, könnte ich Kraft auf das senkrechte Stufenbrett ausüben. Da liegt doch unten in einem Zimmer ein Geißfuß, den andere Handwerker gestern gebraucht haben, fällt es mir ein. Ich hole das Teil und kann das Brett damit in der Tat etwas bewegen. Doch noch sperrt es sich. Erst als ich auf der anderen Seite unten das Brett nach innen drücke und es gleichzeitig über den Hebel und damit ziemlicher Kraft zur Wand hin schiebe, hakt mit einem Ruck eine Versperrung aus. Das Brett schnappt an der Wandseite nach innen und ich kann es dann an der Geländersprosse vorbei wegziehen. Mein Herz schlägt bis zum Hals.
Doch die Aufregung ist umsonst. Es gibt hier zwar einen Hohlraum, aber da ist nur Luft. Auch die eigens mitgebrachte Taschenlampe bestätigt bei besserem Licht: das Nest ist leer. Nicht eine einzige Goldmünze liegt hier. Aber mein Gehirn sagt mir auch: Dieses Versteck ist real, hier hat sicher einmal etwas gelegen.
Enttäuscht sehe ich mir den Mechanismus an. Es ist eine raffinierte Konstruktion. Ich muss das Brett nur wieder gerade einschieben und über den Hebel Druck ausüben, dann muss es wieder einrasten. Aber damit warte ich noch ein wenig. Ich habe mich fast zwei Stunden damit gequält, das Versteck zu öffnen. Es einfach gleich wieder zuzumachen, das fällt mir schwer. Denn ich bin schon stolz auf mein Geschick und möchte ein Zeichen hinterlassen. Also schreibe ich auf ein Stück Papier die Ordensregel der Benediktiner „ora et labora“ also „bete und arbeite“ und rate damit gleichsam künftigen Schatzsuchern, es doch besser mit einträglicher Arbeit zu versuchen. Den Zettel einfach reinlegen will ich auch nicht. Ich nehme etwas Malerfarbe und will ihn damit von unten an die Trittstufe ankleben. Aber Moment – da befindet sich doch schon Papier, da ist etwas angeheftet, oder vielmehr in einen kleinen Holzspalt eingeschoben. Vorsichtig ziehe ich daran. Ein vergilbtes Blatt. Es ist zusammengefaltet. Ich klappe es auf. Eine Schrift, die ich kaum lesen kann. Sie erinnert mich an Urkunden, als die Schreiber mit vielen Rundungen eine heute nur schwer lesbare Schrift formten. Ich beginne zu lesen: Et ego dico vobis: Petite et dabitur vobis…. Weiter komme ich nicht. Ein Geräusch hat mich aufgeschreckt. Vielleicht ist es ja nur eine Katze. Aber besser ich gehe jetzt, möchte nicht mit geöffneter Treppe im Haus entdeckt werden. Ich stecke das Papier ein, zögere einen Moment. Doch dann klebe ich doch mein „ora et labora“ innen unter die Treppe. Das Verschließen der Stufe geht ganz einfach, jetzt, wo ich den Mechanismus verstanden habe. Niemand hat mich bemerkt. Erleichtert trete ich ins Freie. Nach dem leicht modrigen Geruch der alten Wände genieße ich die frische Luft.





























