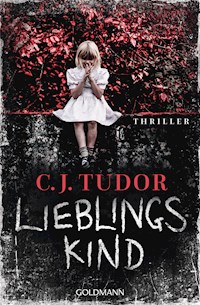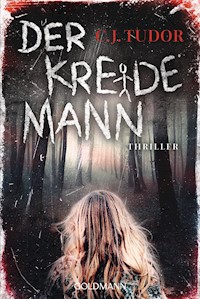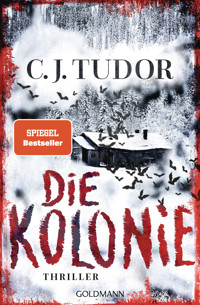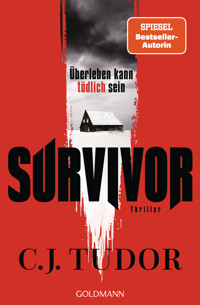9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor 500 Jahren: Acht Märtyrer wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Vor 30 Jahren: Zwei Mädchen verschwanden für immer. Vor zwei Monaten: Ein Pfarrer hat sich in der Kapelle erhängt. Willkommen in Chapel Croft.
Für die Pfarrerin Jack Brooks und ihre Tochter Flo sollte es ein Neustart sein: neuer Job, neues Zuhause. Aber Jack stößt auf eine eingeschworene Dorfgemeinschaft, in der Misstrauen gegenüber Fremden tief verwurzelt ist. Schon bald muss sie sich fragen: Wer schickt ihnen düstere Drohbotschaften? Und warum hat Flo Visionen von brennenden Mädchen? Chapel Crofts Geheimnisse liegen verborgen in einem dunklen Grab, aber nun kehren die alten Gespenster zurück – und sie werden keinen Frieden finden, bis sie nicht Vergeltung geübt haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Vor 500 Jahren: Acht Märtyrer wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Vor 30 Jahren: Zwei Mädchen verschwanden für immer. Vor zwei Monaten: Ein Pfarrer hat sich in der Kapelle erhängt. Willkommen in Chapel Croft.
Für die Pfarrerin Jack Brooks und ihre Tochter Flo sollte es ein Neustart sein: neuer Job, neues Zuhause. Aber Jack stößt auf eine eingeschworene Dorfgemeinschaft, in der Misstrauen gegenüber Fremden tief verwurzelt ist. Schon bald muss sie sich fragen: Wer schickt ihnen düstere Drohbotschaften? Und warum hat Flo Visionen von brennenden Mädchen? Chapel Crofts Geheimnisse liegen verborgen in einem dunklen Grab, aber nun kehren die alten Gespenster zurück – und sie werden keinen Frieden finden, bis sie nicht Vergeltung geübt haben …
Weitere Informationen zu C. J. Tudor und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches
C. J. Tudor
Das Gotteshaus
Thriller
Deutsch von Marcus Ingendaay
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Burning Girls« bei Michael Joseph, Penguin Random House UK, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Betty & Betty Ltd
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Juni 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © James Johnstone/Gettyimages; FinePic®, München
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-27988-2V004www.goldmann-verlag.de
Für Neil, Betty und Doris.Den Großen, die Schlaue und die Maus.
Brennende Mägdelein:
Aus: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie
Als brennende Mägdelein (engl. burning girls) werden die überlebensgroßen Reisigpuppen bezeichnet, die in der englischen Ortschaft Chapel Croft (Grafschaft Sussex) alljährlich zum Gedenken an die Opfer der sogenannten Ketzerverfolgungen durch Maria I. von England entzündet werden. Während der Regentschaft von Maria I. (1553–1558), die schon bald den Beinamen »die Katholische« bzw. »die Blutige« erhielt, fanden insgesamt acht protestantische Einwohner von Chapel Croft den Tod auf dem Scheiterhaufen, darunter zwei minderjährige Mädchen. Sie gelten heute als Märtyrer (Sussex Martyrs). Das Feuer der brennenden Mägdelein findet alljährlich in der landesweiten Bonfire Night am Abend des 5. November statt.
Prolog
Was bin ich für ein Mann?
Es war eine Frage, die er sich in letzter Zeit öfter vorlegte.
Ich bin ein Mann Gottes, ein Diener des Herrn. Ich erfülle seinen Willen.
Aber reichte das?
Er starrte auf das kleine weiß gekalkte Haus, das im rotgoldenen Schein der Spätsommersonne vor ihm lag. Ein Cottage mit dem landestypischen Strohdach. An der Hauswand rankte Klematis, in den Bäumen zwitscherten die Vögel. Träges Bienengesumm.
Hier wohnt das Böse. Ausgerechnet hier in dieser friedlichen Umgebung.
Während er über den schmalen Fußpfad weiter auf das Haus zuging, verstärkte sich sein ungutes Gefühl, und sein Magen zog sich zu einem harten schmerzenden Ball zusammen. Noch ehe er anklopfen konnte, wurde ihm aufgetan.
»Hochwürden, Gott sei Dank! Sie schickt der Himmel.«
Vor ihm stand die Mutter. Sie sah aus, als wäre sie am Ende ihrer Kräfte. Die strähnigen braunen Haare wie an den Schädel geklatscht, die Augen blutunterlaufen, die Haut furchig und fahl.
So sieht es aus, wenn man Satan im Haus hat.
Er trat ein. Augenblicklich umgab ihn säuerlicher Gestank, als wäre schon lange nicht mehr reinegemacht worden. Wahrscheinlich roch das ganze Haus so. Wie hatte es nur so weit kommen können? Er spähte die Treppe hoch. Das Dunkel im oberen Teil lauernd und bösartig wie ein unreiner Nebel, in den sich kein Christenmensch freiwillig begab. Seine Hand suchte Halt am Treppengeländer, seine Beine verweigerten den Dienst. Er kniff die Augen zusammen und rang nach Luft.
»Hochwürden?«
Ich bin ein Mann Gottes.
»Na, dann zeigen Sie mal.«
Er stieg die Treppe hoch. Im Obergeschoss gab es nur drei Zimmer. Aus einem davon blickte ihn kurz ein Junge an. Schmuddeliges T-Shirt, Shorts, stierer Blick. Nur Sekunden später knallte die Tür zu.
Aber zu ihm wollte er ohnehin nicht. Er öffnete die Tür dahinter, wo Hitze und Gestank ein Medium geschaffen hatten, das ihm den Atem raubte. Er hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht zu würgen.
Ein Bett, über und über besudelt mit Blut und Körperflüssigkeiten. An den Bettpfosten hingen noch die Handfesseln – leer, offen. Und auf der Matratze ein lederner Instrumentenkoffer mit den Werkzeugen der Befreiung vom Bösen, allesamt durch Schlaufen gesichert: ein schweres Kruzifix, eine Bibel, Weihwasser, etliche Musselintücher.
Zwei Gegenstände fehlten, sie lagen auf dem Boden. Ein Skalpell und ein Sägemesser, beides blutbeschmiert. Das meiste Blut aber war auf dem Boden. Es bildete eine große Pfütze, die den toten Körper umfloss wie ein rubinroter Umhang.
Er schluckte, und sein Mund war plötzlich so trocken wie die verdorrten Sommerweiden in der Gegend. »Guter Gott, was ist denn hier passiert?«
»Das sagte ich doch. Der Teufel hat seine …«
»Genug. Schweigen Sie!«
Dann erregte etwas auf dem Nachttisch seine Aufmerksamkeit, und er trat näher. Eine kleine schwarze Schatulle. Einen Moment lang starrte er darauf und drehte sich anschließend zur Mutter, die an der Tür die Hände rang und ihn flehentlich ansah.
»Was sollen wir jetzt bloß tun?«
Wir? Offenbar war es von nun an auch sein Problem.
Er blickte auf die verstümmelte, blutige Leiche am Boden.
Was für ein Mann bin ich?
»Holen Sie Putzlappen und Chlorbleiche. Sofort!«
WELDON HERALD
Donnerstag, 24. Mai 1990
Zwei Mädchen vermisst
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei abgängigen Teenagern aus Sussex: Merry Lane und Joy Harris. Die beiden 15-jährigen Mädchen sollen gemeinsam von zu Hause weggelaufen sein. Joy Harris wurde zuletzt am Abend des 12. Mai an einer Bushaltestelle in Henfield gesehen. Merry Lane verschwand eine Woche später aus ihrem Elternhaus in Chapel Croft, sie hinterließ einen Abschiedsbrief.
Obwohl die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Verbrechen ausgeht, kann, so ein Sprecher, »eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden«. Die beiden Mädchen werden daher dringend gebeten, sich bei ihren Eltern zu melden.
»Keine Angst, euch passiert nichts. Alle machen sich nur furchtbare Sorgen um euch und wären schon beruhigt, wenn sie wüssten, dass ihr wohlauf seid. Ihr könnt jederzeit zurückkommen.«
Joy ist 1,65 Meter groß und hat lange hellblonde Haare und ein noch kindliches Gesicht. Vor ihrem Verschwinden war sie mit einem pinkfarbenen T-Shirt sowie stonewashed Jeans und Turnschuhen der Marke Dunlop Green Flash bekleidet.
Merry ist auffällig schlank, 1,70 Meter groß und trug einen grauen Oversized-Pulli, Jeans und schwarze Leinenschuhe.
Bei Antreffen oder Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Vermissten bitte Nachricht an die Polizeiinspektion Weldon unter der Nummer 01323 456723 oder Crimestoppers unter 0800 555 111.
1
»Es ist wahrlich eine äußerst missliche Situation.«
Seine Exzellenz, Bischof John Durkin, lächelt huldvoll.
Was aber nichts heißen muss, denn ich bin sicher, er macht das bei allen so. Diese huldvolle Art ist seine Methode, die Welt zu zwingen. Wahrscheinlich geht er sogar huldvoll kacken.
Der jüngste Bischof, der je die Diözese North Nottinghamshire regierte, ist ein glänzender Redner und Autor einiger vielbeachteter theologischer Abhandlungen, und es würde mich sehr wundern, wenn er nicht zumindest den Versuch unternommen hätte, auf dem Wasser zu wandeln.
Kurz und gut, ein Wichser, wie er im Buch steht.
Ich weiß es. Seine Amtskollegen wissen es. Und seine Untergebenen erst recht. Insgeheim, denke ich manchmal, weiß er es sogar selbst. Ein Wichser.
Leider spricht das nur niemand laut aus. Ich auch nicht. Ich schon gar nicht. Nicht heute. Nicht, solange er meinen Job, mein Haus und meine gesamte Zukunft in seinen wurstigen manikürten Griffeln hält.
»Ein solcher Vorfall ist geeignet, den Glauben einer ganzen Gemeinde zu erschüttern«, erklärt der Bischof.
»Vielleicht. Aber um den Glauben geht es hier nicht. Was ich sehe, ist in erster Linie Trauer und Wut. Ich werde trotzdem nicht zulassen, dass diese Geschichte alles zerstört, was wir uns aufgebaut haben. Das heißt, ich kann die Menschen jetzt, wo sie mich am meisten brauchen, nicht im Stich lassen.«
»Dass die Leute Sie brauchen, möchte ich bezweifeln. Die Besucherzahlen sind im Keller, die Bibelstunden abgesagt, und bei den Kindergruppen, so höre ich, sieht man sich gerade nach einer neuen Pfarrgemeinde um.«
»Nach einem solchen Polizeieinsatz auch kein Wunder. In dieser Gemeinde macht man einen großen Bogen um alles, was mit der Polizei zu tun hat.«
»Das verstehe ich ja …«
Nein, tut er nicht. Er versteht gar nichts. Einer wie Durkin bekommt die Innenstadtbezirke von Nottingham doch nur aus Versehen zu Gesicht. Zum Beispiel, wenn sein Chauffeur auf der Fahrt zu seinem privaten Sportstudio falsch abbiegt. Denn auch das Reich eines John Durkin ist nicht von dieser Welt – in diesem Fall der ärmsten Stadt des Vereinigten Königreichs.
»Trotzdem meine ich, dass wir das wieder hinkriegen. Ich kann das Vertrauen wiederherstellen.«
Was ich ihm verschweige: Dass ich mir diese Aufgabe selbst auferlege, als Buße. Ja, ich habe einen Fehler begangen, aber ich laufe nicht weg, sondern mache alles wieder gut.
»Wie stellen Sie sich das vor? Glauben Sie, Sie können Wunder wirken?« Noch bevor ich etwas erwidern kann, redet er weiter, denn das kann er, reden. »Hören Sie zu, Jack. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes gegeben haben. Aber Sie dürfen solche Sachen nicht so nah an sich heranlassen.«
Ich sitze plötzlich kerzengerade da und bin versucht, die Arme vor der Brust zu verschränken wie ein patziger Teenager. Ich sage: »Bislang hielt ich genau das für unsere Aufgabe: den Menschen nahe zu sein, eine Verbindung herzustellen.«
»Auch, ja. Aber bei alledem dürfen wir unser öffentliches Erscheinungsbild nicht vergessen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Überall ist die Kirche auf dem Rückzug. Immer weniger Leute gehen zum Gottesdienst. In so einer Lage können wir schlechte Presse gar nicht gebrauchen.«
Es ist das Einzige, was Durkin überhaupt interessiert: was die Zeitungen schreiben, der »Auftritt« der Kirche, wie er gerne sagt. Und nach PR-Maßstäben habe ich dem Laden tatsächlich schwer geschadet. Indem ich ein Mädchen retten wollte, habe ich es dem Verderben anheimgegeben.
»Und jetzt? Soll ich mein Amt niederlegen?«
»Keineswegs. Es wäre eine Schande, jemanden Ihres Kalibers mir nichts, dir nichts ziehen zu lassen.« Er arrangiert seine Hände zu einer Kirchturmspitze und kommt sich nicht einmal blöd vor. »Außerdem, wie stünden wir dann da? Es wäre erst recht ein Schuldeingeständnis. Nein, der nächste Schritt will wohlüberlegt sein.«
Aber sicher. Zumal er es war, der mir diese Gemeinde gegeben hat. Ich war ja mal so etwas wie sein Champion in der großen Dackelshow eines zeitgemäßen Christentums. Und es lief ja auch gut für uns. Dieser verwahrloste Sprengel in einem sozialen Brennpunkt von Nottingham, er erwachte zu neuem Leben. Das Samenkorn, das auf harten Asphalt fiel …
Bis Ruby auftauchte.
»Was schlagen Sie vor?«
»Ich versetze Sie. Irgendwohin, wo Sie weniger unter Beobachtung stehen. Ich denke da an eine kleine Gemeinde in Sussex, die gerade ohne Seelsorger dasteht – was so niemand voraussehen konnte. Der Ort heißt Chapel Croft, und es handelt sich ausdrücklich um eine Vertretungsstelle. Bis zur Ernennung des Nachfolgers sind Sie dort Kaplan.«
Ich starrte ihn entgeistert an. Mir ist, als würde mir soeben der Boden unter den Füßen weggezogen.
»Entschuldigung, aber das geht nicht. Meine Tochter macht im kommenden Jahr die Mittlere Reife. Wir können nicht ohne Weiteres umziehen.«
»Ich habe Ihre Versetzung schon mit Bischof Gordon aus der Diözese Weldon abgeklärt. Die Entscheidung ist gefallen.«
»Sie haben was? Wie soll das gehen ohne Ausschreibung und alles? Und es gibt mit Sicherheit geeignetere Kandidaten aus der Region.«
Er wischte den Einwand mit einer Handbewegung weg. »Wir kamen eher zufällig darauf. Er erwähnte etwas von einer Vakanz – ich hatte den passenden Mann, das war alles. Wie das Leben so spielt.«
Und es spielt wie verrückt, wenn Durkin die Strippen zieht. Das kann er besser als Meister Gepetto.
»Sehen Sie es positiv: eine malerische Gegend, frische Landluft, Wiesen und Felder. Und eine kleine unkomplizierte Gemeinde. Tut Ihnen und Ihrer Tochter vielleicht ganz gut.«
»Ich weiß selber, was uns guttut und was nicht. Die Antwort ist nein.«
»Schade, dann muss ich wohl deutlicher werden, Jack«, und er fixiert mich mit seinem Blick. »Chapel Croft ist, soweit es mich betrifft, kein unverbindlicher Vorschlag, sondern …« Er hebt seine Hände in Unschuld.
Und genau deshalb ist Durkin der jüngste Bischof, den diese Diözese je gesehen hat. Selig sind die Sanftmütigen, aber das Land erben Typen wie Durkin.
Ich balle die Fäuste im Schoß. »Schon verstanden.«
»Dann ist ja alles klar. Sie fangen nächste Woche an. Und packen Sie Ihre Gummistiefel ein, Sie werden sie brauchen.«
2
»O. Mein. Gott.«
»Ruhe jetzt! Du missbrauchst schon wieder den Namen des Herrn.«
»Ich weiß, aber …« Flo schüttelt den Kopf. »Guck dir die Bruchbude doch an!«
Wo sie recht hat, hat sie recht. Ich fahre rechts ran und besehe mir unser neues Haus. Das heißt das Haus des Herrn. Unsere Dienstunterkunft befindet sich direkt daneben: ein kleines Cottage, das vielleicht ganz gemütlich wäre, stünde es auch nur annähernd im Lot. Tatsächlich neigt sich das Häuschen wie ein Parallelogramm zur Seite, fast so, als hätte es beschlossen, sich still und leise, Stein für Stein, vom Acker zu machen.
Das Haus des Herrn sieht allerdings kaum besser aus: ein kleiner, ehedem altweißer Kasten, bei dem alles weggelassen wurde, was eine Kirche normalerweise ausmacht. Es gibt weder Spitzdach noch Kreuz noch Buntglasfenster, lediglich vier lukenähnliche Lichteinlässe in der Fassade, zwei oben, zwei unten. Zwischen den beiden oberen ist eine Uhr, umrahmt von einem Bibelvers:
Nun wandelt als Weise und kauft die Zeit aus,
denn die Tage sind böse.
Wie sinnreich! Vor allem, da beim Wort »wandelt« das kleine »w« fehlt. Doch statt ihre Zeit auszukaufen, haben sich die Leute hier lieber dafür entschieden, den Zahn der Zeit nagen zu lassen.
Ich steige aus, und schlagartig dringt mir die klamme Kälte bis unter die Haut. Ringsum nichts als Äcker und Wiesen, das Dorf besteht aus maximal zwei Dutzend Häusern. Dazu kommen ein Pub, ein Dorfladen und eine Gemeindehalle. Das Einzige, das man hier zu hören kriegt, sind Vögel und gelegentlich das einsame Summen einer Biene. Das kann ja heiter werden.
»Okay«, sage ich so optimistisch, wie es das Szenario hergibt, »dann schauen wir mal, wie die Kirche von innen aussieht.«
»Willst du nicht lieber wissen, wo wir wohnen?«, nölt Flo.
»Erst das Haus des allmächtigen Vaters, dann das Haus für seine Kinder.«
Sie verdreht genervt die Augen und erklärt mich auf diese Weise kurzerhand für blöd. Mädchen in der Pubertät kommunizieren regelmäßig mit dieser Methode. Verständlich, denn ihnen ist nicht entgangen, wie schnell sie im rein verbalen Kräftemessen unterliegen.
»Außerdem«, sage ich, »steckt der Möbelwagen noch irgendwo auf der M25. In der Kirche können wir uns wenigstens setzen. Da haben sie nämlich Bänke, weißt du?«
Sie knallt die Wagentür zu und trottet missmutig hinter mir her. Ich blicke sie an: Mit ihrem dunklen Fransenbob, dem gegen große Widerstände erkämpften Nasenpiercing (das sie für die Schule allerdings abnehmen muss) und der schweren Nikon, die sie überallhin mitschleppt, hat sie große Ähnlichkeit mit Winona Ryder in Beetlejuice.
Zur Kirche führt ein langer Fußweg. Gleich am Gittertor befindet sich ein zerbeulter Briefkasten. Für den Fall, dass niemand da ist, so meine Anweisung, fände ich darin die Schlüssel. Ich greife in den Briefschlitz und – Bingo! – fische zwei silberne Sicherheitsschlüssel heraus (offenbar für das Cottage) sowie ein schweres Eisenteil, das aussieht wie aus Tolkiens Mittelerde. Kirchenschlüssel sind anscheinend immer auch ein Symbol.
»Hinein kommen wir schon einmal«, sage ich.
»Super!«, lautet Flos begeisterter Kommentar.
Ich überhöre das und stoße das Tor auf. Der Weg ist steil und, nun ja, unwegsam, und zu beiden Seiten erheben sich schiefe Grabsteine aus der verwilderten Rasenfläche. Wahrlich ein Totenacker. Auf der linken Seite fällt mir ein schwärzlich verwitterter Obelisk auf, deutlich größer als die anderen Steine. Davor zwei vertrocknete Blumensträußchen – so scheint es zumindest aus der Distanz. Bei genauerem Hinsehen aber zeigt sich: Es sind keine Sträuße, sondern kleine Reisigpuppen.
»Was ist denn das?«, fragt Flo und greift nach ihrer Kamera.
Ohne nachzudenken, sage ich: »Brennende Mägdelein.«
Sie kniet sich hin, um sie gleich mal mit ihrer Nikon einzufangen.
»Laut Internet sind sie so etwas wie eine Tradition hier«, sage ich. »Sie erinnern an die Protestantenverfolgungen unter Maria der Katholischen. Und im engeren Sinn an die Märtyrer von Sussex.«
»Der was?«
»Der Märtyrer von Sussex. Zwei davon kamen hier aus dem Ort. Zwei Mädchen, die damals genau hier, vor dieser Kirche verbrannt wurden.«
Sie steht auf und zieht ein Gesicht. »Und deswegen machen die Leute diese gruseligen Figuren?«
»Richtig. Die dann am Jahrestag ihres Märtyrertods verbrannt werden.«
»O Mann, das klingt echt nach Blair Witch.«
»Na ja, was willst du? Wir sind hier auf dem Land«, sage ich mit einem letzten verächtlichen Blick auf die Reisigpuppen. »Da erhalten sich solche Bräuche.«
Flo zückt ihr Handy und macht noch ein paar Bilder für die asozialen Netzwerke und ihre Freundinnen in Nottingham. Guckt mal: Bauern-Barbies. Damit verschönern diese Deppen ihr Dorf. Dann kommt sie nach.
Wir gelangen zur Kirchentür, und ich probiere den Schlüssel aus. Das Schloss ist sehr schwergängig, wirkt wie eingerostet, aber schließlich dreht sich der Schlüssel doch. Knirschend öffnet sich die Tür. Knirschend bedeutet hier: mit einem Geräusch wie aus einem Horrorfilm. Ich schiebe die Tür weiter auf.
Trotz der hellen Augustsonne herrscht drinnen tiefe Düsternis. Meine Augen brauchen eine Weile, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Erst weiter oben, in Höhe der schmutzigen Fenster, dringen einzelne Lichtbalken in den Raum und beleuchten den schwebenden Staub aus Jahrhunderten, so kommt es mir vor.
Auch sonst ist in dieser Kirche manches anders, als ich es gewohnt bin. Das Kirchenschiff ist ausgesprochen schmal, bietet Platz für gerade einmal ein halbes Dutzend Bänke direkt vor dem Altar. Dafür führen enge Holztreppen zu beiden Seiten hinauf auf eine Art Galerie mit weiteren Bänken, was an einen Theatersaal erinnert. Würde mich wundern, wenn diese klaustrophobische Einrichtung nicht gegen die Brandschutzverordnung verstößt.
Erst einmal aber riecht es so muffig, als sei der Raum schon ewig nicht mehr benutzt worden, dabei fanden hier noch bis vor Kurzem Gottesdienste statt. Dazu kommt jene unschöne Eigenart sämtlicher Sakralbauten: Immer ist es darin kalt und stickig zugleich.
Gleich hinter dem Eingang stoße ich auf eine gelbe Barriere mit dem handgeschriebenen Hinweis:
Achtung, lose Bodenplatten! Unfallgefahr!
»Ich nehme alles zurück«, sagt Flo. »Das ist keine Bruchbude, sondern das letzte Dreckloch.«
»Es könnte schlimmer sein.«
»Echt? Wie das?«
»Na ja, zumindest ist nicht der Holzwurm drin. Oder der Schwamm. Und es gibt keinen Käferbefall, das ist doch schon was.«
»Also, ich warte draußen.« Sie macht kehrt und geht hinaus.
Ich bleibe, denn ich weiß ohnehin nicht, was ich ihr jetzt sagen soll. Sie braucht wohl etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Ich habe sie aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, ihrer Stadt, ihrer Schule, ihrem Freundeskreis, und sie an einen Ort verpflanzt, der außer Äckern und Kuhscheiße wenig zu bieten hat. Keine Ahnung, wie ich sie dafür gewinnen kann.
Ich blicke auf den Holzaltar.
»Herr, was soll ich hier?«
»Kann ich Ihnen helfen?«
Ich fahre herum.
Hinter mir steht ein Mann, klein und von auffällig bleicher Gesichtsfarbe. Ein Eindruck, der durch die hohen Geheimratsecken und die straff nach hinten gekämmten schwarzen Haare noch verstärkt wird. Trotz des warmen Wetters trägt er einen schwarzen Anzug über dem grauen kragenlosen Hemd. Auf mich wirkt er wie ein Vampir auf Urlaub.
»Vielen Dank. Sie haben recht: Ich habe auf solche Fragen auch noch nie eine direkte Antwort bekommen.« Lächelnd strecke ich ihm meine Hand entgegen. »Ich bin Jack.«
Er hingegen schaut mich weiter voller Misstrauen an. »Und ich bin der Gemeindevorsteher. Wie sind Sie hier hereingekommen?«
Mir wird plötzlich klar, wie wichtig die weiße Halsbinde eines Pfarrers ist (die ich gerade nicht anhabe) und dass diesem Arbeiter im Weinberg wahrscheinlich nur die Ankunft eines gewissen Reverend Brooks avisiert wurde. Woran sollte er mich auch erkennen? Klar, er hätte mich googeln können. Aber diese Möglichkeit erscheint doch allzu theoretisch bei jemandem, der noch mit Tinte und Feder kommuniziert. So sieht er nämlich aus.
»Entschuldigung, ich bin Jack Brooks, der neue Reverend.«
Seine Miene hellt sich auf, eine Nuance jedenfalls, und er errötet minimal. Ich gebe zu, mein Name führt öfter zu Missverständnissen – die ich aber auf perverse Weise genieße.
»Ach du lieber Gott! Ja dann, in diesem Falle … Ich hatte nur nicht …«
»Sie hatten etwas anderes erwartet?«
»Ja.«
»Jemanden, der etwas größer ist, schlanker, attraktiver?«
Und dann platzt eine Stimme dazwischen: »MUM!«
Ich wende mich um. Flo steht in der Tür, kreidebleich und mit weit aufgerissenen Augen. Alle meine Mutterinstinkte geben nun Alarm.
»Was ist los? Was hast du?«
»Mum, da draußen ist ein Mädchen. Ich glaube, sie ist verletzt. Komm schnell!«
3
Das Mädchen ist kaum älter als zehn. Es trägt ein Kleid, das einmal weiß gewesen sein muss, es ist barfuß … und über und über mit Blut beschmiert.
Das Blut ist wirklich überall und hat sowohl ihr Gesicht als auch die blonden Haare rotbraun eingefärbt. Sie kommt über den Pfad auf uns zu, und jeder Schritt hinterlässt auf dem unebenen Pflaster einen blutigen Abdruck.
Auch ich starre sie erst einmal nur an, auf der Suche nach einer Erklärung. Was um Himmels willen ist hier geschehen? Wurde sie von einem Auto angefahren? Doch die Straße ist leer, weit und breit kein Wagen in Sicht. Und dann das viele Blut. Mich wundert, dass sie sich überhaupt noch auf den Beinen halten kann.
Ich gehe auf sie zu und knie mich hin.
»Hallo, mein Schatz. Bist du verletzt?«
Die Kleine hebt den Kopf. Sie hat eisblaue Augen, ein Farbton, wie ich ihn noch nie gesehen habe, überzogen von einem unguten Glanz, der den Zugang zu ihr unmöglich macht. Trotzdem schüttelt sie den Kopf. Verletzt ist sie wohl nicht. Aber woher dann das viele Blut?
»Weißt du, was passiert ist?«
»Er hat sie umgebracht.«
Trotz der Hitze überläuft es mich kalt.
»Wer hat wen umgebracht?«
»Pippa.«
»Flo«, sage ich leise. »Ruf sofort die Polizei.«
Flo zückt ihr Handy, starrt aber nur ungläubig auf das Display. »Ich hab kein Netz.«
Shit. Mich überfällt ein Déjà-vu, bei dem mir ganz flau wird: Blut, ein kleines Mädchen … Nicht schon wieder.
Ich wende mich an den Gemeindevorsteher, unseren bleichen Famulus, der am Kirchentor stehen geblieben ist: »Ich habe Ihren Namen nicht verstanden.«
»Aaron.«
»Gibt es hier irgendwo einen Festnetzanschluss, Aaron?«
»Ja, im Pfarrbüro.«
»Können Sie von dort die Polizei rufen?«
Er zögert. »Ich kenne das Mädchen. Sie ist von der Harper-Farm.«
»Wie heißt sie?«
»Poppy.«
Ich lächle ihr aufmunternd zu. »Poppy, wir holen Hilfe, okay?«
Doch Aaron rührt sich nicht, entweder aus Unentschlossenheit oder weil er selbst noch wie gelähmt ist. Auf jeden Fall erweist er sich als wenig hilfreich.
»Jetzt machen Sie schon!«, herrsche ich ihn an.
Während er sich beleidigt davonschleicht, höre ich das hochtourige Heulen eines Fahrzeugs in der engen Dorfstraße. Ehe ich gucken kann, rast ein Range Rover um die Ecke und kommt mit blockierenden Rädern und spritzendem Splitt vor dem Kirchtor zum Stehen. Die Tür fliegt auf.
»Poppy!«
Ein schwergewichtiger Kerl mit schmutzig blonden Haaren springt heraus und stürmt direkt auf uns zu.
»Herrgott, Poppy! Ich habe dich überall gesucht. Was soll das? Einfach so wegzurennen!«
Aber mich beeindruckt er damit nicht. »Ist das Ihre Tochter?«
»Ja, das ist meine Tochter. Ich bin Simon Harper!« Er sagt das, als müsste man dies wissen. »Und wer zum Teufel sind Sie?«
Ich muss mir auf die Zunge beißen, um ihm nicht gleich die passende Antwort zu geben, und sage nur: »Ich bin Reverend Brooks, die neue Pfarrerin. Können Sie mir erklären, was hier eigentlich los ist? Ihre Tochter ist von oben bis unten voller Blut.«
Er verzieht das Gesicht. Wenn ich mich nicht täusche, ist er ein paar Jahre älter als ich. Breiter Typ, allerdings nicht dick. Ein Stiernacken mit der entsprechenden Visage. Offenbar ist er nicht an Widerworte gewöhnt, schon gar nicht von einer Frau.
»Es ist nicht so, wie es aussieht.«
»Echt jetzt? Also für mich sieht es aus wie das Texas Chainsaw Massacre.« Das kommt aber nicht von mir, sondern von Flo.
Simon Harper blitzt sie böse an, hält sich aber lieber an mich. »Ich versichere Ihnen, Reverend, das ist alles nur ein Missverständnis. Poppy, her zu mir!« Poppy hingegen weicht vor seiner ausgestreckten Hand zurück und versteckt sich hinter mir.
»Ihre Tochter sprach davon, dass jemand umgebracht wurde.«
»Was? Ich höre wohl nicht recht.«
»Ja, eine gewisse Pippa.«
»Ach das!« Er verdreht die Augen. »Das ist Unsinn.«
»Was Unsinn ist und was nicht, überlassen wir lieber der Polizei.«
»Erst einmal ist es nicht Pippa, sondern Peppa. Und Peppa ist ein Schwein.«
»Was bitte?«
»Was Sie hier sehen, ist Schweineblut.«
Ich starre ihn an, und mir bricht der Schweiß aus. Von der Dorfstraße her ist das kernige Knattern eines Treckers zu hören. Simon Harper seufzt vernehmlich.
»Könnten wir kurz reingehen und sie ein bisschen sauber machen? So kann ich sie in dem Wagen nicht mitnehmen.«
Ich werfe einen Blick auf unsere windschiefe Bleibe.
»Bitte hier entlang.«
Und so betrete auch ich zum ersten Mal unser neues Heim. Nicht gerade die Einzugsparty, die ich mir erträumt habe. Flo holt ein paar Plastikstühle von der Terrasse, damit Poppy sich setzen kann, und ich entdecke im Unterschrank der Spüle einen angebrochenen Seifenspender und ein halbwegs sauberes Geschirrtuch. Was ich im Dunkel des Schranks ebenfalls sehe: eine Taschenlampe in Gesellschaft einer faustgroßen Spinne.
»Ich gucke mal im Wagen nach«, sagt Flo. »Ich glaube, da haben wir noch Feuchttücher. Ich hole ihr auch ein T-Shirt von mir, damit sie nicht so rumlaufen muss.«
»Gute Idee.«
Dann ist sie weg, und ich bin richtig stolz auf sie. Sie ist eben doch jemand, der anpackt, wenn es darauf ankommt – trotz ihrer Launen.
Ich halte das Geschirrtuch unter den Wasserhahn und knie mich vor Poppy hin, um ihr Gesicht von dem Blut zu befreien.
Schweineblut! Wie kommt so viel Schweineblut auf ihr Gesicht?
»Ich weiß, das alles macht jetzt nicht den besten Eindruck«, erklärt Simon Harper wie zur Entschuldigung.
»Ich richte nicht«, sage ich. »Oberster Grundsatz in meinem Job.«
Was so natürlich nicht stimmt. Nachdem ich Poppy das Blut von Stirn und Ohren gewischt habe, sieht sie schon eher aus wie ein kleines Mädchen. Und nicht wie jemand, der mit knapper Not einem Stephen-King-Finale entronnen ist.
»Sie sagten, es sei nicht so, wie es aussieht. Wie war es denn wirklich?«
»Ich besitze die Harper-Farm. Unsere Familie betreibt schon sehr lange Landwirtschaft. Wir schlachten auch selbst, das heißt, wir haben eine eigene Schlachterei. Ich weiß, dass viele Leute heutzutage diese Vorstellung nicht ertragen, aber …«
Ich lasse mich in meiner Arbeit nicht stören, sondern sage nur: »Auf jeden Fall sollte man wissen, woher unser Essen kommt. In meiner letzten Gemeinde war ein Großteil der Kinder der Meinung, Fleisch sehe von Natur aus wie ein Hamburger-Patty von McDonald’s.«
»Genau. Genau so ist es. Und wir bei uns haben den beiden Kindern von Anfang an beigebracht, was Fleisch-erzeugung bedeutet und dass deshalb jede Sentimentalität fehl am Platz ist. Rosie, unsere Große, hat das auch immer akzeptiert, aber Poppy ist, was das angeht … nun ja, sensibler.«
Irgendetwas sagt mir, dass er seine Tochter wohl nicht oft als sensibel beschreibt. Vermutlich ist das Wort nur der Platzhalter für etwas ganz anderes. Ich streiche Poppy übers Haar, und sie sieht mich aus eisblauen Augen an, als wäre dahinter niemand zu Hause.
»Deswegen haben ich und Emma – Emma ist meine Frau – auch schon tausendmal gesagt, sie soll wenigstens das mit den Namen lassen.«
»Namen?«
»Ja. Dass sie den Ferkeln Namen gibt, Poppy, meine ich. Aber sie musste ja unbedingt ihren Willen haben. Wohin das führt, sehen wir jetzt. So werden die Tiere vermenschlicht, und sie kommt nicht mehr von ihnen los, besonders von dem einen.«
»Sie meinen Peppa?«
»Ja. Und heute Morgen war Schlachtung.«
»Verstehe.«
»Und Poppy sollte gar nicht zu Hause sein. Rosie war mit ihr zum Spielplatz. Aber irgendwas muss da passiert sein, jedenfalls kamen sie sehr früh wieder zurück, und plötzlich steht Poppy vor mir …«
Er bricht ab, blickt mich ratlos an, und ich versuche, mir die grausige Szene vorzustellen.
»Aber wie kommt es, dass sie so voller Blut ist?«
»Na ja … sie wird wohl ausgerutscht sein und hat sich dabei die Sachen versaut. Auf jeden Fall ist sie dann weggelaufen, den Rest kennen Sie.« Er blickt mich an. »Sie können mir glauben, dass ich mich alles andere als gut fühle. Aber wir haben nun mal einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir leben von der Fleischerzeugung.«
Tatsächlich habe in diesem Moment fast so etwas wie Mitgefühl. Ich spüle das Geschirrtuch aus und tupfe Poppy die letzten Blutflecken vom Gesicht. Dann hole ich ein Haargummi aus meiner Jeans und raffe ihre klebrigen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen.
Ich probiere ein aufmunterndes Lächeln. »Na also. Ich wusste doch, dass ein kleines Mädchen in dir steckt.«
Nach wie vor keine Reaktion, was mich ein bisschen beunruhigt. Andererseits ist das nach einem Trauma normal, ich habe so etwas schon öfter erlebt. Als Seelsorger in einem Brennpunkt hat man eben nicht nur mit Kuchenbacken und Wohltätigkeitsbasaren zu tun. Immer wieder begegnet man schwer gestörten Menschen, und Kindesmisshandlung hört ebenfalls nicht an der Stadtgrenze auf, so viel weiß ich.
Ich wende mich zu Simon. »Hat Poppy denn noch andere Haustiere?«
»Da wären die Hunde, aber die sind im Zwinger.«
»Vielleicht würde es ja helfen, wenn sie ein eigenes Tier hätte. Irgendetwas Kleines wie einen Hamster, um den sie sich kümmern könnte.«
Einen Moment lang sieht es so aus, als käme der Vorschlag bei ihm an, aber dann macht er wieder dicht.
»Danke für den Tipp, Reverend, aber ich weiß selber, wie ich meine Tochter erziehe.«
Ich bin versucht, ihn darauf hinzuweisen, dass der Anschein dagegenspricht. Zum Glück kommt Flo dazwischen. Sie hat Feuchttücher dabei und ein Fan-Shirt mit einem spillerigen Jack Skellington.
»Geht auch so was?«
Ich nicke und fühle mich plötzlich müde. »Ja, das geht.«
Wir stehen an der Tür und sehen zu, wie Vater und Tochter in den Range Rover steigen. Flos Sweatshirt ist viel zu groß für Poppy und schlackert ihr um die Knie. Dann fahren sie weg.
Während wir ihnen nachblicken, lege ich Flo den Arm um die Schulter. »So viel zur ländlichen Idylle.«
»Es fängt jedenfalls schon gut an. Ich sage dir, das wird spitze hier.«
Ein Kommentar, der mir tatsächlich ein kurzes Lachen entlockt. Aber dann kommt uns eine schwarze Gestalt entgegen, Aaron. Er hat einen großen Karton in der Hand. Mist, den hatte ich total vergessen. Wo war er eigentlich die ganze Zeit?
»Ich nehme an, die Polizei ist auf dem Weg?«, sage ich.
»Nein, das nicht. Als ich Simon Harper sah, hielt ich das nicht mehr für nötig.«
Ach, nicht nötig? Offenbar ist Simon Harper ein mächtiger Mann im Dorf. Aber so geht es in vielen kleinen Gemeinden zu, wo eine einzige Familie den Ton angibt. Weil man das schon immer so gemacht hat. Oder weil die Leute Angst haben. Oder beides.
»Außerdem fiel mir ein«, sagt Aaron weiter, »dass ich Ihnen ja noch etwas geben sollte.«
Er hält mir den Karton hin. Darauf in großer Blockschrift mein Name.
»Was ist das?«
»Das weiß ich nicht. Aber es wurde gestern vor der Kirche abgestellt.«
»Von wem?«
»Hab ich nicht gesehen. Ich nahm an, es ist ein Willkommenspräsent.«
»Vielleicht von deinem Vorgänger«, sagt Flo.
»Das möchte ich bezweifeln«, erwidere ich. »Er ist tot.« Ich blicke zu Aaron hinüber, der mich vielleicht pietätlos findet, und füge hinzu: »Es tut mir leid, was mit Reverend Fletcher passiert ist. Es muss für Sie ein ziemlicher Schock gewesen sein.«
»Das ist wohl wahr.«
»War er denn krank?«
»Krank?« Aaron blickt mich verständnislos an. »Hat man Ihnen es denn nicht gesagt?«
»Ich weiß nur, dass er ganz plötzlich verstorben ist.«
»Das stimmt. Er hat sich umgebracht.«
4
»Sie hätten es mir sagen müssen.«
Durkins Stimme am anderen Ende der Leitung macht sich so klein, dass sie kaum zu verstehen ist. »Wahrlich eine missliche … daher … nicht vertiefen.«
»Mir egal, ob Sie das vertiefen wollen oder nicht. Ich hätte es wissen müssen.«
»Das hat nichts mit Ihnen persönlich zu … und ich bedaure es auch sehr.«
»Wer weiß noch davon?«
»Nur wenige … der Gemeindevorsteher natürlich … und der Pfarrgemeinderat.«
Also der ganze Ort. Dunkin redet, er redet in einem fort, und ich hänge mich noch weiter aus dem Schlafzimmerfenster im Obergeschoss. Es ist die einzige Stelle, an dem ich so etwas wie Handyempfang habe, drei Balken, immerhin, wenn ich mich nicht bewege.
»Reverend Fletcher … er hatte schon länger psychische Probleme und … Glück für uns, bereits seiner Versetzung in den Ruhestand zugestimmt, als es passierte. Demnach war er streng genommen nicht einmal mehr Gemeindepfarrer …«
Mit anderen Worten: Was haben wir mit dir kleinem ehemaligen Dorfpfarrer zu schaffen? Durkins Kaltschnäuzigkeit grenzt ans Pathologische und würde ihn in der Politik sicher weit bringen. Aber vielleicht sind Amtskirche und politische Parteien gar nicht so verschieden. Wir predigen beide doch immer nur vor den eigenen Anhängern.
»Trotzdem, man hätte es mir sagen müssen. Ein solcher Vorfall wirkt sich unmittelbar auf meine Arbeit aus. Er beeinflusst die Art, wie wir wahrgenommen werden.«
»Da haben Sie natürlich recht, das haben wir übersehen.«
Na klar, übersehen. Aber jemand wie Durkin übersieht nichts. Er wollte mir bloß keinen Grund liefern, die Stelle nicht anzutreten.
»Ist das alles, Jack?«
»Ehrlich gesagt nein. Da ist noch etwas, das ich gerne wüsste.«
Natürlich sollte es eigentlich keine Rolle spielen. Wenn der Tod nur der Übergang ins Jenseits ist, sind die genauen Umstände eigentlich nicht mehr von Belang. Aber das stimmte so noch nie.
»Wie hat er sich das Leben genommen?«
Das Schweigen am anderen Ende währt so lang, dass ich mich frage, ob vielleicht doch noch eine ehrliche Antwort kommt. Durkin denkt offenbar nach. Schließlich ein Seufzer.
»Er hat sich in der Kirche erhängt.«
Flo kniet auf dem Wohnzimmerboden und packt alle möglichen Sachen aus den Umzugskartons. Deren Zahl ist zum Glück überschaubar. Als der Möbelwagen endlich eintraf, brauchten die beiden jungen Kerle mit den Tattoos gerade einmal zwanzig Minuten, um unseren gesamten weltlichen Besitz abzuladen. Als Ergebnis von zwanzig Jahren Arbeit nicht gerade ehrfurchtgebietend.
Ich lasse mich auf das zerschlissene Sofa fallen, das sich in dem winzigen Wohnzimmer ganz schön breitmacht. Alles in diesem Cottage ist eng, niedrig und wackelt. Die Fenster gehen nicht richtig auf, wodurch es drinnen unerträglich heiß wird, und im Türrahmen zwischen Küche und Wohnzimmer muss ich jedes Mal den Kopf einziehen, dabei bin ich keineswegs von amazonenhafter Gestalt.
Das Badezimmer ist olivgrün gestrichen, in den Ecken wuchert der Schimmel, und eine Dusche gibt es nicht. Heizung und Warmwasser verteilen sich auf einen Ölbrenner und einen antiken Kaminofen, der nach meinem Eindruck dringend einer technischen Überprüfung unterzogen gehört, sonst sterben wir hier demnächst an Kohlenmonoxidvergiftung.
Doch der alte Kotten hat auch Vorteile. Zum einen wohnen wir hier mietfrei. Und wir können alles nach Herzenslust verändern, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen. Aber das kommt alles später. Erst einmal will ich nur etwas essen, ein Stündchen fernsehen und dann ins Bett.
Flo sieht mich an. »Ich hoffe, nach dem Drama von vorhin gerät nicht in Vergessenheit, in welchem Loch wir hier gelandet sind.«
»Nein«, antworte ich, »aber ich bin zu müde, um mich jetzt darüber aufzuregen. Ich nehme nicht an, dass es hier in der Nähe einen Take-away gibt?«
»Doch, im nächsten Ort ist ein Domino’s. Habe ich auf der Fahrt hierhin gegoogelt.«
»Halleluja, die Zivilisation! Sollen wir uns was auf Netflix ansehen?«
»Soweit ich weiß, hat BT Mobile den Breitbandanschluss noch nicht geschaltet.«
Stimmt. Mist.
»Also nur normales Fernsehen.«
»Wenn du dich da nicht mal täuschst.«
»Was? Wieso?«
Sie steht vom Boden auf, setzt sich neben mich aufs Sofa, legt mir den Arm um die Schulter.
»Was stimmt an dem Bild nicht, Michael?«
Das ist ein Zitat aus The Lost Boys, und ich bin gerührt, dass mein kulturelles Erbe aus den Achtzigern auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
»Ich gebe dir einen Tipp. Siehst du hier irgendwo eine Antenne?«
»Ach herrje, das darf doch nicht wahr sein.«
»Yep …«
»O Gott, wohin habe ich uns geführt?«
»Hoffentlich nicht in die Mordhauptstadt der Welt.«
»Na ja, solange es nur um Vampire geht, hätte ich da was: jede Menge Kruzifixe.«
»Plus einen mysteriösen Karton.«
Richtig, die Kiste. Ich bin noch immer so aufgebracht über die Verlogenheit von Durkin und Konsorten, dass ich die Ursache der Tragödie glatt verdrängt habe. Ich blicke umher. Die Kiste, die Kiste.
»Keine Ahnung, wo ich sie gelassen habe.«
»In der Küche.«
Flo springt auf und kommt einen Moment später mit der Kiste zurück. Misstrauisch sehe ich das Ding an.
Reverend Jack Brooks, so steht es geschrieben.
»Also, was ist jetzt? Mach schon auf«, sagt Flo und hält mir eine Schere hin.
Ich nehme die Schere und schlitze das Kreppband auf, mit dem die Kiste verschlossen ist. Innen liegt etwas, das in Seidenpapier eingeschlagen ist, dazu eine Karte. Ich nehme die Karte heraus.
Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar werde, noch heimlich, was man nicht wissen werde. Darum, was ihr in der Finsternis saget, das wird man im Licht hören; was ihr redet ins Ohr in den Kammern, das wird man auf den Dächern ausrufen. (Lukas, 12:2-3)
Ich blicke Flo an. Sie zieht die Brauen hoch und sagt: »Ein bisschen melodramatisch, nicht?«
Ich lege die Karte beiseite und entferne das Seidenpapier. Zum Vorschein kommt ein Köfferchen aus braunem Leder.
Ein Anblick, der in mir ein Frösteln auslöst.
»Mach doch mal auf«, sagt Flo.
Leider fällt mir kein vernünftiger Grund ein, es nicht zu tun, und so hole ich das Köfferchen aus der Kiste und lege es aufs Sofa. Irgendetwas stößt dabei im Innern aneinander. Ich öffne die beiden Schließen.
»Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar werde.«
Das Innere ist mit rotem Samt ausgeschlagen, und sämtliche Teile sind mit Riemen gesichert: eine ledergebundene Bibel, ein schweres Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus, Weihwasser, Musselintücher, ein Skalpell sowie ein großes Messer mit einer Sägeklinge.
»Was ist das?«, fragt Flo.
Ich muss schlucken, denn mir ist plötzlich übel. »Das? Das ist ein exorzistischer Werkzeugkoffer, mit den Instrumenten gegen das Böse.«
»Wow! Ich wusste gar nicht, dass bei einer Teufelsaustreibung auch Messer gebraucht werden.«
»Normalerweise ist das auch nicht so.«
Ich greife in den Koffer und hole das große Messer heraus. Ein schweres Teil, aber der abgenutzte Elfenbeingriff liegt gut in der Hand, kühl und glatt. Wenn da nicht die rostbraunen Flecken auf der gezackten Klinge wären.
Flo beugt sich näher darüber. »Mum, ist das etwa …?«
»Ja, ist es.«
Irgendwie kommen wir heute aus dieser Nummer nicht raus.
Blut.
5
Der Mond hier. Man glaubt ja nicht, wie anders der Mond hier draußen aussieht. Aber genau das tut er.
Er streckt die Hand aus, spreizt die Finger, lässt das Mondlicht hindurchscheinen. Die silbrigen Strahlen umspielen seine Hand und rieseln ins Gras. Gras. Auch das ist neu. Drinnen gab es kein Gras. Es gab überhaupt nichts Weiches. Nicht einmal das Bettzeug war weich. Und das Mondlicht kam höchstens durch irgendwelche Schießscharten-Öffnungen, war gerichtet. Gerichtetes Licht, dem das meiste, das Eigentliche genommen wurde durch die vielen Gebäude, die sich ihm in den Weg stellten. Und wenn es tatsächlich irgendwo auftraf, dann hart auf harte Oberflächen wie Beton oder Stahl.
Hier draußen hingegen kann es sich ausdehnen, fließen. Es taucht – ja, taucht – den ganzen Park in seinen Silberschein und glitzert noch auf dem spärlichsten Halm. Wen kümmert es, wenn die Wiese tatsächlich nur ein räudiger Müllplatz ist, übersät von Kippen und weggeworfenen Cidreflaschen? Für ihn ist es das Paradies, kein Scherz, es ist der verdammte Garten Eden. Sein Bett ist eine Parkbank, seine Wohlfühlmatratze besteht aus Wellpappe, und den Schlafsack hat er einem Besoffenen geklaut. Selbst unter Bettlern und Dieben gibt es eben keine Ehre mehr. Egal, ihm erscheint es als königliche Schlafstatt, seidene Bettwäsche und Daunenkissen inklusive.
Er ist frei. Nach vierzehn Jahren. Und diesmal gibt es kein Zurück. Er hat das ganze Rehabilitationsprogramm durchlaufen und ist endlich clean. Erweist sich als braver Junge und gibt den Drogen keine Macht mehr.
Es ist noch nicht zu spät, so sagte die Therapeutin immer. Sie können noch ein neues Leben anfangen, all das hinter sich lassen.
Alles gelogen natürlich. Niemand kann seine Vergangenheit hinter sich lassen, denn sie gehört zu dir wie nichts sonst. Sie zieht dir nach wie ein alter Köter, weicht nie von deiner Seite. Und ab und zu beißt sie dich.
Er lacht in sich hinein. Ihr hätte der Vergleich bestimmt gefallen. Sie sagte, er hätte ein »Händchen« für so etwas. Also Wörter, Sprache allgemein. Mag sein. Aber noch lieber benutzte er seine Fäuste, denn er bekam seinen Zorn nicht unter Kontrolle. Sein Zorn verdüsterte alles, raubte ihm die Wörter, machte ihn im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos und umfing ihn mit einem roten Nebel, in dem er nur noch wild um sich schlug.
Sie müssen lernen, Ihre Impulse zu kontrollieren, sagte sie immer. Sonst hat das Monster wieder die Oberhand.
Nachts in seiner Zelle stellte er sich vor, wie sie neben ihm lag, seine Stirn streichelte und im Flüsterton auf ihn einredete. Alles, um ihn zu beruhigen, denn die Isolation und der Entzug waren anders nicht zu ertragen. Auch jetzt irrt sein Blick noch einmal durch die Dunkelheit, auf der Suche nach ihr. Nichts. Er ist allein. Doch das wird sich ändern.
Er zieht den Schlafsack hoch bis zum Kinn und bettet seinen Kopf auf die harte Bank. Es ist eine laue Nacht, und er ist froh, unter freiem Himmel zu schlafen. So kann er den Mond sehen und die Sterne und sich auf den folgenden Tag freuen.
Wie ging noch mal dieses Lied? Irgendwas mit »Only a day away«? Ging doch so, oder?
Manchmal sangen sie das sogar.
Schade, dass wir keine Waisenkinder sind wie Annie, sagte sie öfter. Dann könnten wir von hier abhauen.
Worauf sie sich noch enger an ihn schmiegte mit ihren knochigen Gliedmaßen und dem Wuschelhaar, das nach Butterkeks roch.
Er lächelt zufrieden: Tomorrow, tomorrow, I’m coming to find you.
6
Das Hochamt am Sonntag ist das Highlight in der Arbeitswoche eines Pfarrers. Wenn man heute noch nennenswerte Besucherzahlen generiert – und damit meine ich alles im zweistelligen Bereich –, dann sonntags.
Meine alte Gemeinde in Nottingham war überwiegend schwarz, und dort war der Sonntag tatsächlich ein Tag der, ja, ein Tag der inneren Erhebung. Was für ein altmodisches Wort und was für eine altmodische Sitte, im Sonntagsgottesdienst nur im Sonntagsstaat zu erscheinen. Wo sonst bekam man in ihrer Welt Damenhüte zu Gesicht oder schwarze Anzüge oder kleine Mädchen mit bombenfest verdrehten Zöpfen und großen Schleifen im Haar? So wie bei Ruby.
Diese Leute verwandelten den Sonntag in einen wahren Tag des Herrn, indem sie sich erhoben und mich. Auch wenn man natürlich merkte, dass nichts an ihrer Garderobe neu oder sonderlich elegant war und dass so manche Hose, so manches Kleid einst für schlankere Hüften angeschafft wurde. Sie kamen aus den ärmsten Vierteln der Stadt, aber sie sparten keine Mühe, denn es ging auch um ihre Würde.
Ich hatte bereits andere Gemeinden mit einer soliden Besucherquote, aber nie eine mit so viel Stil. Denn wo die Outdoorjacken das Bild beherrschen, sind auch Shorts oder Hotpants kein schockierender Anblick mehr. Das niedrigschwellige Angebot ist gewollt. Wir nehmen, was wir kriegen können.
Ich gebe zu, das kann frustrierend sein. Doch ich sage mir: Wenn auch nur ein einziger Mensch von mir getröstet wird, hat sich meine Arbeit gelohnt. Denn die Kirche ist nicht nur für die Gläubigen da, sondern für alle, die nichts mehr haben, woran sie glauben können. Die Einsamen, die Verlorenen, die Heimatlosen, die nichts haben, wo sie ihr Haupt hinlegen. Ich finde, die Kirche muss als Schutzraum erlebbar sein. So habe ja auch ich zu Gott gefunden, damals, als ich nicht wusste, wo aus noch ein. Damals hat jemand die Hand ausgestreckt nach mir, und diese Freundlichkeit habe ich nie vergessen. Seitdem versuche ich, ein wenig davon zurückzugeben.
Im Augenblick weiß ich noch nicht, was ich von meiner neuen Gemeinde halten soll. Auf dem Dorf ist man ja eher konservativ, was zur Folge hat, dass auch die Kirche noch eine gewisse Rolle spielt. Gleichzeitig sind die Kirchenmitglieder älter. Es ist ganz erstaunlich, wie viele Leute den Glauben wiederentdecken, sobald sie einmal ihre Dritten haben – und das Ende näher rückt.
Wie auch immer, an diesem Sonntag bin ich noch nicht dran. Offiziell trete ich mein Amt erst in zwei Wochen an, und Reverend Rushton aus Warblers Green übernimmt bis dahin die Sonntagsmesse. Wir haben bereits gemailt. Ein netter Kerl, glaube ich, engagiert und überlastet wie die meisten Landpfarrer. Zurzeit betreut er drei Gemeinden und unsere noch dazu. Eigentlich eine Zumutung, doch er kleidet es in diplomatische Worte.
»Gott mag allgegenwärtig sein, ich persönliche schaffe nicht einmal vier Gemeinden richtig.«
Diese Situation erklärt auch meine überstürzte Versetzung. Auf dem Land ist der Pfarrermangel eben besonders sichtbar. Doch das scheint nicht alles zu sein.
Irgendwas stimmt mit diesem Dorf nicht, siehe das mysteriöse Begrüßungspaket. Es lässt mir keine Ruhe, weswegen ich in der ersten Nacht auch kaum ein Auge zugetan habe. Dazu die drückende Stille. Keine Polizeisirenen in der Nacht, keine Besoffenen auf der Straße, die Krach machen. Eigenartig, was mit der Zeit alles zum beruhigenden Hintergrundgeräusch wird. Und immer wieder drängten sich die Ereignisse des Tages nach vorn. Poppy mit ihrem blutbesudelten Gesicht, das Sägemesser aus dem Exorzistenkoffer, dazwischen Ruby, die vor meinem geistigen Auge immer mehr zu Poppy wurde. Alle diese Bilder im Kopf hatten eines gemeinsam: Blut.
Warum habe ich diesen Posten überhaupt angenommen? Was will ich hier eigentlich erreichen?
Am Morgen, kurz nach sieben, quäle ich mich aus dem Bett. Irgendwo draußen kräht penetrant ein Hahn. Na wunderbar, Morgenstund’ hat Gold im Mund. Ich mache mir einen Kaffee und gebe der Versuchung nach einer Zigarette nach. Den Tabak und die Drehmaschine habe ich abends zuvor in einer Küchenschublade versteckt, unter einem Geschirrtuch.
Flo liegt mir dauernd in den Ohren, ich soll endlich aufhören. Ich bemühe mich, aber das Fleisch ist schwach. Also drehe ich mir am Küchentisch heimlich eine Zigarette, ziehe mir die alte Kapuzenjacke über meine Joggingklamotten und rauche heimlich an der Hintertür. Vielleicht bekomme ich so die düsteren Gedanken aus dem Kopf. Draußen ist es schon warm, trotz des wolkenverhangenen Himmels. Immerhin, ein neuer Tag, mit frischen Herausforderungen. Es ist tatsächlich etwas, wofür ich Gott jeden Morgen Dank sage. Danke für diesen guten Morgen, lalala … Die Zukunft ist eben noch ungestaltet, jeder neue Tag ein Geschenk, also nutze die Zeit klug.
Doch wie die meisten Pfarrer halte ich mich oft selbst nicht an das, was ich predige.
Ich rauche die Zigarette zu Ende und gehe ins Bad, das wie gesagt keine Dusche hat. Der umständliche Badespaß in der Wanne hebt meine Stimmung nicht, aber wenigstens kann ich mir die Haare waschen. Beim Föhnen im ungewohnten Licht stelle ich fest, dass sich meine grauen Haare in Grenzen halten, dasselbe gilt für die Falten. Allerdings profitiere ich auch davon, dass ein paar Extrapfunde mein Gesicht vorteilhaft auspolstern. Unterm Strich kann man also sagen, ich sehe aus wie jede andere gestresste Mutter in meinem Alter. Nicht der Knaller, aber es geht.
Ich frage meine Tochter. »Na, wie sehe ich aus?«
Sie schaut mich kurz an und sagt: »Fertig.«
»Danke. Und sonst?«
Ich habe mich für den pfarrermäßigen Freizeitlook entschieden. Oder »Casual Hochwürden«, wie man heute sagt. Jeans mit Kollarhemd und weißem Rundkragen. Erkennbarkeit ist wichtig, selbst wenn ich noch gar nicht im Dienst bin.
»Für mein Gefühl ist das Schwarz etwas too much.«
»Neonfarben und Netzstrümpfe kommen später.«
»Wann später?«
»Weihnachten, dachte ich.«
»Übertreib es nicht, Mum.«
»Das hatte ich auch nicht vor. Aber ich muss schon ein Zeichen setzen.«
Sie grinst. »Na dann. Du siehst spitze aus.«
»Danke.« Da fällt mir ein: »Und was ist mit dir?«
»Was soll mit mir sein?«
»Alles okay?«
»Mir geht’s gut.«
»Wirklich?«
»Nur eine Bitte: Mach das nicht noch mal, okay? Ich meine, ich kann es ja verstehen. Aber ich wollte nie aus Nottingham weg. Und es ist sowieso nur vorübergehend, oder? Oder? Wie du immer sagst: Es ist, wie es ist.«
»Manchmal bist du mir schon etwas zu erwachsen.«
»Einer von uns muss es sein.«
Ich will zu ihr, sie in den Arm nehmen, aber sie verschanzt sich hinter ihrem Buch.
»Kommst du nachher mit?«
»Muss ich?«
»Das musst du wissen.«
»Eigentlich wollte ich noch mal zum Friedhof und ein paar Bilder machen.«
»Gut. Dann viel Spaß.«
Ich versuche, die kleine Enttäuschung nicht an mich heranzulassen. Natürlich hat sie keine Lust auf eine öde Messe in einer verstaubten Dorfkirche. Sie ist fünfzehn, und ich hielt noch nie viel davon, die eigenen Kinder zum Glauben zu zwingen.
Meine eigene Mutter versuchte nämlich genau das. Ich weiß noch, wie ich als kleines Kind jedes Mal mitgehen musste. Das tausendmal gewaschene Sonntagskleidchen noch immer so kratzig, dass ich keine Sekunde still sitzen konnte auf diesen harten Bänken. Kalt war es auch, und bei dem Pfarrer in seinem schwarzen Gewand musste ich anfangen zu weinen. Später wurde die Religion zur Krücke, mit der sie sich durchs Leben schleppte. Das und der Gin und die Stimmen in ihrem Kopf. Auf mich wirkte das alles so abschreckend, dass ich so früh wie möglich von zu Hause abhaute.
Der Glaube sollte eine bewusste Entscheidung sein, nicht irgendwas, das man in jungen Jahren eingeimpft bekommt, wenn man sich nicht wehren kann. Den Glauben kann man auch nicht weitergeben wie ein Familienerbe. Glaube ist immateriell und keine amtlich beglaubigte Wahrheit, nicht einmal für einen Pfarrer. Es ist etwas, an dem man arbeiten muss – wie eine Ehe, wie Kinder.
Da läuft manches nicht rund, aber das liegt in der Natur der Sache. Es gibt Anfechtungen. In unserer Welt geschieht einfach zu viel Böses. Da kann man sich schon mal fragen, ob Gott überhaupt existiert, und wenn ja, warum er so ein Arschloch ist. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass das Böse nicht seinetwegen passiert. Gott sitzt nicht in seinem himmlischen Kontrollraum und überlegt sich die nächste Dschungelprüfung für unseren Glauben. Gott ist nicht wie dieser Christof aus der Truman Show, der Produzent von allem, der darüber entscheidet, was uns als Nächstes widerfährt.
Das Böse geschieht, weil sich das Leben aus einer Abfolge zufälliger, unberechenbarer Ereignisse zusammensetzt. Und weil wir Fehler machen. Aber Gott ist barmherzig, wenigstens hoffe ich das.
Ich schnappe mir die Kapuzenjacke vom Küchenstuhl und schaue kurz im Wohnzimmer vorbei. »Ich bin dann mal weg.«
»Mum?«
»Ja?«
»Was willst du wegen dieses Koffers unternehmen?«
Wenn ich das wüsste. Allein der Anblick von diesem Ding hat mich mehr erschüttert, als ich mir eingestehen will. Oder zumindest vor Flo zugeben will. Woher kommt dieser Koffer? Wer besitzt so etwas heutzutage? Und wer hat es an der Kirche abgegeben – und warum?
»Ich weiß nicht. Ich werde noch mal mit Aaron reden.«
Flo gefällt das nicht.
»Was, diesem Creep? Bei dem wird einem ja gruselig.«
Ich will ihr sagen, dass sie nicht so hart über ihre Mitmenschen urteilen soll, aber ganz ehrlich: Ich finde ihn auch gruselig. Wobei ich ja einiges gewöhnt bin. In der Gemeindearbeit findet sich so manche seltsame Gestalt, auch viele Einsame zieht es dahin. Aber Aaron ist noch einmal etwas anderes. Er löst in mir ein Gefühl aus, das ich lieber vergessen würde.
»Reden wir später darüber, okay?«
Ich ziehe mir die Jacke über.
»Na gut. Aber, Mum …?«
»Was hast du?«
»An deiner Stelle würde ich eine andere Jacke anziehen. Diese hier stinkt nach Zigarettenqualm.«
7
Aaron ist bereits da, als ich die Kirche betrete. Er steht zusammen mit einem dicklichen Lockenkopf von Pfarrer an der Wand neben dem Eingang und redet auf den armen Mann ein. Es ist erst halb zehn, und noch ist niemand da.
So wie sich die beiden plötzlich umdrehen, muss ich den Eindruck gewinnen, sie reden über mich. Vielleicht ist das paranoid, vielleicht aber auch nicht. Und warum sollten sie nicht über mich reden? Ich bin schließlich die Neue. Irgendetwas daran gefällt mir nicht, aber ich lasse mir nichts anmerken.
»Hallo! Ich hoffe, ich störe nicht.«
Der Lockenkopf ist hocherfreut. »Reverend Brooks, wie schön! Ich bin Reverend Rushton – Brian für Sie. Endlich lernen wir uns persönlich kennen.«
Er streckt mir seine Patschehand entgegen. Er ist nicht sehr groß, und seine rötlich marmorierte Haut lässt erahnen, dass er den Genüssen des Lebens nicht abgeneigt ist. Sein Blick ist klar, die lustigen Augen schießen hin und her und blitzen vor intelligenter Bosheit. Ohne sein Kollar könnte man ihn auch für einen Kneipenwirt halten. Oder für Bruder Tuck.
»Reverend, Sie machen sich keinen Begriff davon, wie froh wir sind, dass Sie endlich da sind. Und ich ganz besonders natürlich.«
Ich schüttle seine Patschehand. »Danke.«
»Und? Wie gefällt es Ihnen hier?«
»Gut. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Man braucht eine Weile, um wirklich anzukommen.«
»Nein, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich war schon als Kaplan in Warblers Green, dreißig Jahre ist das jetzt her. Ich weiß, ich weiß, aber ich bin halt zu bequem. Außerdem liebe ich diese Gemeinde. Und ganz besonders …«, er schmeißt sich verschwörerisch an mich heran, »… ganz besonders den Pub dort, der zufällig direkt neben der Kirche ist.«
Sein Glucksen, so tief und echt, ist irgendwie ansteckend.
»Daraus kann man Ihnen nun wirklich keinen Vorwurf machen.«
»Nicht wahr? Aber der Unterschied zu Nottingham dürfte erheblich sein.«
»Das stimmt wohl.«
»Doch seien Sie nachsichtig mit uns Bauerntölpeln. Wir sind gar nicht so übel, wenn man uns einmal kennt. Und ehrlich, hier wurde schon lange kein Mensch mehr in einer Strohpuppe verbrannt. Jedenfalls nicht seit der letzten Sonnenwendfeier.«
Wieder dieses Glucksen, wobei sein Gesicht noch weiter anläuft. Er zückt ein Taschentuch und tupft sich den Schweiß von der Stirn.
Aaron räuspert sich. »Also, das Thema der heutigen Messfeier lautet: ›Neuer Anfang, neue Freunde‹.« Seine Grabesstimme ist offene Feindseligkeit und vermittelt mir, worauf ich mich einstellen muss mit solchen Freunden. »Auch Reverend Rushton hielt das Thema für angemessen.«
»Keine Angst, Sie müssen heute nicht sprechen. Wir machen das später bei Ihrer offiziellen Amtseinführung. Auf jeden Fall sind Sie jetzt da, und das ist schon mal gut.« Er zwinkert mir zu. »Die Nachricht von Ihrer Ankunft hat sich herumgesprochen wie ein Lauffeuer. Alle wollen die neue Pfarrherrin sehen.«
In mir zieht sich alles zusammen. »Na toll.«
»Dann wollen wir mal«, sagt Rushton, steckt sein Taschentuch weg und klatscht in die Hände. »Gleich rennt uns das Publikum die Bude ein.«
Aaron zieht es Richtung Altar, und ich setze mich in eine der vorderen Bänke.
»Ach, da fällt mir ein …«, sagt Rushton ein bisschen zu beiläufig, um noch als echt durchzugehen. »Aaron sagte mir, Sie wären gestern Harper und seiner Tochter begegnet.«
Womit auch die Frage beantwortet wäre, was sich wirklich herumgesprochen hat.
»Ja. Die Begegnung war sehr aufschlussreich.«
Er stutzt und wählt seine nächsten Worte mit Bedacht.
»Die Harpers sind seit Generationen hier ansässig. Die Familie gab es schon zu Zeiten der Märtyrer von Sussex, falls Ihnen das etwas sagt.«
»Sicher, das waren die Protestanten, die während der Herrschaft von Maria der Katholischen hingerichtet wurden.«
Er scheint mit der Antwort zufrieden. »Sehr gut.«
»Ich hab’s im Internet nachgelesen.«
»Dann wissen Sie ja Bescheid. Diese Geschichten sind hier in der Gegend noch höchst lebendig. Ein Vorfahre von Simon Harper war einer davon. Auf dem Friedhof haben sie ihnen sogar ein Denkmal gesetzt.«
»Haben wir gesehen. Und auch die brennenden Mägdelein, die sie davor abgelegt haben.«
Seine buschigen Brauen heben sich. »Ach, das mit den Mägdelein wissen Sie auch schon? Sieht so aus, als hätten Sie Ihre Hausaufgaben gemacht. Manche finden diese Sitte ja makaber, aber im Dorf ist man stolz auf seine Märtyrer.« Er gluckst, ehe seine Miene wieder ernst wird. »Wie auch immer, die Harpers zählen in diesem Dorf zu den Stützen der Gesellschaft. Sind deswegen auch entsprechend angesehen. Nicht zuletzt, weil sie im Lauf der Jahre viel für das Dorf und die Kirche getan haben.«
»Inwiefern?«
»Durch Spenden beispielsweise. Außerdem hat ihr Betrieb viele Arbeitsplätze geschaffen.«
Also Geld, denke ich. Darauf läuft es ja immer hinaus.
»Ich wollte später ohnehin zu ihnen«, sage ich. »Nachsehen, wie es Poppy geht.«
»Es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich bei ihnen vorzustellen«, sagt er, wobei er mich skeptisch mustert. »Und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.«
Mir fällt der Koffer auf dem Küchentisch ein, die seltsame Karte. Weiß Rushton etwas? Vielleicht, aber sicher bin ich nicht. Besser das Thema jetzt nicht ansprechen.
»Danke«, sage ich. »Wenn mir noch etwas einfällt, komme ich auf Sie zu.«
Die Messe ist schnell vorbei. Die Kirche ist etwa halb voll, womöglich auch hier die große Ausnahme. Ein Anblick, an den man sich erst gewöhnen muss. Selbst in meiner relativ gut besuchten Innenstadtgemeinde war am Sonntag höchstens jeder vierte Platz besetzt. Außerdem sind nicht nur die Alten gekommen. Mir fällt ein dunkelhaariger Mann in den Vierzigern auf, der ganz allein am Ende einer Bank sitzt. Sogar mehrere Familien sind da, wenngleich nicht die Harpers. Offenbar beschränkt sich ihre Unterstützung auf das Finanzielle.
Während des ganzen Gottesdiensts sind aller Augen auf mich gerichtet. Ich spüre, wie die Leute mich abchecken. Verständlich, sage ich mir. Ich bin die Neue, und ich bin eine Frau. Sie sehen nur das »Hundehalsband«, nicht mich.
Wenn Rushton spricht, menschelt es sehr. Er vertritt einen gelassenen Christenglauben, der sich nicht in Bibelsprüchen einmauert. Ihm ist klar, dass die Leute nicht kommen, um die Frohe Botschaft im Wortlaut zu empfangen, sondern in ihrer angewandten Form. Die Bibel ist nun mal wahnsinnig alt und leider auch etwas spröde. Die besten Pfarrer übertragen daher die Bibel auf die Lebenswirklichkeit ihrer Gemeinde, und Rushton beherrscht das aus dem Effeff. Stünde ich gerade nicht derart unter Beobachtung, würde ich mir Notizen machen.
Obwohl seit über fünfzehn Jahren »Pfarrherrin«, habe ich den Eindruck, ich lerne nie aus. Vielleicht, weil man es als Frau ohnehin schwerer hat, ernst genommen zu werden, keine Ahnung. Selbst erwachsene Menschen kennen ja das Gefühl, die Erwachsenenrolle nur vorzuspiegeln. Da wir tief im Innern noch Kind sind, reden wir wie ein Kind, sind klug wie ein Kind und so weiter. Und wir laufen in viel zu großen Schuhen durch die Welt und wünschen uns nichts so sehr wie jemanden, der uns versichert, dass Monster in Wirklichkeit nicht existieren.
Rushton macht es kurz und schmerzlos. Und stellt sich nach dem Schlusssegen an den Ausgang, um jeden persönlich zu verabschieden. Ich halte mich zurück, denn das ist seine Show. Trotzdem fragen mich mehrere Leute, wie es mir bisher im Dorf gefällt. Andere finden es schön, endlich mal ein neues Gesicht zu sehen. Wieder andere ignorieren mich demonstrativ, aber auch das geht in Ordnung. Als endlich der letzte Grauschopf an mir vorbeigewackelt ist, atme ich tief durch. Der erste öffentliche Auftritt wäre damit geschafft. Rushton hat bereits den Autoschlüssel in der Hand.
»Ich muss um halb zwölf in Warblers Green sein«, sagt er. »Wir sehen uns dann morgen.«
»Morgen? Wieso morgen?«
»Neun Uhr früh, Gemeinderatssitzung hier in der Kirche. Dann besprechen wir den ganzen organisatorischen Kram.«
»Richtig. Ja klar.«
Den Termin muss ich wohl vergessen haben. Oder er wurde mir nie mitgeteilt. Meine Versetzung vollzog sich in einer Geschwindigkeit, die einen eigentlich misstrauisch machen muss. Als wollte Durkin mich nur so rasch wie möglich loswerden.
»Aber vielleicht treffen wir uns auch einfach mal nur so, zu einem Kaffee oder, besser, auf ein Bier. Dann erzähle ich Ihnen, wie das hier so läuft«, sagt Rushton weiter.
»Klingt gut. Gerne.«
»Dann machen wir es so. Ich habe ja Ihre Nummer, ich gebe Ihnen per WhatsApp Bescheid.«
Er ergreift meine Hand und schüttelt sie zünftig. »Ich bin sicher, Sie kommen hier gut klar.«
»Ich fühle mich fast schon wie zu Hause«, lächle ich zurück.