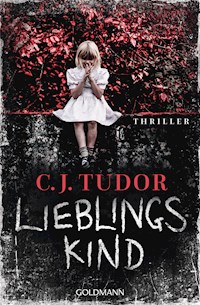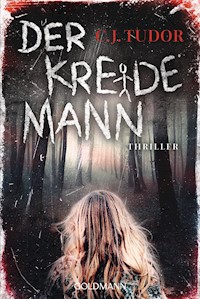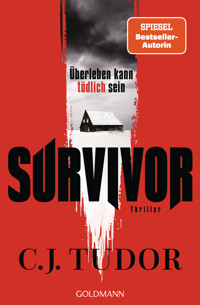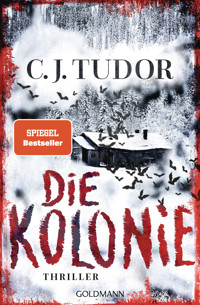
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer Kleinstadt in Alaska wird ein Junge tot aufgefunden. Seine Kehle ist zerfetzt, seinem Körper alles Blut entwichen. Die Brutalität des Mordes erinnert an eine Tat, die 25 Jahre zurück liegt. Detective Barbara Atkins wird zur Unterstützung von Sheriff Jensen Tucker hinzugezogen, der den ursprünglichen Fall untersucht hatte. Die Einwohner von Deadhart glauben jedoch zu wissen, wer der Schuldige ist: ein Mitglied der nahe gelegenen Vampirkolonie, die in einer alten Bergbausiedlung tief in den Bergen lebt. Barbara gerät unter Druck, die gesamte Kolonie gezielt töten zu lassen. Doch die Beweise sind nicht stichhaltig, und die Menschen lügen. Dann verschwindet ein weiterer Teenager. Barbara und Tucker bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Wahrheit herauszufinden: Jagen sie einen kaltblütigen Mörder – oder ein blutdürstiges Monster?
- Willkommen in Deadhart, Alaska. Einwohner: 673. Lebende.
- Der neue rasante Thriller der SPIEGEL-Bestsellerautorin - atmosphärisch, raffiniert, intelligent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
In einer Kleinstadt in Alaska wird ein Junge tot aufgefunden. Seine Kehle ist zerfetzt, seinem Körper alles Blut entwichen. Die Brutalität des Mordes erinnert an eine Tat, die 25 Jahre zurückliegt. Detective Barbara Atkins wird zur Unterstützung von Sheriff Jensen Tucker hinzugezogen, der den ursprünglichen Fall untersucht hat. Die Einwohner von Deadhart glauben jedoch zu wissen, wer der Schuldige ist: ein Mitglied der nahe gelegenen Vampirkolonie, die in einer alten Bergbausiedlung tief in den Bergen lebt. Barbara gerät unter Druck, die gesamte Kolonie gezielt töten zu lassen. Doch die Beweise sind nicht stichhaltig, und die Menschen lügen. Dann verschwindet ein weiterer Teenager. Barbara und Tucker bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Wahrheit herauszufinden: Jagen sie einen kaltblütigen Mörder – oder ein blutdürstiges Monster?
Weitere Informationen zu C.J. Tudor und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
C.J. Tudor
Thriller
Deutsch von Marcus Ingendaay
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Gathering« bei Michael Joseph, Penguin Random House UK, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2024 by Betty & Betty Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Paul Sheen / Trevillion Images und
FinePic®, München
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30501-7V004
www.goldmann-verlag.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
EPILOG
DANKSAGUNG
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Leseprobe: C.J. Tudor, Schneewittchen schläft
Newsletter-Anmeldung
Für Mum. Lieb dich.
Wie so viele indigene Spezies wurden Vampire von ihren menschlichen Revierkonkurrenten verteufelt und terrorisiert – bis hin zur vollständigen Verdrängung. In entlegenen Landstrichen existieren zwar noch einige Kolonien, doch gilt ihr Bestand als akut gefährdet. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass Vampire schon in naher Zukunft nichts weiter sein werden als eine Legende.
Aus: Die wahre Geschichte der Vampirevon Professor Benjamin Fletcher
Tatsächlich greifen Vampire höchst selten Menschen an. Die meisten ernähren sich seit alters her ausschließlich von Tierblut, und dies ist in der Konsequenz kaum barbarischer als der Speisezettel des durchschnittlichen Fleischessers.
Dr. Steven Barker, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Forensische Vampirstudien (IFV)
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes genießen Vampire den Schutzstatus einer vom Aussterben bedrohten Art. Gezielte Tötungen sind demnach genehmigungspflichtig und ausschließlich zum Schutz der Allgemeinheit zulässig, wenn andere, humanere Entnahmemöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen.
Herstellung und Verbreitung von Vampirtrophäen, auch nichtgewerblicherArt, sind verboten.
Vampirschutzgesetz (VamSchG) aus dem Jahr 1983
Nichts und niemand wird uns je davon abhalten, diese Ausgeburten Satans zur Strecke zu bringen. Es ist ein wahrhaft göttliches Werk, denn sie sind dem Herrn ein Gräuel. Wir werden nicht ruhen, bis auch der Letzte von ihnen in der tiefsten Hölle schmort.
Reverend Colleen Grey, Kirche vom Heiligen Kreuz
1
Man konnte wirklich nicht behaupten, dass das Leben an Beau Grainger vorbeigegangen war.
Zwar hatte sich dieses Leben meist so gleichförmig abgespult, dass man vergebens nach den sonst üblichen Höhen und Tiefen suchte, dafür blickte er jetzt ohne Bitternis auf die Vergangenheit zurück. Das Leben in jener Kleinstadt in Alaska war immer gut zu ihm gewesen, es gab weder alte Wunden noch offene Rechnungen, wozu also fortziehen? Die meisten Orte auf der Welt werden nach kurzer Zeit zur Normalität – ebenso wie die meisten Menschen. Da konnte er auch gleich dort bleiben, wo er war.
Er hatte zu seiner Zeit zwei Frauen geliebt und eine davon geheiratet. Mit dieser zog er drei Kinder groß und sorgte dafür, dass aus ihnen etwas wurde. Ein viertes kam tot auf die Welt, und ausgerechnet dieses Kind ließ ihm jetzt keine Ruhe. Was uns nicht vergönnt ist, beschäftigt uns wohl am meisten, das liegt in der Natur des Menschen.
Beau hatte seine Frau Patricia vor zehn Jahren an die Demenz verloren, seit dreien lag sie auf dem örtlichen Friedhof. Bei der Beerdigung war seine Trauer um die Frau, die er einst geliebt hatte, jedoch schon abgeschlossen, und er begrub eigentlich eine Fremde.
Jetzt, mit neunundsiebzig Jahren, hatte Beau nur noch wenige gute Freunde, allerdings auch wenig, das er bereute. Kann man auf der Zielgeraden des Lebens mehr verlangen, abgesehen vielleicht von einem kurzen, schmerzlosen Tod? Soweit es Beau betraf, konnte er sich nicht beklagen. Trotzdem gab es auch für Männer seines Schlags diese Tage, an denen sie einfach zu viel grübelten.
Heute war einer dieser Tage.
Seine Gelenke schmerzten, was unter Tiefdruckeinfluss vorkam. Der Kaffee schmeckte bitter, und nicht einmal ein Schuss Whiskey verbesserte diesen Eindruck. Fernsehen hatte für ihn keinen Reiz, und Bücher konnten ihn nicht ablenken. Er war einfach unruhig.
Und so marschierte er in seinem kleinen, gemütlichen Wohnzimmer auf und ab. Es war immer dieselbe ausgetretene Straße zwischen den abgewetzten Ledersesseln und dem offenen Kamin, über dem seine Trophäen hingen.
Denn Beau war mit Leib und Seele Jäger. Er liebte die Natur, aber er liebte auch den erregenden Moment, in dem ein fremdes Wesen durch seinen Willen starb. Gutes Waidwerk erforderte Geduld, und davon hatte Beau mehr als genug. Die Jägerei bestand zu einem Großteil aus Beobachten und Warten, der Schuss war lediglich der Kulminationspunkt der lautlosen Pirsch. Um ein anderes Tier wahrhaft zu erkennen, musste man ihm im Moment des Todes in die Augen blicken.
Beau trat näher an die ausgestopften Köpfe heran. Es waren ordentliche Präparate, angebracht auf hölzernen Trophäenschilden, die Cal Bagshaw einst für ihn geschnitzt hatte – auch er seit fast einem Jahr tot, Kehlkopfkrebs.
Beau starrte in die glasigen Augen und strich mit dem Finger über die fahlen, vertrockneten Lefzen rund um die Reißzähne.
»Na los, beiß mich«, flüsterte er und gluckste, obwohl sich ihm gleichzeitig die Nackenhaare sträubten.
Aber nicht vergessen, alter Knabe: Schon ein Biss trifft ins Leben. The first cut is the deepest.
Beau riss sich los, von seiner Trophäe, von solchen Gedanken. So ein Quatsch, dachte er. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Stattdessen wandte er sich jetzt dem Fenster zu. Am Horizont schossen schwarze Wolkenzinnen in den Himmel. Das sanft gewellte Schneefeld davor wirkte wie ein gefrorenes Meer. Ein Sturm zog auf, schien aber keine Frische zu bringen. Im Gegenteil, etwas Fauliges lag in der Luft. Beau kannte diesen Geruch, und ihm schwante nichts Gutes.
Sie waren wieder da.
Jetzt begann alles von vorn.
2
Der Taxifahrer war ein Quatscher.
Na toll.
Barbara vermutete, dass sein Geschäft zu dieser Jahreszeit eher mau lief und er deswegen jeden Fahrgast volltextete. Das kam davon, wenn man allein lebte, was dieser Mann offensichtlich tat. Der lange Vollbart, die Speisereste auf seinem Overshirt und nicht zuletzt der intensive Körpergeruch deuteten darauf hin, dass sich sein Verhältnis zur Welt auf ein einziges schroffes Kürzel reduzierte: LMAA. Womit Barbara keinesfalls sagen wollte, dass Männer ohne Frauen aus Prinzip verwahrlosten. Was jeder Mensch aber brauchte, war jemand, um den man sich bemühen musste. Ohne ein Gegenüber, ohne diesen Spiegel ließ man sich gehen und roch irgendwann auch so. Wer wüsste das besser als sie?
Der Taxifahrer hieß Alan, so stand es jedenfalls vorn auf der Lizenz. »Call me Al«, grinste er. »So wie in dem Lied.«
»Gern«, hatte sie gesagt. Und gelächelt.
Tatsächlich hasste sie dieses Lied. Und auch das silberne Kruzifix und der Rosenkranz an Call-me-Als Rückspiegel waren überhaupt nicht ihres. Aber jeder, wie er will. Dies ist ein freies Land.
Im Übrigen war sie auf den nächsten Meilen vollauf damit beschäftigt, seine unvermeidlichen Quatscher-Fragen abzuschmettern. Sagen Sie, sind Sie zum ersten Mal hier? Antwort: Ja. Wollen Sie hier Urlaub machen? Antwort: Ja. Was beides gelogen war, aber dazu führte, dass er mit ihr sämtliche Touristenattraktionen der Gegend durchging. Das waren zwar nicht viele, aber davon ließ sich eine Labertasche wie er nicht bremsen. Außerdem konnte sich das mit den Attraktionen auch sehr schnell ändern.
Das Taxi zog eine Wirbelschleppe aus Eis und Schnee hinter sich her, doch das nahm Barbara hinter der Seitenscheibe kaum wahr. Sie sah atemberaubende Landschaft und unberührte Natur mit Bergen, Wäldern und Schnee. Und hinter jeder Kurve: noch mehr Berge, noch mehr Wälder, noch mehr Schnee. Wer auf so etwas stand, bitte schön. Doch die Unberührtheit hatte einen Grund. Dieses Land war absolut lebensfeindlich. Außerhalb des warmen Taxis setzte binnen Minuten der Kältetod ein. Also, nicht zu sehr berühren lassen.
Barbara unterdrückte ein Gähnen. Erst der Nachtflug von New York nach Anchorage, dort weiter per Lufttaxi nach Talkeetna (ein nervenzerfetzendes Erlebnis) und jetzt noch anderthalb Stunden über den Parks Highway an ihren Einsatzort in der tiefgefrorenen alaskischen Taiga. Sie hatte keine Ahnung, warum sie ihrer Ausleihe an ein paar Dorfsheriffs je zugestimmt hatte.
»Weil Sie unsere beste Forensikerin sind«, hatte Decker gesagt.
»Ich dachte, das wäre Edwards?«
»Edward hat familiäre Verpflichtungen, Sie ja wohl nicht.«
»Das heißt, als kinderloser Single habe ich automatisch die Arschkarte?«
Decker platzierte seine Wurstfinger auf der Tischplatte und beugte sich in gespielter Einfühlung nach vorn. Decker war ein etwas kurz geratener Dicker mit einem schwarzen Haarkranz und dem rötlichen Gesicht des Infarktkandidaten. Seit zehn Jahren war er jetzt ihr Vorgesetzter, aber Barbara bezweifelte, ob er überhaupt ihren Vornamen kannte.
»Atkins, wenn Sie wünschen, kann ich das Ganze auch in ein Kompliment verpacken und sagen, dass Sie eben besser sind als Edwards. Sie und nur Sie sind unser anerkannter Experte auf diesem Gebiet.«
»Wäre nett, Sir.«
Decker aber fehlte der Sinn für diese Art Humor, stattdessen sagte er: »Ihr Flug ist jedenfalls gebucht. Und packen Sie ausreichend Knoblauch ein, Sie werden ihn brauchen.«
Dann wandte er sich wieder seinem Bildschirm zu, das Gespräch war damit beendet.
Barbara stand auf. »Gut, dass Sie mich erinnern. So kann ich den Männern was Leckeres kochen.«
»Zumindest wissen Sie mal, wo Ihr Platz ist.«
Ihr Lächeln gefror. »Bei allem Respekt, Sir, manchmal sind Sie echt ein Arschloch.«
Wortlos verließ sie das Büro. Allerdings musste sie sich später eingestehen, dass sie sich die Entsendung nach Alaska allein durch ihr bekanntermaßen sonniges Gemüt eingefangen hatte. Sie galt nicht als schwierig.
Und deswegen saß sie jetzt hier in diesem Taxi, unentwegt beobachtet von Al, der einfach nicht aufgab: »Normalerweise verirren sich nur wenige Touristen nach Deadhart«, sagte er. »Ausgenommen ein paar Gruftis und Dark-Wave-Typen, die nur das Ortsschild fotografieren und schnell wieder weg sind, zurück nach Talkeetna – Sie auch?«
Ertappt, dachte Barbara. Unterschätze nie einen Taxifahrer, nicht einmal am Arsch der Welt. Sie haben die ganze Menschheit im Rückspiegel, man kann ihnen nichts vormachen.
»Das weiß ich noch nicht«, sagte sie. »Das werden wir sehen.«
Al nickte, räusperte sich. »Ich dachte nur, weil Sie nach Deadhart wollen: Ist das vielleicht wegen dem Jungen?«
Barbaras Anspannung wuchs. Sollte sich die örtliche Polizei nicht an die achtundvierzigstündige Nachrichtensperre halten und abwarten, bis sie, Barbara, ein offizielles Statement zum Tod des Jungen abgab? Alles andere brachte nur Unruhe in die Stadt – mit allen Folgen.
»Welchem Jungen?«, fragte Barbara scheinheilig.
Dann trafen sich ihre Blicke im Rückspiegel, und das silberne Kruzifix tanzte dazu, als wäre ihre Frage der Brüller des Tages.
»Dem ermordeten Jungen«, erwiderte Al.
Okay, die Nachrichtensperre hatte schon einmal nicht funktioniert. Und wenn Quatscher Al Bescheid wusste und die Horrorstory brühwarm an seine Fahrgäste weitergab, konnten sie es auch gleich in den Hauptnachrichten bringen. Das Problem war, dass sie nicht die geringste Vorstellung hatte, wie sich Gerüchte in dieser Einöde verbreiteten. Konnte sie den Geist noch zurück in die Flasche stopfen? Sie überlegte. Nein, besser sie ging offen mit dem Vorfall um. Oder tat zumindest so.
»Sie haben recht«, seufzte sie. »Ich bin wegen des Jungen hier. Was reden die Leute denn so darüber?«
Sie schenkte Al ein taktisches Lächeln, doch das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er sie ausgetrickst hatte. Jetzt wollte sie ihn wenigstens veranlassen, auch sein Wissen preiszugeben.
»Sie müssen sich übrigens keine Sorgen machen«, sagte Al und senkte die Stimme, als wären sie nicht allein im Taxi. »Mir ist klar, dass Sie erst mal inkognito bleiben wollen. Von mir erfährt niemand etwas, okay?«
»Dafür bin ich Ihnen sehr verbunden, Sir.«
»Ich habe die Sache auch nur erwähnt, weil meine Schwester Carol, sie wohnt ebenfalls in Deadhart …«
»Verstehe.«
»Sie hat mir von dem Jungen erzählt. Und auch, dass sie irgendeinen Spezialermittler einfliegen lassen.«
»Ah.«
»Und da Sie ganz offensichtlich nicht von hier stammen und ich nur selten eine Tour nach Deadhart bekomme, lag der Schluss nahe. Außerdem – bitte nicht falsch verstehen –, dass Sie von der Polizei sind, sieht ein Blinder.«
Ach wirklich? Dass sie mit ihren kurzen Beinen, ihrer stämmigen Figur und einer Nase, die ein gutes Steak aus fünfzig Schritt Entfernung erschnüffeln konnte, keine Schönheit war, wusste sie ja. Zum Ausgleich war sie patent. Patent, das sagten alle. Patent, das war ein Mix aus zuverlässig, aber leider furchtbar öde. Barbara, die gute, alte Barbara, das bewährte Schlachtross mit dem Pferdehintern, welcher jetzt, mit Anfang fünfzig, auch nicht mehr knackiger wurde. Und mit dem Alter mochte Weisheit kommen, aber es kamen auch: Verdauungsprobleme und Mom-Jeans mit hohem Elastan-Anteil.
»Gut beobachtet, muss ich sagen. Ich wäre Ihnen trotzdem dankbar, wenn Sie meine Anwesenheit erst mal für sich behielten.«
»Aber sicher, verlassen Sie sich darauf. Meinen Sie, Sie bleiben länger hier?«
Die Strecke führte mittlerweile stetig bergan. Zu ihrer Rechten sah sie Steilhänge, die mit düsteren Fichten und dürren Birken bewachsen waren. Linker Hand öffnete sich die Landschaft zu einem breiten Flusstal – das musste der Susitna River sein. Barbara schluckte. Sie konnte weder mit Bergen etwas anfangen, noch mit Wasser.
»Kommt drauf an, was ich finde«, sagte sie.
Sie blickte in den Rückspiegel und erkannte schon an Als Augen, dass ihm ihre Antwort missfiel. »Mit Verlaub«, erklärte er, »was hier geschehen ist, dürfte doch wohl klar sein.«
»Ach, wirklich?«, gab sie ungewollt schroff zurück.
»Ja, wirklich, Ma’am. Ich verstehe ja, warum Sie hier sind. Jemand muss den Papierkram erledigen und auf dem Totenschein die richtigen Kästchen ankreuzen. Aber eigentlich weiß doch jeder hier, dass einer aus der Kolonie den Jungen getötet hat. Und ich sage nicht einmal mit böser Absicht. Aber sie können nicht aus ihrer Haut, sie müssen das tun. Und früher oder später passiert es eben, das ist Tatsache. Wie wir bei dem Jungen gesehen haben.«
Abermals zwang sie sich zu einem Lächeln. »Also, ich persönlich bin eher schlecht im Kästchenankreuzen. Ich beschränke mich darauf, den Täter zu ermitteln.«
Doch Al tat so, als hätte er sie nicht gehört. »Ich habe nichts gegen Randgruppen und will auch niemanden ausgrenzen, oder wie das heißt. Leben und leben lassen, sage ich immer. Aber mit denen aus der Kolonie ist das wie mit einem Tier. Klar liebe ich meinen Hund. Aber wenn er ein Kind beißt, würde ich ihn sofort erschießen, keine Diskussion. Das ist nämlich so: Wenn sie einmal Blut geleckt haben, sind sie anders nicht mehr zu stoppen. Wie bei einem Tier.«
»Aber würden Sie deswegen gleich das ganze Rudel abknallen?«, fragte Barbara.
»Wenn ich nicht weiß, welcher Hund das Kind gebissen hat, auf jeden Fall. Dann ist das ganze Rudel dran.«
Das Kruzifix pendelte hin und her, und ihr Blick ging hinaus in den eisigen Luftraum über dem Tal. Wie hoch waren sie eigentlich? Die Straßenverhältnisse jedenfalls hatten sich deutlich verschlechtert, und Barbara wurde sich plötzlich bewusst, dass sie allein von vier Reifen auf dem vereisten Terrain gehalten wurden. Schön, das Taxi war ein SUV mit Allradantrieb und die Bereifung entsprechend heavy duty. Und dennoch: Wenn sie nur ein wenig vom Fahrweg abkamen, stürzten sie über den jähen Abhang direkt in die eisigen Wasser des Susitna River. Ihr war deshalb daran gelegen, Al nicht weiter abzulenken, sie schenkte sich eine Antwort und nickte nur. »Wahrscheinlich haben Sie recht. Aber sagen Sie, ich bleibe hier eine ganze Woche. Was kann man denn so in seiner Freizeit unternehmen?«
Da lächelte Al und war wieder ganz in seinem Element, worin Barbara ihn nur unterstützen konnte. Die Rolle als Tourguide lag ihm einfach mehr, und die ganze Situation entspannte sich wieder, zumal auch der Highway leicht bergab führte. Seufzend lehnte sich Barbara zurück. Doch dann bog der Wagen auf eine schmale Nebenstrecke ein, wo der dunkle Wald ganz nah an sie heranrückte. Plötzlich hatten sie nur noch einen dünnen Streifen Himmel über sich, und selbst dort, so schien ihr, zog bereits die Dämmerung herauf. Barbara blickte auf die Uhr. Gerade einmal Viertel nach drei, aber zu dieser Jahreszeit waren die Tage in Alaska kurz. Weiter im Norden, über dem Polarkreis, begann bald der arktische Winter. Zwei Monate lang ging dann die Sonne gar nicht mehr auf, und selbst hier unten, rund um Talkeetna, waren mehr als fünf Stunden Tageslicht nicht drin. Das erklärte aber auch, warum sich die Kolonien hauptsächlich in dieser Gegend befanden. Allerdings war die hiesige winterliche Dunkelphase mit entsprechend langen Tagen im Sommer erkauft. Die Mitternachtssonne brachte sie zwar nicht um, aber angenehm war es für sie auch nicht. Kolonien, die nicht in sonnenärmere Regionen umziehen konnten, hielten in dieser Zeit Sommerruhe.
Vor ihnen, im Licht der Scheinwerfer, tauchte jetzt ein handgefertigtes Ortsschild auf: Deadhart. Einwohner: 673. Darunter hatte ein Scherzbold gekritzelt: LEBEND.
Hübsch. Auch wenn man die Einwohnerzahl jetzt nach unten korrigieren muss, dachte Barbara. 672 stimmte wohl eher.
Dann, nach einer langen Linkskurve, kam endlich der Ort in Sicht.
»Heiliger … Was ist das?«
Es war erst Anfang November, doch die kleine Gemeinde war bereits illuminiert wie das große Weihnachtswunderland. Jedes Haus entlang der kurzen Hauptstraße war über und über behängt mit blinkenden Lichterketten, in jedem Fenster funkelten Weihnachtssterne und Kreuze, jeder Baum erstrahlte im Schein vielfarbiger Glühlampen. Manche hatten offenbar ihre komplette Altersvorsorge in leuchtende Elchfiguren und Merry-Christmas-Lightboxen investiert. Gleichwohl war das Bild seltsam unharmonisch. Wer genauer hinsah, erkannte zwischen dem Weihnachtszauber auch Halloween-Kürbisse, Hirschgeweihe und bleiche Schädeltrophäen. Und vom Dach des kleinen Supermarkts winkte ein LED-Santa-Claus den Kunden onkelhaft zu. Da aber die Lämpchen der Grußhand ausgefallen waren, endete die Bewegung optisch irgendwo in Höhe seines Gemächts und wirkte dadurch mehr als unangebracht.
Barbaras Augen mussten sich an das Lichtermeer erst gewöhnen. »Anscheinend wird die besinnliche Vorweihnachtszeit hier großgeschrieben.«
»Wie man’s nimmt«, sagte Al. »Es erhöht in jedem Fall das Sicherheitsgefühl.«
»Aber die Leute wissen schon, dass Kunstlicht sie nicht abschreckt?«
»Klar wissen sie das, Ma’am. Aber zumindest sehen sie dann, wer oder was sich auf den Straßen rumtreibt.«
»Auch wieder wahr.«
»Wo soll ich Sie absetzen?«, fragte Al. »Am Hotel oder bei der Polizei?«
»Erst mal zur Pol…«
Sie kam nicht mehr dazu, den Satz zu beenden, denn Al trat voll auf die Bremse. Barbara wurde rabiat in den Gurt gedrückt und biss sich auf die Zunge.
»Shit!«, fluchte Al.
Ein dumpfer Schlag. Barbara sah nach vorn. Ein Junge hockte wie Spiderman auf der Kühlerhaube. Bleiches Gesicht, weit aufgerissene Augen, die sie einen Moment lang nur anstarrten.
Dann, ebenso schnell, wie er vor ihr aufgetaucht war, sprang der Junge über das Dach und war verschwunden. Al riss die Tür auf und brüllte ihm nach: »Wenn du mir einen Kratzer gemacht hast, lernst du mich kennen, du kleiner Scheißer.«
Aber der Junge war bereits außer Reichweite und nur noch ein Schemen zwischen den Häusern.
Al schüttelte den Kopf. »Diese verdammten Rotznasen.«
Barbara stieg aus. »Haben wir ihn angefahren?«
»Angefahren? Das soll wohl ein Witz sein. Sie haben doch gesehen, wie er hinten vom Wagen gehüpft ist. Eines weiß ich ganz sicher: Unfallopfer machen so etwas nicht.«
Barbara meinte aber, einen Aufprall gehört zu haben. Sie ging in die Hocke und suchte den Boden ab. Im matschigen Schnee entdeckte sie einen hellroten Tropfen. Blut. Als sie danach tastete, stieß ihre Fingerspitze an etwas Scharfes. Ein Glassplitter. Barbara hob ihn auf und besah sich die Front des SUV. Dort war keine Beschädigung zu erkennen. Es blieb bei einem Blutstropfen und einem Glassplitter auf dem Boden.
»Ich schwöre, ich habe ihn nicht berührt.« Al stieg aus und blieb nervös neben der Fahrertür stehen.
Mit knackenden Gelenken erhob sich Barbara. »Kennen Sie den Jungen?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, tue ich nicht. Und die Jugendlichen hier sind ja auch nicht alle schlecht. Ihnen ist halt langweilig, da kommt man auf die dümmsten Ideen. Vor allem wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind.« Er zuckte die Achseln. »Kids sind Kids, was will man machen?«
Barbara schenkte ihm ein versöhnliches Lächeln. »Wir waren alle mal jung, nicht wahr?«
»Da sagen Sie was.« Al hatte sich beruhigt und setzte sich wieder hinters Steuer.
Barbara jedoch blickte nachdenklich in die Richtung, in die der Junge verschwunden war. Okay, Kids sind Kids, da hatte Al recht. Aber dieser Junge wirkte weder betrunken noch high.
Sondern im Gegenteil völlig verängstigt. Als wäre der Teufel hinter ihm her.
3
Al hielt vor einem weißen Schindelbungalow, der unglücklich zwischen dem Drugstore auf der einen und dem Roadhouse Grill (und Hotel) auf der anderen Seite eingeklemmt war.
Barbara war das gar nicht recht. »Eigentlich wollte ich zur Polizei«, sagte sie.
»Dies ist die Polizei, Ma’am.«
Barbara sah genauer hin. Tatsächlich hing neben der Tür ein handgemaltes Pappschild, das den Besucher informierte: »Gemeinde Deadhart, Bürgermeisteramt, Polizeistation.«
»Das neue Schild ist schon bestellt.«
»Und was ist mit dem alten?«
»Geklaut. Vermutlich von Jugendlichen.«
Na dann.
Al grinste. »Ich hole Ihren Koffer.«
Während Al hinten zugange war, stieg Barbara aus. Der Beinahe-Unfall hatte sie mit Adrenalin geflutet, doch das war jetzt vorbei. Sie spürte auf einmal die Kälte, die viel aggressiver war als noch in Anchorage. Es gab eben keine Bebauung wie in Anchorage, die dem unbarmherzigen Nordwind wenigstens etwas von seiner Unmittelbarkeit nahm. Die Kälte in Deadhart, sie schnitt ins Fleisch wie mit tausend winzigen Rasierklingen. Und sie trug einen Geruch heran, der ihr auf unangenehme Weise bekannt vorkam. Den Geruch von Nadelholz, fauligen Gewässern, Fisch – abgerundet von einer kaum merklichen Marihuana-Note. Der Stoff war hier nicht einmal verboten. Vielleicht gönnte sich in einem der Häuser gerade jemand ein Tütchen. Allerdings sah Barbara nirgendwo offene Fenster.
Sie stampfte mit den Füßen und schlug die behandschuhten Hände aneinander. Sie hatte plötzlich Hunger.
Al kam mit ihrem Koffer.
»Das wären dann hundertvierzig Dollar, Ma’am.«
Ist nicht wahr, dachte sie. Das Taxi verfügte über kein Taxameter, und sie war ziemlich sicher, dass ihr die Frau von der Agentur einen Fahrpreis von einhundertzwanzig genannt hatte. Aber hinter ihr lag ein langer Tag, und sie war überhaupt nicht in Streitlaune. Sie war hier, das war das Wichtigste, und jetzt wollte sie auch sofort loslegen. Ihre typische Ungeduld. Außerdem: Je eher sie anfing, je eher sie diesen Provinzfall zum Abschluss brachte, desto eher konnte sie wieder weg. Und vielleicht hatte Al ja recht. Vielleicht gab es wirklich nur ein paar Kästchen anzukreuzen, und der Rest der Zeit war Touristenprogramm. Netter Gedanke, der ihr jedoch schon im Moment der Entstehung irreal vorkam. Ganz abgesehen davon, dass sie Sehenswürdigkeiten in jeder Form ablehnte. Was sie des Sehens für würdig hielt, entschied sie erstens selber. Und zweitens wurde das reine Sehen auch überschätzt. Weil es täuschen konnte. Um wirklich ein Gefühl für einen Ort zu bekommen, musste man in ihn eintauchen, musste ihn riechen, fühlen, musste ihn leben. Kurz gesagt, man musste sich die Hände schmutzig machen.
Sie fischte drei Fünfziger aus ihrer Börse, in der Hoffnung, dass Al dafür die Klappe hielt.
Al nickte. »Die Firma dankt, Ma’am. Rufen Sie einfach an, wenn Sie wieder wegwollen. Aber berücksichtigen Sie das Wetter. Bei Sturm stellt das Lufttaxi den Betrieb ein, und von Talkeetna aus geht im Winter nur einmal im Monat ein Zug. Auch die kleineren Landstraßen sind längst nicht durchgehend passierbar. Gut möglich, dass Sie hier länger festhängen.«
Super. Barbara blickte umher. Trotz der vielen Lichter spürte sie, wie eine gewaltige Dunkelheit diesen Ort niederdrückte. Die Festbeleuchtung auf der Main Street schien die Wildnis ringsum sogar noch bedrohlicher zu machen. Nein, das war wirklich kein freundlicher Platz zum Leben, sondern eine Gefahrenzone, Kriegsgebiet. »Die Natur hat Appetit auf die Unbekümmerten«, hatte ihr Vater sie einst gelehrt, lallend nach einem Sixpack Bier. »Deshalb sorge immer dafür, dass du der Jäger bist und nicht die Beute.«
»Danke, ich werd’s mir merken«, sagte Barbara. »Und könnte ich bitte eine Quittung haben?«
»Aber sicher«, sagte Al und riss ein Blatt von dem Quittungsblock ab, den er aus seiner Gesäßtasche zog. »Den Betrag können Sie bestimmt selber eintragen«, sagte er mit einem Augenzwinkern.
»Danke, Al, sehr freundlich«, lächelte sie, auch wenn sie wusste, dass sie dies nicht ausnutzen würde. Barbara war korrekt, immer schon gewesen. Und ehrlich, wie der Tag lang war. Was hier in Alaska jedoch nicht viel heißen musste.
Sie verabschiedete sich von Al und sah ihm nach, als er wegfuhr. Heim in seine dunkle Fünfunddreißig-Quadratmeter-Fertighaushütte, die sie in diesem Moment förmlich vor sich sah. Dort würde er sich vor dem Fernseher eine Mikrowellenmahlzeit reinstopfen und sich vor dem Schlafengehen mit einem Porno einen runterholen. Ein realistisches Szenario, oder? Oder nicht? Was, wenn nicht? Was, wenn Al ein begnadeter Hobbykoch war? Was, wenn er Bücher und Musik liebte und gar keinen Fernseher hatte? Wäre doch möglich. Annahmen über andere Leute bargen immer einen Rest Ungewissheit, doch manchmal – wie bei Al – wusste man einfach Bescheid. Bauchgefühl. Und bei Al zu Haus, das war so sicher wie das Amen in der Kirche, stand neben dem Fernsehsessel einer dieser kleinen Kosmetikeimer – für die gebrauchten Kleenex. Oder sie wollte ihre eigenen Handschuhe fressen.
Barbara wandte sich um und musterte die Polizeistation von Deadhart. Auch dort, rund um die Fenster, die ortsüblichen Lichterketten, abwechselnd mit springenden Rentieren und grinsenden Kürbisgesichtern. Die ganze Stadt erschien ihr wie ein wahr gewordener nightmare before Christmas.
Aber so war das in solchen Käffern, sagte sie sich. Sie hatten ihre Eigenarten, und man tat gut daran, alles genau so zu machen wie die anderen. Sie nahm ihren Koffer und ging zur Tür. Drückte, da abgeschlossen war, die Klingel an der Seite. Es tat sich nichts. Sie drückte erneut und ließ es dauerklingeln.
Aus der Sprechanlage antwortete ein gehörschädigendes Knistern, gefolgt von einer verwaschenen Frauenstimme, die sagte: »Oh. Shit.« Erst dann die Ansage: »Deadhart, Bürgermeisteramt und Polizei.«
»Ja, hallo, hier ist Detective Barbara Atkins vom Institut für Forensische Vampirstudien …«
»Ach so, der Dracula-Doc. Kleinen Moment, ich lasse Sie rein.«
Dracula-Doc? Barbara verdrehte die Augen. Das konnte ja heiter werden. Der Summer ertönte, und sie drückte die Tür auf. Vor ihr ein kurzer Korridor, von dem zwei Türen abgingen. Die Tür auf der Rechten führte zu den Arrestzellen, eigentlich nicht mehr als zwei Käfige mit Pritsche.
Die Tür links musste dann wohl das gemeinsame Amtszimmer von Bürgermeister und Polizei von Deadhart sein. Und richtig, sie entdeckte etliche große Aktenschränke und drei Schreibtische auf einer Grundfläche, die maximal Platz für zwei geboten hätte.
Und mittendrin, auf dem letzten freien Stück Boden, stand eine untersetzte Frau mit dichter schwarzer Kurzhaarfrisur, indigenem Hintergrund, vielleicht Mitte vierzig. Sie trug eine Brille, eine farbenfrohe Bluse und Jeans, woraus Barbara schloss, dass es sich nicht um den Polizeichef Pete Nicholls handelte. Die Frau streckte ihr die Hand entgegen.
»Hi, Detective Atkins!«, sagte sie, um sich im nächsten Moment zu korrigieren. »Sagt man eigentlich Detective oder Doktor?«
Lächelnd ergriff Barbara die kleine Hand. »Ach, was mich betrifft, reicht Barbara vollauf.«
Tatsächlich wäre beides richtig gewesen. Sie hatte einen Doktor in forensischer Vampiranthropologie und war zugleich Detective der Mordkommission.
Das Lächeln der Frau wurde noch breiter. »Dann für Sie bitte auch Rita.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Rita.«
Barbara fand diese Frau auf Anhieb sympathisch. Ihr Blick war klar und direkt, ihr Lächeln echt.
»Sie arbeiten mit Chief Nicholls zusammen?«, fragte Barbara.
Die Frage schien sie zu amüsieren. »Könnte man so sagen. Ich bin die Aushilfe, bis ein neuer Officer hier sein Pflichtjahr antritt. Bis dahin hat Pete nur mich.«
»Wer missbraucht da wieder den Namen des Herrn?«
Barbara wandte sich um. Im hinteren Teil des Raums, am Durchgang zur kleinen Teeküche, stand ein hochgewachsener, drahtiger Mann mit einem Becher Kaffee. Er trug ein Holzfällerhemd mit hochgerollten Ärmeln und eine schwarze Jeans. Sein gelichtetes Haar war raspelkurz geschoren und der Schnurrbart penibel gestutzt. Er konnte nicht älter sein als Barbara, war aber sichtlich fitter. Unwillkürlich zog sie bei seinem Anblick den Bauch ein.
»Chief Nicholls?«
Er trat auf sie zu und streckte ihr seine gepflegte, leicht pigmentfleckige Hand entgegen. »Derselbe. Und Sie müssen Detective Atkins sein, hochgeschätzte Doctora der forensischen Vampiranthropologie.«
Sie ergriff seine Hand – eine Spur zu lang. »Aber Sie dürfen auch gerne Dracula-Doc sagen …« Dies mit einem Augenzwinkern in Richtung Rita.
Nicholls blickte die andere Frau an. »Bitte, das hast du nicht wirklich gesagt?«
Rita hielt sich mit gespieltem Schrecken den Mund zu.
»Das ist in Ordnung«, sagte Barbara. »Dracula-Doc geht doch, finde ich. Ich habe schon viel Schlimmeres gehört.«
Nicholls lächelte etwas gequält. »Auch mich hat man mit Namen bedacht, die wirklich nicht mehr spaßig sind.« Er trat an seinen Schreibtisch und stellte den Kaffee ab. »Darf ich Ihnen auch einen bringen? Dann können Sie sich etwas aufwärmen.«
»Das wäre nett, danke«, erwiderte Barbara und legte eine Extraportion Gefühl in ihre Stimme.
»Ich geh schon«, sagte Rita. »Wie wollen Sie ihn, Barbara?«
»Mit Milch und zwei Stückchen Zucker.«
»Kommt sofort.«
»Ich hoffe, Sie wissen die Ehre zu schätzen«, sagte Nicholls zu Barbara. »Diesen Service kriegt nicht jeder von Bürgermeisterin Williams.«
Barbara starrte Rita an. »Sie sind die Bürgermeisterin hier?«
Rita winkte ab. »Na ja, es klingt bedeutender, als es ist. Hauptsächlich Büroarbeit. Ich stelle Waffenscheine aus und sorge dafür, dass die Leute sich wenigstens ansatzweise an die Lebensmittelverordnung halten. Allgemeine Daseinsvorsorge, könnte man sagen. Von Zeit zu Zeit greife ich auch dem Chief unter die Arme. Und – nicht zu vergessen – ich mache den besten Kaffee nördlich des sechzigsten Breitengrads.«
Nicholls hob die Brauen: »Und warum kriege ich dann nie so einen?«
»Weil ich die Bürgermeisterin bin, Schatz«, gab Rita gut gelaunt zurück.
Nicholls schüttelte den Kopf. »Da sehen Sie es: Die Frau ist eindeutig irre. Aber in der Stadt schätzt man sie dafür. Warum auch immer.«
»Oh, das ist nicht so schwer zu verstehen«, sagte Barbara. »Vielleicht, weil man sie einfach mögen muss.«
Barbara setzte sich und öffnete ihre dicke Daunenjacke. Im Büro war es zwar warm, aber von Wohlfühltemperatur konnte keine Rede sein.
Außerdem befand sie sich jetzt direkt im Fokus von Nicholls, der sie eingehend musterte. Barbara hatte mit ihm lediglich einmal kurz gemailt und keine Ahnung, was sich dieser Dorfsheriff unter einem Spezialisten vorstellte. Aber vermutlich fragte sich Nicholls in diesem Moment genau dasselbe.
Endlich unterbrach Nicholls die irritierende Pause. »Und? Hatten Sie eine angenehme Reise?«, fragte er.
»Ja, hatte ich durchaus …« Sie zögerte. »Der Taxifahrer wusste übrigens schon von der Sache mit diesem Jungen …«
»Sie meinen Marcus Anderson«, unterbrach Nicholls. »Der Junge hat einen Namen.«
Barbara nickte. »Natürlich. Tut mir leid, Sir. Aber worauf ich hinauswollte: Der Taxifahrer wusste bereits über alles Bescheid. Anscheinend hat er eine Schwester in der Stadt.«
Nicholls schnalzte mit der Zunge. »Richtig: Carol Haynes. Eine echte Quasselstrippe. Arbeitet in dem Eisenwarenladen. Aber davon abgesehen, wir sind hier auf dem Dorf. Die Leute reden, jeder kennt jeden. So etwas wie eine Nachrichtensperre können Sie vergessen, es funktioniert nicht. Deshalb möchte ich die Sache möglichst bald geklärt haben.«
Barbara rutschte nervös auf ihrem Stuhl hin und her. »Ich werde mich bemühen, Sir.«
Er seufzte. »Das letzte Tötungsdelikt dieser Art fand hier vor fünfundzwanzig Jahren statt …«
An dieser Stelle musste sie präzisieren. »Entschuldigung, Sir: Welcher Art das Tötungsdelikt war, müssen Sie schon mir überlassen.«
Nicholls nickte widerwillig. »Das mag richtig sein. Trotzdem sollten Sie das Gesamtbild im Auge behalten. Deadhart ist eine ziemlich ruhige Stadt. Sicher, wir haben hier die üblichen Probleme mit Alkohol und Drogen, vor allem unter den Jugendlichen. Aber nichts, was aus dem Rahmen fällt. Und so einen Mord hat es seit dem Danes-Jungen nicht mehr gegeben. Erst, als sie erneut auftauchten …« Barbara sah, wie sich sein Unterkiefer anspannte.
»Das heißt, seit etwa anderthalb Jahren? Seit dieser Zeit existiert wieder eine Kolonie?«
»Genau. Und ich sage Ihnen ganz offen, Detective, seit dieser Zeit kommt diese Stadt nicht mehr zur Ruhe. Die Leute fragen sich, warum sie zurückgekehrt sind. Warum gerade jetzt? Die Spannungen waren deshalb von Anfang an hoch. Die Leute fragen sich, warum nicht endlich jemand den Notstand erklärt – und aufräumt.«
Für Barbara keine Überraschung. Sie hätte ihren weißen Arsch verwettet, dass die Leute genau das wollten: jemanden, der mal so richtig aufräumt. Weil sie nämlich der Meinung waren, dass Gesetze immer nur anderen etwas verbieten.
»Sir, eine Keulung verfügt man nicht einfach nebenbei. Aus diesem Grund findet sie auch so selten statt. Die gezielte Tötung einer ganzen Gemeinschaft, Männer, Frauen und Kinder … ist die Ultima Ratio.«
»Sie sagen es. Und ich rede von der Sicherheit einer ganzen Stadt, Männer, Frauen und Kinder.« Die Lippe unter dem Schnurrbart zuckte. »Die Gesetzeslage ist eindeutig: Eine Keulung kann angeordnet werden, wenn eine Kolonie Menschenleben bedroht.«
»Ist mir bekannt.«
»Ein Junge ist tot«, fuhr Nicholls fort. »Ich weiß nicht, ob sich seine Eltern je von diesem Schlag erholen. Aber die Leute in der Stadt verlangen, dass jetzt Gerechtigkeit geschieht, so oder so.«
Barbaras Nackenhaare stellten sich auf. »Dann sollten Sie sie schleunigst darauf aufmerksam machen, dass der Gesetzgeber diese Lynchjustiz nicht länger toleriert, insbesondere wenn Minderjährige betroffen sind. Es kann nicht sein, dass jeder das Gesetz in die eigene Hand nimmt.«
Und es konnte auch nicht schaden, Nicholls zu verstehen zu geben, dass sie durchaus ihre Hausaufgaben gemacht hatte. So kannte sie zum Beispiel sämtliche Details aus dem Mordfall Todd Danes – samt seinem erschütternden Nachspiel.
Abermals nickte Nicholls. »Ich sage Ihnen nur, wie die Stimmung unter den Leuten ist.« Wohingegen Barbara den Eindruck hatte, dass sie schon viel zu viel von dieser Stimmung mitgekriegt hatte. Aber das sprach sie nicht aus.
»Damals, als Todd Danes ermordet wurde«, fragte sie, um das Thema zu wechseln, »waren Sie da schon Sheriff?«
»Nein, das muss Jensen Tucker gewesen sein. Und danach, bis zu seiner Pensionierung vor sechs Jahren, war Ben Graves Sheriff. Ich kam erst danach.«
»Wo waren Sie vorher?«
»Seattle.«
Barbara hob eine Braue. »Nicht gerade ein Karrieresprung, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten.«
»Ich brauchte in erster Linie einen Tapetenwechsel.«
Eine nähere Erläuterung blieb aus, auch wenn Barbara darauf wartete.
»Und was ist mit Ihnen?«, fragte Nicholls stattdessen.
»Mit mir?«
»Wie sind Sie in Ihrem Fachbereich gelandet?«
Ihr blieb die Antwort erspart, da zum Glück Rita mit dem Kaffee kam. »Okay, Leute, einmal Bürgermeisterinnenkaffee für den Detective-Doc«, sagte Rita und stellte den Becher auf dem Schreibtisch ab. Sogleich stieg Barbara das betörende Aroma in die Nase.
»Mein Gott, wie das duftet!«
»Sehen Sie, ich lüge nicht … zumindest nicht, was Kaffee angeht«, gluckste Rita, ehe ihr die veränderte Stimmung im Raum auffiel. »Gut, dann gehe ich mal. Der Rest kann auch bis morgen warten. Ihr beiden wollt sicher ungestört eure Polizeisachen besprechen.«
»Nicht nötig«, sagte Nicholls. »Ich könnte mir vorstellen, dass Barbara erst mal ins Hotel will, sich ein wenig frisch machen – wenn sie ihren Kaffee ausgetrunken hat, natürlich.«
»Eher nicht«, entgegnete Barbara. »Ich möchte keine Zeit verlieren. Zumal Sie ja sagten, dass Sie die Sache möglichst bald geklärt haben wollen.«
Knappes Lächeln von Nicholls. »Das will ich immer noch.«
»Dann bin ich ja froh«, strahlte Rita. »Irgendetwas sagt mir, dass ihr beiden gut miteinander könnt.«
Barbara griff nach ihrem Kaffee. »Zumindest weiß jeder, woran er bei dem anderen ist«, sagte Barbara. »Meinen Sie nicht auch, Chief?«
»Unbedingt«, entgegnete Nicholls mit versteinerter Miene.
Das Mädchen saß in seinem Zimmer. Wartend. Horchend. Es war hungrig, aber das war nichts Neues. Es wusste auch längst, wie man das nagende Bauchweh verdrängte, den Begleiter des Hungers. Ihr Fänger hielt sie beim Essen kurz.
Die Tür war abgeschlossen, und es gab nur ein einziges, vergittertes Fenster, das zudem schwarz übermalt war. Das Mädchen störte sich nicht daran. Es war notwendig. Außerdem hatte ihr Fänger das schwarze Fenster mit einem pinkfarbenen Rollo drapiert, auf dem Einhörner tanzten. So sah alles weniger nach Gefängnis aus.
Ebenso hatte ihr Fänger für allerlei Beschäftigungsmöglichkeiten gesorgt, vom Radio über den alten Plattenspieler bis hin zu Kabelfernsehen und Videorekorder. Ihr Bücherregal quoll über von Paperbacks. Sie hatte einen Heimtrainer für ihre Fitness und ein eigenes Bad mit Dusche.
Ihr Fänger war kein Monster. Denn eigentlich liebten sie sie, das versicherten sie ihr jeden Tag.
Alles geschah nur zu ihrem Besten. Oder vielmehr zu ihrem Schutz. Das verstand sie doch, oder?
Ja, das verstand sie.
Und, nein, das verstand sie ganz und gar nicht.
Das Mädchen trat an das Bücherregal. Ihr Geschmack hatte sich mit den Jahren gewandelt. Begonnen hatte sie mit den Klassikern und nacheinander alles durchprobiert: Krimis, Science-Fiction, Horror. Irgendwann war sie bei Gedichten angelangt und noch später bei eigenen Schreibversuchen. Aber Wörter auf Papier schienen irgendwie nie zu reichen, um all das wiederzugeben, was sie empfand. Vielleicht gab es einfach auch nur zu wenige Wörter.
Mittlerweile interessierten sie eher Sachbücher. Bücher über Religion, Philosophie, allen möglichen Selbstfindungskram. Ihr Fänger förderte sie darin. Sagte, es sei eine gute Vorbereitung für den Tag, an dem sie erneut die Welt betreten würde. Daneben hatte sich das Mädchen mehrere Fremdsprachen selbst beigebracht, einschließlich Latein. Der menschliche Geist war ein gefräßiges Tier. Wirklich satt war er nie.
Das Mädchen setzte sich aufs Bett. An diesem Tag stand ihr der Sinn nicht nach Büchern. Oder Fernsehshows. Oder Quizsendungen.
Das lag nicht nur an dem nagenden Schmerz in ihrem Bauch.
Irgendwas war anders an diesem Tag, das spürte sie. Neu und gleichzeitig bekannt. Halb vergessen und jetzt plötzlich wieder da.
Ein Gefühl, dass sie mit alledem nicht allein war.
Es war eine leise murmelnde Stimme in ihrem Kopf.
Wie ein entfernter Geruch, ein elektrisches Flirren in ihren Muskeln, ausgelöst wovon?
Irgendwer näherte sich.
Und genau wie sie war er sehr hungrig.
4
»Sagen Sie mir doch erst einmal, was schon bekannt ist.«
Nicholls öffnete eine Schublade und knallte etliche Aktenhefter auf den Tisch. Geballte Information auf Papier, Digitalisierung nach Alaska-Art. Aber wer war sie, Barbara, um sich darüber zu erheben? Sie selbst war ja nicht besser. Old School, wenn man es freundlich ausdrücken wollte. Schön, sie besaß ein Smartphone und ein Notebook. Aber das Notebook stammte noch aus der Ära der Floppy-Disc, und ihr Smartphone nutzte sie für nichts Smarteres als die Telefonfunktion und SMS.
Sie lehnte sich zurück, um erst einmal nur zuzuhören. »Mich interessiert, wie Sie die Sache sehen.«
Nicholls schlug einen Aktenhefter auf. Barbara nippte an ihrem Kaffee. Sie hatte Nicholls das Wort erteilt und konnte sehen, wie sehr ihm das gefiel. Er war ein Mensch, der gern das Kommando hatte. Für sich genommen und in seinem Beruf nicht einmal eine schlechte Eigenschaft. Aber von einem bestimmten Punkt an wurde natürlich alles zum Problem.
»Okay, was haben wir?«, begann er. »Am 10. November dieses Jahres ging der fünfzehnjährige Marcus Anderson nach dem Abendessen noch mal raus, um sich mit seinem gleichaltrigen Freund Stephen Garrett zu treffen – und kehrte anschließend nicht mehr in sein Elternhaus zurück. Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt noch unbesorgt, da Marcus angegeben hatte, möglicherweise bei den Garretts zu übernachten. Als er auch am darauffolgenden Morgen nicht wiederkehrte, schrieb ihm die Mutter eine SMS, auf die sie keine Antwort erhielt. Sie rief daher die Mutter von Stephen an, von der sie erfuhr, dass Marcus nicht bei den Garretts übernachtet hatte. Stephen Garrett selbst sagte, dass Marcus um circa 21:00 Uhr nach Hause aufgebrochen war. Die beiden hatten den Abend zusammen mit einem weiteren Jungen, Jacob Bell, in einer alten Jagdhütte im Wald verbracht. Das allein ist allerdings nicht ungewöhnlich. Viele Jugendliche tun das, wenn sie für sich sein wollen. Dort können sie rauchen und trinken und überhaupt tun und lassen, was ihnen beliebt. Sie wissen sicher, was ich meine …«
»O ja, ich erinnere mich vage«, sagte Barbara. »Und in dieser Hütte wurde er später auch aufgefunden?«
Nicholls nickte und schob einige Tatortbilder über den Tisch.
Barbara studierte sie. Das Erste, was ihr auffiel: Marcus war dünn, ein richtiger Schlaks. Nicht untypisch für sein Alter, wenn der Körper mit dem reinen Längenwachstum nicht Schritt hielt – egal, wie viel sie aßen. Der Junge lag mit gespreizten Armen, gespreizten Beinen auf dem rauen, schmutzigen Dielenboden und war lediglich mit Jeans und Sweatshirt bekleidet. Beide Hosenbeine waren leicht nach oben gerutscht und entblößten seine Unterschenkel und die zerschlissenen Socken. Ein Schuh war abgefallen. Barbara schluckte. Am liebsten hätte sie wenigstens die Jeans nach unten gezogen, damit der Junge es nicht so kalt hatte. Ein törichter Gedanke natürlich. Diesem Jungen wurde nie wieder warm.
Ihr Blick wanderte hoch zum Hals. Eine Zone maximaler Zerstörung. Aufgerissene Haut, Knorpel und Bänder und überhaupt alles, was diesen Hals einst ausgemacht hatte, bildeten eine einzige blutige Masse, dessen Bestandteile höchstens noch vom Pathologen zugeordnet werden konnten. Einzelne Blutspritzer befanden sich auch auf seinem Gesicht und dem Sweatshirt, allerdings längst nicht genug für eine Wunde dieser Schwere. Eigentlich hätte der ganze Kopf in einer Blutlache liegen müssen, tat er aber nicht. Was nur den Schluss zuließ, dass sich die Lache woanders befand, nicht in dieser Hütte. Und dass die Leiche bewegt wurde. Oder aber, andere Möglichkeit: Das Blut war gleich an Ort und Stelle abgesaugt worden. Inkorporiert.
Bis hierhin traf der vorläufige Polizeibericht wohl zu. Auf den ersten Blick wies alles auf einen Angriff aus der Kolonie hin.
Aber schau dir das lieber noch mal an, mahnte Susans Stimme in ihrem Kopf. Du meinst, du hättest jedes Detail gesehen? Hast du nicht. Du hast höchstens einen Blick darauf geworfen. Jetzt guck noch einmal hin – und bitte genau.
Sie holte ihre Brille hervor und besah sich jedes Foto erneut. Diesmal konzentrierte sie sich auf den näheren Umkreis der Leiche – Marcus. Etliche Gegenstände auf dem Boden waren mit nummerierten Spurentafeln versehen wie das halbe Dutzend Joint-Stummel, die drei Bierdosen, das Handy neben Marcus’ Hand. Aber da war noch etwas.
»Was ist das?«, fragte Barbara und deutete auf ein kleines pinkfarbenes Objekt. Nicholls griff in seine Schublade (auf dieser Wache wohl das Äquivalent eines Asservatenschranks) und holte ein Plastiktütchen hervor.
Barbara nahm das Tütchen entgegen. Darin war ein kleines rosafarbenes Teil mit Bruchkanten. Sie hatte keine Ahnung, was das sein sollte. Offenbar gehörte es zu etwas, aber was?
»Irgendeine Idee?«, fragte Nicholls.
»Hmm. Irgendein Kunststofffragment.«
»Ja, dachte ich auch. Deshalb habe ich es sichergestellt. Ich weiß aber nicht, ob es relevant ist. Vielleicht lag das Ding schon ewig da rum.«
»Vielleicht. Doch dazu sieht es eigentlich zu sauber aus, wenn man die Umgebung bedenkt. Selbst das muss nichts heißen. Vielleicht haben Sie ja recht, und es ist wirklich nicht relevant.«
Ihre Erfahrung sprach allerdings dagegen. Barbara zückte ihr Notizbuch und schrieb: »Rosa Plastikteil.«
»Ich hole mir noch einen Kaffee«, sagte Nicholls. »Rufen Sie, wenn Sie mich brauchen.«
»Danke.«
Barbara nahm sich die Fotos ein drittes Mal vor. Trotz der wenigen Blutspuren rund um Marcus’ Leiche dürfte der Täter nicht annähernd so sauber davongekommen sein. Die große Beinarterie war ein Geysir. Der Täter musste also seine besudelten Sachen irgendwo loswerden. Barbara notierte auch das. Überhaupt Kleidung. Da war noch etwas, das irgendwie nicht ins Bild passte. Aber was?
Abermals sah sie den Jungen an. Er trug ein blaues Sweatshirt, dazu Jeans, Socken, Winterstiefel. Aber keinen Anorak! Die Kids hatten sich in einer Jagdhütte versammelt, in der es sicher minus fünf Grad kalt war. Wo also war seine Winterjacke?
Nicholls trat wieder ins Zimmer.
»Haben Sie eigentlich seine Jacke gefunden?«, fragte sie ihn.
»Was?«
»Die Jacke von Marcus. Hier auf den Bildern trägt er nämlich keine.«
Nicholls setzte seinen Kaffeebecher ab. »Nein, eine Jacke haben wir nicht gefunden.«
»Oh.«
»Oh?«
Sie blickte ihn an. »Nun ja, weil er eine getragen haben muss. Haben Sie seine Eltern nicht gefragt, oder seine Freunde?«
Nicholls schien die Frage zu irritieren. »Natürlich habe ich das. Und, klar, er trug eine Jacke. Eine Jacke der Marke North Face, Farbe Grau und dem Vernehmen nach nagelneu.«
»Und wo ist die Jacke jetzt?« Barbara ließ nicht locker.
»Ich bin davon ausgegangen, dass der Täter sie an sich genommen hat, möglicherweise als eine Art Trophäe.«
Barbara runzelte die Stirn. Denn das passte nun überhaupt nicht zur Kolonie-Theorie. Solche Angriffe waren typischerweise impulsiv. Täter mit diesem Hintergrund agierten aus Zorn, Verlangen, Hunger. Jedenfalls mit einem hohen Aggressionspotenzial. Trophäen interessierten sie nicht, wenn sie bekommen hatten, was sie brauchten.
»Erzählen Sie mir von den anderen Jungen«, sagte Barbara.
Nicholls schob genervt das Kinn vor. »Sie waren es nicht.«
Der Einwand kam ein bisschen zu schnell. Barbara setzte ihr verbindlichstes Lächeln auf und griff wieder zu ihrem Kaffee.
»Das habe ich auch nicht gesagt, Sir. Ich hätte nur gern etwas mehr über sie erfahren.«
Nicholls sah sie voller Argwohn an, gab dann aber seufzend nach. »Stephen ist ein ganz normaler Jugendlicher. Nicht dumm, aber schnell abgelenkt. Seine Eltern sind im Outdoor-Tourismus tätig. Seine Mutter, Jess, stammt von hier, sein Vater Dan kommt aus Kanada und bietet geführte Trekking-Touren durch den Nationalpark an, auf die ihn Stephen manchmal begleitet.«
»Also ist Stephen mit der Umgebung vertraut?«
»Ich denke doch, ja. Er hatte schon mehrfach mit uns zu tun, aber nichts, was einen beunruhigen müsste. Das Übliche halt: Alkohol, einmal eine Schlägerei mit einem anderen Jugendlichen, das war’s. Er ist kein Killer.«
Das, dachte Barbara, musst du wohl mir überlassen. Nach ihrer Erfahrung war besonders bei kleineren Vergehen die Dunkelziffer hoch. Auf jede angezeigte Tat kamen mindestens sechs weitere, die nie bekannt wurden. Umgekehrt gab es in jeder Gruppe immer den einen Dummen, den man am Ende zur Verantwortung zog. Entweder weil er nichts vertrug oder noch weiterprügelte, wenn die Cops bereits im Anmarsch waren. Ob Stephen so einer war, konnte sie nur in einem Gespräch feststellen.
»Und was ist mit dem anderen, diesem Jacob Bell?«, fragte sie.
Nicholls räusperte sich. »Der ist mit seinem Dad erst vor neun Monaten zugezogen.«
»Keine Mutter?«
»Die Eltern sind offenbar geschieden.«
»Warum gerade hierhin?«
»Der Vater, Nathan Bell, stammt von hier.«
Bell. Der Name kam Barbara bekannt vor. »Gehörte er nicht auch zum Freundeskreis von Todd Danes?«
»Das ist richtig. Aber ich würde das nicht überinterpretieren. Dies ist eine kleine Welt, und Todds Mörder hat gestanden. Über den Tathergang gibt es eigentlich keinen Zweifel.«
Mag sein, dachte Barbara. Aber über das, was im Anschluss geschah, sind Zweifel wohl angebracht.
»Hören Sie«, fuhr Nicholls fort, »ich will ehrlich zu Ihnen sein. Nathan Bell interessiert mich eigentlich gar nicht. Nun gut, er trinkt zu viel, und, ja, man kann sagen, er vernachlässigt seinen Sohn. Das sehen Sie an den Klamotten, die Jacob am Leib trägt, ebenso wie an den Fehlzeiten in der Schule. Aber das können Sie nicht dem Jungen anlasten.«
Barbara nickte und horchte gleichzeitig auf. »Seine Eltern kann man sich nicht aussuchen, habe ich recht?«
»Genau so ist es.«
»Was ist mit den Eltern von Marcus?«
»Das sind grundsolide Leute. Sie besitzen den Supermarkt hier im Ort. Marcus ist ihr einziges Kind. Im Augenblick halten sie sich bei Verwandten in Talkeetna auf.«
»Mit ihnen muss ich ebenfalls sprechen.«
»Ich weiß. Sie müssten in ein, zwei Tagen wieder da sein.«
Barbara nickte, auch wenn das Gespräch nicht so verlief, wie sie es sich gewünscht hätte. Gott, war dieser Kerl zäh.
Aber es half nichts. Dann musste sie ihm eben jedes Detail einzeln aus der Nase ziehen. Ihr fiel nämlich noch etwas ein: »Leben die Eltern von Todd Danes eigentlich noch in Deadhart?«
Nicholls schüttelte den Kopf. »Angeblich sind sie kurz nach dem Mord zusammen mit seiner jüngeren Schwester nach Fairbanks gezogen. Wollten dort wohl neu anfangen.« Er sah sie vielsagend an. »Falls das überhaupt geht, wenn man die Asche seines Kindes mit in den Koffer packen muss.«
Schon verstanden, dachte Barbara.
Und fuhr unbeirrt fort: »Das heißt, Stephen und Jacob waren die Letzten, die Marcus gegen 21:00 Uhr lebend gesehen haben?«
»Richtig. Marcus ging zusammen mit ihnen nach Hause, stellte aber fest, dass er sein Handy in der Hütte vergessen hatte, und ging noch einmal zurück.«
»Die beiden anderen haben ihn nicht begleitet?«
»Es sind Jungs. Jungs kletten nicht so zusammen wie Mädchen.«
»Und Mädchen würden das gar nicht tun, wenn Jungs nicht so wären, wie sie sind.« Und schob, ehe er darauf etwas sagen konnte, gleich die nächste Frage nach: »Also haben wir letztlich nur ihre Aussage, dass Marcus zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war?«
Nicholls verdrehte die Augen. »Glauben Sie im Ernst, wir hätten das nicht in Betracht gezogen? Das Szenario ist ja nicht so abwegig. Es wird viel getrunken, man gerät in Streit, es geht zur Sache und … zack … schon liegt einer am Boden und steht nicht wieder auf. Aber hätte es sich tatsächlich so abgespielt – dies bei allem Respekt –, wären Sie gar nicht hier.«
»Darf ich fragen, woher Sie diese Gewissheit nehmen?«
Nicholls griff wieder in seine Schublade und holte eine weitere durchsichtige Plastiktüte hervor – mit einem Handy darin.
»Marcus’ Smartphone?«
Nicholls grinste selbstzufrieden. Er hatte sie mit voller Absicht im Unklaren gelassen und sich seinen Knüller für ganz zuletzt aufbewahrt – während sie sich mit ihren Fragen zum Idioten machte.
Mit überlegener Langsamkeit schob er ihr das Handy hin.
»Hier, werfen Sie mal einen Blick darauf. Das ist der Beweis, dass unser Täter aus der Kolonie kommt.«
5
Das Video war dunkel und verrauscht und weniger als eine Minute lang. Gefühlt war es aber länger. Auf dem ersten Bildausschnitt war nur der verdreckte Boden der Jagdhütte zu sehen. Marcus musste die Kamera eingeschaltet haben, als der Angriff bereits lief. Ein letzter Versuch, festzuhalten, was mit ihm geschah?
Zumindest war es ihm gelungen, das Handy noch umzudrehen, denn Barbara erkannte plötzlich eine Gestalt, die sich allem Anschein nach auf ihn geworfen hatte und ihn nun auf den Boden drückte.
Aber ob Mann oder Frau, war unmöglich zu bestimmen. Die Aufnahme war einfach zu dunkel, außerdem trug der Angreifer schwarze Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke. Vampire waren im Allgemeinen nicht besonders groß, dafür aber außerordentlich stark.
Marcus wehrte sich nach Kräften. Doch sosehr er sich auch wand, es gab kein Entkommen. Die Gestalt über ihm hob jetzt den Kopf. Für einen Sekundenbruchteil sah Barbara die scharfen weißen Eckzähne, ehe sie sich in seinen Hals bohrten. Marcus schrie auf, was Barbara einen Stich versetzte. Im gleichen Moment entglitt Marcus das Handy, und es gab wieder nur eine statische Sequenz außerhalb des eigentlichen Geschehens. Barbara erkannte daher nur ein Stück Boden und einen Teil der Wand, als Marcus erneut aufschrie. Die Handykamera hielt dieses Bild noch ein paar Sekunden länger fest, bevor sie abrupt abschaltete.
Beweis erbracht.
Zumindest nach Meinung von Nicholls. Und Decker, dieses Arschloch, hatte sie natürlich auch mit keinem Wort vorgewarnt. Danke für nichts nach New York.
Aber Beweis war ein großes Wort. Sie war da längst nicht so sicher.
Zunächst: Wer hatte die Aufnahme gestoppt? Marcus im Todeskampf? Oder sein Mörder? Und warum hatte er dann nicht gleich das Handy mitgenommen?
Irgendetwas an diesem Hergang passte nicht, der Detective in ihr hörte einfach nicht auf zu nörgeln.
»Ich muss mir das Ganze noch einmal in Ruhe ansehen«, sagte sie schließlich zu Nicholls.
»Bitte, lassen Sie sich Zeit«, erwiderte Nicholls hochmütig. »Morgen können Sie auch die Leiche sehen. Mehr dürfte wohl nicht erforderlich sein.«
Kommt darauf an, dachte Barbara. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Da sie das Handy nicht mitnehmen konnte, lud er ihr das Video auf ihr Notebook, ehe sie hinüberging, um im Roadhouse Grill und Hotel einzuchecken.
Barbara hatte sofort den Eindruck, dass die Eigentümer den Hotelteil erst später hinzugefügt hatten. Dementsprechend war auch ihr Zimmer. Dabei war es nicht einmal soo schlecht. Schräg wäre die passendere Beschreibung. Für die Zimmerdecke galt das sogar wörtlich. Sie musste den Kopf einziehen, um an ihr durchgelegenes Doppelbett zu gelangen. Auch praktisch: Das Bad teilte sie sich mit dem einzigen anderen Zimmer nebenan. Und die altertümliche Dusche stotterte wie ein Vollhorst bei seinem ersten Date. Gleichviel, das Bettzeug war sauber und gestärkt, die Patchworkdecke erinnerte sie an ihre Oma, und es gab sogar einen Wasserkocher mit Instantkaffee und Milch.
Das junge Mädchen, das sie auf ihr Zimmer brachte, übergab ihr einen Metallring mit zwei Schlüsseln. »Einer ist für Ihr Zimmer und der andere für die Eingangstür unten. Das Restaurant öffnet um zehn, Frühstück gibt es bei uns nicht. Aber gegenüber ist ein Coffeeshop, da können Sie ab acht etwas bekommen.«
Alles in allem hatte Barbara schon schlechter genächtigt. Auch das Grill-Restaurant entsprach ziemlich genau ihrer Erwartung. Wohin sie auch kam, es war wohl so etwas wie der amerikanische Standard. Auf der einen Seite die Bar, in der Mitte ein paar Tische und an den Wänden ringsum die Sitznischen. Die Wände selbst zierten altmodische Flinten, Tierköpfe aus der Region und historische Fotos der Stadt und ihrer Bewohner. Weitere Andenken waren hinter der Bar zu bestaunen, wie hölzerne Pflöcke und Kreuze sowie ein Schaukasten voller langer, gelblicher Zähne. Die Griffe der Bierpumpen waren aus Oberarmknochen gefertigt. Natürlich antik und somit nicht illegal. Nur abgrundtief geschmacklos.
Aber nochmals: Wer war sie, um darüber die Nase zu rümpfen? Sie war hier nicht in New York oder im linksgrün gestrickten Kalifornien, wo derlei menschenverachtende Kuriosa politisch so wenig gingen wie nostalgische Erinnerungen an die gute alte Zeit – einschließlich Lynchmord, Galgenstrick und Ku-Klux-Klan-Kutten. In Käffern wie diesen hielt man eben das Brauchtum hoch. Sicher, man konnte das rückschrittlich finden, doch es hatte wohl eher mit einer gewissen Bockigkeit zu tun. Insofern hielt man das Brauchtum auch weniger hoch als sich selbst daran fest – während man links und rechts von der Moderne überholt wurde. Langfristig war der Fortschritt dadurch zwar nicht aufzuhalten (klappte sowieso nie), aber man wollte es ihm wenigstens so schwer wie möglich machen.
Immerhin, die Speisekarte war halbwegs zivilisiert, wenn auch etwas wildschwein- und karibulastig. Dem Essensgeruch nach zu urteilen, gab man sich in der Küche erkennbar Mühe. Barbara setzte sich in eine Nische in der Ecke und bestellte bei dem Mädchen, das sie schon kannte, einen Cheeseburger mit Pommes und ein großes Bier. Das Mädchen war vielleicht achtzehn, neunzehn Jahre alt und hatte eine violette Mähne mit einem dramatischen Undercut auf der einen Seite. Sie trug ein Pearl-Jam-T-Shirt und eine kaputte Jeans, was im Idiom des Fortschritts aber nicht kaputt genannt wurde, sondern destroyed. Das Bier kam sofort, was Barbara Gelegenheit gab, sich noch einmal das Video anzusehen.
Nicholls hatte darauf verzichtet, sie zu begleiten, aber kaum aus Rücksichtnahme vor der erschöpften Kollegin aus der großen Stadt. Sie war der Neuling hier, die Außenseiterin, die Cheechako. Er legte keinen Wert darauf, mit ihr in einen Topf geworfen zu werden. Barbaras Anwesenheit in Deadhart war im besten Fall ein notwendiges Übel. Darin war er sich sogar mit Barbara einig.
Der Saal war etwa halb voll. Ausnahmslos Einheimische. November war nicht gerade Touristensaison und Deadhart im Übrigen auch kein Urlaubsort. Da ging man besser nach Talkeetna oder Fairbanks. Unauffällig musterte Barbara ihre Umgebung. Wie das alte Ehepaar zwei, drei Sitznischen weiter. Oder die Familie mit zwei Kindern an einem der runden Tische in der Mitte. Oder die silbergraue Grande Dame an dem Zweiertisch, zusammen mit dem pubertierenden Mädchen in dem auffällig braven blauen Kleid. Und nicht zuletzt die alten Knacker, die hinten an der Bar die Stellung hielten.
Sie alle hatten sich nach ihr umgedreht, als Barbara den Raum betrat. Manche ganz offen, andere eher verstohlen. Eigentlich fiel sie in Menschenansammlungen nicht auf, was ihr in ihrem Beruf zugutekam. Nicht so hier. In einem hautengen Trikot und Federboa hätte das Aufsehen kaum größer sein können. Da blieben Kommentare natürlich nicht aus. Etwa von dem alten Sack an der Bar, der ihr im Vorbeigehen etwas hinterherschickte, das sie zwar nicht verstand, aber nicht als Kompliment auffasste.
Barbara quittierte es mit einem Lächeln: »Ihnen ebenfalls einen angenehmen Abend, Sir.«
Worauf dem Kerl außer einem finsteren Blick nichts weiter einfiel, als sein Glas auf ex auszutrinken und auf den Tresen zu knallen. Und für mich einmal dasselbe wie dieser Herr da, dachte Barbara. Einen Old Fashioned mit extra viel Bitter.
Es überraschte sie dann auch nicht, als sich der derselbe Kerl – leicht schwankend – auf ihren Tisch zubewegte. In gewisser Weise hatte sie sogar darauf gewartet. Sie klappte ihr Notebook zu und sah ihm lächelnd entgegen.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
Der Mann war vielleicht Ende siebzig und hochgewachsen für sein Alter. Barbara vermutete, dass sich unter dem Windbreaker und dem karierten Hemd noch immer ein durchtrainierter Oberkörper befand und keine faltige Greisenbrust. Allerdings war sein Gesicht tief zerfurcht, und die wasserblauen Augen wiesen Anzeichen einer Linsentrübung auf. Auch die militärisch kurz gehaltenen Haare, die sich an den Ecken deutlich auslichteten, machten kein Hehl aus seinem hohen Alter.
»Sind Sie der Dracula-Doc?«, fragte er.
Barbara behielt ihr anfängliches Lächeln einfach bei. (Es war ein alter Rat ihrer Mutter: »Mach eine Reißzwecke dran.«) Sie streckte ihm die Hand entgegen. »Barbara Atkins, Sir. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Er blickte auf ihre Hand, als hätte sie noch kurz zuvor ins Klo gegriffen.
»Ma’am, ich will ja nichts sagen, aber Sie verschwenden hier Ihre Zeit.«
Endlich war es raus. Barbara ließ ihre Hand sinken.
»Ach wirklich?«
»Wir alle wissen, wer – oder was – den Anderson-Jungen abgeschlachtet hat. Und wir wissen auch, was wir in einem solchen Fall zu tun haben.«
»Und das wäre, Sir?«
»Beim letzten Mal brachten wir die Scheusale zur Strecke und jagten anschließend die ganze Bande zum Teufel. Danach war Ruhe.«
Barbara nickte. »Ich habe davon gelesen. Eine ungenehmigte Massentötung, bei der drei Vertreter der Kolonie getötet wurden. Sie können von Glück reden, dass gegen die Täter nicht ermittelt wurde.«
Der Mann schnaubte verächtlich, und Barbara registrierte den Bourbon in seinem Atem. »Wieso? Sie gehen ja auch nicht gegen Schädlingsbekämpfer vor.«
»Einer Ihrer sogenannten Schädlinge war noch minderjährig.«
Er verdrehte die Augen. »Na und? Es sind keine Kinder in unserem Sinne. Manche sehen vielleicht so aus, aber dahinter verbirgt sich etwas ganz anderes.«
Was ebenfalls nicht richtig ist, dachte Barbara. Die Praxis, Kinder »umzudrehen«, war von den Kolonien schon vor Jahrhunderten abgeschafft worden. Bei den meisten Kolonie-Kindern handelte es sich um eigenen Nachwuchs. Mag sein, ihre Entwicklung vollzog sich langsamer als bei Menschenkindern, dennoch handelte es sich immer noch um Kinder.
»Eigentlich haben wir sie gerettet«, fuhr der Mann fort. »Und zwar vor der ewigen Verdammnis. Wir haben getan, was nötig war.«
»Wirklich? Und das Verstümmeln von Leichen zählt auch dazu?«
Hinter den weißen Schleiern in seinen Augen blitzte etwas auf, und sein Gesicht verhärtete sich.
Da schaltete sich von außen eine weitere Stimme ein. »Alles in Ordnung hier?« Barbara sah hoch. Vor ihnen stand die Dame in Grau.
Anders als der Rest der Gäste trug sie nicht die übliche Provinzkluft, bestehend aus Jeans und Holzfällerhemd, sondern ein langes graues Kleid und klobige Stiefel. Auffällig war auch die Halskette mit dem prächtigen Silberkruzifix.
»Wir unterhalten uns nur ein wenig«, sagte Barbara zu ihr.
Die Frau lächelte. »Na dann ist ja alles gut«, sagte sie und richtete ihren Blick auf den alten Mann. »Trotzdem, Beau, hast du wohl genug für heute. Du willst doch nicht, dass Jess dich wieder holen kommt.«