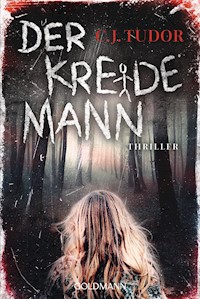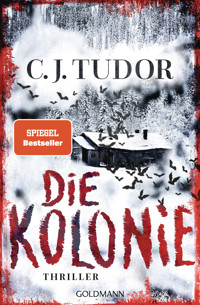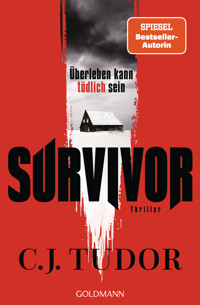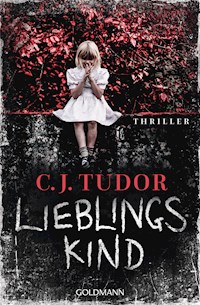
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eines Nachts verschwand seine geliebte Annie. Aus ihrem eigenen Bett. Das ganze Dorf hat sie gesucht, überall. Alle haben das Schlimmste befürchtet. Und dann, wie durch ein Wunder, kehrte sie vierundzwanzig Stunden später zurück. Aber sie konnte – oder wollte – nicht sagen, was ihr zugestoßen war. Und auch er konnte es sich nicht erklären. Er wusste nur, dass sie nicht mehr dieselbe war. Nicht mehr seine Annie. Und er bekam Angst - mörderische Angst vor seiner eigenen kleinen Schwester ...
Beklemmend, unheimlich und Atem beraubend spannend – der neue Thriller von C.J. Tudor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Joe hatte sich geschworen, nie mehr nach Arnhill zurückzukehren – der Ort, in dem er aufgewachsen war und in dem sein Leben einst zerbrach, nachdem seine geliebte kleine Schwester Annie verschwunden war. Jahre später erhält er plötzlich eine schockierende Botschaft, die mit einem Schlag die Geister seiner Jugend wieder erweckt: Das Unheil, das damals wie eine dunkle Wolke über Arnhill lag, scheint wieder neue Opfer zu fordern. Und Joe beschließt, in die kleine Stadt in der englischen Provinz zurückzukehren, um endlich eine Antwort auf die Frage zu bekommen, die ihn all die Jahre gequält hat: Wer hat die Menschen auf dem Gewissen, die auf so mysteriöse Weise in Arnhill ums Leben kamen? Und was geschah damals mit Annie wirklich? Denn der schlimmste Tag in Joes Leben war nicht der, an d^em seine Schwester verschwand. Es war der, an dem sie zurückkehrte …
Weitere Informationen zu C. J. Tudor und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
C. J. Tudor
Lieblingskind
Thriller
Deutsch von Werner Schmitz
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Taking of Annie Thorne« bei Michael Joseph, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2019Copyright © der Originalausgabe 2019 by C. J. Tudor
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Arcangel/© Vanessa Skotnitsky
Rahmen: FinePic®, München
CN · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-21423-4V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Schriftsteller sind wie Puzzles. Wir brauchen Geduld, Beharrlichkeit und manchmal jemanden, der uns wieder zusammensetzt.Für Neil, der mich vollständig macht.
Prolog
Noch bevor er das Haus betritt, weiß Gary, hier stimmt was nicht.
Grauenhaft süßlicher Geruch dringt aus der offenen Tür ins Freie; Fliegenschwärme surren im stickigen Flur, und wenn das kein todsicheres Anzeichen dafür ist, dass mit diesem Haus etwas nicht stimmt, nicht stimmt im schlimmstmöglichen Sinn, dann ist es die Stille.
In der Einfahrt steht ein gepflegter weißer Fiat; neben der Haustür lehnt ein Fahrrad, im Flur liegen Gummistiefel. Ein typisches Familienhaus. Und auch wenn so ein Haus leer ist, hallt es darin lebendig. Es liegt nicht bleiern und unheilverkündend unter einer alles erstickenden Decke des Schweigens wie dieses Haus.
Trotzdem ruft er noch einmal: »Hallo? Jemand zu Hause?«
Cheryl hebt die Hand und klopft energisch an die offene Tür. Zu, als sie ankamen, aber nicht abgeschlossen. Auch daran war etwas nicht richtig. Arnhill mag ein kleines Dorf sein, aber immer noch schließt hier jeder seine Haustür ab.
»Polizei!«, ruft sie.
Nichts. Keine Schritte, kein Quietschen oder Flüstern. Gary stöhnt, er spürt einen abergläubischen Unwillen, das Haus zu betreten. Nicht nur wegen des grauenhaften Todesgeruchs. Da ist noch etwas. Etwas aus Urzeiten, das ihn drängt wegzulaufen, auf der Stelle.
»Sarge?« Cheryl mustert ihn von unten, eine bleistiftdünne Augenbraue fragend hochgezogen.
Er blickt auf seine eins sechzig große, kaum hundert Pfund schwere Kollegin herab. Mit seinen eins fünfundachtzig und knapp 110 Kilo ist Gary der Balu neben dem zierlichen Bambi Cheryl. Jedenfalls äußerlich. Was das Innere angeht, soviel sei gesagt, muss Gary bei Disney-Filmen immer weinen.
Er nickt ihr grimmig zu, und die beiden gehen hinein.
Der satte Verwesungsgeruch durchdringt alles. Gary schluckt, versucht durch den Mund zu atmen und wünscht verzweifelt, ein anderer – irgendein anderer – hätte diesen Anruf entgegengenommen. Cheryl verzieht das Gesicht und hält sich die Hand vor die Nase.
Diese Häuser sind alle ähnlich gebaut. Kleiner Flur. Links die Treppe. Wohnzimmer rechts, hinten die winzige Küche. Gary steht vor dem Wohnzimmer. Dann stößt er die Tür auf.
Er hat schon viele Tote gesehen. Ein Kind, Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht. Einen Teenager, zerfleischt von einem Mähdrescher. Entsetzlich, ja. Sinnlos, ganz bestimmt. Aber das hier. Das ist übel, denkt er. Echt übel.
»Scheiße«, flüstert Cheryl, und Gary hätte es nicht besser ausdrücken können.
Dieses eine Wort sagt alles. Scheiße.
Eine Frau, wie hingeworfen auf einem abgewetzten Ledersofa in der Mitte des Zimmers, vor ihr ein großer Flachbildfernseher. Die Mattscheibe mit einem spinnwebartigen Sprung, auf dem Dutzende fetter Schmeißfliegen träge herumkrabbeln.
Die anderen umschwirren die Frau. Die Tote, verbessert sich Gary. Keine Person mehr. Nur ein Leichnam. Nur ein weiterer Fall. Reiß dich zusammen.
Verwesung hat sie aufgeschwemmt, dennoch kann er erkennen, dass sie im Leben schlank gewesen sein muss, mit heller Haut, die jetzt fleckig und von grünen Adern durchzogen ist. Sie ist gut gekleidet. Karierte Bluse, eng anliegende Jeans, Lederstiefel. Ihr Alter ist schwer zu schätzen, zumal von ihrem Kopf kaum etwas übrig ist. Was genaugenommen nicht stimmt. Knochensplitter und Hautfetzen kleben an der Wand, am Bücherregal und auf den Kissen.
Kaum Zweifel, wer den Abzug betätigt hat. Die Schrotflinte liegt noch auf ihrem Schoß, gehalten von aufgedunsenen Fingern. Gary sieht es vor sich: Lauf in den Mund gesteckt, Abzug gedrückt, Geschoss tritt leicht nach links versetzt aus, denn dort ist der Schaden am größten, logisch, da sie die Flinte in der Rechten hält.
Gary ist bloß ein uniformierter Sergeant und hat mit Forensik nicht viel zu tun, aber er lässt sich kaum eine Folge von CSI entgehen.
Die Verwesung hat offenbar ziemlich schnell eingesetzt. Es ist heiß in dem kleinen Haus, geradezu stickig. Die Außentemperatur liegt bei knapp 25 Grad, die Fenster sind geschlossen, die Vorhänge zwar zugezogen, aber in dem Zimmer herrschen mindestens 30 Grad. Schon läuft ihm der Schweiß über den Rücken, seine Achselhöhlen sind feucht. Cheryl, die sonst nie die Ruhe verliert, fährt sich über die Stirn und verzieht unbehaglich das Gesicht.
»Mist. Was für eine Schweinerei«, sagt sie mit einem Überdruss, den er nicht von ihr gewohnt ist.
Sie starrt die Leiche auf dem Sofa an, schüttelt den Kopf und sieht sich mit grimmiger Miene im Zimmer um. Gary weiß, was sie denkt. Nettes Häuschen. Nettes Auto. Nette Kleidung. Aber was sich im Innern abspielt, das weiß man nie.
Die einzigen Möbelstücke außer dem Sofa sind ein schwerer Bücherschrank aus Eiche, ein kleiner Couchtisch und der Fernseher. Gary betrachtet ihn noch einmal und fragt sich, wie der Sprung in die Scheibe gekommen sein könnte und warum die Fliegen so gierig darauf herumkrabbeln. Er geht näher heran, hört Glassplitter unter seinen Schuhen knirschen und bückt sich.
Von Nahem erkennt er die Ursache. Das gesprungene Glas ist mit dunklem, verkrustetem Blut bedeckt. Blut ist von der Mattscheibe auf den Fußboden gelaufen, und nur zufällig ist Gary nicht in die klebrige Lache getreten, die sich auf den Holzdielen ausgebreitet hat.
Cheryl kommt zu ihm. »Was ist das? Blut?«
Er denkt an das Fahrrad. Die Gummistiefel. Die Stille.
»Wir müssen das ganze Haus überprüfen«, sagt er. Sie sieht ihn beunruhigt an und nickt.
Die Treppe ist steil, sie knarrt und weist weitere Blutspuren auf. Oben führt ein enger Flur zu zwei Schlafzimmern und einem winzigen Bad. Hier ist die Hitze noch drückender, der Gestank noch bestialischer. Gary bedeutet Cheryl, im Bad nachzusehen. Kurz glaubt er, sie wolle widersprechen. Der Geruch kommt offenbar aus einem der Schlafzimmer, doch ausnahmsweise gehorcht sie ihrem ranghöheren Kollegen und geht zaghaft die paar Schritte durch den Flur.
Er steht mit einem metallischen Geschmack im Mund vor der ersten Schlafzimmertür und drückt sie langsam auf.
Das Zimmer gehört einer Frau. Sauber, ordentlich und leer. Kleiderschrank in einer Ecke, Kommode am Fenster, großes Bett mit makelloser cremefarbener Decke. Auf dem Nachttisch eine Lampe und ein Foto in einfachem Holzrahmen. Er nimmt es hoch. Ein Junge, zehn oder elf, klein und drahtig, mit breitem Lächeln und verstrubbelten blonden Haaren. O Gott, betet er unwillkürlich. Bitte, Gott, nein.
Noch beklommener als zuvor geht er in den Flur zurück, wo Cheryl bleich und nervös auf ihn wartet.
»Das Bad ist leer«, sagt sie, und er weiß, sie denkt dasselbe wie er. Nur noch ein Zimmer übrig. Nur noch eine Tür, hinter der sich der Hauptgewinn verbirgt. Unwillig fuchtelt er eine Fliege weg und würde gern einmal tief Luft holen, aber der Gestank schnürt ihm die Kehle zu. Stattdessen packt er die Klinke und stößt die Tür auf.
Cheryl ist zu abgebrüht und erbricht sich nie, gibt jetzt aber ein würgendes Geräusch von sich. Auch ihm dreht sich der Magen um, doch er schafft es, den Brechreiz zu unterdrücken.
Vorhin hatte er gedacht, das hier sei schlimm. Falsch. Es ist ein verdammter Albtraum.
Der Junge liegt auf dem Bett, bekleidet mit einem zu großen T-Shirt, schlabbrigen Shorts und weißen Sportsocken. Das Gummigewebe der Socken gräbt sich in das geschwollene Fleisch seiner Unterschenkel.
Strahlend weiße Socken, bemerkt Gary. Blendend weiß. Blütenweiß. Wie aus einer Waschmittelreklame. Oder vielleicht kommen sie ihm nur so vor, weil alles andere rot ist. Dunkelrot. Rote Streifen auf dem übergroßen T-Shirt, rote Flecken auf den Kissen und Laken. Und wo das Gesicht des Jungen sein sollte, ist nur ein konturloser roter Brei, in dem es von Käfern und Fliegen wimmelt, die sich in das zerstörte Fleisch gewühlt haben.
Garys Gedanken kehren zu der gesprungenen Mattscheibe und der Blutlache auf dem Fußboden zurück, und plötzlich sieht er es vor sich. Wie der Kopf des Jungen immer wieder an den Fernseher geschlagen und dann so lange auf den Boden gehämmert wird, bis von dem Gesicht nichts mehr übrig ist.
Und darum ging es vermutlich, denkt er, als er den Blick auf das andere Rot richtet. Das grellste Rot. Das unübersehbarste Rot. Große Buchstaben an der Wand über der Leiche des Jungen:
NICHT MEIN SOHN
1
Geh niemals zurück. Den Rat bekommt man oft zu hören. Alles hat sich verändert. Nichts ist mehr so, wie du es in Erinnerung hast. Lass die Vergangenheit in der Vergangenheit ruhen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Die Vergangenheit kommt immer wieder hoch. Wie ein schlechtes Curry.
Ich will nicht zurückgehen. Nein. Da steht noch manches höher auf meiner Wunschliste: nicht bei lebendigem Leibe von Ratten gefressen werden, Line-Dance und solche Sachen. Anders gesagt, ich will unter keinen Umständen jemals in das Dreckskaff zurückkehren, in dem ich aufgewachsen bin. Aber manchmal bleibt einem nur die Entscheidung für das Falsche.
Und deswegen fahre ich jetzt noch vor sieben Uhr morgens auf einer kurvenreichen Fernstraße durch die Landschaft von North Nottinghamshire. Ich habe diese Straße seit Langem nicht mehr gesehen. So wie ich auch sieben Uhr morgens seit Langem nicht mehr gesehen habe.
Auf der Straße ist nichts los. Nur ein paar Autos überholen mich, eins hupt (womit der Fahrer zweifellos andeutet, ich behindere seine Lewis-Hamiltonsche Raserei zu irgendeinem beschissenen Job, den er unbedingt ein paar Minuten früher antreten will). Und es stimmt, ich fahre langsam. Nase an der Windschutzscheibe, die Hände ums Steuer gekrampft, dass die Knöchel weiß hervortreten: ganz langsam.
Ich fahre nicht gern. Wann immer möglich, lasse ich es. Ich gehe zu Fuß oder nehme den Bus, für weitere Strecken den Zug. Dummerweise hat Arnhill keine nennenswerten Busverbindungen, und der nächste Bahnhof ist zwölf Meilen entfernt. Da bleibt mir nur das Auto. Wie gesagt, manchmal hat man keine Wahl.
Ich blinke, biege ab und setze die Fahrt auf Landstraßen fort, die noch schmaler und tückischer sind. Auf beiden Seiten erstrecken sich Äcker in nassem Braun oder schmutzigem Grün, Schweine beschnüffeln die Luft in rostigen Wellblechhütten zwischen windschiefen Birkenwäldchen. Sherwood Forest, oder was davon übrig ist. Robin Hood und Little John sieht man heutzutage nur noch auf schlecht gemalten Schildern heruntergekommener Kneipen. Die Männer in diesen Kneipen sind meist ziemlich angesäuselt, und das Einzige, was man einbüßt, sind die Zähne, wenn man diese Männer schief ansieht.
Der Norden ist gar nicht so rau, wie man immer sagt. Und Nottinghamshire liegt ja auch nicht hoch im Norden – höchstens für Leute, die nie über den Höllenring der M25 um London hinausgekommen sind. Aber farblos ist es dort, flach, längst nicht so lebendig, wie man von ländlichen Gegenden erwartet. Als hätten die einst hier so zahlreichen Bergwerke alles Leben von innen heraus weggeschaufelt.
Nachdem ich lange Zeit keinerlei Anzeichen von Zivilisation bemerkt habe, nicht mal einen McDonald’s, taucht endlich ein verwittertes Schild vor mir auf: WILLKOMMENINARNHILL.
Darunter hat irgendein schlagfertiges kleines Arschloch hinzugefügt: UNDGLEICHEINSINDIEFRESSE.
Arnhill hat nichts Anheimelndes. Das Dorf wirkt abweisend, verbiestert und griesgrämig. Man bleibt unter sich und beäugt Besucher mit Misstrauen. Die Leute sind stoisch, unerschütterlich und müde, alles auf einmal. So ein Dorf sieht einen finster an, wenn man kommt, und spuckt auf den Boden, wenn man geht.
Von ein paar Bauernhöfen und älteren Steinhäusern in der Peripherie einmal abgesehen, hat Arnhill nichts Malerisches oder Idyllisches. Das Bergwerk wurde vor fast dreißig Jahren geschlossen, doch seine Altlasten durchdringen immer noch alles wie das Erz die Gesteinsschichten. Hier gibt es keine reetgedeckten Dächer oder hängenden Blumenampeln. Das Einzige, was hier vor den Häusern hängt, ist Wäsche an der Leine und die eine oder andere Flagge mit dem Georgskreuz.
Eintönige verrußte Reihenhauszeilen säumen die Hauptstraße, dazwischen ein schmuddliger Pub: The Running Fox. Früher gab es noch zwei – The Arnhill Arms und The Bull −, aber die sind schon lange zu. Damals, zu meiner Zeit, drückte der Wirt des Fox – Gypsy – immer ein Auge zu, wenn welche von uns älteren Jungs dort was tranken. Ich weiß noch, wie ich da in dem verdreckten Klo einmal drei Pints Snakebite und praktisch meine kompletten Eingeweide ausgekotzt habe, und als ich rauskam, wartete er schon mit Mopp und Eimer.
Der Imbiss nebenan, The Wandering Dragon, ist ähnlich unberührt von Fortschritt, frischer Farbe oder – möchte ich wetten – einer neuen Speisekarte. Eine Lücke in meiner lückenlosen Erinnerung: der kleine Eckladen, wo wir immer Kaugummi, fliegende Untertassen und Schokoriegel kauften, ist nicht mehr da. Stattdessen jetzt ein Sainsbury’s Local. Offenbar ist nicht einmal Arnhill vollständig immun gegen den Lauf des Fortschritts.
Ansonsten sehe ich meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Nichts hat sich verändert. Das Dorf ist leider genau so, wie ich es in Erinnerung habe.
Ich fahre weiter die Hauptstraße entlang, vorbei an dem schäbigen Kinderspielplatz und dem kleinen Dorfanger. In der Mitte die Statue eines Bergarbeiters. Denkmal für die Kumpel, die bei dem Grubenunglück von 1949 ums Leben kamen.
Jenseits der Highlights des Dorfs sehe ich auf einem kleinen Hügel das Schultor. Arnhill Academy heißt die Schule jetzt. Die Gebäude sind frisch verputzt, der alte Englisch-Block, von dessen Dach einmal ein Kind gestürzt ist, wurde abgerissen und durch eine Sitzecke im Freien ersetzt. Man kann einen Scheißhaufen in Glanzpapier wickeln, aber es bleibt trotzdem ein Scheißhaufen. Ich muss es wissen.
Ich fahre auf den Lehrerparkplatz hinter dem Gebäude und klettere aus meinem altersschwachen Golf. Zwei andere Autos stehen dort – ein roter Corsa und ein alter Saab. Schulen sind auch in den Sommerferien selten ganz leer. Lehrer müssen Stundenpläne und Unterrichtsmaterial erstellen oder Krisengespräche führen. Oder Vorstellungsgespräche.
Ich schließe den Wagen ab und gehe möglichst ohne zu hinken um das Gebäude herum zum Haupteingang. Heute tut das Bein weh. Was vom Fahren kommt, aber auch von dem Stress, hier zu sein. Manche Leute bekommen Migräne; ich bekomme das Pendant dazu in meinem schlimmen Bein. Eigentlich sollte ich meinen Stock benutzen. Aber ich hasse das. Damit komme ich mir wie ein Behinderter vor. Die Leute sehen mich mitleidig an. Ich hasse es, bemitleidet zu werden. Sein Mitleid sollte man sich aufsparen für die, die es verdienen.
Als ich die Treppe zum Eingang hinaufgehe, zucke ich vor Schmerz zusammen. Auf einer glänzenden Tafel über dem Portal steht »Gut, besser, am besten. Gib niemals auf. Bis dein Gut besser und dein Besser das Beste sind.«
Sehr erbaulich. Wozu mir natürlich Homer Simpsons Gegenentwurf einfällt: »Kinder, ihr habt euer Bestes versucht und seid kläglich gescheitert. Lasst es euch eine Lehre sein und versucht es erst gar nicht.«
Ich drücke auf die Gegensprechanlage neben der Tür. Als es knistert, beuge ich mich vor und sage: »Ich möchte zu Mr Price?« Noch ein Knistern, eine schrille Rückkopplung, dann ein Summen. Ich reibe mir das Ohr, stoße die Tür auf und gehe hinein.
Als Erstes bemerke ich den Geruch. Jede Schule hat ihren eigenen. In den modernen Schulgebäuden riecht es nach Desinfektionsmitteln und Bildschirmreiniger. In Privatschulen nach Kalk, Holzfußböden und Geld. Arnhill Academy riecht nach vergammelten Hamburgern, Klosteinen und Hormonen.
»Hallo?«
Eine streng dreinblickende Frau mit kurzgeschorenem Haar und Brille hebt hinter dem Glaskasten des Empfangs den Kopf.
Miss Grayson. Wohl kaum. Ist die nicht längst im Ruhestand? Dann sehe ich es. Das fette braune Muttermal an ihrem Kinn, mit der steifen schwarzen Haarborste darin wie eh und je. Gott. Sie ist es wirklich. Das heißt, vor all diesen Jahren, als ich sie für eine uralte Schachtel hielt, war sie erst – was? – vierzig? So alt wie ich jetzt.
»Ich möchte zu Mr Price«, wiederhole ich. »Ich bin’s, Joe … Mr Thorne.«
Ob sie mich erkennt? Offenbar nicht. Es ist ja auch lange her, und sie hat unzählige Schüler durch diese Türen kommen sehen. Ich bin nicht mehr der dünne kleine Junge in zu großer Schuluniform, der hastig durch die Vorhalle huschte, voller Angst, von ihr beim Namen gerufen und ausgeschimpft zu werden, weil mir das Hemd aus der Hose hing oder ich nicht den Vorschriften entsprechende Turnschuhe anhatte.
Miss Grayson war nicht nur schlecht. Oft hatte ich sie mit einigen der schwächeren, schüchternen Schüler in ihrem Büro gesehen. Sie klebte Pflaster auf zerschrammte Knie, wenn die Schulschwester nicht da war, setzte die Kinder hin und gab ihnen Fruchtsaft zu trinken, während sie auf einen Lehrer warteten, oder ließ sich von ihnen beim Abheften helfen, alles Mögliche, um ihnen ein wenig Entlastung von den Qualen des Schulhofs zu verschaffen. Eine kleine Zuflucht.
Trotzdem hatte ich eine Heidenangst vor ihr.
Immer noch, denke ich. Sie stöhnt – macht mir unmissverständlich klar, wie sehr ich ihre Zeit, meine Zeit und die Zeit der Schule verschwende – und greift nach dem Telefon. Ich frage mich, warum sie heute überhaupt hier ist. Sie gehört nicht zum Lehrkörper. Andererseits überrascht es mich nicht. Als Kind konnte ich mir Miss Grayson außerhalb der Schule gar nicht vorstellen. Sie war Teil des Gebäudes. Allgegenwärtig.
»Mr Price?«, bellt sie. »Ich habe hier einen Mr Thorne für Sie. Okay. Ja. Gut.« Sie legt den Hörer auf. »Er kommt gleich.«
»Schön. Danke.«
Sie wendet sich wieder ihrem Computer zu, ich bin entlassen. Kein Tee oder Kaffee.
Und gerade jetzt schreien alle meine Neuronen nach einer Koffeinspritze. Ich hocke mich auf einen Plastikstuhl und versuche nicht wie ein sündiger Schüler auszusehen, der auf den Direktor wartet. Mein Knie pocht. Ich lege die gefalteten Hände darauf und massiere es verstohlen mit den Fingern.
Durchs Fenster sehe ich ein paar Kinder, ohne Schulkleidung, am Tor herumlungern. Sie trinken Red Bull und sehen sich kichernd was auf ihren Smartphones an. Ein Déjà-vu-Erlebnis überschwemmt mich. Ich bin wieder fünfzehn, hänge an demselben Tor herum, trinke Panda Cola und … worüber haben wir uns kichernd gebeugt, als es noch keine Smartphones gab? Smash Hits und geklaute Pornohefte, nehme ich an.
Ich senke den Blick auf meine Stiefel. Das Leder ist ein bisschen abgestoßen. Ich hätte sie putzen sollen. Ich brauche dringend einen Kaffee. Um ein Haar knicke ich ein und bettle um eine verdammte Tasse, als ich Schuhe auf dem gebohnerten Linoleum quietschen höre und die Doppeltür zum Hauptkorridor aufschwingt.
»Joseph Thorne?«
Ich stehe auf. Harry Price entspricht vollkommen meinen Erwartungen – oder doch nicht ganz. Hager und zermürbt, Mitte fünfzig, ausgebeulter Anzug, Slipper. Das Haar schütter und grau, nach hinten gekämmt; ein Gesicht, als sei er ständig kurz davor, furchtbare Neuigkeiten zu erfahren. Eine Wolke müder Resignation umschwebt ihn wie schlechtes Aftershave.
Er lächelt. Ich sehe schiefe, nikotinfleckige Zähne. Was mich daran erinnert, dass ich seit der Abfahrt in Manchester keine Zigarette mehr geraucht habe. Dies und der Schmacht auf Kaffee macht mich so fertig, dass ich nur noch die Zähne zusammenbeißen kann.
Dann strecke ich die Hand aus und schaffe meinerseits ein hoffentlich freundliches Lächeln. »Schön, Sie kennenzulernen.«
Er mustert mich. Ich bin größer als er, mindestens eine Handbreit. Glattrasiert. Guter Anzug, ziemlich teuer. Dunkles Haar, allerdings jetzt mit manchen grauen Stellen. Dunkle Augen mit vielen roten Äderchen. Man sagt, ich hätte ein ehrliches Gesicht. Was nur beweist, wie wenig die Leute wissen.
Er nimmt meine Hand und schüttelt sie kräftig. »Mein Büro ist gleich nebenan.«
Ich rücke meine Schultertasche zurecht, versuche möglichst wenig zu hinken und folge Harry in sein Büro. Showtime.
»Das Empfehlungsschreiben Ihres vorigen Direktors klingt sehr vielversprechend.«
Selbstverständlich. Ich habe es selbst geschrieben.
»Danke.«
»Das alles hier macht einen sehr guten Eindruck.«
Lügen ist eins meiner Spezialgebiete.
»Aber …«
Jetzt kommt’s.
»Seit Ihrer letzten Stellung hatten Sie eine recht lange Pause – über zwölf Monate.«
Ich greife nach dem schwachen Milchkaffee, den Miss Grayson vor mir auf den Schreibtisch knallt, nehme einen Schluck und versuche nicht das Gesicht zu verziehen.
»Ja, richtig, das war Absicht. Ich wollte ein Sabbatjahr einlegen. Nach fünfzehn Jahren Lehrertätigkeit musste ich einfach mal meine Batterien aufladen. Über meine Zukunft nachdenken. Mich entscheiden, wie es weitergehen sollte.«
»Und darf ich fragen, was Sie in Ihrem Sabbatjahr gemacht haben? Ihr Lebenslauf ist da ein wenig vage.«
»Nachhilfe. Gemeindearbeit. Dann eine Zeitlang als Lehrer im Ausland.«
»Ach? Wo denn?«
»Botswana.«
Botswana? Wo zum Teufel kam das jetzt her? Keine Ahnung, wo das überhaupt genau liegt.
»Das ist sehr lobenswert.«
Und erfinderisch.
»Ganz uneigennützig war das nicht. Das Wetter war besser.«
Wir lachen beide.
»Und jetzt wollen Sie wieder Vollzeit als Lehrer arbeiten?«
»Ich bin bereit für die nächste Etappe meiner Laufbahn, ja.«
»Dann wäre meine nächste Frage: Warum möchten Sie hier an der Arnhill Academy arbeiten? Aus Ihrem Lebenslauf würde ich schließen, dass Sie sich die Schulen praktisch aussuchen können.«
Aus meinem Lebenslauf könnte man schließen, ich hätte längst den Nobelpreis verdient.
»Na ja«, sage ich, »ich komme von hier. Ich bin in Arnhill aufgewachsen. Ich würde der Gemeinde gern etwas zurückgeben.«
Er schiebt unbehaglich Papiere auf seinem Schreibtisch herum. »Ihnen sind die Umstände bekannt, warum die Stelle neu zu besetzen ist?«
»Ich lese Zeitung.«
»Und was sagen Sie dazu?«
»Tragisch. Entsetzlich. Aber eine einzige Tragödie sollte sich nicht auf eine ganze Schule auswirken.«
»Freut mich, das zu hören.«
Freut mich, den Satz geübt zu haben.
»Obwohl«, füge ich hinzu, »mir natürlich klar ist, dass Sie alle noch ziemlich aufgewühlt sein müssen.«
»Mrs Morton war eine sehr beliebte Lehrerin.«
»Ganz bestimmt.«
»Und Ben, nun ja, war ein sehr vielsprechender Schüler.«
Mir schnürt sich die Kehle zu, aber nur ein bisschen. Ich habe gelernt, meine Gefühle zu unterdrücken. Doch kurz setzt es mir zu. Ein Leben voller Verheißungen. Dabei ist das Leben nie etwas anderes. Eine Verheißung. Keine Garantie. Wir bilden uns gern ein, wir hätten einen festen Platz in der Zukunft, haben aber nur eine Reservierung. Das Leben kann jeden Augenblick storniert werden, ohne Vorwarnung, ohne Rückerstattung, ganz gleich, wie weit man auf der Reise gekommen ist. Selbst wenn man kaum Zeit hatte, sich die Umgebung anzusehen.
Wie Ben. Wie meine Schwester.
Ich merke, Harry spricht immer noch.
»Das ist natürlich eine heikle Situation. Man hat Fragen gestellt. Wie konnte die Schule nicht mitbekommen, dass eine ihrer Lehrerinnen psychisch instabil war? Waren womöglich Schüler in Gefahr?«
»Ich verstehe.«
Ich verstehe, dass Harry sich mehr um seine Stellung und die Schule sorgt als um den armen Benjamin Morton, dem von dem einzigen Menschen auf der Welt, der ihn hätte beschützen müssen, das Gesicht zertrümmert worden war.
»Ich will damit sagen, ich muss bei der Besetzung dieser Stelle Vorsicht walten lassen. Eltern müssen Vertrauen zu uns haben können.«
»Absolut. Und ich verstehe durchaus, wenn Sie einen besseren Kandidaten haben …«
»Das habe ich nicht gesagt.«
Hat er nicht. Das weiß ich selber. Und ich bin ein guter Lehrer (meistens). Tatsache ist, Arnhill Academy ist ein Drecksloch. Weit unter Durchschnitt. Mit schlechtem Ruf. Er weiß es. Ich weiß es. Für diese Schule einen anständigen Lehrer zu bekommen wird schwerer sein, als einen Bären zu finden, der nicht in den Wald scheißt, erst recht unter den gegenwärtigen »Umständen«.
Ich reite weiter darauf herum. »Darf ich ganz aufrichtig sein?«
Es macht sich immer gut, das zu sagen, wenn man nicht die Absicht hat, aufrichtig zu sein.
»Ich weiß, Arnhill Academy hat Probleme. Gerade deswegen möchte ich hier arbeiten. Ich möchte nichts geschenkt haben. Ich suche eine Herausforderung. Ich kenne diese Kinder, weil ich selbst mal eins von ihnen war. Ich kenne die Gemeinde. Ich weiß genau, mit wem und was ich es zu tun habe. Das schreckt mich nicht. Tatsächlich dürften Sie bald feststellen, wie wenig mich schreckt.«
Ich spüre, ich habe ihn überzeugt. In Bewerbungsgesprächen bin ich gut. Ich weiß, was die Leute hören wollen. Und vor allem, ich erkenne, wenn sie verzweifelt sind.
Harry lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. »Nun, ich denke, ich habe keine weiteren Fragen mehr.«
»Gut. Also, hat mich gefreut, Sie …«
»Ach, übrigens, noch etwas.«
Oh, Scheiße …
Er lächelt. »Wann können Sie anfangen?«
2
Drei Wochen später
Im Haus ist es kalt. Kalt wie in einem Gebäude, das seit einiger Zeit verschlossen und unbewohnt ist. Die Kälte zieht einem in die Knochen und bleibt dort, auch wenn man die Heizung voll aufgedreht hat.
Und es riecht. Nach Leerstand und billiger Farbe und Nässe. Die Fotos auf der Website werden dem nicht gerecht. Sie lassen auf eine Art heruntergekommene Eleganz schließen. Malerische Vernachlässigung. Die Wirklichkeit ist anders: bitter und baufällig. Nicht dass ich es mir leisten kann, wählerisch zu sein. Irgendwo muss ich schließlich wohnen, und selbst in einem Kaff wie Arnhill ist dieses Haus das einzige, das ich bezahlen kann.
Natürlich ist das nicht der einzige Grund, warum ich mich dafür entschieden habe.
»Alles in Ordnung?«
Ich drehe mich zu dem glatthaarigen Mann im Türrahmen um. Mike Belling von Belling & Co. Vermietungsagentur. Nicht von hier. Zu gut gekleidet, zu wortgewandt. Ich merke ihm an, er will nur von hier weg, zurück in sein Londoner Büro, und sich die Kuhscheiße von seinen glänzend schwarzen Schuhen abwischen.
»Nicht ganz, was ich erwartet habe.«
Sein Lächeln schrumpft. »Nun, laut unserer Objektbeschreibung handelt es sich um ein traditionelles Wohnhaus ohne viel modernen Komfort, das seit einiger Zeit leersteht …«
»Gewiss«, sage ich unschlüssig. »Sie sagten, der Boiler ist in der Küche? Vielleicht sollte ich erst einmal einheizen. Danke, dass Sie mich reingelassen haben.«
Er bleibt verlegen stehen. »Da wäre noch etwas, Mr Thorne …«
»Ja?«
»Der Scheck für die Kaution?«
»Was ist damit?«
»Das ist sicher nur ein Versehen, aber … wir haben ihn noch nicht erhalten.«
»Ach?« Ich schüttele den Kopf. »Die Post wird wirklich immer schlimmer.«
»Na ja, kein Problem. Wenn Sie vielleicht …«
»Selbstverständlich.«
Ich ziehe das Scheckheft aus meiner Jackentasche. Mike Belling reicht mir einen Stift. Ich lehne mich an die Armlehne des fadenscheinigen Sofas und stelle einen Scheck aus. Ich reiße ihn raus und gebe ihn ihm.
Er lächelt. Er wirft einen Blick auf den Scheck, und das Lächeln verschwindet. »Fünfhundert Pfund? Kaution und erste Monatsmiete machen zusammen tausend.«
»Richtig. Aber jetzt habe ich das Haus mit eigenen Augen gesehen.« Ich blicke mich um und verziehe das Gesicht. »Offen gesagt, das ist eine Bruchbude. Kalt und feucht, und es riecht. Sie könnten schon froh sein, wenn sich hier Hausbesetzer einnisten würden. Und Sie waren nicht einmal so freundlich, vor mir herzukommen und die Heizung anzumachen.«
»Ich kann das leider nicht akzeptieren.«
»Dann suchen Sie sich einen anderen Mieter.«
Jetzt muss er Farbe bekennen. Ich sehe ihn zögern. Niemals Schwäche zeigen.
»Oder finden Sie vielleicht keinen? Vielleicht will niemand dieses Haus mieten, nach dem, was sich hier abgespielt hat? Sie wissen schon, diese Lappalie von wegen Mord und Selbstmord, von der Sie mir nichts erzählt haben.«
Seine Miene erstarrt, als habe ihm jemand ein heißes Schüreisen hinten reingerammt. Er schluckt. »Gesetzlich sind wir nicht verpflichtet, Mieter darüber zu informieren, was …«
»Nein. Aber moralisch? Das wär doch ganz nett?« Ich setze ein gewinnendes Lächeln auf. »In Anbetracht dessen halte ich einen erheblichen Nachlass auf die Kaution für das Mindeste, was Sie mir anbieten können.«
Seine Kiefer malmen. Neben seinem rechten Auge zuckt es. Er würde gern grob werden, mich vielleicht sogar schlagen. Aber das kann er nicht, denn dann würde er seinen behaglichen Job verlieren, zwanzig Riesen im Jahr plus Provision, und wovon soll er dann seine schicken Anzüge und glänzend schwarzen Schuhe bezahlen?
Er faltet den Scheck und schiebt ihn in seine Mappe. »Alles klar. Kein Problem.«
Ausgepackt habe ich schnell. Ich bin keiner von denen, die sich nie von ihren Sachen trennen können. Was die Leute mit Zierrat haben, ist mir ein Rätsel, und Fotos sind gut und schön, wenn man Familie und Kinder hat, aber ich habe keine. Meine Kleidung trage ich, bis sie abgetragen ist, und ersetze sie durch genau die gleiche.
Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Zwei Dinge habe ich mir zum Schluss aufgehoben und nehme sie als Letzte aus meinem kleinen Koffer. Das eine ist ein verschlissenes Päckchen Spielkarten. Ich stecke es in die Tasche. Manche Kartenspieler haben Glücksbringer bei sich. Ich habe nie an Glück oder Pech geglaubt, bis ich zu verlieren begann. Dann schob ich die Schuld auf mein Pech, auf die Schuhe, die ich gerade anhatte, auf die beschissene Konstellation der Sterne. Auf alles, nur nicht auf mich selbst. Die Karten waren mein umgekehrter Talisman – eine ständige Mahnung, wie sehr ich alles vermasselt hatte.
Das zweite ist sperriger und in Zeitungspapier gewickelt. Ich hebe sie aus dem Koffer und lege sie aufs Bett, so sachte, als wäre sie ein lebendiges Baby, und wickle sie vorsichtig aus.
Pummelige Beinchen ragen aufwärts, winzige Hände sind zu Fäusten geballt, glänzend blonde Haare enden in zerdrückten Locken. Leere blaue Augen starren mich an. Oder zumindest eins davon. Das andere klappert lose in der Höhle, blickt schräg zur Seite, als hätte es etwas Interessanteres erblickt und hielte es nicht für nötig, seinen Gefährten zu informieren.
Ich nehme Annies Puppe und setze sie auf die Kommode, von wo sie mich mit ihrem schiefen Blick Tag und Nacht betrachten kann.
Den Rest des Nachmittags und den Abend werkle ich herum, um mich aufzuwärmen. Das Bein schmerzt, wenn ich zu lange sitze. Die Kälte und Feuchtigkeit im Haus sind nicht gerade hilfreich. Die Heizkörper scheinen nicht in Ordnung zu sein – vermutlich irgendwo Luft in den Leitungen.
Im Wohnzimmer steht ein Holzofen, aber eine gründliche Suche im Haus und in dem kleinen Schuppen draußen fördert kein Stückchen Holz zutage. Immerhin entdecke ich in einem Schrank einen alten Elektroradiator. Ich schalte ihn ein, die Glühstäbe braten sich durch eine dicke Staubschicht, und in der Luft verbreitet sich Brandgeruch. Dennoch sollte das Ding eine gewisse Wärme abgeben, falls es mir nicht vorher einen tödlichen Stromschlag versetzt.
Das Haus scheint mir trotz seines eher schlechten Zustands einmal ein behagliches Heim gewesen zu sein. Bad und Küche sind abgenutzt, aber sauber. Der Garten hinter dem Haus ist weitläufig, fußballfreundlich und von offenem Land umgeben. Ein nettes, gemütliches, sicheres Haus, in dem ein kleiner Junge aufwachsen kann. Nur dass er das nie geschafft hat.
Ich glaube nicht an Gespenster. Meine Oma erklärte mir immer gern: »Es sind nicht die Toten, vor denen du dich fürchten musst, Kleiner. Sondern die Lebenden.« Sie hatte beinahe recht. Ich glaube aber tatsächlich daran, dass man den Widerhall schlimmer Geschehnisse noch lange Zeit spüren kann. Sie prägen sich in die Struktur unserer Wirklichkeit wie Fußabdrücke in Beton. Was sich da eingeprägt hat, ist längst verschwunden, aber die Spur lässt sich nie mehr verwischen.
Vielleicht bin ich deswegen bis jetzt noch nicht in sein Zimmer gegangen. Mit dem Haus könnte ich mich anfreunden, aber es fragt sich, ob das Haus sich mit mir anfreunden will. Wie denn auch? Etwas Schreckliches ist in diesen Mauern geschehen, und Mauern vergessen nicht.
Ich habe nichts zu essen eingekauft, habe aber auch keinen Hunger. Sobald der Uhrzeiger über die Sieben gerutscht ist, öffne ich eine Flasche Bourbon und schenke mir einen Vierfachen ein. Meinen Laptop kann ich nicht benutzen, weil ich noch keine Internetverbindung eingerichtet habe. Fürs Erste kann ich nicht viel mehr tun als herumsitzen, mich an die neue Umgebung gewöhnen und möglichst wenig an den Schmerz in meinem Bein und das vertraute, schwache Grummeln in meinen Eingeweiden denken. Ich nehme das Päckchen Spielkarten und lege es auf den Couchtisch, ohne es zu öffnen. Dafür sind die Karten nicht da. Stattdessen höre ich Musik auf meinem Handy und lese einen hochgelobten Thriller, dessen Ende ich mir schon denken kann. Dann stehe ich in der Hintertür, rauche eine Zigarette und starre in den zugewucherten Garten.
Der Himmel ist dunkler als ein Grab in der Hölle, kein einziger Stern durchbohrt das Schwarz. Ich hatte vergessen, wie finster es auf dem Lande ist. Zu lange in der Stadt gelebt. In Städten wird es nie richtig dunkel, und auch nicht so still. Ich höre nur meinen Atem und das Knistern des Zigarettenfilters.
Wieder frage ich mich, warum ich eigentlich zurückgekommen bin. Ja, Arnhill ist abgelegen, ein halb vergessener Punkt auf der Landkarte. Aber das Ausland wäre sicherer gewesen. Ein paar tausend Meilen zwischen mir, meinen Schulden und Leuten, die einem eine Pechsträhne nicht nachsehen. Nicht, wenn man nicht zahlen kann.
Ich hätte meinen Namen ändern können, vielleicht einen Kellnerjob irgendwo in einer Strandbar bekommen. Bei Sonnenuntergang Margaritas schlürfen. Stattdessen habe ich mich für das hier entschieden. Falls nicht das hier sich für mich entschieden hat.
Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube aber, dass gewisse Dinge fest in unseren Genen verdrahtet sind. Wir sind programmiert, auf bestimmte Weise zu agieren und zu reagieren, und das formt unser Leben. Ändern können wir daran so wenig wie an unserer Augenfarbe oder an den Sommersprossen, die wir in der Sonne kriegen.
Oder das alles ist nur eine Ausrede, um uns vor der Verantwortung zu drücken. Tatsache ist, eines Tages wäre ich sowieso zurückgekommen. Die E-Mail hat mir die Entscheidung nur leichter gemacht.
Sie landete vor knapp zwei Monaten in meinem Posteingang. Eigentlich erstaunlich, dass sie nicht gleich in den Junkordner verschoben wurde.
Absender: [email protected]
Betreff: Annie
Fast hätte ich sie sofort gelöscht. Der Absender war mir unbekannt. Wahrscheinlich ein Troll, irgendein makabrer Scherz. An manche Dinge sollte man nicht mehr rühren. Es kann nichts Gutes daraus werden, sich noch einmal damit zu befassen. Das einzig Vernünftige war: die Nachricht löschen, den Papierkorb leeren und die Sache vergessen.
Nach dieser Feststellung klickte ich sie auf:
Ich weiß, was mit Ihrer Schwester geschehen ist.
Es geschieht wieder.
3
Eltern sollten niemals eins ihrer Kinder bevorzugen. Auch so eine dumme Redensart. Natürlich tun Eltern das. Es liegt in der menschlichen Natur. Und geht auf Zeiten zurück, in denen nicht unsere gesamte Brut überlebte. Man bevorzugte das stärkste Küken. Sinnlos, sich an eins zu hängen, das es nicht schaffen würde. Und seien wir ehrlich, manche Kinder sind einfach liebenswerter.
Annie war der Liebling unserer Eltern. Was man verstehen konnte. Sie kam zur Welt, als ich sieben war. Ich war schon lange kein süßes Kleinkind mehr. Sondern ein fertiger dünner Junge mit permanent zerschrammten Knien und schmutzigen Hosen. Niedlich war nichts mehr an mir. Ich hatte auch keine Lust, mit meinem Dad im Park Fußball zu spielen oder ein Spiel von Nottingham Forest anzusehen, was vielleicht geholfen hätte. Ich blieb lieber zu Hause und las Comics oder spielte am Computer.
Mein Dad war enttäuscht, meine Mum verärgert. »Geh mal an die frische Luft«, schimpfte sie. Schon mit sieben hielt ich frische Luft für überschätzt, und wenn ich einmal widerstrebend gehorchte, endete es jedes Mal damit, dass ich über oder in oder auf etwas stolperte und völlig verdreckt nach Hause kam, wo die Schimpferei dann weiterging.
Kein Wunder, dass meine Eltern sich nach einem anderen Kind sehnten: Sie wollten ein niedliches kleines Mädchen, das sie knuddeln und rosa anziehen konnten, ohne dass es sich angewidert aus ihren Armen wand.
Damals war mir nicht klar, dass meine Eltern schon länger ein zweites Kind zu bekommen versuchten. Ein Brüderchen oder Schwesterchen für mich. Wie ein besonderes Geschenk, ein Gefallen, den sie mir tun wollten. Ich war mir nicht sicher, ob ich einen Bruder oder eine Schwester brauchte. Meine Eltern hatten doch mich. Noch ein Kind schien mir überflüssig wie ein Kropf.
Auch nach Annies Geburt blieb ich skeptisch. Ein komischer, schrumpliger rosa Klops, ihr Gesicht zerknautscht und wie außerirdisch. Und sie tat nichts anderes als schlafen, kacken oder schreien. Ihr schrilles Gebrüll ließ mich nachts nicht schlafen, stundenlang starrte ich an die Decke und wünschte, meine Eltern hätten mir einen Hund gekauft, oder von mir aus einen Goldfisch.
In den ersten Monaten verharrte ich in Apathie, empfand weder Liebe noch Abneigung für mein kleines Schwesterchen. Wenn sie mich angluckste oder meinen Finger drückte, bis es sich anfühlte, als würde er blau anlaufen, blieb ich ungerührt – selbst wenn meine Mum vor Entzücken gurrte und meinen Dad anschrie: »Hol den verfluchten Fotoapparat, Sean«.
Wenn Annie mir nachkrabbelte oder meine Sachen anfasste, ging ich schneller oder nahm ihr die Sachen weg. Ich war nicht unfreundlich, nur uninteressiert. Ich hatte nicht um sie gebeten und sah daher keinen Grund, mich um sie zu kümmern.
Das ging so, bis sie ungefähr zwölf Monate alt war. Kurz vor ihrem ersten Geburtstag lernte sie laufen und Laute von sich zu geben, die sich fast wie Wörter anhörten. Plötzlich war sie eher ein kleiner Mensch als ein Baby. Interessanter. Unterhaltsam, könnte man sagen, mit ihrem unverständlichen Geplapper und dem wackligen Altmännergang.
Ich begann mit ihr zu spielen und zu reden. Als sie anfing, mich nachzumachen, bekam ich ein seltsames Gefühl in der Brust. Wenn sie mich ansah und »Joe-ee, Joe-ee« lallte, wurde mir ganz warm im Bauch.
Bald folgte sie mir überallhin und machte alles nach, was ich tat; lachte über meine Grimassen, hörte aufmerksam zu, wenn ich ihr Sachen erzählte, die sie unmöglich verstehen konnte. Wenn sie weinte, brauchte ich sie nur einmal kurz zu streicheln, und sie hörte auf; so sehr war sie bestrebt, es ihrem großen Bruder recht zu machen, dass all ihr sonstiger Kummer auf der Stelle vergessen war.
So hatte mich noch niemand geliebt. Nicht einmal Mum und Dad. Natürlich liebten sie mich. Aber nie sahen sie mich mit jener grenzenlosen Bewunderung an, wie mein Schwesterchen es tat. Niemand tat das. Ich war es gewohnt, mitleidig oder verächtlich angesehen zu werden.
Als kleiner Junge hatte ich kaum Freunde. Ich war nicht direkt schüchtern. Einer meiner Grundschullehrer erzählte meinen Eltern, ich sei »hochnäsig«. Dabei war es wohl nur so, dass ich andere Jungen mit ihren öden Aktivitäten, auf Bäume klettern und sich prügeln, einfach langweilig und stumpfsinnig fand. Im Übrigen war ich völlig zufrieden, mir selbst überlassen zu sein. Bis dann Annie kam.
Für den dritten Geburtstag meiner Schwester sparte ich mein Taschengeld und kaufte ihr eine Puppe. Keine von diesen teuren aus dem Spielzeuggeschäft, die Laute von sich geben und Pipi machen konnten. Mein Dad hätte vielleicht von einer billigen »Raubkopie« gesprochen. Sie war wirklich ein wenig hässlich und unheimlich mit ihrem harten blauäugigen Blick und den komisch gespitzten Lippen. Aber Annie liebte diese Puppe. Sie trug sie überall herum und wiegte sie jeden Abend in den Schlaf. Aus irgendeinem Grund (vermutlich hatte sie mal was falsch verstanden) gab sie ihr den Namen »Abbie-Eyes«.
Als Annie fünf war, war Abbie-Eyes längst von Barbie und Mein kleines Pony verdrängt und lag in einem Regal in Annies Zimmer. Doch immer wenn Mum vorschlug, die Puppe auf dem Flohmarkt zu verkaufen, machte Annie entsetzliches Geschrei, schnappte sie und drückte sie so fest an sich, dass ich mich nur wunderte, warum diese blauen Plastikaugen nicht aus den Höhlen sprangen.
Annie und ich blieben uns auch weiterhin nahe. Wir lasen zusammen, spielten Karten oder Computerspiele an meinem gebraucht gekauften Sega Megadrive. An verregneten Sonntagnachmittagen, wenn Dad im Pub war und Mum am Bügelbrett stand und die warme Luft im Zimmer nach Weichspüler roch, machten wir es uns auf einem Sitzsack gemütlich und schauten zusammen alte Videos – ET, Ghostbusters, Jäger des verlorenen Schatzes; manchmal auch neuere Filme, für die Annie wahrscheinlich noch zu jung war, wie Terminator 2 und Total Recall.
Dad hatte einen Freund, der Raubkopien machte und für 50 Pence verkaufte. Das Bild war ein bisschen unscharf, und manchmal waren die Dialoge schwer zu verstehen, aber wie Dad gern sagte: »In der Not frisst der Teufel Fliegen« oder »Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul«.
Ich wusste, Mum und Dad hatten nicht viel Geld. Dad hatte in der Zeche gearbeitet, aber nach dem Streik nicht mehr, auch wenn unsere Grube danach nicht sofort geschlossen worden war.
Er war einer der Bergarbeiter, die den Streik nicht mitgemacht hatten. Davon sprach er nie, aber ich wusste, die schlechte Stimmung, die Spannungen und Schlägereien – Kollege gegen Kollegen, Nachbar gegen Nachbarn – hatten ihm allzu sehr zugesetzt. Ich war noch ziemlich jung, als das alles passierte, aber ich weiß noch, wie Mum das Wort »Schuft« von unserer Haustür schrubbte. Einmal warf jemand einen Ziegelstein durch unser Fenster, als wir alle vor dem Fernseher saßen. Am nächsten Abend ging Dad mit ein paar Freunden aus. Als er zurückkam, hatte er eine aufgeplatzte Lippe und war auch sonst übel zugerichtet. »Die Sache ist geregelt«, sagte er zu Mum, so grimmig und entschlossen, wie ich ihn noch nie gehört hatte.
Dad veränderte sich nach dem Streik. In meinen Augen war er immer ein Hüne gewesen, groß und stark, mit dichtem, dunklem Lockenkopf. Danach schien er zu schrumpfen, dünner und gebeugter zu werden. Wenn er lächelte, was immer seltener geschah, schnitten die Fältchen um seine Augenwinkel tiefer in die Haut. Die Haare an seinen Schläfen wurden grau.
Schließlich kündigte er und schulte auf Busfahrer um. Ich vermute, der neue Job gefiel ihm nicht. Der Lohn war durchaus anständig, aber nicht so gut wie in der Zeche. Er und Mum stritten sich häufiger, entweder weil sie seiner Meinung nach zu viel Geld ausgab oder weil er einfach nicht wusste, was es kostete, eine wachsende Familie zu ernähren und zu kleiden. Er ging jetzt immer öfter in den Pub. Und immer in denselben, den, in dem die Grubenarbeiter tranken, die zur Arbeit gegangen waren. The Arnhill Arms. Die am Streik teilgenommen hatten, tranken im Bull. The Running Fox war als einziger Pub so etwas wie neutrales Gelände. Dorthin ging keiner der Grubenarbeiter. Aber ich wusste von ein paar älteren Jungen, die es taten, weil sie dort sicher sein konnten, nicht ihrem Dad oder Opa zu begegnen.
Meine Eltern waren keine schlechten Eltern. Sie liebten uns so, wie es ihnen möglich war. Wenn sie stritten oder nicht immer viel Zeit für uns hatten, dann nicht deshalb, weil sie sich nichts aus uns machten, sondern schlicht, weil sie hart arbeiteten, kaum Geld übrig hatten und oft müde waren.
Natürlich hatten wir einen Fernseher, einen Kassettenrekorder und einen Computer, trotzdem unterhielten wir uns die meiste Zeit selbst: Annie und ich spielten auf der Straße Fangen und Fußball, malten mit Kreide auf dem Gehweg oder spielten Karten, um uns an verregneten Nachmittagen die Zeit zu vertreiben. Ich hatte nie etwas dagegen, meine kleine Schwester zu unterhalten. Es machte mir Freude, die Zeit mit ihr zu verbringen.
Bei schönem Wetter (oder wenn es wenigstens nicht in Strömen regnete) scheuchte Mum Annie und mich ohne Weiteres an einem Samstagmorgen aus dem Haus, gab uns ein paar Münzen für Süßigkeiten und erwartete uns erst zum Abendessen zurück. Meistens fanden wir das gut. Wir waren frei. Wir hatten unsere Fantasie. Und wir hatten uns beide.
Mit fünfzehn, sechzehn änderte sich das. Ich fand neue »Freunde«. Stephen Hurst und seine Gang. Raue Burschen, die mit einem tapsigen Außenseiter wie mir eigentlich nichts anfangen konnten.
Vielleicht deutete Hurst meine Außenseiterrolle falsch und hielt mich gerade deswegen für taff. Oder er sah in mir bloß einen, den er leicht manipulieren konnte. Warum auch immer, jedenfalls war ich dumm genug, dankbar zu sein, dass ich in seiner Gang mitmachen durfte. Als Einzelgänger hatte ich mich nie unwohl gefühlt. Aber ein bisschen gesellschaftliche Akzeptanz kann berauschend wirken auf einen Teenager, der vorher nirgendwo willkommen gewesen war.
Wir lungerten herum und machten alles, was Jugendbanden so machen: Schimpfwörter benutzen, rauchen und trinken. Den Spielplatz mit Graffiti verschandeln und die Schaukeln oben über die Stangen wickeln. Die Häuser von Lehrern, die wir nicht mochten, mit Eiern bewerfen, und denen, die wir richtig hassten, die Reifen zerstechen. Und andere Kinder schikanieren. Kinder, die schwächer waren als wir. Kinder, die, auch wenn ich mir das nicht eingestehen wollte, so waren wie ich.
Plötzlich war es nicht mehr cool, sondern absolut peinlich, mich mit meiner acht Jahre alten Schwester abzugeben. Wenn Annie fragte, ob sie mit mir zum Einkaufen kommen dürfe, erfand ich Ausreden oder verdrückte mich, bevor sie mich gehen sah. Wenn ich draußen bei meiner neuen Gang war, wandte ich mich ab, wenn Annie mir winkte.
Auf der Straße ignorierte ich den Schmerz in ihren Augen und ihre enttäuschte Miene. Dafür strengte ich mich zu Hause doppelt an, alles wiedergutzumachen. Sie wusste, dass ich zu viel des Guten tat. Kinder sind nicht dumm. Aber sie ließ mich. Und davon fühlte ich mich noch schlechter.
Das Blöde daran ist (wie ich heute weiß), dass ich immer lieber mit Annie als mit jedem anderen zusammen gewesen bin. Sich als harter Bursche zu gebärden ist nicht dasselbe wie wirklich einer zu sein. Ich wünschte, ich könnte meinem fünfzehnjährigen Ich neben einem Haufen anderer Dinge erklären, dass Mädchen eigentlich nicht auf die Stillen stehen, dass es nicht funktioniert, sein Ohr mit einem Eiswürfel zu betäuben, wenn man sich ein Loch reinstechen lassen will, und dass Thunderbird kein Wein und auch kein passendes Getränk ist, das man vor einem Hochzeitsempfang trinken sollte.
Vor allem wünschte ich, meiner Schwester sagen zu können, dass ich sie geliebt habe. Mehr als alles. Sie war meine beste Freundin, die Person, bei der ich wirklich ich selbst sein konnte, und die Einzige, die mich zum Lachen brachte, bis mir die Tränen kamen.
Aber das geht nicht. Weil meine Schwester verschwand, als sie acht Jahre alt war. Damals dachte ich, es sei das Schlimmste auf der Welt, das jemals passieren könnte.
Und dann kam sie zurück.
4
Meinen Antritt an der Arnhill Academy bereite ich auf die übliche Weise vor: Erst trinke ich am Abend vorher zu viel, dann wache ich zu spät auf, verfluche den Wecker und hinke widerwillig und gereizt über den Flur ins Bad.
Ich drehe die Dusche über der Wanne voll auf – ein halbherziges Getröpfel −, klettere hinein, erwische ein paar Spritzer warmes Wasser und steige wieder raus, trockne mich ab und ziehe saubere Sachen an.
Ich entscheide mich für ein schwarzes Hemd, dunkelblaue Jeans und meine verschlissenen alten Converse: schick und smart für den Start. Ein blöder Spruch, ich weiß. Den habe ich von meinem alten Wohngenossen Brendan. Brendan ist Ire. Das heißt, er hat für jede Situation diverse Sprüche auf Lager. Die meisten sind absolut sinnfrei, aber den hier habe ich immer verstanden. Jeder hat ein Paar smarte Schuhe. Die man anzieht, wenn man sich wohlfühlen möchte. Manchmal braucht man sie mehr als sonst.
Ich ziehe mir einen Kamm durchs Haar und lasse es trocknen, während ich nach unten gehe, um einen schwarzen Kaffee und eine Zigarette zu mir zu nehmen. Letztere qualme ich einen Schritt vor der Hintertür. Draußen ist es kaum kälter als drinnen. Aus der harten grauen Betondecke des Himmels spritzt mir ein fieser Nieselregen ins Gesicht. Falls die Sonne einen Hut aufhat, kann es nur ein Regenhut sein.
Kurz vor Viertel vor neun bin ich am Schultor, ein paar Schüler sind auch schon da: ein Mädchentrio, alle drei sind mit ihren Smartphones zugange und werfen ihr streng geglättetes Haar zurück; mehrere Jungen, die sich scherzend herumschubsen, was jederzeit im Handumdrehen zu einer echten Schlägerei ausarten kann. Zwei Emo-Kids mit finsteren Ponyfransen, unter denen her sie Autoritätspersonen verächtlich anblicken können.
Und dann die Einzelgänger. Die mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern herbeischleichen. Mit dem langsamen, unsicheren Gang der Verdammten: die Mobbing-Opfer.
Ein Mädchen fällt mir auf: klein, roter Krauskopf, unreine Haut und schlecht sitzende Schuluniform. Sie erinnert mich an eine Schülerin aus meiner eigenen Schulzeit: Ruth Moore. Sie roch immer ein bisschen streng, und keiner wollte in der Klasse neben ihr sitzen. Die anderen Kinder verhöhnten sie mit gereimten Sprüchen: »Ruth Moore, wie kann sie nur, frisst für drei, täglich Haferbrei.« »Ruth Moore, Müllabfuhr, leckt kein Eis, nur echten Scheiß.«
Komisch, wie kreativ Kinder sein können, wenn sie grausam sind.
Nicht weit dahinter erblicke ich Opfer Nummer zwei – groß und dünn, mit dunklen Haaren, die ihm fast senkrecht vom Kopf stehen. Er trägt eine Brille und geht leicht nach vorn gebeugt, teils wegen seiner Länge, teils wegen des schweren Rucksacks über seiner Schulter. Ich wette, er ist eine Niete im Fußball und allen anderen Sportarten, aber auf der PlayStation der unbestrittene King. Sein Anblick versetzt mir einen Stich.
»Hey, Marcus, verfickte Pussy!«
Der Ruf kommt aus einer Gruppe von Jungen, die hinter ihm herschlendern. Sie sind zu fünft. Elfte Klasse, schätze ich. Sie nähern sich dem Langen mit dem wiegenden Gang von Schlägern. Passiv-aggressiv. Der Anführer – groß, gutaussehend, dunkles Haar – legt dem Langen einen Arm um die Schultern und sagt etwas zu ihm. Der Lange gibt sich locker, aber seine ganze Körpersprache schreit das Gegenteil. Die anderen bilden einen lockeren Kreis. Flucht verhindern. Ihm den Weg in die Schule oder fort von ihnen versperren.
Ich halte Abstand. Sie haben mich noch nicht gesehen. Ich bin auf der anderen Straßenseite. Und natürlich wissen sie nicht, dass ich Lehrer bin. Ich bin bloß ein vergammelter Typ in Dufflecoat und Converse. Und dieser Typ könnte ich auch bleiben. Noch ist kein Unterricht. Wir sind nicht einmal auf dem Schulgelände. Und es ist mein erster Tag. Es wird noch andere Tage geben, andere Chancen, solche Angelegenheiten zu regeln.
Ich ziehe meine Marlboro Lights aus der Tasche und sehe zu, wie die Gang den Langen an eine Hauswand drängt. Das nervöse Lächeln ist verflogen. Er versucht etwas zu sagen. Der Anführer drückt ihm einen Arm an die Kehle, während einer von der Gang ihm den Rucksack von der Schulter streift und die anderen wie ein Rudel wilder Hunde darüber herfallen, Bücher und Hefte auspacken, Seiten herausreißen und auf den in Folie gewickelten Sandwiches herumtrampeln.
Einer von ihnen schwenkt hämisch ein offenbar neues iPhone. Warum?, denke ich. Warum lassen Eltern ihre Kinder mit diesem Scheiß zur Schule gehen? Zu meiner Zeit jedenfalls war das Schlimmste, was einem von solchen Typen geklaut werden konnte, dass bisschen Essensgeld oder der Lieblingscomic.
Ich werfe einen sehnsüchtigen Blick auf meine Zigaretten. Dann stecke ich sie seufzend wieder ein und gehe über die Straße auf die Szene zu.
Der Lange versucht nach seinem Phone zu greifen. Der Anführer rammt ihm ein Knie in die Weichteile und nimmt es seinem Kumpan aus der Hand.
»Uuuuh, neu. Schön.«
»Bitte«, ächzt der Lange. »Das ist ein Geschenk … zum Geburtstag.«
»Wüsste nicht, dass wir eine Einladung zu deiner Party bekommen haben.« Der Anführer sieht seine Spießgesellen an. »Oder haben wir?«
»Na. Muss in der Post verloren gegangen sein.«
»Nicht mal ’ne SMS, nichts.«
Der Anführer hebt das Phone hoch über seinen Kopf. Der Lange greift danach, aber nur zaghaft. Er ist um einiges größer als sein Peiniger, gibt sich aber schon geschlagen. Ich kenne diesen Blick.
Der Anführer grinst: »Hoffentlich lasse ich es nicht fallen …«
Ich packe seinen erhobenen Unterarm. »Bestimmt nicht.«
Der Anführer dreht sich um. »Wer zum Teufel bist du denn?«
»Mr Thorne, dein neuer Englischlehrer. Aber du darfst Sir zu mir sagen.«
Alle murmeln durcheinander. Dem Anführer entgleisen die Gesichtszüge, aber nur ein bisschen. Dann setzt er ein Lächeln auf, das er vermutlich für freundlich hält. Jetzt missfällt er mir noch mehr.
»Wir haben nur ein bisschen rumgeflachst, Sir. War nur Spaß.«
»Tatsächlich?« Ich sehe den Langen an. »Hast du Spaß gehabt?«
Er sieht zum Anführer und nickt kaum merklich. »Nur rumgeflachst.«
Ich lasse den Anführer los – ungern – und gebe dem Langen sein Phone zurück.
»An deiner Stelle, Marcus, würde ich das morgen zu Hause lassen.«
Wieder nickt er, jetzt doppelt gestraft. Ich frage den Anführer: »Name?«
»Jeremy Hurst.«
Hurst. Mein Auge zuckt. Natürlich. Hätte ich eigentlich erkennen müssen. Die dunklen Haare haben gestört, aber jetzt sehe ich die Familienähnlichkeit. Das angeborene Flackern von Grausamkeit in seinen blauen Augen.
»War’s das, Sir?«
»Sir«, betont. Sarkastisch. Ich soll anbeißen. Aber das wäre zu simpel. Andere Tage, sage ich mir, später.
»Vorläufig.« Ich drehe mich zu den anderen um. »Ihr verzieht euch jetzt. Und wenn ich euch irgendwann auch nur einen Kaugummi auf den Boden fallen lassen sehe, reiß ich euch den Arsch bis zu den Ohren auf.«
Zwei müssen beinahe grinsen. Ich weise mit dem Kinn zum Schultor, und sie setzen sich in Bewegung. Hurst bleibt am längsten, bevor auch er sich umdreht und lässig von dannen zieht. Marcus zögert.
»Du auch«, sage ich.
Er rührt sich immer noch nicht.
»Na?«
»Das hätten Sie nicht tun sollen.«
»Du meinst, ich hätte zulassen sollen, dass er dein neues Phone kaputtmacht?«
Er schüttelt müde den Kopf und wendet sich ab. »Sie werden schon sehen.«
5
Ich muss nicht lange warten.
Mittagspause. Ich sitze am Pult, mache Notizen und gratuliere mir, dass ich den Vormittag überstanden habe, ohne meine Klassen zu Tode zu langweilen oder einen Schüler – oder mich selbst – aus dem Fenster zu werfen.
Wie Harry so zutreffend bemerkt hat, ist es eine Weile her, seit ich das letzte Mal vor einer Klasse gestanden habe. Ich war tatsächlich etwas eingerostet. Dann fiel mir ein, was ein alter Kollege einmal zu mir gesagt hatte: Unterricht halten ist wie Radfahren. Man verlernt es nicht. Und wenn du das Gefühl hast, du wackelst und kippst gleich um, denk immer daran, die dreißig Kinder da vor dir warten nur darauf, dich auszulachen und dir das Rad zu klauen. Also strample weiter, auch wenn du keine Ahnung hast, wo es hingeht.
Ich strampelte weiter. Am Ende des Vormittags bin ich nicht wenig stolz auf meinen Erfolg.
Kein Zustand von Dauer.
Es klopft, und Harry steckt seinen Kopf herein.
»Ah, Mr Thorne? Gut, dass Sie da sind. Alles in Ordnung?«
»Nun, bis jetzt ist niemand bei mir eingeschlafen, also muss ich wohl sagen: ja.«