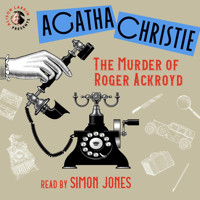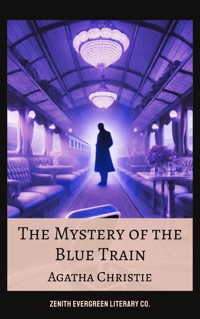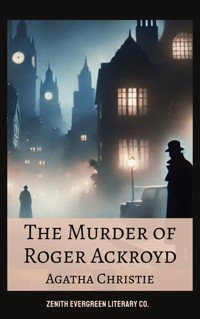9,99 €
Mehr erfahren.
Beim Urlaub an der englischen Riviera machen Hercule Poirot und Captain Hastings die Bekanntschaft der bezaubernden Nick Buckley. Das Erbe der jungen Frau allerdings, ein wunderschönes altes Haus mit Blick aufs Meer, scheint Begehrlichkeiten zu wecken. Denn gleich dreimal kommt es zu mysteriösen Unfällen, denen sie nur mit Glück heil entgeht. Für Poirot steht die Sache fest: Ohne seine Hilfe ist Miss Buckleys Schicksal besiegelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Agatha Christie
Das Haus an der Düne
Ein Fall für Poirot
Aus dem Englischen von Monika Gripenberg
Atlantik
Für Eden Philpotts in Dankbarkeit für seine Freundschaft und die Ermutigung vor vielen Jahren
Erstes KapitelHotel Majestic
In meinen Augen kann kein Küstenort Südenglands St. Loo das Wasser reichen. Zu Recht gebührt ihm der Ehrentitel »Die Perle unter den Badeorten«, was einen unweigerlich an die französische Riviera erinnert. Jedenfalls ist für mich die Küste Cornwalls in jeder Hinsicht genauso faszinierend wie die Südfrankreichs.
Als ich dies meinem Freund Hercule Poirot gegenüber äußerte, meinte er lediglich: »Genau das stand gestern auf der Karte im Speisewagen, mon ami. Also keine sehr originelle Bemerkung Ihrerseits.«
»Ja, mag sein, aber finden Sie nicht auch, dass es stimmt?«
Daraufhin lächelte er still vor sich hin und antwortete nicht sofort auf meine Frage, weshalb ich sie wiederholte.
»Ich bitte tausendmal um Vergebung, Hastings. Ich war soeben in Gedanken ganz weit weg, und zwar genau in dem von Ihnen erwähnten Teil der Welt.«
»Im Süden Frankreichs?«
»Exakt. Ich musste an den letzten Winter dort denken und an die aufregenden Ereignisse.«
Ich erinnerte mich. Poirot hatte mit gewohntem, unbeirrbarem Scharfsinn einen mysteriösen und verzwickten Mordfall im berühmten Train bleu gelöst.
»Ach, ich bedaure es zutiefst, dass ich nicht dabei sein konnte«, bemerkte ich.
»Da geht es mir genauso«, sagte Poirot. »Ihre Kennerschaft wäre für mich von unschätzbarem Wert gewesen.«
Ich sah ihn von der Seite an. Erfahrung hatte mich gelehrt, seinen Komplimenten zu misstrauen, diesmal schien er es jedoch ernst zu meinen. Und warum auch nicht? Schließlich kenne ich seine Methoden wie kein Zweiter.
»Ganz besonders vermisste ich Ihre lebhafte Phantasie, Hastings«, fuhr er beinahe träumerisch fort. »Ein wenig Abwechslung tut immer gut. Mein Diener Georges, ein lobenswerter Zeitgenosse, mit dem ich zuweilen den einen oder anderen Gesichtspunkt eines Falles erörtere, verfügt leider über keinen Funken Phantasie.« Diese Bemerkung schien mir völlig irrelevant.
»Sagen Sie, Poirot«, bemerkte ich. »Reizt es Sie nicht, Ihre alten Aktivitäten wieder aufzunehmen? Dieses untätige Leben …«
»Passt mir ganz wunderbar in den Kram, mein Freund. Gibt es etwas Schöneres, als in der Sonne zu sitzen? Können Sie sich eine edlere Geste vorstellen, als auf dem Zenit seines Ruhms abzutreten? Man wird über mich sagen: ›Da geht Hercule Poirot! Der Große, der Einzigartige! Einen wie ihn hat es nie zuvor gegeben und wird es nie wieder geben.‹ Eh bien – ich bin zufrieden. In aller Bescheidenheit, mehr verlange ich gar nicht.«
Ich für meine Person fand das Wort »bescheiden« nicht gerade passend. Aber anscheinend hatte die Überheblichkeit meines Freundes mit den Jahren nur zugenommen. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, strich beinahe zärtlich über seinen Schnurrbart und schnurrte förmlich vor Selbstzufriedenheit.
Wir befanden uns auf einer der Terrassen des größten Hotels in St. Loo, dem Majestic. Es machte seinem Namen alle Ehre, wie es da in einer großzügigen Anlage mit Meeresblick majestätisch thronte. Zu unseren Füßen erstreckte sich der Garten des Hotels, in dem sich sogar einige Palmen wiegten. Das Meer glitzerte tiefblau, der Himmel war wolkenlos und die Sonne brannte mit der geballten Kraft der echten Augustsonne (was in England in diesem Monat leider nicht immer der Fall ist). Das emsige Summen der Bienen war zu hören – alles in allem war es eine vollkommene Idylle.
Wir waren erst gestern Abend angekommen und der heutige Morgen war der Beginn unserer geplanten Ferienwoche. Wenn sich dieses Wetter nur hielt, so würde sie in der Tat perfekt werden.
Ich hob die Morgenzeitung auf, die mir aus der Hand gefallen war, und nahm das Ritual der morgendlichen Lektüre wieder auf. Die politische Lage war zwar unbefriedigend, aber gleichzeitig uninteressant. Unruhen in China, ein ausführlicher Bericht über eine angebliche Betrugsaffäre in der City, aber eigentlich nichts Fesselndes.
»Merkwürdige Sache, diese Papageienkrankheit«, bemerkte ich beim Umblättern.
»Sehr merkwürdig.«
»Hier steht etwas über zwei weitere Todesopfer in Leeds.«
»Äußerst bedauerlich.«
Ich blätterte weiter.
»Noch immer nichts von diesem Flieger, diesem Seton, und seinem Flug um die Welt. Einer von diesen tollkühnen Burschen. Fabelhafte Erfindung, sein Wasserflugzeug, die Albatros. Nicht auszudenken, wenn er weiter nach Westen geflogen ist. Man hofft natürlich noch immer. Möglicherweise hat er es bis zu einer Pazifikinsel geschafft.«
»Auf den Salomon-Inseln soll es doch noch Kannibalen geben, nicht wahr?«, erkundigte sich Poirot scheinheilig.
»Muss ein prima Kerl sein. So etwas macht einen doch wieder stolz darauf, Engländer zu sein.«
»Jedenfalls tröstet es über die Niederlagen in Wimbledon hinweg«, sagte Poirot.
»Aber, ich – ich wollte doch auf keinen Fall«, stammelte ich.
Mit einer eleganten Handbewegung wischte mein Freund den Entschuldigungsversuch beiseite.
»Ich für meine Person«, verkündete er, »bin Kosmopolit und keine Amphibie wie das Gefährt Ihres armen Captain Seton. Zudem hege ich, wie Sie ja wissen, schon immer große Bewunderung für die Engländer. Sie gilt beispielsweise der Gründlichkeit, mit der Sie sich der Lektüre ihrer Tageszeitung widmen.«
Ich war inzwischen bei der Politik gelandet.
»Der Innenminister scheint ganz schön in der Patsche zu sitzen«, bemerkte ich stillvergnügt.
»Der Arme. O ja, und ob der Grund zur Sorge hat! Nicht zu knapp! Sodass er sogar höchst ungewöhnliche Stellen um Hilfe angesucht hat.«
Ich machte große Augen.
Mit einem feinen Lächeln zog Poirot ein ordentlich mit einem Gummiband zusammengehaltenes Bündel aus seiner Tasche – die Morgenpost. Dem entnahm er einen Brief und schob ihn mir über den Tisch zu.
»Er hätte schon mit der gestrigen Post ankommen müssen«, sagte er.
Ich las den Brief und spürte dabei ein angenehmes Kribbeln vor Aufregung.
»Ja, aber Poirot«, rief ich. »Das ist ja höchst schmeichelhaft.«
»Finden Sie, mein Freund?«
»Er schwärmt in den höchsten Tönen von Ihren Fähigkeiten.«
»Damit hat er ja auch vollkommen recht«, befand Poirot und schlug bescheiden die Augen nieder.
»Er ersucht Sie, diese Angelegenheit für ihn zu bereinigen – betrachtet es sogar als persönlichen Gefallen Ihrerseits.«
»Schon möglich. Es ist überflüssig, mir das alles mitzuteilen. Sehen Sie, lieber Hastings, ich habe den Brief ja bereits gelesen.«
»Zu schade«, rief ich aus. »So finden unsere Ferien ein abruptes Ende.«
»O nein, nein, calmez-vous – das kommt überhaupt nicht in Frage.«
»Aber der Innenminister sagt, die Sache sei dringend.«
»Damit mag er richtigliegen – oder auch nicht. Diese Politiker regen sich immer gleich auf. Ich kenne das, in der Abgeordnetenkammer in Paris beispielsweise …«
»Ja, ja sicher, Poirot, aber sollten wir denn nicht mit den Vorbereitungen beginnen? Der Schnellzug nach London ist bereits fort – er fährt schon um zwölf. Der nächste Zug …«
»Ruhig Blut, Hastings, ich flehe Sie an, ruhig Blut. Immer diese Aufregung, diese Emotion. Wir werden weder heute noch morgen nach London fahren.«
»Aber dieser Auftrag …«
»Geht mich nichts an. Ich gehöre nicht zu Ihrer Polizei, Hastings. Man bittet mich lediglich in meiner Eigenschaft als Privatdetektiv, einen Fall zu übernehmen. Eh bien, ich lehne ab.«
»Sie lehnen ab?«
»Aber ja. Ich schreibe mit vollkommener Höflichkeit, drücke mein Bedauern aus, entschuldige mich überschwänglich und erkläre, dass ich am Boden zerstört bin – was wollen Sie mehr? Ich habe mich zurückgezogen – meine Karriere ist beendet.«
»Aber Sie sind noch lange nicht am Ende!«, rief ich mit großer Wärme aus.
Poirot tätschelte mein Knie.
»Da spricht der wahre Freund – der treue Weggefährte. Und dabei haben Sie auch noch völlig recht. Die grauen Zellen funktionieren noch tadellos – der Aufbau, die Methodik –, alles noch immer da. Aber, mein Freund, abgetreten ist abgetreten. Es ist zu Ende. Ich möchte keine Diva sein, die ihrem Publikum ein Dutzend Abschiedsvorstellungen zumutet. Mit stiller Größe sage ich: Lasst die junge Generation ans Ruder. Vielleicht gelingt ihnen sogar etwas Bemerkenswertes. Ich bezweifle es zwar, aber es ist immerhin möglich. Jedenfalls dürften ihre Fähigkeiten ausreichen, diese fraglos langweilige Affäre des Innenministers zu klären.«
»Aber Poirot, die Ehre, der Ruhm!«
»Da stehe ich längst drüber. Dem Innenminister ist es als klugem Mann natürlich klar, dass allein die Inanspruchnahme meiner Dienste einen erfolgreichen Abschluss der Angelegenheit garantiert. Was wollen Sie? Er hat Pech. Hercule Poirot hat seinen letzten Fall gelöst.«
Ich sah ihn an. In meinem tiefsten Innern bedauerte ich seine Halsstarrigkeit. Ein derartiger, wie im Brief angedeuteter Fall hätte seinem ohnehin weltberühmten Ruf noch ein wenig mehr Glanz verliehen. Und dennoch rang mir seine unnachgiebige Haltung Achtung ab. Plötzlich durchfuhr mich ein Gedanke und ich musste lächeln.
»Ich frage mich«, sagte ich, »ob Sie keine Angst haben. Eine derart entschiedene Erklärung bedeutet doch gewissermaßen, die Götter herauszufordern.«
»Es ist unmöglich«, erwiderte er, »die Entscheidung eines Hercule Poirot ins Wanken zu bringen.«
»Unmöglich, Poirot?«
»Da haben Sie auch wieder recht, mon ami. Nichts ist unmöglich. Eh, ma foi, ich will nicht behaupten, dass eine Kugel, die hinter mir in die Wand einschlägt, keine Nachforschungen meinerseits auslösen würde. Schließlich bin ich auch nur ein Mensch.«
Ich musste lächeln. Ein kleiner Kieselstein war gerade neben uns auf der Terrasse aufgeschlagen und Poirots anschaulicher Vergleich regte meine Phantasie an. Nun bückte er sich und hob den Kiesel auf, während er fortfuhr.
»Ja, man ist auch nur ein Mensch. Alles ist gut und schön, man ist wie der schlafende Hund in Ihrem Sprichwort, den man allerdings lieber nicht wecken sollte.«
»In der Tat«, fuhr ich fort, »sollten Sie eines Morgens einen Dolch neben Ihrem Kopfkissen finden, dann sei Gott dem Übeltäter gnädig.«
Er nickte ziemlich geistesabwesend.
Unvermittelt und zu meiner Überraschung erhob er sich und ging die wenigen Stufen zum Garten hinunter. Zur gleichen Zeit erschien auf der Bildfläche ein junges Mädchen, das sich rasch in unsere Richtung bewegte.
Ich hatte eben den Eindruck gewonnen, dass es sich um ein ausgesprochen hübsches Mädchen handelte, als meine Aufmerksamkeit auf Poirot gelenkt wurde, der aus Unachtsamkeit über eine Wurzel gestolpert und gestürzt war. Dabei landete er genau vor den Füßen des Mädchens, und sie und ich halfen ihm gemeinsam wieder auf die Beine. Natürlich galt das Hauptaugenmerk meinem kleinen Freund, aber dennoch entgingen meiner Aufmerksamkeit weder das von dunklem Haar umrahmte, schelmische Gesicht noch die großen, veilchenblauen Augen.
»Tausendmal Vergebung«, stammelte Poirot. »Mademoiselle sind zu freundlich. Ich bedauere unendlich – autsch! – mein Fuß, oh, er peinigt mich sehr. Nein, nein, nichts Ernstes – nur ein verstauchter Knöchel. In ein paar Minuten ist alles wieder gut. Wenn Sie mir allerdings helfen wollten. Hastings – Sie und Mademoiselle könnten mich in die Mitte nehmen, wenn Mademoiselle die Güte hätte. Es ist mir peinlich, Sie darum zu bitten.«
Ich zu seiner Rechten und das Mädchen zur Linken, verfrachteten wir Poirot rasch in einen Stuhl auf der Terrasse. Mein Vorschlag, einen Arzt kommen zu lassen, stieß bei meinem Freund auf schärfste Ablehnung.
»Ich versichere Ihnen, es ist nichts. Nur ein verstauchter Knöchel. Im Moment zwar schmerzhaft, doch bald vorbei.« Er zog eine Grimasse. »Sehen Sie, in einer petite Minute ist alles vergessen. Mademoiselle, ich danke Ihnen tausendmal. Sie sind sehr freundlich. Setzen Sie sich doch, ich flehe Sie an.«
Das Mädchen zog sich einen Stuhl heran.
»Nicht der Rede wert«, sagte sie. »Aber ich finde auch, Sie sollten Ihren Knöchel untersuchen lassen.«
»Mademoiselle, ich versichere Ihnen, es ist nur eine Bagatelle. Ihre angenehme Gesellschaft ist die beste Kur.«
Das Mädchen lachte.
»Das haben Sie schön gesagt.«
»Wie wäre es mit einem Cocktail?«, schlug ich vor. »Genau der richtige Zeitpunkt.«
»Nun ja …« Sie zögerte. »Vielen Dank.«
»Einen Martini?«
»Ja, bitte – einen trockenen.«
Ich ging los, um die Drinks zu bestellen. Bei meiner Rückkehr fand ich Poirot und das Mädchen in angeregter Unterhaltung.
»Denken Sie nur, Hastings«, sagte er, »das Haus dort an der Landzunge – Sie wissen schon welches –, das wir so bewundert haben, es gehört Mademoiselle hier.«
»Tatsächlich?«, sagte ich, obwohl ich mir keinerlei derartiger Bewunderung bewusst war. Im Grunde hatte ich das Haus überhaupt nicht wahrgenommen. »Es wirkt unheimlich und imposant zugleich, wie es dort so ganz isoliert steht.«
»Es heißt End House«, sagte das Mädchen. »Ich hänge sehr daran, aber es ist alt und baufällig. Es wird wohl bald zusammenfallen und dann ist es dahin.«
»Sie sind der letzte Spross eines alten Geschlechts, Mademoiselle?«
»Oh, so bedeutend sind wir nicht. Allerdings gibt es die Buckleys in dieser Gegend schon seit zwei- oder dreihundert Jahren. Mein Bruder verstarb vor drei Jahren, ja eigentlich könnte man sagen, ich bin der letzte Spross der Familie.«
»Das ist aber traurig. Leben Sie allein, Mademoiselle?«
»Oh! Ich bin viel unterwegs und wenn ich mal zu Hause bin, geht meist eine ausgelassene Bande bei mir ein und aus.«
»Das ist mir zu modern. Vor meinem geistigen Auge sah ich Sie, mutterseelenallein, vom Familienfluch gepeinigt in einem dunklen, geheimnisvollen Herrenhaus sitzen.«
»Wie herrlich! Sie haben eine äußerst lebhafte Phantasie. Nein, es spukt nicht in End House. Oder wenn doch, dann muss es sich um einen wohlwollenden Geist handeln. In den letzten drei Tagen bin ich nämlich dreimal knapp dem Tod entronnen. Da muss ein mächtiger Schutzengel seine Hand im Spiel haben.«
Poirot setzte sich voller Aufmerksamkeit auf.
»Dem Tod entronnen? Das klingt interessant, Mademoiselle.«
»Oh! Nichts Aufregendes. Lauter Unglücksfälle, wissen Sie.« Sie zuckte zurück, als eine Wespe an ihr vorbeiflog. »Verwünschte Wespen! Hier muss irgendwo ein Nest sein.«
»Die Bienen und die Wespen sind nicht Ihr Fall, nicht wahr, Mademoiselle? Sie sind schon öfter gestochen worden – ja?«
»Nein, das nicht – aber ich verabscheue es, wie sie einem direkt vor dem Gesicht herumfliegen.«
»Bienen unterm Hütchen – Flausen im Kopf«, sagte Poirot. »Ihr altes englisches Sprichwort.«
Da wurden die Cocktails serviert. Wir erhoben unsere Gläser und tauschten die üblichen nichts sagenden Artigkeiten aus.
»Eigentlich erwartet man mich zur Cocktailstunde im Hotel«, sagte Miss Buckley. »Wahrscheinlich wundern sie sich bereits, wo ich stecke.«
Poirot räusperte sich und stellte sein Glas ab.
»Ah, ein Königreich für eine schöne Tasse dicke Schokolade«, murmelte er. »Aber in England gibt es so etwas nicht. Und doch gibt es hier ein paar ganz nette Sachen. Die jungen Mädchen, zum Beispiel, wie sie ihre Hüte auf- und absetzen – so graziös und mit leichter Hand …«
Das Mädchen starrte ihn verwundert an.
»Was meinen Sie damit? Warum sollten sie das nicht tun?«
»Das fragen Sie nur, weil Sie jung sind – blutjung, Mademoiselle. Ich hingegen bin den Anblick hochgetürmter und steifer Frisuren gewohnt. Auf denen dann, mit unzähligen Nadeln befestigt – là – là – là et là – der Hut thront.«
Er vollführte in der Luft vier grimmige Fechtstöße.
»Wie furchtbar unbequem!«
»Ah! Und ob!«, sagte Poirot mit mehr Empfindsamkeit als jede noch so gepeinigte Hutträgerin. »Bei Wind wurde es zur Qual – man bekam Migräne.«
Miss Buckley nahm ihren einfachen, breitkrempigen Filzhut ab und warf ihn nachlässig neben sich.
»Und heutzutage machen wir es einfach so«, sagte sie lachend.
»Was vernünftig und bezaubernd zugleich ist«, sagte Poirot mit einer leichten Verbeugung.
Ich betrachtete sie mit Neugier. Ihr dunkles, zerzaustes Haar unterstrich das Koboldhafte ihrer gesamten Erscheinung. Dazu passte das kleine, lebhafte, herzförmige Gesicht ebenso wie die riesigen dunkelblauen Augen und noch etwas – etwas Magisches und Magnetisches. Oder vielleicht eine Spur von Rücksichtslosigkeit? Unter den Augen lagen dunkle Schatten.
Unsere Terrasse war wenig besucht. Die Hauptterrasse, auf der sich die meisten Leute aufhielten, befand sich genau um die Ecke an einer Stelle, wo die Klippe direkt ins Meer hinabfällt. Um eben diese Ecke bog nun ein Mann mit sonnenverbranntem Gesicht. Er hatte einen breitbeinigen Gang, und um ihn herum war ein Hauch von Salzwasser und Unbekümmertheit – mit einem Wort ein echter Sohn des Meeres.
»Ich hab keine Ahnung, wo das Mädel steckt«, sagte er und seine Stimme drang mühelos bis zu uns. »Nick – Nick.«
Miss Buckley stand auf.
»Ich wusste ja, sie würden Theater machen. Bravo, mein Junge! George – hier bin ich.«
»Freddie lechzt nach einem Drink. Komm, Mädchen, gehen wir.«
Mit unverhohlener Neugier musterte er Poirot, der sich sicherlich vom Großteil der Freunde Nicks deutlich abhob.
Das Mädchen übernahm die Vorstellung mit einer vagen Geste.
»Commander Challenger – und – äh …«
Doch zu meiner Überraschung nannte Poirot nicht, wie erwartet, seinen Namen, sondern erhob sich stattdessen, verbeugte sich sehr förmlich und murmelte: »Von der englischen Marine. Ich hege die größte Wertschätzung für die englische Flotte.«
Diese Art Bemerkung nimmt ein Engländer nicht gerade mit großem Wohlwollen auf und Commander Challengers Gesicht nahm eine noch dunklere Rottönung an. Nick Buckley rettete schließlich die Situation.
»Komm schon, George. Halt nicht Maulaffen feil. Wir gehen zu Freddie und Jim.«
Sie schenkte Poirot ein Lächeln.
»Danke für den Cocktail. Hoffentlich geht es Ihrem Knöchel bald besser.«
Mit einem kurzen Nicken in meine Richtung schob sie ihren Arm unter den des Seemanns und sie bogen gemeinsam um die Ecke.
»Das also ist einer von Mademoiselles Freunden«, murmelte Poirot nachdenklich. »Einer von der ausgelassenen Bande. Wie finden Sie ihn? Lassen Sie mich das Urteil eines Experten hören, Hastings. Würden Sie ihn als einen feinen Kerl bezeichnen?«
Ich dachte einen Augenblick nach und versuchte, mir darüber klar zu werden, was Poirot wohl meinte, wer für mich ein »feiner Kerl« sei. Dann gab ich meine zögerliche Zustimmung.
»Ja, doch«, sagte ich. »Auf den ersten Blick scheint er ganz in Ordnung.«
»Wer weiß«, meinte Poirot.
Das Mädchen hatte seinen Hut vergessen. Poirot bückte sich danach und balancierte ihn geistesabwesend auf dem Finger.
»Ob er wohl zärtliche Gefühle für sie hegt? Was meinen Sie, Hastings?«
»Mein lieber Poirot! Wie in aller Welt könnte ich das beurteilen. Geben Sie mir den Hut. Die Dame wird ihn vermissen. Ich werde ihn ihr bringen.«
Poirot ignorierte meine Aufforderung. Er fuhr fort, den Hut langsam auf seinem Finger kreisen zu lassen.
»Noch nicht. Ça m’amuse.«
»Also wirklich, Poirot!«
»Ja, mein Freund. Ich werde alt und kindisch, nicht wahr?«
Er hatte buchstäblich meine Gedanken gelesen und ich war etwas konsterniert, sie so deutlich ausgesprochen zu hören. Poirot kicherte in sich hinein, lehnte sich nach vorne und hielt dabei seinen Finger an einen Nasenflügel.
»Aber nicht doch – noch bin ich nicht so senil, wie Sie denken. Wir werden den Hut zurückgeben – aber selbstverständlich werden wir das –, nur etwas später. Wir werden ihn nach End House zurückbringen und haben so die Gelegenheit, die bezaubernde Miss Nick wiederzusehen.«
»Poirot«, sagte ich. »Ich glaube fast, Sie haben sich verliebt.«
»Sie ist ein hübsches Mädchen – eh?«
»Das müssen Sie schon selbst beurteilen. Wieso fragen Sie da mich?«
»Weil ich es – und das ist das Tragische – bedauerlicherweise eben nicht beurteilen kann. Für mich ist heutzutage alles schön, was jung ist. Jeunesse – jeunesse … Das ist die Tragödie des Alters. Aber Sie – ich appelliere an Sie! Natürlich ist Ihr Urteilsvermögen nach Ihrem langjährigen Argentinienaufenthalt nicht auf dem neuesten Stand und hinkt etwa fünf Jahre nach, aber es ist immer noch moderner als meines. Sie ist doch hübsch – nicht wahr? Hat Sie das gewisse Etwas für die Geschlechter?«
»Für eines genügt vollkommen, Poirot. Ich würde sagen, die Antwort fällt ausgesprochen positiv aus. Wieso sind Sie so interessiert an der jungen Dame?«
»Bin ich das denn?«
»Na, hören Sie mal, wenn man bedenkt, was Sie gerade gesagt haben.«
»Mon ami, Sie sind das Opfer eines Missverständnisses. Vielleicht interessiere ich mich sogar für die Dame – jawohl –, aber viel mehr interessiere ich mich für ihren Hut.«
Ich blickte ihn prüfend an, aber er schien es völlig ernst zu meinen.
Er nickte mit dem Kopf. »Ja, Hastings, genau dieser Hut.« Er hielt ihn mir hin. »Sehen Sie denn nicht den Grund für mein Interesse?«
»Ein netter Hut«, sagte ich leicht befremdet. »Aber ziemlich alltäglich. Viele junge Mädchen tragen solche Hüte.«
»Aber nicht so einen.«
Ich sah ihn mir noch einmal näher an.
»Sehen Sie nun, Hastings?«
»Ein völlig üblicher, brauner Filzhut. Guter Stil …«
»Ich bat Sie nicht um eine Beschreibung. Es ist offensichtlich, dass Sie nichts sehen. Es ist schon beinahe unglaublich, mein armer Hastings, wie selten Sie überhaupt etwas sehen! Das erstaunt mich jedes Mal aufs Neue. Aber schauen Sie doch nur, Sie lieber, alter Esel – dazu brauchen Sie keine grauen Zellen – nur die Augen. Sehen Sie – sehen Sie doch!«
Und da, zu guter Letzt, entdeckte ich, worauf er hinauswollte. Der Hut drehte sich langsam auf seinem Finger, und dieser steckte in einem Loch in der Hutkrempe. Als er merkte, dass ich verstanden hatte, zog er den Finger heraus und hielt mir den Hut hin. Es war ein kleines, exaktes Loch, kreisrund und ich konnte mir seinen Zweck, falls es überhaupt einen gab, nicht vorstellen.
»Haben Sie bemerkt, wie Mademoiselle Nick vor der Biene zurückzuckte? Die Biene unterm Hütchen – das Loch im Hütchen?«
»Ja, aber eine Biene könnte doch nie ein derartiges Loch machen.«
»Exactement, Hastings! Welch Scharfsinn! Das könnte sie allerdings nicht. Aber, mon cher, eine Kugel schon!«
»Eine Kugel?«
»Mais oui! So eine Kugel zum Beispiel.«
Auf seiner Handfläche lag ein kleiner Gegenstand.
»Eine abgefeuerte Kugel, mon ami. Das war es, was wir hörten, als wir uns auf der Terrasse unterhielten. Eine Kugel!«
»Sie glauben doch nicht …«
»Ich glaube, dass nur ein einziger Zoll aus diesem Loch im Hut ein Loch im Kopf gemacht hätte. Verstehen Sie nun mein Interesse, Hastings? Sie hatten ja so recht, als Sie mich davor warnten, das Wort ›unmöglich‹ zu benutzen. Ja – man ist nur ein Mensch. Ah! Doch er hat einen schweren Fehler begangen, dieser Möchtegernmörder, nämlich als er auf sein Opfer schoss und dabei ganze zwölf Zoll von Hercule Poirot entfernt war. Das ist eindeutig sein Pech. Aber ist Ihnen nun klar, weshalb wir End House und Mademoiselle unbedingt einen Besuch abstatten müssen? ›In drei Tagen dreimal dem Tod entronnen.‹ Genau das hat sie gesagt. Wir müssen schnell handeln, Hastings. Die Gefahr lauert vielleicht schon an der nächsten Ecke.«
Zweites KapitelEnd House
»Poirot«, sagte ich. »Ich habe nachgedacht.«
»Eine äußerst lobenswerte Sache, mein Freund. Machen Sie weiter.«
Wir saßen an einem kleinen Fenstertisch beim Lunch.
»Dieser Schuss muss in unmittelbarer Nähe von uns abgefeuert worden sein. Dennoch haben wir nichts gehört.«
»Und nun denken Sie, dass wir ihn gehört haben müssten, in dieser Stille, in der man nur das Rauschen der Wellen vernimmt.«
»Nun ja, es ist schon merkwürdig.«
»Nein, ist es gar nicht. An manche Geräusche gewöhnt man sich derart, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Heute zum Beispiel, sind die Rennboote den ganzen Morgen quer durch die Bucht gerast. Zuerst haben Sie sich darüber beschwert, doch bald schon bemerkten Sie sie gar nicht mehr. Ma foi, meiner Treu, solange auch nur eines dieser Boote auf dem Meer herumrast, könnte man ein Maschinengewehr unbemerkt abfeuern.«
»Ja, das ist wohl wahr.«
»Ah! Voilà«, raunte Poirot. »Mademoiselle und ihre Freunde. Sieht ganz so aus, als ob sie hier lunchen wollen. Dann allerdings muss ich ihr den Hut zurückgeben, Aber das macht nichts. Die Angelegenheit ist ernst, daher brauchen wir keinen Vorwand mehr für einen Besuch.«
Behände erhob er sich aus seinem Sessel, durchquerte eilends den Raum und überreichte den Hut mit einer Verbeugung genau in dem Moment, als sich Miss Buckley und ihre Begleitung zu Tisch setzen wollten.
Sie waren zu viert, Nick Buckley, Commander Challenger, ein weiterer Mann und noch eine junge Dame. Von unserem Platz aus konnte man sie nur undeutlich erkennen. Von Zeit zu Zeit schallte das dröhnende Lachen des Marineoffiziers herüber. Anscheinend war er ein unkomplizierter, liebenswürdiger Bursche und ich fasste sofort Zuneigung zu ihm.
Mein Freund war während des Essens einsilbig und zerstreut. Er zerkrümelte sein Brot, gab seltsame, kleine Ausrufe von sich und rückte sämtliche Gegenstände auf dem Tisch zurecht. Mein Versuch, Konversation zu machen, stieß auf wenig Gegenliebe und so gab ich bald auf.
Poirot blieb auch nach dem Käse noch lange am Tisch sitzen. Sobald allerdings die anderen den Raum verließen, erhob auch er sich. Sie ließen sich gerade an einem Tisch im Salon nieder, als Poirot äußerst forsch auf sie zumarschierte. Er wandte sich direkt an Nick.
»Mademoiselle, auf ein kurzes Wort, ich bitte Sie!«
Das Mädchen verzog leicht das Gesicht. Mir war nur allzu klar, was sie dachte. Sie fürchtete, dieser drollige kleine Ausländer könnte lästig werden. Ich fühlte mit ihr, denn ich wusste, wie sie die Situation empfand. Relativ unwillig trat sie ein paar Schritte zur Seite.
Beinahe unmittelbar danach sah ich, wie Poirot ihr leise einige hastige Worte zuraunte und ihr Gesicht einen erstaunten Ausdruck annahm.
In der Zwischenzeit fühlte ich mich ziemlich unbehaglich und peinlich berührt. Challenger kam mir taktvoll und sensibel zu Hilfe, indem er mir eine Zigarette anbot und eine belanglose Bemerkung machte. Das Ergebnis unserer gegenseitigen Abschätzung schien ganz offensichtlich Sympathie auf beiden Seiten zu sein. Ich nahm an, dass ich mehr seinem Typ entsprach als der Mann, mit dem er den Lunch eingenommen hatte und den zu begutachten ich jetzt Gelegenheit hatte. Es war ein großer, blonder, ziemlich eleganter junger Mann, mit einer ausgeprägten Nase und betont gutem Aussehen. Er wirkte arrogant und sprach übertrieben schleppend. Besonders missfiel mir sein geschniegeltes Äußeres.
Dann betrachtete ich die Frau. Sie saß mir genau gegenüber in einem großen Sessel und hatte gerade ihren Hut abgenommen. Sie war ein ungewöhnlicher Typ – sie glich einer müden Madonna. Ihr blondes, beinahe farbloses Haar trug sie in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Ihr abgezehrtes Gesicht war kalkweiß – und dennoch auf eine unerklärliche Weise anziehend. Die Iris ihrer Augen schimmerte hellgrau und die Pupillen waren stark geweitet. Ihre ganze Person strahlte eine seltsame Gleichgültigkeit aus. Sie sah mich unverwandt an. Plötzlich begann sie zu sprechen.
»Setzen Sie sich doch – bis Ihr Freund mit Nick fertig ist.«
Sie hatte eine affektierte Stimme, matt und künstlich – doch auch sie besaß eine seltsame Anziehungskraft –, sie klang irgendwie eindringlich, schleppend und gleichzeitig schön. Sie schien mir die apathischste Person zu sein, der ich je begegnet bin. Was von ihr ausging, war eine Apathie des Geistes, als ob sie alles auf der Welt für hohl und nichtig hielte.
»Miss Buckley war liebenswürdigerweise meinem Freund behilflich, als er sich heute Morgen den Knöchel verstauchte«, erklärte ich und nahm ihr Angebot an.
»Das hat Nick bereits erzählt.« Sie betrachtete mich noch immer träge. »Jetzt ist sein Knöchel wieder in Ordnung, oder?«
Ich fühlte, wie mir unter ihrem Basiliskenblick das Blut ins Gesicht schoss.
»Nur eine vorübergehende Zerrung«, erklärte ich.
»Oh! Gut, ich bin froh, dass Nick die ganze Sache nicht erfunden hat. Wissen Sie, sie ist die begnadetste Lügnerin auf Gottes Erdboden. Erstaunlich, aber es ist schließlich auch ein Talent.«
Ich wusste beim besten Willen nicht, was ich dazu sagen sollte. Meine Verlegenheit schien sie zu amüsieren.
»Nick ist eine meiner ältesten Freundinnen«, stellte sie fest, »und ich habe Loyalität immer für eine langweilige Tugend gehalten, und Sie? Mehr etwas für Schotten – so etwas wie Sparsamkeit oder Sonntagsgebote. Dabei ist Nick schließlich wirklich eine Schwindlerin, nicht wahr, Jim? Diese abenteuerliche Geschichte mit ihren Bremsen – Jim meint, da sei gar nichts dran gewesen.«
Der blonde Mann sagte mit weicher, wohltönender Stimme: »Und ich verstehe ein bisschen etwas davon.«
Er wandte seinen Kopf. Draußen zwischen den anderen Autos stand ein langer, roter Wagen mit einer langen, metallisch glänzenden Kühlerhaube. Es schien länger und intensiver rot als jedes andere Auto. Ein Superauto!
»Ist das Ihr Wagen?«, fragte ich aus einem plötzlichen Impuls heraus.
Er nickte.
Ich unterdrückte das wilde Verlangen zu sagen: »Genau danach sieht er auch aus!«
In diesem Augenblick kam Poirot zu uns zurück. Ich stand auf, er nahm mich am Ellbogen und zog mich mit einer schnellen Verbeugung davon.
»Es hat geklappt, mein Freund. Wir treffen uns um halb sieben mit Mademoiselle in ihrem Haus. Dann ist sie von ihrer Autopartie zurück. Ja, ganz sicher ist sie dann wieder zurück – und zwar heil und gesund.«
Er machte ein besorgtes Gesicht und auch sein Ton verriet Sorge.
»Was haben Sie ihr gesagt?«
»Ich bat sie um eine möglichst schnelle Unterredung. Natürlich reagierte sie zuerst ein wenig unwillig. Sie hat gedacht – ich konnte ihre Gedanken förmlich lesen: ›Wer ist nur dieser kleine Mann? Ist er ein Prolet, ein Hochstapler, ein Filmregisseur?‹ Sie war zunächst etwas unwillig und hätte gerne abgelehnt – aber das ist schwer – auf eine derart spontane Anfrage fällt eine Zusage leichter als eine Absage. Sie wird jedenfalls um halb sieben zu Hause sein. Ça y est!«
Ich stellte fest, das wäre dann wohl in Ordnung, aber meine Bemerkung wurde eher ungnädig aufgenommen. In der Tat war Poirot auf dem Sprung wie die sprichwörtliche Katze. Den ganzen Nachmittag tigerte er in unserem Wohnzimmer auf und ab, hielt leise Selbstgespräche, arrangierte ständig sämtliche Nippesfiguren neu und rückte sie gerade. Als ich ihn ansprechen wollte, winkte er nur ab und schüttelte den Kopf.
Schließlich brachen wir bereits um sechs vom Hotel auf.
»Es scheint alles so unwirklich«, bemerkte ich beim Hinuntergehen. »Jemanden im Hotelgarten erschießen zu wollen. Nur ein Verrückter würde so etwas tun.«
»Da bin ich ganz anderer Ansicht. Unter bestimmten Voraussetzungen wäre es sogar eine ziemlich sichere Sache. Zunächst muss es ein einsamer Garten sein. Hotelgäste sind wie eine Schafherde. Wenn es üblich ist, auf der Terrasse mit Meerblick zu sitzen – eh bien, also sitzen auch alle dort. Nur ich, der ich ein Individualist bin, ich sitze auf der Terrasse mit Gartenblick. Und auch da bemerkte ich nichts. Wie Sie vielleicht sehen können, gibt es genügend Deckung – Bäume, Palmen, blühende Sträucher. Jeder könnte ohne weiteres Mademoiselle auflauern. Und sie würde sicher diesen Weg entlangkommen. Von der Villa über die Landstraße würde es viel länger dauern. Mademoiselle Nick Buckley wird daher immer die Abkürzung wählen.«
»Und dennoch war es ein enormes Risiko. Man hätte ihn ja doch sehen können – und dann wäre es ihm unmöglich gewesen, die Schießerei als Zufall zu kaschieren.«
»Nicht als Zufall – das nicht.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nichts – nur eine kleine Idee. Sie mag funktionieren oder auch nicht. Lassen wir das jetzt mal außer Acht und wenden wir uns der eben erwähnten, notwendigen Bedingung zu.«
»Und zwar welcher?«
»Das können Sie mir doch sicher sagen, Hastings.«
»Nichts läge mir ferner, als Sie des Vergnügens zu berauben, sich auf meine Kosten schlau zu fühlen!«
»Oh! Dieser Sarkasmus! Diese Ironie! Nun, eine Tatsache ist doch überdeutlich: Das Motiv darf nicht auf der Hand liegen. Wenn dem so wäre – dann wäre das Risiko allerdings zu groß! Die Leute würden reden: ›Wer weiß, ob es Soundso war? Wo war Soundso, als der Schuss abgefeuert wurde?‹ Nein, die Person des Mörders – besser gesagt, des Möchtegernmörders – darf nicht eindeutig sein. Und das, Hastings, ist der Grund für meine Furcht. Jawohl, in diesem Augenblick habe ich Angst. Ich mache mir Mut. Ich sage mir: ›Sie sind zu viert.‹ Ich sage mir: ›Es wäre Wahnsinn.‹ Und dennoch habe ich Angst. Diese ›Unfälle‹ – ich möchte mehr darüber hören!«
Er drehte sich abrupt um.
»Es ist noch früh. Gehen wir den Weg über die Landstraße. Den Garten kennen wir bereits. Nehmen wir doch einmal den normalen Weg dorthin unter die Lupe.«
Dieser führte uns vom Haupteingang des Hotels rechts einen steilen Hügel hinauf. Der Weg endete in einem schmalen Pfad mit einem Schild: »Nach End House. Sackgasse.«
Wir folgten dem Pfad und nach ein paar hundert Metern machte er eine plötzliche Biegung und endete an einem morschen Eingangstor, dem vor allem ein wenig Farbe gutgetan hätte.
Rechts davon gab es ein kleines Pförtnerhaus, das in auffallendem Kontrast zu dem Tor und dem Zustand des grasbewachsenen Fahrwegs stand. Ein kleiner Garten war tipptopp gepflegt. Blütenweiße Vorhänge hingen an den Fenstern, die Rahmen und Läden waren frisch gestrichen.
Ein Mann in einer ausgeblichenen Norfolk-Jacke arbeitete über ein Blumenbeet gebeugt. Als das Tor quietschte, richtete er sich auf und drehte sich in unsere Richtung. Er war um die sechzig Jahre alt, mindestens einen Meter achtzig groß, massig und hatte ein wettergegerbtes Gesicht. Er war beinahe völlig kahl. Seine Augen leuchteten und funkelten in einem lebhaften Blau. Er schien ein angenehmer Zeitgenosse zu sein.
»Guten Abend«, wünschte er, als wir vorbeigingen.
Ich erwiderte seinen Gruß und als wir die Auffahrt entlanggingen, konnte ich förmlich spüren, wie uns diese blauen Augen neugierig nachstarrten.
»Ich wüsste zu gerne«, sagte Poirot nachdenklich.
Dabei beließ er es, ohne sich zu irgendwelchen Erklärungen herabzulassen, was er denn gerne wüsste.
End House war ein großes Haus und wirkte ziemlich düster. Die Bäume, deren Äste teilweise bis zum Dach reichten, schlossen es fast völlig ein. Ganz eindeutig war es reparaturbedürftig. Poirot bedachte es mit einem anerkennenden Blick, bevor er die Glocke betätigte – eine dieser altmodischen Glocken, für die man die Kräfte eines Herkules benötigte und die, einmal in Gang gesetzt, in vorwurfsvollem Ton immer weiterläutete.
Die Tür wurde von einer Frau mittleren Alters geöffnet – eine respektable Frau in Schwarz – so würde ich sie beschreiben. Sie wirkte sehr ehrbar, ein wenig kummervoll und völlig gleichgültig.
Miss Buckley, so sagte sie, sei noch nicht zu Hause. Poirot erklärte ihr, dass wir eine Verabredung hätten. Sie war einer der Menschen, die Fremden gegenüber zu Misstrauen neigen, weshalb es für ihn nicht leicht war. Ohne mir irgendwie schmeicheln zu wollen, nehme ich an, dass wohl eher meine Wenigkeit ihre Entscheidung positiv beeinflusste. Jedenfalls wurden wir weitergebeten und in das Empfangszimmer geführt, wo wir auf Miss Buckley warten sollten.
Der sonnige Raum mit Seeblick hatte absolut nichts Melancholisches an sich. In seiner schäbigen Gemütlichkeit lieferten sich die Stilrichtungen ein spannendes Duell. Billige, ultramoderne Vielfalt kämpfte gegen viktorianische Behäbigkeit. Waren die Vorhänge aus verblichenem Brokat, so strahlten die Möbelbezüge neu und fröhlich bunt, während die Kissen definitiv grell waren. An den Wänden hingen, wie ich fand, recht ordentliche Familienporträts. Neben dem Grammophon lagen willkürlich verstreut einige Schallplatten. Es gab ein Kofferradio, praktisch keine Bücher, nur eine Zeitung lag aufgeschlagen auf dem Sofa. Poirot nahm sie in die Hand – und legte sie mit einem abfälligen Gesichtsausdruck wieder zurück. Es war der St. Loo Herald. Irgendetwas veranlasste ihn, sie ein zweites Mal aufzunehmen, und er widmete sich gerade einem Artikel, als die Tür aufging und Nick Buckley den Raum betrat.
»Ellen, bringen Sie das Eis«, rief sie über die Schulter und kam dann auf uns zu.
»Also, hier bin ich – die anderen habe ich abgeschüttelt. Ich sterbe vor Neugierde. Bin ich etwa die lang gesuchte Heldin für einen Film? Sie waren so ernst und feierlich« – damit wandte sie sich an Poirot –, »dass es gar nichts anderes sein kann. So machen Sie mir doch schon ein anständiges Angebot.«
»Ach, wie schade, Mademoiselle …«, setzte Poirot an.