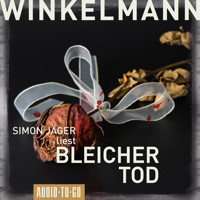9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kerner und Oswald
- Sprache: Deutsch
Leni kommt nach Hamburg, um dort ein Praktikum zu machen. Über eine Zimmervermittlung mietet sie sich in einer Villa am Kanal ein. Schnell freundet sie sich mit ihrer Zimmernachbarin an – aber die ist am nächsten Morgen spurlos verschwunden. Weil ihr das merkwürdig vorkommt, sucht sie nach ihr. Freddy Förster, früher erfolgreicher Geschäftsmann, ist inzwischen auf der Straße gelandet. Zufällig beobachtet er, wie jemand einen Mann am Steuer seines Autos erschießt. Um nicht zum nächsten Opfer zu werden, sucht er den Mörder. Bis er auf Leni trifft, die das Verschwinden ihrer neuen Freundin nicht hinnehmen will. Bald begreifen die beiden, dass ihre beiden Fälle mehr miteinander zu tun haben, als ihnen lieb ist – und dass sie in großer Gefahr schweben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Das Haus der Mädchen
Thriller
Über dieses Buch
Leni kommt nach Hamburg, um dort ein Praktikum zu machen. Über eine Zimmervermittlung mietet sie sich in einer Villa am Kanal ein. Schnell freundet sie sich mit ihrer Zimmernachbarin an – aber die ist am nächsten Morgen spurlos verschwunden. Weil ihr das merkwürdig vorkommt, sucht sie nach ihr.
Freddy Förster, früher erfolgreicher Geschäftsmann, ist inzwischen auf der Straße gelandet. Zufällig beobachtet er, wie jemand einen Mann am Steuer seines Autos erschießt. Um nicht zum nächsten Opfer zu werden, sucht er den Mörder.
Bis er auf Leni trifft, die das Verschwinden ihrer neuen Freundin nicht hinnehmen will. Bald begreifen die beiden, dass ihre beiden Fälle mehr miteinander zu tun haben, als ihnen lieb ist – und dass sie in großer Gefahr schweben …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildung esemelwe;duncan1890/Getty Images, shutterstock, textures.com
ISBN 978-3-644-40480-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meinen Freund Markus Knüfken. Ein Abenteurer wie ich.
Alle Personen dieser Geschichte sind frei erfunden, jegliche Übereinstimmung mit der Realität ist unbeabsichtigt. Einige Orte, wie die Kanäle und die Straße Eilenau in Hamburg, gibt es aber wirklich. Nicht jedoch das Haus mit der Nummer 39b, auch das ist frei erfunden. Aber es könnte ein solches Haus geben – denken Sie immer daran, wenn Sie Ihren Urlaub planen!
Kapitel 1
1.
Der Mann am Straßenrand erinnerte Oliver an einen Untoten. Groß und vogelscheuchendürr, schlich er gebückt durch den feinen Nieselregen, die Schultern nach vorn gebeugt, das Kinn auf der Brust. Seine Arme schlenkerten hin und her, als habe er keine Kontrolle über sie, er torkelte auf steifen Beinen von einer Seite des Gehsteiges zur anderen. Die Straßenlaternen übergossen ihn mit schmutzig fahlem Licht. Sein langer Mantel reichte ihm bis in die Kniekehlen, die losen Enden des Gürtels wehten hinter seinem Rücken wie zwei zusätzliche Arme.
Eine Nachtgestalt, wie es sie viele gab in der Stadt, ein obdachloser Streuner auf der Suche nach einem Lager. Vielleicht hatte ihn jemand fortgejagt von dem Platz, an dem er es sich für die Nacht bequem gemacht hatte. Das Leben auf der Straße war gefährlich. Erst vor zwei Wochen war ein Landstreicher im Stadtpark von Unbekannten angezündet worden. Mit schwersten Brandverletzungen war er in die Notaufnahme gekommen, wo Oliver ihn im Vorbeigehen gesehen hatte. Ein Klumpen Fleisch, mit der Kleidung verschmolzene schwarze Krusten, hie und da nässende rote Inseln. Nur Beine und Füße waren unversehrt geblieben, und der sportlich-fröhliche Nike-Schriftzug auf den verdreckten neongelben Laufschuhen hatte sich Oliver tief ins Gedächtnis eingebrannt. In dem Moment war er froh gewesen, als Krankenpfleger auf Station zu arbeiten und nicht in der Notaufnahme. Zwar bekam er auch dort Schlimmes zu sehen, hatte aber deutlich mehr Zeit, sich darauf einzustellen.
Der Untote auf dem Gehweg torkelte gegen einen Laternenpfahl, hielt sich einen Moment daran fest, stieß sich ab und driftete zur Fahrbahn hin. Falls er stürzte, würde Oliver ihm helfen müssen. Wegsehen und weiterfahren verbot ihm die Berufsehre, aber mitten in der Nacht seinen Wagen zu verlassen, um einem offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann zu helfen, ängstigte ihn.
Der Fremde erreichte eine Bahnunterführung, tauchte in die Dunkelheit darunter ein, und als er auf der anderen Seite in den orangefarbenen Lichtschein der Bogenlampe geriet, drehte der Mann sich plötzlich um, hob die Hand und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Oliver, so als wolle er ihn wissenlassen, dass er ihn sehr wohl bemerkt hatte.
Olivers Herz setzte einen Schlag aus. Sein Fuß senkte sich automatisch aufs Gaspedal. Der alte Corsa hoppelte, wollte absaufen, überlegte es sich im letzten Moment anders und machte einen Satz nach vorn. Er schoss an dem Mann vorbei. Im Rückspiegel sah Oliver ihn winken.
In einiger Entfernung leuchtete eine Ampel rot. Oliver nahm den Fuß vom Gas und ließ den Wagen ausrollen. Mit einem Blick in den Rückspiegel überzeugte er sich davon, dass der Zombie ihm nicht folgte.
An der Ampel wartete bereits ein alter weißer Fiat-Kastenwagen. Nieselregen zog durch das Streulicht seiner Bremsleuchten. Aus dem verrosteten Auspuffrohr tuckerten in Stößen dunkle Abgase, so als habe der Wagen starken Husten.
Sicher einer dieser Zeitungsverteiler, die jede Nacht unterwegs waren, um an bestimmten Stellen zusammengeschnürte Pakete zu deponieren, von denen sich die Verteiler bedienten. Dann bemerkte Oliver das polnische Kennzeichen. Vielleicht waren es doch eher Wanderarbeiter auf dem Weg zu einer der zahllosen Baustellen in der Stadt.
Zwei Dinge geschahen gleichzeitig.
Die Ampel schaltete auf Gelb, und hinter der schmutzigen Heckscheibe in der rechten Tür des Kastenwagens tauchte eine Hand auf, klatschte gegen das Glas und rutschte daran herunter. Die weit gespreizten Finger hinterließen eine blutige Spur.
Das Ganze dauerte nur so lange, wie die Ampel brauchte, um auf Grün zu springen, und während Oliver wie erstarrt hinter dem Steuer saß, zog der Kastenwagen davon, eine schwarze Abgaswolke hinter sich herziehend.
Oliver fuhr nicht weiter. Er atmete auch nicht, bis die Ampel über Gelb wieder auf Rot schaltete. Das Signallicht riss ihn aus der Schockstarre, und er fragte sich, ob er das gerade wirklich gesehen hatte. Eine blutige Hand im Innenraum des alten Kastenwagens?
Das konnte nicht sein! Er war übermüdet und verwirrt, wahrscheinlich wurde er krank, seine Sinne spielten ihm Streiche, so wie eben mit dem Zombie.
Als die Ampel wieder auf Grün sprang, gab er Gas, drückte richtig auf die Tube, der altersschwache Motor des Corsa heulte auf, als er bis in den Vierten hochschaltete. Hinter der abknickenden Vorfahrt einer scharfen Rechtskurve entdeckte er den weißen Kastenwagen, bevor der nach links in eine Seitenstraße einbog. Oliver setzte ordnungsgemäß den Blinker und folgte ihm.
Erkältung und Müdigkeit hin oder her, Oliver glaubte nicht daran, sich getäuscht zu haben. Dafür war das Bild vor seinem inneren Auge zu real. Die verkrümmten Finger, das Handgelenk mit diesen bunten Freundschaftsbändern, die blutigen Streifen an der schmutzigen Scheibe.
Die Straße führte in ein Industriegebiet, das sich bis zum Hafen hin erstreckte. Hier fuhr Oliver nie entlang, auch wenn es auf der Strecke zu seiner Wohnung eine Abkürzung gewesen wäre. Die Gegend war ihm unheimlich. Zu viele dunkle Ecken, zu viele verfallene Hallen, verrostete Schienenstränge und fensterlose Häuserfassaden.
Schnell holte er den Kastenwagen ein und sah schon von weitem den blutigen Handabdruck an der Scheibe.
Oliver zog sein Handy hervor, um während der Fahrt ein Foto zu schießen, auf dem sowohl der Handabdruck als auch das polnische Kennzeichen zu erkennen waren. Dafür musste er dicht auffahren. Als plötzlich die Bremsleuchten des Kastenwagens aufleuchteten, stieg Oliver voller Schreck auf die Bremse. Der Corsa bockte und brach nach rechts aus. Oliver packte mit beiden Händen das Lenkrad, das Handy fiel in den Fußraum, der Straßenrand mit der schroff aufragenden Mauer kam rasend schnell näher. Oliver schrie, kurbelte am Lenkrad, der Corsa änderte die Richtung, rammte ein paar Meter weiter ein Straßenschild, soff ab und blieb stehen. Das Schild kippte mit der Kante auf die Windschutzscheibe, blitzartig breitete sich darauf ein Riss aus.
Mit weit aufgerissenen Augen saß Oliver da.
Stille.
Tiefe, eindringliche Stille.
An der rechten Straßenseite stand eine alte Tankstelle ohne Tanksäulen, in der sich eine Werkstatt für Autoglas befand. Sprung im Glas, wir machen das, hieß es auf einer Werbetafel vorn am Überdach.
Sekunden vergingen, die sich wie Minuten anfühlten. Oliver presste sein Gesicht gegen das Lenkrad, griff zwischen seinen Beinen hindurch nach hinten, tastete nach seinem Handy und fand es unter dem Sitz. Mit den Fingerspitzen versuchte er, es zu sich herzuziehen, ohne dabei die Straße aus den Augen zu verlieren.
In einiger Entfernung tauchten aus der Richtung, in der der Kastenwagen verschwunden war, Scheinwerfer auf. Mattgelbes Licht, wie es die alten Fahrzeuge noch hatten. Kein Xenon, kein Neon – eher eine Kerze hinter Glas.
«Komm schon, komm schon.» Oliver geriet ins Schwitzen, bekam die glatte gläserne Kante des Handys aber nicht richtig zu fassen.
Die Scheinwerfer kamen näher und näher, hielten unaufhaltsam auf ihn zu.
In Panik verriegelte Olli die Türen. Sein Herz raste, und sein Atem kondensierte an der Seitenscheibe.
In weniger als zwei Metern Entfernung rollte der weiße Kastenwagen langsam an ihm vorbei. Wegen der beschlagenen Scheibe war es Oliver nicht möglich, Details zu erkennen. Was er sah, war der helle Fleck eines Gesichts mit den Augen darin, die zu ihm herüberstarrten. Täuschte er sich, oder leuchteten sie wirklich rot?
Oliver verdrehte seinen Hals, um dem Wagen hinterherschauen zu können. Plötzlich flammten die Bremsleuchten auf, und der Fiat wendete auf der Fahrbahn.
«Nein, nein, nein!», rief Oliver und tastete wie von Sinnen nach seinem Handy.
Die gelblichen Scheinwerfer tauchten im Rückspiegel des Corsa auf.
Oliver wusste, er musste hier weg. Seine einzige Chance lag in der Flucht. Allerdings stand sein Wagen noch immer mit der Schnauze an dem gekippten Verkehrsschild. Zurück konnte er nicht, weil hinter ihm der Kastenwagen heranrollte. Er saß in der Falle!
Die Scheinwerfer blendeten auf. Helles Licht flutete den Innenraum des kleinen Corsa. Endlich konnte Olli mit den Fingerspitzen sein Handy berühren, war aber zu hektisch und stieß es nur noch weiter unter den Sitz.
Im selben Moment flog die Fahrertür des Fiat auf.
Eine Gestalt im schwarzen Regenmantel stieg aus und tauchte an der Seitenscheibe des Corsa auf. Sie klopfte gegen das Glas. Nur leicht, ohne Nachdruck, so als sei dies ein Vorschlag und kein Befehl.
Oliver war vor Angst wie gelähmt. Selbst wenn er gewollt hätte, hätte er sich nicht bewegen können. In diesem Moment hasste er sich dafür, nicht mutiger zu sein.
Die Hand klopfte noch einmal, jetzt fordernder. Dann machte sie ein eindeutiges Zeichen: Er solle die Scheibe herunterkurbeln.
Obwohl eine Stimme in seinem Kopf schrie, es nicht zu tun, überwand Oliver seine Lähmung, erfasste die Kurbel und ließ die Scheibe ein paar Zentimeter herunter.
«Alles in Ordnung?», fragte der Fremde.
«Ja … danke, ich …»
«Brauchen Sie Hilfe?»
«Nein … ich … es geht schon, die Polizei müsste jeden Augenblick hier eintreffen.»
Oliver wusste nicht, warum er das sagte, es kam einfach so aus ihm heraus.
Einen Augenblick lang sagte der Fremde nichts, und Oliver gab sich schon der Hoffnung hin, die Warnung hätte Wirkung gezeigt.
«Steig aus», befahl der Mann ruhig, fast schon sachlich und mit einer Eiseskälte, wie Oliver sie noch nie gehört hatte. Das Fünkchen Hoffnung erlosch.
Oliver schüttelte den Kopf und kurbelte die Scheibe wieder hoch. Durch den von den Gummilippen freigewischten Spalt sah er, wie der Mann eine Waffe aus dem Hosenbund zog und den Lauf auf das Fenster richtete.
Er schoss, ohne zu zögern.
Das Fenster zerbarst, und Oliver spürte etwas heiß in seine linke Schulter eindringen. Der Schmerz war nicht so schlimm, aber sein Arm war von einer Sekunde auf die andere gelähmt. Warmes Blut lief seinen Rücken hinab. Die Kugel war glatt durch seine Schulter hindurchgegangen.
Mit dem Griff der Waffe schlug der Mann das restliche Glas heraus. Oliver schrie, strampelte mit den Füßen und lehnte sich halb auf den Beifahrersitz hinüber. Der Fremde zog den Verriegelungsknopf an der Tür hoch und öffnete sie.
Dann hob er die Waffe, und Olli blickte in das kleine schwarze Mündungsloch.
Er riss die rechte Hand hoch und hielt sie schützend vor sein Gesicht.
«Bitte … bitte nicht … ich hab doch gar nichts geseh…»
Die Kugel durchschlug seine Hand und drang in seinen Kopf ein.
2.
Zwei Tage später
Ihr Zug erreichte den Hamburger Hauptbahnhof mit zweistündiger Verspätung. In der großen Halle roch es nach Abgasen und zerriebenem Metall. Leni zog den schweren Rollkoffer über den Bahnsteig hinter sich her und spürte, wie sich Müdigkeit und Stress hinter den Schläfen durch ein unangenehmes Pochen bemerkbar machten. In den Bahnhofshallen war einiges los. Die Menschen irrten scheinbar hektisch und ziellos umher, jeder ganz bei sich selbst und ohne Rücksicht auf andere. Durch ständiges Ausweichen versuchte Leni Zusammenstöße zu verhindern. Niemand achtete auf sie. Die Leute schauten auf ihre Handys, Reisepläne, zur Seite, auf ihre Füße oder stur geradeaus. Nur keinen Blickkontakt aufnehmen. Als sie den Ausgang erreichte, war Leni sogar noch genervter, dabei hatte sie schon geglaubt, diese Chaoszugfahrt sei nicht zu toppen. Eines stand fest: Bahnfahren war nicht ihr Ding und würde es auch niemals werden. Sie tat es, weil sie kein Auto besaß und dazu gezwungen war, denn beim Busfahren wurde ihr schlecht. Wenn sie erst einmal genug Geld verdiente, würde sie sich als Allererstes einen vernünftigen Wagen zulegen, mit dem sie fahren konnte, wann und wohin sie wollte. Und zwar ohne Kontakt zu anderen Menschen.
Bis dahin war es aber noch ein langer Weg, das wusste sie. Immerhin war dieses Praktikum beim Verlag ein wichtiger Schritt zum Ziel – auch wenn es erst einmal kein Gehalt gab, sondern nur eine Art Aufwandsentschädigung.
Sehnsüchtig sah Leni zu der Reihe wartender Taxis hinüber. Die Adresse, unter der sie über die Online-Zimmervermittlung BedtoBed.com – einen neuen und wesentlich kleineren Konkurrenten von AirBnB – ein Zimmer für die nächsten drei Wochen gemietet hatte, lag vom Bahnhof drei Kilometer entfernt.
Sie schaute zum Nachthimmel hinauf. Wenigstens war es trocken und für diese Zeit sogar noch warm.
Die Kleidung klebte nach sieben Stunden im ICE, in dem die Klimaanlage ausgefallen war, an ihrem Körper, sie fühlte sich schmutzig und unwohl und sehnte sich nach einer Dusche. Nach einem Bett. Nach so etwas wie einem Zuhause, in dem sie für sich sein konnte. Unter Menschen zu sein stresste Leni, das war schon immer so gewesen. Vielleicht liebte sie Bücher deshalb so sehr. In Geschichten konnte man Menschen kennenlernen, ohne ihnen persönlich begegnen zu müssen. Man hatte Zeit, nachzudenken, sich ein Bild zu machen, abzuwägen – alles, was in der schnellen Welt von heute fehlte. Bücher waren für Leni die bessere Realität, denn sie sorgten für den richtigen Abstand.
In einem weiten Bogen zog sie an den wartenden Taxis vorbei und warf aus den Augenwinkeln neidische Blicke zu anderen Reisenden hinüber, die sich eines leisten konnten. Jemanden zu fragen, ob sie mitfahren dürfe, war keine Option für sie. Das fiel in die gleiche Kategorie, wie per Anhalter zu fahren. Viel zu gefährlich! Außerdem lag es ihr nicht, Fremde anzusprechen und um Hilfe zu bitten.
Drei Kilometer waren schließlich noch zu bewältigen.
Da es ihr erster Besuch in Hamburg war und sie sich überhaupt nicht auskannte, nutzte sie zum Navigieren ihr Handy. Aber auch das war nicht so einfach, wenigstens nicht für Leni. Sie kannte sich nicht besonders gut mit diesen ganzen Apps aus.
Sie lief und lief. Hievte den schweren Koffer über Bordsteine, umkurvte Schlaglöcher, suchte Schilder mit Straßennamen, glich die Karte auf dem Display mit der Realität ab, die irgendwie anders aussah, ging in falsche Richtungen und wieder zurück. Vor einer besonders hohen Kante blieb eine der beiden Rollen des Koffers zwischen den Metallstreben eines Kanaldeckels hängen. Leni riss und zog, die Rolle brach ab und blieb im Kanaldeckel stecken.
«Ach, komm schon, bitte nicht», flehte sie und spürte Verzweiflung aufsteigen.
Sie versuchte, die Rolle zu befreien, um sie vielleicht irgendwie wieder am Koffer anzubringen, konnte sie aber nicht zwischen den Streben herauslösen. Zu allem Überfluss vertrieb ein laut hupender Bus sie von der Straße. Leni gab auf und ging weiter. Mit Schlagseite eierte der schwere Koffer über den Asphalt kratzend hinter ihr her.
Nach mehr als einer Stunde Fußmarsch erreichte sie die Straße, in der ihr Domizil für die nächsten drei Wochen lag.
Die Eilenau.
Zu behaupten, sie sei fix und fertig, traf es nicht wirklich. Leni fühlte sich mehr tot als lebendig, sie stank so sehr nach Schweiß, dass sie sich selbst riechen konnte, ihre Füße brannten, und ihre Knie taten weh. Sie wusste, mit sechsundzwanzig sollte man sich nach einem Fußmarsch nicht wie ein alter Mensch fühlen, man sollte fitter sein und so etwas leicht wegstecken. Aber sie war eben nicht fit. Wer in diesem Alter schon dreitausend Bücher gelesen hatte, kam nicht dazu, auch noch ins Fitness-Studio zu gehen. Und selbst wenn – Leni hatte daran kein Interesse.
Sie stützte sich an einem Poller ab, der unbefugtes Parken verhinderte, atmete tief ein und aus und betrachtete ihre Umgebung. Auf der rechten Seite der Straße verlief ein Kanal. Die Wasseroberfläche lag vier Meter tiefer als die Straße, war vielleicht sechs, sieben Meter breit und so glatt wie Fensterglas. Mächtige Weiden wuchsen auf dieser Seite des Kanals, ihre langgliedrigen Äste hingen bis ins Wasser, und in ihrem Laub schimmerte das orangefarbene Licht der Straßenlaternen. Am Ufer lagen Hausboote vertäut. Sechs Stück zählte Leni, die so etwas noch nie gesehen hatte. Es waren flache Boote mit modernen Aufbauten aus Metall und Holz. In einem von ihnen brannte Licht hinter weißen Vorhängen, in einem anderen flackerte ein Fernseher. Das sah gemütlich aus, wie ein Zuhause, eine Zuflucht in der Natur mitten in der Stadt. Aber Leni hatte Angst vor Wasser; sie hätte sich nie in ein solches Hausboot gewagt.
Auf brennenden Füßen ging sie weiter und achtete auf die Hausnummern. Alte, stuckverzierte Kaufmannsvillen standen hier neben gesichtslosen Bauten aus den siebziger Jahren. Ungefähr in der Mitte der Eilenau fand Leni Haus Nummer 39b.
Ein imposanter Bau!
Fünf Stockwerke hoch, Stuck an der vorderen Fassade sowie eine Einfahrt zur Tiefgarage. Das Haus sah weder besonders gepflegt noch ungepflegt aus, so als kümmerten sich nicht die Besitzer der Wohnungen darum, sondern irgendwelche Dienstleister. Das große, üppig begrünte Grundstück war von der Straße durch eine Mauer mit eingelassenen, schmiedeeisernen Elementen getrennt. Nach oben hin spitz zulaufende Metallstangen vermittelten einen wehrhaften, abweisenden Eindruck.
Alles in allem ganz in Ordnung, dachte Leni. Es lag kein Müll vor der Tür, und es lungerten keine Junkies herum.
Sie wollte eben zwischen zwei geparkten Autos hervortreten und die Straße überqueren, da schoss von links ein flacher silberner Sportwagen mit schwarzem Cabriodach heran. Der Motor klang hart und trocken, im Inneren wummerten Bässe. Leni kannte sich mit Autos nicht besonders gut aus, hielt den Wagen aber für einen Porsche.
Mit quietschenden Reifen stoppte er genau vor Nummer 39b.
Leni zog den einen Fuß, den sie bereits auf die Straße gesetzt hatte, wieder zurück und verbarg sich zwischen den geparkten Autos.
Die Beifahrertür sprang auf, ein Schwall lauter Musik schwappte in die Nacht, nackte lange Beine glitten aus dem Wageninneren, und spitze High Heels berührten den Asphalt. Leni sah unter dem unanständig kurzen schwarzen Lederrock ein weißes Höschen aufblitzen.
Die Frau wollte aussteigen, doch eine gebräunte Hand packte sie im Nacken und zog sie ins Wageninnere zurück. Die Frau schrie, und als ihre Hand verzweifelt nach der Tür griff, war Leni klar, dass dies kein Spaß war. Die Frau wurde gegen ihren Willen im Wagen festgehalten.
Leni wusste, sie musste handeln, sofort, aber da war diese Sperre in ihrem Inneren, die sie daran hinderte. Eine Art Überlebensinstinkt, der ihr davon abriet, sich in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen. Vielleicht war es klüger, sich versteckt zu halten und einfach nur den Notruf zu wählen. Dies war eine Großstadt, die Polizei wäre sicher schnell vor Ort.
Doch in dem Sportwagen schrie die Frau, und niemand außer Leni hörte es. Egal, wie schnell die Polizei auch sein würde, sie wäre niemals rechtzeitig hier.
«Also gut … also gut», flüsterte Leni und trat auf die Straße.
3.
Während Jana wartete, spielte sie mit den Freundschaftsbändern an ihrem Handgelenk, knibbelte nervös daran herum, löste einzelne Fäden und zerfranste sie.
Mit einem lauten Pling fiel der Wassertropfen in die runde Metallschüssel. Der Abstand zwischen den einzelnen Tropfen betrug zwanzig Sekunden, das hatte Jana Heigl durch Mitzählen herausgefunden, und bis der Boden der großen Schüssel bedeckt war, dauerte es ungefähr drei Minuten. So lange musste sie warten, bis aus dem Pling-Pling wieder ein leises Platschen wurde. Das Geräusch ertrug sie besser, es war sanfter und fraß sich nicht so tief in ihren Kopf. Aber sie wusste auch, dass sie spätestens nach fünf Minuten durch die Gitterstäbe greifen, die Schüssel zu sich heranziehen und sie in einem Zug leeren würde. Das Wasser darin, nicht mehr als ein Mundvoll, war klar und kalt, schmeckte unglaublich gut und linderte für einen Moment das Brennen in ihrer Kehle und den ekelhaften Geschmack in ihrem Mund.
Jana starrte zu der niedrigen Gewölbedecke hinauf, wo sich an einem Spalt zwischen den Backsteinen ein neuer Tropfen bildete. Langsam schwoll er an, wurde dicker und dicker, bis die Schwerkraft ihn von der Decke riss. Sie folgte ihm mit den Augen und beobachtete seinen Aufprall in der Schüssel. Ein wenig spritzte aus der Schüssel heraus auf den Steinboden, und Jana trauerte um diese verlorene Flüssigkeit. Ihr Durst war unmenschlich, sie hätte die Feuchtigkeit vom Boden geleckt, wenn sie herangekommen wäre.
Automatisch fuhr ihre Zunge über ihre trockenen, rissigen Lippen. Ihre Kehle fühlte sich so wund an wie damals mit zwölf, als man ihr die Mandeln herausoperiert hatte. Sie wusste noch, wie enttäuscht sie gewesen war, als es statt des erhofften Vanilleeises nur glasklare und geschmacklose Eiswürfel gegeben hatte.
Das Leben war voller Enttäuschungen.
Pling.
Wieder ein Tropfen.
Zehn, vielleicht zwanzig mussten noch folgen, bis das Geräusch sich änderte und sie darüber nachdenken konnte, erneut zu trinken.
Dieses Sich-Zusammenreißen kostete sie unermesslich viel Kraft. Sie war ein ungeduldiger Mensch, der ungeduldigste der Welt, wie Niklas oft sagte.
Der Gedanke an Niklas machte sie traurig. Sie wusste ja, wie sehr er sich um sie sorgte und dass er sie liebte, auch wenn er es nicht immer zeigte. Dieser Streit war unnötig gewesen, sie hätte nicht auf dem Kurzurlaub bestehen sollen – und schon gar nicht hätte sie ohne ihn fahren dürfen. Jetzt bereute Jana es, sich nicht von Niklas verabschiedet zu haben. Sie war einfach gegangen, ohne ihm die Chance auf eine Versöhnung zu geben. Sie hatten gemeinsam eine Städtetour durch Deutschland geplant, er wusste also, dass sie zuerst nach Hamburg, danach nach Berlin und über Köln zurück nach München wollte, aber er wusste nicht, wo sie wann sein würde.
Bestimmt suchte er bereits nach ihr, zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder. Jana vermisste sie alle, und an sie zu denken tat ihr in der Seele weh. Wenn sie nur nicht immer ihren Dickkopf durchsetzen müsste! Warum nur stieß sie die Menschen, die sie liebte, ständig vor den Kopf?
In der schier endlosen Zeit, die sie in diesem Gewölbe gefangen gehalten wurde, hatte sie geweint und gebetet und sich selbst und Gott versprochen, zukünftig netter zu ihren Liebsten zu sein.
Sie wusste nicht, wo sie war und wie sie hierhergekommen war, konnte sich nur an einige Augenblicke erinnern, die wie Stroboskop-Blitze vor ihrem inneren Auge auftauchten. Die Autofahrt, das Rumpeln und Schaukeln, der Spalt zwischen den beiden Türen, durch den sie hinausschauen konnte, weil ein Gummi fehlte. Der kleine silberne Wagen mit dem blonden Mann am Steuer. Ihre blutige Hand an der Scheibe, der Abdruck daran, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Obwohl es weh tat, weil ihre Haut an den Handgelenken wundgescheuert war, war es ihr gelungen, diese Fessel abzustreifen, nicht jedoch die Fußfessel, die mit einer Metallöse am Wagenboden verbunden war.
Ihre nächste Erinnerung setzte in diesem Gewölbe ein. Nackt in einen wärmenden Schlafsack gehüllt, war sie auf einem weichen Bett erwacht. Sie hatte die Augen aufgeschlagen und zuallererst das metallene Schild an der Wand gesehen.
Wer schweigt, überlebt.
Plopp.
Da war er, der erste Tropfen, der in eine geschlossene, ausreichend hohe Wasserschicht fiel und deshalb ein anderes Geräusch erzeugte. Jana schluckte trocken. Sie hatte fast dreißig Jahre alt werden müssen, um zu erfahren, wie sich wirklicher Durst anfühlte und was er mit dem Verstand machte: Er schaltete ihn quasi ab. Nichts anderes als der Durst selbst und der Wunsch, trinken zu können, spielten dann noch eine Rolle. Angst nicht, Schmerzen nicht, Liebe nicht. Der Durst war ein gnadenloser Diktator, der keine anderen Gefühle neben sich duldete.
Das Geräusch einer zufallenden Tür riss Jana aus ihren Gedanken. Einen Moment lang glaubte sie, ein Vibrieren in der Wand zu spüren, an der sie mit dem Rücken lehnte. Schließlich hörte sie ein Schaben und Kratzen – ein furchterregendes Geräusch, so als lebte etwas Großes in den Wänden.
Jana schob sich an der Wand empor und behielt das schwarze, halbrunde Loch im Blick, aus dem die Geräusche anscheinend drangen. Es befand sich rechts von ihr zwischen zwei gewaltigen Stützpfeilern, die die niedrige Gewölbedecke trugen, war kaum höher als einen halben Meter und sah aus wie der Zugang zu einer Höhle.
Sie war sich ganz sicher: Von dort kam das Schaben und Kratzen.
Es wurde lauter, intensiver, ein qualvolles Keuchen gesellte sich hinzu, und Jana lief es kalt den Rücken hinab. Sie hätte nicht geglaubt, dass ihre Angst noch steigerungsfähig war – jetzt wurde sie eines Besseren belehrt.
Jana spürte, wie sich ein Schrei in ihr aufbaute.
Wer schweigt, überlebt.
Und sie wollte überleben, unbedingt, deshalb schlug sie sich die Hand vor den Mund, sperrte den Schrei ein, der sich als ein dumpfes, gequältes Geräusch dahinter entlud.
Denn in diesem Moment schob sich der Kopf eines grauenvollen Wesens aus dem Loch hervor.
4.
Leni nahm ihren Mut zusammen und trat auf die Straße.
«Hey! Was machen Sie da! Hören Sie sofort auf!»
Zivilcourage war schließlich wichtig!
Im letzten Sommersemester an der Uni, wo sie literarisches Schreiben studierte, hatte Leni einen Kursus belegt für richtiges Verhalten in gefährlichen Situationen. Sei laut, hatte der Trainer ihr eingebläut. So laut du kannst! Schrei, mach andere auf dich aufmerksam, gebärde dich meinetwegen wie eine Verrückte, aber sei auf keinen Fall ein stilles stummes Opfer. Und wenn du ein stilles stummes Opfer siehst, dann sei du seine Stimme. Die Welt hört nur noch die, die lauter sind als das feige Schweigen.
Leni schrie jetzt, und zwar richtig laut, aber im Wagen schien sie wegen der noch lauteren Musik niemand zu hören. Sie musste näher heran.
Zwei Schritte, mehr nicht. Sich selbst in Gefahr zu bringen war keine vernünftige Strategie, auch das hatte der Trainer gesagt.
Die schmale Hand der Frau klammerte sich noch immer an den Türholm, ihre Beine strampelten in der Luft, der Rock war hochgerutscht, sodass Leni jetzt den ganzen Slip sehen konnte. Weil der Sportwagen so niedrig war, blieb alles andere, was sich im Inneren abspielte, vor ihr verborgen.
«Ich rufe die Polizei», schrie Leni lauthals.
Diesmal hörte man sie.
Jemand regelte die Lautstärke der Musik herunter. Die Frau kam aus dem Dunkel unter dem Cabriodach hervor. Sie floh aber nicht, wie Leni es erwartet hatte, sondern blieb auf der Kante des Sportsitzes hocken. Ihr langes blondiertes Haar sah zerrupft aus, die Lippen waren viel zu stark geschminkt, die weit geöffnete Bluse entblößte mehr als nur den Brustansatz. An den Ohrläppchen trug sie auffällige silberne Ohrringe in Form von Indianerfedern.
«Was bist du denn für eine?», fragte sie und knöpfte die oberen beiden Knöpfe der Bluse zu.
«Soll ich noch mit raufkommen oder nicht?», fragte der Mann am Steuer des Wagens.
«Nee, lass mal, muss morgen früh raus», antwortete die Blondine.
Sie stieg aus und strich den Rock glatt. Eine wunderschöne Frau mit schlanker Taille, weiblicher Hüfte und großer Oberweite, eine Frau, wie Leni sie niemals sein würde.
«Ich … ich dachte …», stotterte Leni.
«Schon klar, was du dachtest, aber hier ist alles in Ordnung. Kannst weitergehen.»
«Dann mach endlich die Tür zu», rief der Fahrer, und für den Bruchteil einer Sekunde sah Leni im Wageninneren seine Hand. Sie ruhte auf dem Schalthebel, war braun gebrannt, und ums Handgelenk lag eine goldene Kette mit übertrieben dicken Gliedern.
«Geht’s noch!», fuhr die Blondine ihn an und schlug die Tür zu.
Der Motor röhrte auf, und der Sportwagen schoss davon.
«Arschloch!», rief die Frau ihm hinterher, dann wandte sie sich Leni zu.
«Was ist? Warum glotzt du mich so an?»
«Ich … nichts …» Leni sah zu Boden.
«Was machst du überhaupt um diese Zeit hier auf der Straße?»
«Ich wohne da drüben.»
«Da?» Die Blondine zeigte auf das Haus Nummer 39b.
Leni nickte.
«Seit wann?»
«Seit heute … quasi. Ich komme gerade eben an.»
Leni spürte, wie die Blondine sie eingehend musterte. Schließlich stolzierte sie auf ihren unfassbar hohen und schmalen Absätzen auf sie zu.
«Dann sind wir quasi Nachbarinnen, du und ich. BedtoBed-Zimmer?»
Leni sah auf und nickte.
«Ich auch. Eine Woche Party in Hamburg. Ich angele mir einen Millionär. Soll ja genug davon geben hier. Und du?»
«Ich bin für ein Praktikum in der Stadt.»
«Ja, so siehst du auch aus. Lass mich raten. Du kommst aus der Provinz und warst noch nie in einer Metropole wie Hamburg.»
«So ähnlich.»
Leni dachte nicht daran, der Frau zu verraten, wie unglaublich provinziell der Ort war, aus dem sie stammte. Es gefiel ihr dort, aber sie hatte auch immer gewusst, dass ihre Heimat für sie keine Zukunft bereithielt. Ein öder Ort für alte Menschen, die tagein, tagaus an den Fenstern hockten, Zeit und Leben ungenutzt verstreichen ließen, Geister schon zu Lebzeiten. Nicht einmal Internet gab es in Sandhausen. Man musste auf den einzigen Hügel des Ortes hinauf, um ein wenigstens einigermaßen gutes LTE-Signal zu bekommen.
Die Blondine lachte und streckte ihre Hand aus.
«Ich bin Vivien. Und du?»
«Leni.»
«Okay, Leni Landei, dann lass uns mal von der Straße verschwinden, bevor ein irrer Killer in einem Porsche uns entführt und zu Tode foltert.» Vivien lachte lauthals auf, ein richtiges Männerlachen, und ging voran. Leni folgte ihr, den eiernden Koffer hinter sich herziehend. Sie hatte die Ironie im letzten Satz sehr wohl verstanden und ärgerte sich ein wenig darüber. Es hatte sie Überwindung und Mut gekostet einzugreifen, und jetzt machte sich diese aufgebrezelte Blondine über sie lustig.
«Wolltest du mir gerade wirklich helfen?», fragte Vivien auf dem Weg zur schmiedeeisernen Pforte.
«Entschuldige bitte, es sah so aus, als ob … na ja, als ob der Mann dich …»
Vivien drehte sich zu ihr um. Sie hatte wunderschöne, große grüne Augen, die leider viel zu stark geschminkt waren.
«Ach, der Typ ist in Ordnung, vielleicht ein wenig aufdringlich, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob er wirklich so viel Geld hat, wie er behauptet. Aber sag mal: Niemand macht so etwas heutzutage. Die Leute schauen weg oder tun so, als bekämen sie nichts mit. Warum wolltest du mir helfen? Du kennst mich doch gar nicht?»
«Muss man jemanden kennen, um zu helfen?»
Vivien zuckte mit den Schultern.
«Schaden kann es nicht. Also warum?»
Leni dachte einen Moment nach und sagte dann:
«Weil … weil ich dachte, du brauchst Hilfe.»
Das war nicht die ganze Wahrheit, aber die Wahrheit erzählte Leni niemandem. Sie versuchte sogar, sie vor sich selbst zu verschweigen, weil sie nur so halbwegs erträglich war. Meistens klappte das ganz gut.
Vivien sah Leni mit einem Blick an, der zwischen Verwunderung und Unverständnis schwankte, vielleicht lag auch ein wenig Hochmut darin, aber schließlich lächelte sie, entblößte dabei perfekte weiße Zähne und legte Leni einen Arm um die Schultern.
«Na, dann komm mal mit rein, Leni Landei, bevor dir hier auf der Straße noch etwas passiert.»
Die Umarmung fühlte sich nett an, wie eine Wiedergutmachung für den beschissenen Tag, aber Leni konnte mit so viel Nähe nicht gut umgehen. Zur Haustür führten vier Stufen empor, und Vivien musste sie loslassen, weil Leni sich mit ihrem Koffer abmühte.
«In welcher Wohnung bist du?», fragte Vivien und hielt die Tür auf.
«Vierte Etage. Bei …»
«Egbert?»
«Ja.»
«Ich auch! Ist ’ne riesige Wohnung, und alle Zimmer sind vermietet. Wir haben Spanier, Chinesen, Portugiesen und Deutsche. Leider nur ein Bad, dafür mit Wanne. Und zwei Toiletten. Nicht schlecht also.»
«Wie jetzt?», fragte Leni. «Die komplette Wohnung ist über BedtoBed vermietet? Wo sind die eigentlichen Bewohner? Ich dachte, so etwas sei gar nicht erlaubt!»
«Willst du günstig wohnen oder doofe Fragen stellen?»
Vivien bückte sich, streifte ihre Schuhe ab, nahm einen in jede Hand und ging barfuß vor ihr die Treppe hinauf. Ihr schmaler Hintern wackelte, die Wadenmuskeln spielten unter der gebräunten Haut.
Der Koffer war zu schwer, um ihn zu tragen, also zog Leni ihn die vier Stufen hinauf. Vivien wartete an der geöffneten Tür.
«Was hast du da drin? Deinen kompletten Hausstand?»
«Ich bleibe ein bisschen länger», antwortete Leni ausweichend, weil sie nicht zugeben wollte, sechs Bücher eingepackt zu haben, die sie während ihres Aufenthaltes in der Stadt lesen wollte. Dicke Wälzer mit ordentlich Gewicht.
«Wie lange?»
«Drei Wochen.»
«Drei Wochen Urlaub?»
«Nein, wie ich schon sagte, ich mache ein Praktikum.»
«Scheiße, Landei, du kannst einem wirklich leidtun. Einen Fahrstuhl gibt es hier aber nicht. Komm, ich helfe dir.»
Bevor Leni dankend ablehnen konnte, packte Vivien zu. Zusammen trugen sie den Koffer hinauf. Auf halber Strecke ging Leni die Puste aus, während Vivien wirkte, als strenge sie das überhaupt nicht an.
Als sie die vierte Etage erreichten, schwitzte Leni schon wieder aus jeder Pore.
Vivien öffnete die nicht verschlossene Wohnungstür, verschwand im dunklen Flur, machte Licht und kam noch einmal zurück ins Treppenhaus.
«Dein Zimmer ist am Ende des Ganges. Deine Vorgängerin ist erst vor zwei Tagen ausgezogen, das Bett ist also fast noch warm. Vielleicht sieht man sich ja morgen!»
Damit verschwand Vivien, und Leni blieb allein zurück. Sie trat ein, schloss die Wohnungstür und sah sich um. Vor ihr erstreckte sich ein schmaler Gang bis zu einem Fenster, wo er einen Knick nach links machte.
Leni fand es befremdlich, eine fremde Wohnung zu betreten. Sie hatte erwartet, von dem Vermieter begrüßt zu werden, doch offenbar handelte es sich hier tatsächlich um eines der illegalen Angebote, vor denen im Internet gewarnt wurde. Der Chef ihres Praktikumsverlags, Herr Seekamp, hatte Leni auf dieses Haus hingewiesen und gesagt, seine Praktikantinnen bekämen zehn Prozent Rabatt. Wahrscheinlich betrieb er hier ein steuerfreies Nebengeschäft.
Sie folgte dem Gang, kam an vier Zimmertüren vorbei, hinter denen es still war, bog am Ende nach links ab, passierte vier weitere Türen und stand schließlich vor der letzten. Daran haftete eine handschriftliche Notiz.
L. Fontane.
Sie öffnete die Tür und prallte erschrocken zurück.
5.
Jana drückte sich eng an die Wand und beobachtete, wie sich zuerst ein Kopf, dann Arme, Schultern und schließlich der Rest eines Körpers aus dem Loch schob.
Das hier war kein Wesen, sondern ein Mensch. Eine nackte Frau, deren langes dunkles Haar wie ein Vorhang vor ihrem Gesicht hing. Sie krallte ihre Finger in den feuchten Steinboden, zog sich gänzlich aus dem Loch heraus und blieb auf allen vieren hocken. Irgendwo in den Tiefen der Wände erklang ein dumpfes Geräusch, so als schlüge ein Riese mit einem Hammer darauf ein. Nur langsam ebbten Geräusch und Erschütterung ab, und erst, als es vollkommen still war, bewegte die Frau sich wieder.
Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht, legte einen Finger an die Lippen und schüttelte den Kopf.
Jana verstand. Sie sollte nicht sprechen.
Wer schweigt, überlebt.
Die Frau richtete sich auf.
Sie wirkte geschwächt und stützte sich an der Wand ab. Sie war vielleicht vierzig Jahre alt, sehr schlank und hatte langes schwarzes Haar. Da sie nackt war, konnte Jana diverse blaue Flecken an ihrem Körper erkennen. Besonders an den Rippenbögen und am Gesäß häuften sie sich. Manche sahen neu aus, andere verheilten bereits und verfärbten sich gelblich grün.
In kleinen Trippelschritten bewegte Jana sich in ihrem Schlafsack auf das Gitter zu und hielt sich mit den Händen an den Metallstäben fest.
Auf der anderen Seite des schmalen Ganges gab es zwischen mächtigen Stützpfeilern eine weitere Zelle wie die, in der sie sich selbst befand. Quadratisch, mit einem Bett darin und einem Campingklo in einer Nische in der Wand, vor die man einen gelben Duschvorhang ziehen konnte, wenn man seine Notdurft unbeobachtet verrichten wollte.
Die Frau stolperte auf diese Zelle zu, betrat sie, blieb mit dem Rücken zu Jana stehen und wartete. Wenige Sekunden später erklang ein elektrischer Summton, und die Zellentür setzte sich in Bewegung. Sie glitt auf einer Schiene von rechts nach links und rastete metallisch klackend ein.
Stille.
Plopp.
Die Wasserschüssel füllte sich.
Wieder Stille.
Jana starrte auf den schmalen Rücken der Frau. Unter der Haut zeichneten sich die einzelnen Segmente der Wirbelsäule und die Rippenbögen ab. Ihre Pobacken waren rund und ohne Fett, die Beine muskulös und schlank. Ihre Nacktheit schien ihr nichts auszumachen, auch die feuchte Kälte nicht, die Jana so sehr zusetzte, seit sie hier erwacht war.
Eine unerträglich lange Zeitspanne verging, zweimal ploppte es in der Wasserschüssel, aber Jana verspürte jetzt keinen Durst mehr. Hinter ihren Lippen stauten sich Fragen, wollten hinaus, drängten gegen die Sperre aus Angst.
Endlich bewegte sich die Frau. Sie ballte die Hände zu Fäusten, ein Zittern lief durch ihren Oberkörper, dann drehte sie sich um, trat ans Gitter, und ihre schlanken, langen Finger mit den perfekten Nägeln krallten sich darum, so als befürchte sie umzukippen. Die eckigen Stäbe aus glänzendem Stahl rahmten ihr schönes Gesicht ein wie ein Bilderrahmen ein Gemälde.
«Ich darf zu dir sprechen», sagte sie, und Jana erschrak, weil die Worte so unerwartet kamen. «Doch du musst schweigen. Bitte versprich mir zu schweigen! Sonst werde ich jedes deiner Worte zu spüren bekommen.»
Die Frau deutete auf etwas, was Jana selbst bislang nicht bemerkt hatte: eine schwarze Halbkugel an der Decke, in einer Vertiefung an der Stelle, an der vier Bögen der Stützpfeiler zusammenliefen.
«Er kann uns sehen und hören, ihm bleibt nichts verborgen. Auch in diesem Moment sieht er uns zu.»
Beide blickten zu der Halbkugel, die wie das Auge Gottes über ihnen schwebte.
«Ich bin Nummer sechs», fuhr sie fort. «Du bist Nummer sieben. Das sind unsere Namen, wir dürfen uns niemals anders nennen. Meine Aufgabe ist es, dich in die Regeln einzuweisen. Die Einhaltung der Regeln ist immens wichtig, verstehst du? Verstöße ziehen Schmerzen oder Schlimmeres nach sich. Und eines musst du mir bitte glauben …»
Hier brach ihre Stimme zum ersten Mal, und sie musste sich sammeln.
«Der Herr des Hauses kann uns Schmerzen zufügen, die keine Spuren hinterlassen und dennoch deine Vorstellungen und Erfahrungen bei weitem übertreffen. Du erleidest Verletzungen ohne Wunden, die niemals verheilen. Nur wenn wir tun, was er verlangt, werden wir irgendwann gehen dürfen. Nicke bitte, wenn du verstehst, was ich sage, Nummer sieben.»
Jana nickte.
«Gut.»
Nummer sechs schien sich etwas zu entspannen. Angehaltene Luft entwich aus ihrem Körper, sie schloss für einen Moment die Augen und lehnte die Stirn gegen die Metallstreben.
«Wir dürfen nicht darüber reden, wie wir hierhergekommen sind, wer wir vorher waren oder was wir gemacht haben. Es gibt kein Vorher, nur ein Jetzt. Der Herr des Hauses bestimmt, wann unsere Zeit hier endet. Wir sind hier, um ihm zu dienen und zu gefallen. Das allein ist unser Daseinszweck. Er ist ein vielbeschäftigter Mann, deshalb ist es ihm wichtig, seine Wünsche nicht wiederholen zu müssen. Du musst mir gut zuhören und dir alles merken, Nummer sieben, denn bald wirst du nach oben gerufen werden, und dann musst du alles genau so tun, wie ich es dich gelehrt habe und wie ich es von Nummer fünf gelernt habe.»
Die Frage brannte Jana auf der Seele, seitdem die Frau sich selbst Nummer sechs und sie Nummer sieben genannt hatte: Was war mit den Nummern davor? Eins bis fünf?
«Wenn du so weit bist und nach oben gerufen wirst», fuhr die Frau fort und sah Jana nun direkt an, «werde ich nicht mehr benötigt. Du bist dann auf dich allein gestellt, und ich …»
Nummer sechs konnte sich nicht länger auf den Beinen halten. Sie sackte zusammen und setzte sich auf den kalten Boden. Ihr langes Haar verdeckte ihr Gesicht.
Jana hätte gern gegen das Schweigegebot verstoßen, um die Frau zu trösten, und wenn es nur um sie selbst gegangen wäre, hätte sie es auch getan. Aber die Frau hatte gesagt, sie würde jedes Wort zu spüren bekommen, deshalb musste sie weiterhin schweigen.
Schließlich strich Nummer sechs sich die Haare aus dem Gesicht und deutete auf die Wasserschüssel zwischen den beiden Zellen.
«Darf ich trinken?», fragte sie. «Ich bin so entsetzlich durstig.»
Jana nickte. Dann sah sie dabei zu, wie sich Nummer sechs auf den Boden legte und umständlich die Schüssel zu sich heranzog, die im Gang zwischen den Zellen stand. Sie leerte sie in einem Zug.
Jana wünschte sich, vorher selbst getrunken zu haben.
6.
Damit hatte Leni nicht gerechnet.
Das Zimmer war wirklich eine Wucht!
Drei Meter hohe, stuckverzierte Decken mit einem wuchtigen Kronleuchter in der Mitte. Parkettfußboden auf den kompletten zirka dreißig Quadratmetern. Zwischen Bett und Schrank lag ein teuer aussehender, aber etwas abgewetzter Perserteppich. In eine Nische war ein großer Kleiderschrank eingebaut, in dem gerahmten Spiegel daneben konnte Leni sich von Kopf bis Fuß betrachten. Ein zum Fenster hin ausgerichteter, nostalgischer grüner Ohrensessel mit Fußhocker wartete darauf, dass Leni ihn zum Lesen der mitgebrachten Bücher nutzte. Es gab sogar einen kleinen gefliesten Bereich mit Waschbecken, Gesichtsspiegel und Steckdose, wo sie sich die Haare waschen und föhnen konnte.
Leni hatte vorher in verschiedenen Foren erschreckende Dinge über Online-Zimmervermittlungen gelesen. Das reichte von verdreckten, unappetitlichen Besenkammern bis hin zu unfreundlichen oder zudringlichen Vermietern. Alles offenbar haltlos, zumindest in ihrem Fall.
Leni öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen, zog aber die Vorhänge zu. Sie legte ihre verschwitzte, müffelnde Kleidung ab und wusch sich an dem kleinen Waschbecken Gesicht und Hände. Zu mehr war sie nicht mehr fähig, die Dusche draußen auf dem Gang würde sie morgen früh in Anspruch nehmen. Aus dem Koffer suchte sie ihre Schlafkleidung, zog sie an und schlüpfte schließlich unter die frisch duftende Decke.
Einen Moment ließ Leni das Nachtischlämpchen noch an und versuchte, in ihrem neuen Zuhause anzukommen. So etwas dauerte bei ihr erfahrungsgemäß lange. Ihre Oma hatte mal gesagt, Leni habe eine alte Seele, schon von Geburt an. Sie sei klug und den anderen Kindern weit voraus, aber sie sei auch altmodisch, spröde und langsam. Damals hatte Leni das nicht verstanden, heute wusste sie, wie sehr ihre Oma damit richtiggelegen hatte. Eine alte Seele reiste langsam, selbst ein Zug mit ordentlich Verspätung war für sie noch zu schnell. Lenis Körper war in Hamburg angekommen, ihre Seele noch nicht. Vielleicht morgen früh oder gegen Mittag, vielleicht auch erst am Abend, wer konnte das wissen …
Über diese Gedanken fiel Leni in einen tiefen Erschöpfungsschlaf.
Laute Geräusche weckten sie.
Auf dem Gang unterhielten sich Menschen lautstark auf Spanisch miteinander. Die Stimmen entfernten sich, eine Tür schlug zu, und für einen Moment kehrte Ruhe ein, nur um im nächsten Augenblick von anderem Lärm abgelöst zu werden.
Der kam von draußen und klang nach einem heftigen Streit. Leni sträubte sich dagegen, ihr warmes, schützendes Bett zu verlassen, doch durch das offenstehende Fenster drangen die Wortfetzen in ihr Zimmer, und sie konnte nicht wieder einschlafen.
Also huschte sie ans Fenster.
Die Straßenlaternen waren erloschen, die Eilenau lag in Dunkelheit unter ihr. Auch auf den Hausbooten waren längst alle schlafen gegangen.
Leni sah zwei Personen auf das Haus zukommen. Ein Mann und eine Frau, sie etwas größer als er. Sie stritten miteinander.
«Wozu bist du überhaupt zu gebrauchen?», fuhr sie ihn an.
Ihre Worte erinnerten Leni schmerzhaft an ihr Elternhaus. Solche Kräche waren alltäglich gewesen und hatten regelmäßig zu großen Katastrophen geführt. Es war vollkommen egal gewesen, ob man einlenkte und dem Vater recht gab. Er suchte Streit, wollte ihn, provozierte ihn so lange, bis jemand ein falsches Wort sagte oder etwas Falsches tat. Und am Ende hatte es ihre Mama getroffen, immer. Noch heute, sechs Jahre nach dem Tod des Vaters, litt Leni, sobald sie Paare streiten sah.
Plötzlich vermisste Leni ihre Mama. Sie allein in Sandhausen zurückzulassen, in diesem Ort voller Geister, der nichts zu bieten hatte als Tratsch und übles Gerede, war Leni sehr schwergefallen.
Das streitende Paar verschwand aus ihrem Blickfeld, und die Erschütterung der zufallenden Haustür vibrierte im Mauerwerk. Aus einem Reflex heraus sah Leni zur Zimmertür hinüber und überprüfte, ob sie die Sicherheitskette, die es zum Glück gab, vorgelegt hatte.
Hatte sie.
Als sie sich wieder dem Fenster zuwandte, um es zu schließen, fiel ihr Blick auf das Hausboot, das direkt unter ihrem Zimmer vertäut lag.
Ein großer schwarzer Block aus Metall und Holz, umgeben von schwarzem Wasser.
Obwohl es dunkel war hinter den großen Panoramaglasscheiben, glaubte Leni, in einem schmalen Spalt zwischen den Vorhängen ein Gesicht zu sehen. Oder vielmehr ein Augenpaar, das zu ihr heraufsah.
Leni schlug das Fenster zu, schlüpfte zurück unter die warme Daunendecke und zog sie hoch bis ans Kinn.
Sie strengte sich an, fand aber nicht zurück in den Schlaf.
Immer wieder hörte sie, wie ihr toter Vater an der Zimmertür rüttelte und ihre Mama versuchte, ihn davon abzuhalten, auch noch auf die Tochter loszugehen.
In der Dunkelheit glaubte sie sogar zu sehen, wie sich die Klinke bewegte. Langsam senkte sie sich, blieb einen Moment unten, glitt dann geräuschlos wieder hinauf, und plötzlich war Leni wieder ein kleines Mädchen, das sich aus Angst vor dem eigenen Vater ins Bett verkroch.
Auch als der Schlaf sie endlich gnädig aufnahm, hörte sie in ihren Träumen noch lange Zeit fremde Stimmen und Geräusche und sah schließlich ein schwarzes Loch dort, wo die Tür sein sollte. Es drehte sich, schneller und schneller, und in seinem Zentrum stand winkend und lockend Vivien.
«Komm zu mir, Leni, komm zu mir …»
7.
Jens Kerner parkte seinen 65er Chevrolet Farmtruck in einer dunklen Seitengasse. Er liebte den soliden, feuerrot lackierten amerikanischen Pick-up, aber er war auffällig, und wenn er wie jetzt halb dienstlich, halb privat unterwegs war und deshalb nicht auf einen Dienstwagen zurückgreifen konnte, musste er ihn eben verstecken.
Der Zeiger seiner Armbanduhr rückte auf halb zwölf vor. Seit einer halben Stunde saß Jens im Wagen und behielt den Ausschnitt der Straße vor sich im Auge. Bisher hatte sich nichts getan.
Vertrödelte er seine Zeit?
Vielleicht, aber da er genug davon hatte, spielte es keine Rolle. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass diese Maßnahme Erfolg brachte. Sich zum Zeitpunkt eines Mordes – sofern er sich denn genau eingrenzen ließ, was hier der Fall war – später noch einmal an den Tatort zu begeben war unter seinen Kollegen nicht eben weit verbreitet, aber Jens tat das gern. Die Polizei kam immer erst mit deutlicher Verzögerung an einen Tatort, und in der Zeit zwischen der Tat und dem Auffinden der Leiche – oder dem Beginn der Ermittlungen – änderte sich vieles: die Tageszeit, das Licht, die Atmosphäre, die Frequentierung der Umgebung. Und über diese mess- und greifbaren Fakten hinaus änderte sich auch sein ganz persönliches Gefühl für die Umstände, wie sie geherrscht hatten, als der Täter zuschlug.
Da er im Fall des erschossenen Krankenpflegers Oliver Kienat nicht weiterkam, war er, statt ins Bett zu gehen, in seinen geliebten Truck gestiegen, hatte ein paar Runden durch die Stadt gedreht, um den 7-Liter-Motor warm zu fahren, und war schließlich hierhergekommen.
Auf den ersten Blick sah es so aus, als sei Oliver Kienat das zufällige Opfer eines Raubmordes geworden. Sein Portemonnaie, seine Papiere und seine Wohnungsschlüssel fehlten. Allerdings hatten die Jungs von der Spurensicherung tief unter dem Fahrersitz des Opel Corsa ein Handy gefunden – und damit änderte sich alles. Die letzten Anrufe des Opfers waren allesamt unverdächtig, das war in den vergangenen zwei Tagen überprüft worden, aber der junge Mann hatte kurz vor seinem Tod ein Foto geschossen.
Auf dem Bild war die obere Hälfte des hinteren Teils eines weißen Kastenwagens zu erkennen. Der Wagen verfügte über zwei Flügeltüren, eine davon breiter als die andere, in jeder Tür eine Scheibe. Das Licht einer Straßenlaterne spiegelte sich darin. Dennoch konnte man so etwas wie einen Handabdruck auf der linken Scheibe erkennen, sowie Fingerspuren, so als ob die Hand nach unten weggerutscht wäre. Für Jens sah es so aus, als bestünde der Abdruck aus Blut, aber da Kienat beim Auslösen des Fotos gewackelt hatte, war das nicht deutlich.
Leider hatte der junge Mann es auch versäumt, das Kennzeichen zu fotografieren.
Die Frage war, warum Kienat dieses Foto überhaupt geschossen hatte. Er war auf dem Rückweg von seiner Spätschicht im Krankenhaus gewesen, früher als gewöhnlich, da seine Chefin ihn wegen einer beginnenden Erkältung nach Hause geschickt hatte. Man konnte also ausschließen, dass ihm jemand aufgelauert hatte. Kienat war seinem Mörder zufällig begegnet, vielleicht hatte er auf den nächtlichen Straßen etwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen. Vielleicht hatte ihn jemand aus dem Verkehr gezogen, um eine andere Straftat zu verdecken. Wer aus einem solchen Grund tötete, der hatte zuvor auch schon getötet. Der blutige Handabdruck würde zu dieser Annahme passen.
Aber warum hier?
Jens stieß die Autotür auf, stieg aus, zündete sich eine Zigarette an und machte sich auf den Weg. Die Querstraße, in der er parkte, stieß nach wenigen Metern auf die Zufahrt zum Hafen. Fünfzig Meter weiter links war Kienat mit seinem Wagen gegen ein Verkehrsschild gefahren und dann erschossen worden. Eine Kugel durch die Seitenscheibe und die Schulter in den Sitz, eine zweite durch die Hand in den Kopf. Beide aus nächster Nähe abgefeuert.
Die Projektile brachten sie nicht weiter, sie passten zu keiner registrierten Waffe.
Noch im Schatten der Gasse lehnte sich Jens mit der Schulter an eine backsteinerne Mauer und ließ seinen Blick wandern. Die Straßenlaternen brannten hier die ganze Nacht, weil es Lieferverkehr vom und zum Hafen gab, trotzdem war dies eine düstere Ecke. Fußgänger gab es nicht, weder tagsüber noch nachts.
Was den Ablauf der Tat anging, hatte Jens eine genaue Vorstellung: Kienat kommt von seiner Nachtschicht, fährt hier entlang, sieht etwas, was er nicht hätte sehen sollen, wird verfolgt, abgedrängt, zum Halten gezwungen und erschossen. Dabei konnte sich der Täter relativ sicher sein, nicht beobachtet zu werden, und lange dauerte es ja nicht, jemandem in den Kopf zu schießen. Dass der Täter sich keine Zeit genommen hatte, bewies das Handy unter dem Sitz. Bei einer schnellen, oberflächlichen Suche übersah man es. Die Jungs von der Spurensicherung hatten es auch erst entdeckt, als sie den Wagen so richtig auseinandergenommen hatten.
Vor zwei Tagen hatte Jens noch geglaubt, er müsse nur nach anderen Straftaten im Stadtgebiet Ausschau halten, um diesen Mord aufzuklären. Eine Entführung möglicherweise. Doch es gab keine.
Ein Kleintransporter kam die Straße hinunter und fuhr vorbei.
Nachdem er verschwunden war, trat Jens aus der Gasse hinaus und schlenderte zu der Stelle hinüber, an der eine Polizeistreife den Wagen mit dem Erschossenen darin gefunden hatte. Laut Gerichtsmediziner war er ungefähr eine Stunde zuvor getötet worden, so lange hatte der Wagen unentdeckt an dem Straßenschild gestanden. Pures Glück, dass ausgerechnet eine Streife ihn fand. So hatte die Presse bisher keine Notiz davon genommen. Das würde auch so bleiben, bis Jens es für richtig hielt, die Hilfe der Öffentlichkeit in Anspruch zu nehmen.
Das Straßenbauamt hatte das Schild längst ersetzt.
Nichts wies mehr darauf hin, dass hier ein Mensch gestorben war.
Jens zog an seiner Zigarette und ging auf die ehemalige Tankstelle zu, in der jetzt Windschutzscheiben repariert und ersetzt wurden. Ihm kam eine Idee, und er machte sich eine geistige Notiz, um sie gleich am Vormittag in die Tat umzusetzen.
Neben der Halle bewegte sich etwas.
Jens nahm die Zigarette aus dem Mund, weil ihm der Qualm in die Augen stieg, und sah genauer hin.
Tatsächlich, da war jemand!
«Hey!», rief Jens und ging auf die Halle zu.
Sofort sprintete die Gestalt nach links weg. In dem Dreckslicht konnte Jens nicht mehr erkennen als eine hoch aufgeschossene Person in langem Mantel. Mantelschöße und Gürtelenden flatterten hinter ihr her.
«Stehen bleiben!», rief Jens, doch der Flüchtende dachte gar nicht daran, seinem Befehl Folge zu leisten. Er lief einfach weiter, und er war verdammt schnell.
Weniger als hundert Meter konnte Jens die Geschwindigkeit mithalten, dann machten sich die Schachtel Zigaretten pro Tag, sein Alter und der fehlende Sport bemerkbar. Seine Lunge rebellierte, er wurde langsamer. Der Flüchtende machte einen Satz nach rechts und verschwand in einer Seitengasse. Jens sah, wie er über einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun kletterte, geschickt und schnell, so als habe er das trainiert.
Dahinter lag das Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers. Dutzende Fahrzeuge standen in ordentlichen Reihen herum, in einer davon verschwand der Flüchtende.
Jens machte sich daran, ebenfalls den Maschendrahtzaun zu überwinden. So elegant wie der hagere Mann bekam er es jedoch nicht hin. Sein kleiner Altersbauch störte, die ungelenken Glieder weigerten sich, und nachdem er oben abgesprungen war, knickte er beim Aufprall mit dem Fußgelenk um. Heißer Schmerz schoss ihm durchs Bein.
«Scheiße!», schrie er auf, zog seine Waffe und humpelte auf die Reihen geparkter Autos zu.
«Komm da jetzt raus, du blödes Arschloch, oder ich schwöre dir, ich trete dir in den Arsch, bis sie dir einen Seitenausgang legen müssen.»
Der Schmerz im Fußgelenk stachelte Jens’ Wut noch an, und er stürmte leichtsinnig in den dunklen Gang zwischen die geparkten Autos.
Etwas Großes flog ihm entgegen, krachte hart gegen seinen Kopf und schaltete seine Lichter aus.
Kapitel 2
1.
«Hast du einen Ausweis?», fragte der große, übergewichtige Polizist und hakte seine Daumen in die Gürtelschlaufen der Hose. Über dem Bund spannte ein ordentlicher Wohlstandsbauch das schwarze Hemd. Auf seinem Namensschild stand R. Hagenah.
«Wieso?»
«Hast du oder hast du nicht?»
Klar hatte er einen Ausweis, aber es widerstrebte ihm, dem Bullen einfach so zu geben, was er wollte. Und wieso duzte der ihn überhaupt? Diese Frage lag ihm auf der Zunge, doch er schluckte sie runter. Die Bullen saßen am längeren Hebel, und er hatte keine Lust, den Tag in der Arrestzelle zu verbringen.
«Gibt es einen Grund für die Kontrolle?», fragte er.
«Gibt es einen Grund, warum du dich hier versteckst?»
Den gab es, aber er würde mit R. Hagenah nicht darüber sprechen, nicht einmal wenn der freundlicher und nicht so herablassend gewesen wäre.
«Ist schön ruhig hier», antwortete er ausweichend.
Eine verzinkte Metalltreppe führte als Notausgang für den Feuerfall an der Hinterseite des Bürogebäudes aus dem vierten Stock hinunter. Wo sie den Boden erreichte, schirmten Büsche und ein Sichtschutz aus Holzpalisaden für die beiden großen Müllcontainer den Bereich zur Straße hin ab. Von dort konnte man nicht hineinsehen, deswegen hatte er sich nach seiner Flucht vom Schrottplatz in der vergangenen Nacht diesen Platz ausgesucht.
Und wegen seiner Erinnerungen natürlich.
«Wenn du keinen Ausweis hast, nehme ich dich mit auf die Wache», sagte der Bulle, und sein Blick ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er es ernst meinte.
«Was soll der Stress, ich störe hier doch niemanden?»