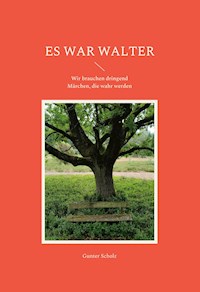Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein schwer herzkranker deutscher Theologieprofessor und ein arbeitsloser junger Mexikaner, unterschiedlicher geht's kaum. Und doch werden diese beiden bald auf das innigste verbunden sein, denn obwohl sie sich nie begegnet sind, haben sie doch eines gemeinsam – ihr Herz. Der eine wird es dem anderen verkaufen, obwohl er selbst nichts davon weiß - und den Kaufpreis dafür erhalten auch andere. Doch nicht nur der Verkauf junger gesunder Herzen und anderer Organe aus gesunden Körpern der zweiten Welt an die reiche erste, auch die Vermittlung von Adoptionen in der gleichen Richtung lohnt sich! Wächst bei den einen das junge Menschenmaterial doch wie Unkraut nach, so dass man seiner kaum noch Herr wird und nicht weiß, wohin damit, so ist es bei wohlhabenden Deutschen Mangelware - und da liegen lukrative Geschäftsideen nahe. Nicht nur der Rauschgiftschmuggel lohnt sich! Und manchmal sind zwei schlagzeilengeile Reporter eben fixer als die offiziellen Hüter von Gesetz und bürgerlich-christlicher Ordnung und Moral, hinter der sich der eigene nicht nur geldwerte Vorteil ach so gut verstecken lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Das Herzopfer
Günter Scholz
Copyright: © 2015 Günter Scholz
Lektorat: Marion Rebmann
www.lektoratrebmann.de
Verlag: epubli GmbH, Berlin
ISBN 978-3-7375-8900-0
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Der ächzende spanische Söldner, blutverschmiert und nur noch mit einer zerrissenen Hose bekleidet, wird die steilen Treppen des Tempels empor geschleift. Als er den verzweifelten Blick nach oben richtet, erblickt er den Priester, sieht ihn aber nur schemenhaft, da die gleißende Sonne hinter der hoch aufgerichteten Gestalt brennt. Oder blendet ihn die goldene Maske, die das Gesicht des Mannes verbirgt, der dem Sonnengott diese Opfer bringt, so im letzten Augenblick das Schicksal seines Volkes, sein Ende abzuwenden? Ist es diese Maske, die die Augen des Opfers blendet? Sind es die stechenden Augen des Priesters, die, eins werdend mit der sie umgebenden goldenen Haut, erst auf sein Gesicht, dann auf seine Brust starren? Er sieht das entsetzliche Steinmesser in der Hand des Mannes, der als einziger seines Volkes noch die Götter besänftigen, ihren Hunger nach Grausamkeit stillen kann. Er sieht, wie das Blut von der Steinklinge tropft, fühlt, wie die Gehilfen des Priesters ihn, das nächste Opfer, fester fassen, ihn weiter über die Stufen nach oben, näher an den Himmel zerren. Er weiß, vor dem Antlitz des Gottes gibt es kein Entrinnen, kein Erbarmen von fanatisch Glaubenden. So versucht er, einen letzten Schutz suchend, sich seines eigenen Glaubens zu erinnern; wie Fetzen im Sturm fliegen die Ermahnungen der eigenen Priester vorbei, erscheint immer wieder das Bild des Gekreuzigten vor ihm, des Opfers, das auch zur Besänftigung des Gottes zu Tode gequält wurde; und so erfasst ihn ein besinnungsloser Schrecken: Auch aus der Brust dieses Opfers, dieses vor seinem Gott gequälten Menschen fließt Blut, auch sein zerschundener Körper ist von einer Lanze aufgerissen – ja, auch er wurde vor seinem Gott zu Tode gemartert, um den Zorn des Allmächtigen abzulenken, zu zerstreuen. Doch es bleibt ihm keine Zeit, sein Schicksal als Opfer mit dem des Gekreuzigten zu vergleichen: Das Steinmesser, der Priester, der Gott, sie warten ungeduldig. Der Allmächtige will das zuckende Herz, sein Herz, seinen qualvollen Tod sehen. Ist es der Irrsinn dieses Gedankens, ist es der panische Wahnsinn der Todesverzweiflung, der ihn beten lässt, oder ist es die seit Kindesbeinen eingeübte Heilsroutine?
„Herz Jesu, du Quelle allen Trostes,
Du Herz, durchbohrt von der Lanze,
Herz Jesu, du Opferlamm für die Sünder,
Herz Jesu, du Sühne für unsere Sünden!“
Die Litanei quält sich über die zerbissenen, die blutenden Lippen des menschlichen Opferlamms, dessen Herz geopfert werden wird für die Vergehen eines Volkes, das nicht das seine ist, das zuckend und sein Blut verspritzend dem Sonnengott entgegen gehalten werden wird für die Sünden von Menschen, die es nicht kennt.
„Herz Jesu, Schlachtopfer der Sünder, erbarme Dich unser!“
Er schreit es hinaus, schreit es empor an die glühende Sonne des Himmels, dessen Blau stählern leuchtet wie die blanken Klingen der Rapiere, die federgeschmückte bunte Holzrüstungen glatt durchfahren, die sich satt stechen in brauner Haut, über die das hellrote Blut so anmutig fließt. Schwebt dort nicht segnend die heilige Jungfrau über den Kämpfern der Krone, der dreifachen Krone?
„O heiligste und unbefleckte Jungfrau! Opfere Du dem ewigen Vater das kostbare Blut deines Sohnes!“
Er will zum Gebet niederfallen, will niedersinken auf seine zerschundenen Knie, doch die Diener des gnadenlosen Gottes zerren ihn weiter, dem heiligen Ort, dem Altar entgegen, auf dem jetzt er, auf dem jetzt sein Herz das Opfer sein wird. Doch dann sind es plötzlich zwei Priester, die ihn erwarten, zwei Sklaven eines erbarmungslosen Gottes, die jedem Befehl gehorchen, die die heiligen Worte hören, Worte, die sie selbst murmeln – die nur sie verstehen. Der zweite Priester trägt die Maske des Jaguars. Die gewaltigen Reißzähne des mächtigen Räubers blitzen im heiligen Licht des Sonnengottes und die Krallen seiner Pfoten strecken sich aus nach ihm, nach seinem wie wild tobenden Herzen.
O nein, es gibt kein Entrinnen, kein Entkommen vor dem Antlitz des Gottes. Es ist ihm, als erhebe sich jetzt zwischen den beiden Priestern ein gewaltiges Kreuz und der Gekreuzigte steige herab, komme mit dieser großen blutenden Wunde in seiner Brust auf ihn zu, stürze auf die hohen Stufen des Tempels, werde neben ihm herab gezerrt. Doch nein, es ist nicht der unschuldig gestrafte Gottessohn, es ist sein Kamerad Juan, der neben ihm kämpfte, mit ihm zusammen gefangen genommen wurde. Er sieht sein Gesicht, erkennt seinen Bart, kann aber dann nur noch in die leere Brusthöhle starren. In wenigen Augenblicken wird auch er so weggezerrt, so weggeworfen werden, ein Leichnam ohne Herz. Schon packen ihn die Helfer – haben sie nicht Tuchmasken vor ihren Gesichtern, tragen sie nicht weiße Kittel? –, werfen ihn auf den Altar. Die Goldmaske des einen Priesters glüht über ihm, seine brennenden Augen tasten seine Brust ab. Die Krallen des Jaguarmenschen ritzen schmerzhaft die Haut seiner Brust, markieren die Stelle zwischen zwei Rippen, in die im nächsten Augenblick das noch vom letzten Opfer blutige Steinmesser hineinfahren wird; ein letztes Mal bäumt sich sein gepeinigter Körper auf, sucht instinktiv dem Unentrinnbaren zu entgehen…
„Lieber Herr Kühn, bitte bleiben Sie ganz ruhig, wir wechseln nur die Elektroden des Monitors aus; wir mussten die alten abziehen, das brennt ein wenig – Sie hatten sicher einen Alptraum.“
Albert Kühn, ordentlicher Professor für systematische Theologie an der Freien Universität, versucht ein wenig zu lächeln. Die Schwester, die neben Chefarzt Dr. Schäffer steht und dem schwer herzkranken Patienten die schweißnasse Stirn abtrocknet, blickt ihren Chef kurz an; dieser wirft einen Blick auf den Monitor, doch die Sorge, die sich in seinem Gesicht ausbreiten will, ist schnell von geübter Freundlichkeit unterdrückt. Er wendet sich erneut seinem Patienten zu:
„Lieber Herr Kühn, wir wollen unter erwachsenen Menschen… “
Er stockt, lacht kurz auf.
„Entschuldigen Sie, ich falle manchmal auch dem Intellektuellen gegenüber in den üblichen Patienten-Jargon; also – die Lage ist äußerst ernst, aber das wissen Sie ja. Ich kann Ihrem Herzen nur noch bedingt helfen, kann es nur noch eine ungewisse Zeit hinhalten, Bypassoperationen und das ganze Spektrum der konservativen Therapie sind ausgereizt.“
Der Arzt beobachtet seinen Patienten, verfolgt genau, wie sich Angst und Resignation aber auch noch nicht erloschener Lebenswille in einem leidenden Antlitz vereinen. Dann hört er die leise Stimme seines Patienten:
„Ach, Sie wissen doch, unser Leben währet siebzig und wenn es hoch kommt, so sind es achtzig Jahre… “
Doch da wird Dr. Schäffer wieder ganz Arzt, Chefarzt. Fast klingt seine Stimme wie die eines ermahnenden Vaters seinem Sohn gegenüber, obwohl er der Jüngere ist.
„Lieber Herr Kühn, erstens sind Sie noch lange keine siebzig, sondern stehen mitten im Leben, wie man so richtig sagt, und zweitens ist es nicht meine Aufgabe, über das Leben und seine voraussichtliche Dauer zu philosophieren oder“,
er lächelt jetzt fast leutselig,
„zu theologisieren, sondern es zu retten, zu erhalten! Also, wir beide wissen, dass es ernst ist, sehr ernst – und die Situation, Ihre Lage, wird täglich instabiler. Lassen Sie es mich in aller Deutlichkeit sagen: Ihr Herz kann jederzeit, täglich, ja stündlich versagen. Ja, es ist nun mal so, wir müssen dem ins Auge sehen. Wir sind hier als kardiologische Fachklinik natürlich auf diesen Ernstfall vorbereitet, in einem gewissen Rahmen können wir das technisch auffangen. Aber das ist ja alles keine Lösung – für uns nicht und vor allem auch für Sie nicht. Darum steht noch eine weitere Entscheidung an, um die wir nicht herum kommen, die schleunigst getroffen werden sollte.“
Ein Hauch von Ungeduld läuft über das Gesicht des Kranken als er antwortet: „Aber ich bin doch auf der Warteliste, bin mit der Transplantation einverstanden, bin innerlich darauf vorbereitet, obwohl… so manchmal denke ich… ach ja, es ist eben alles in Gottes Hand.“
Der Arzt unterdrückt seinen aufkeimenden Ärger darüber, dass er sich mit diesem Gerede aufhalten muss, wäre dies doch Aufgabe der Angehörigen, meinetwegen auch einer ehrenamtlichen Sitzwache für Todkranke. Die machen – als Klinikarzt weiß er das aus langer Erfahrung – so etwas gern, befriedigen auf diese Weise ihren Helferinstinkt, vielleicht auch ihr Bedürfnis nach endlich so richtig praktizierter Nächstenliebe – ja, um Gottes Willen, ja und meinetwegen! Aber doch nicht mit ihm, er hat andere Dinge gelernt, muss sich um Wichtigeres kümmern. Doch er nimmt sich zusammen; schließlich hat er es nicht mit einem Allerweltspatienten zu tun, dem üblichen Patientengut. O nein, hier hat er einen nicht nur gesellschaftlich geachteten, sondern auch einflussreichen und wohlhabenden Kranken vor sich, der für ihn auch ansonsten von höchstem Interesse ist. So zwingt er sich zur Geduld, kann aber einen leicht ironischen Unterton nicht unterdrücken:
„Aber Herr Kühn, sehen Sie doch mal, die Wissenschaft, und gerade die Medizin, sie hat Gott schon so manches aus der Hand genommen. Ach wissen Sie“, er wendet sich von dem Patienten ab, blickt aus dem Fenster, sieht ins Leere, „als Kind habe ich den Robinson Crusoe gelesen. In einem der Kapitel geht es darum, soweit ich mich erinnere, wie Robinson sein Leben auf der Insel aufbaut; und da steht als Überschrift darüber, so in diesen schön altmodischen, ausführlichen Kapitelbeschreibungen: Robinson lernt die Wahrheit des Wortes zu erkennen: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott! So oder ganz ähnlich war es formuliert.“
Auf der Stirn von Professor Kühn erscheint eine nachdenkliche Falte. Er verlässt für einen Augenblick sein jetziges, sein sterbendes Leben, kehrt in seine Jugend zurück. Aber dann schüttelt er ganz leicht den Kopf auf dem breiten Kissen: „Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Eigentlich kenne ich den Robinson doch ganz gut.“
Er lächelt in der Erinnerung:
„In meiner Jugend wurde so etwas ja noch gelesen.“
Aber Dr. Schäffer kommt es auf den Inhalt dieses Satzes an, der sich nicht so ohne weiteres erschließt. Er drängt das Gespräch nach vorn, auf das von ihm angepeilte Ziel zu.
„Als Kind habe ich mich immer über diesen Satz gewundert. Wieso hilft einem Gott, wenn man sich selber hilft? Das ergibt doch keinen Sinn. Dass es aber doch einen Sinn ergibt, und sogar einen sehr vernünftigen, dass es nämlich zu entschlossener Eigeninitiative auffordert, deren Erfolg dann im nachhinein als göttliche Hilfe verstanden wird, das, ja das habe ich erst später begriffen, dann aber gründlich. Man muss sich nur vom kindlichen, vom allmächtigen, vom lieben Gott lösen, dann wird das im Robinson Crusoe Gemeinte klar – und man begreift nicht nur dieses! Aber wem sage ich das?“
Er lacht.
„Einem ausgewiesenen Fachmann, einem richtigen Ordinarius der Theologie – systematische Theologie, wenn ich mich richtig erinnere.“
Professor Kühn lächelt erneut, jetzt ein wenig verlegen. Er weiß nicht so richtig, auf was der Arzt hinaus will, fühlt sich aber doch als ‚Fachmann‘ – seine Eitelkeit lässt ihn die in diesem Wort auch verborgene Ironie überhören – direkt angesprochen. So antwortet er erst einmal vorsichtig, abwartend, will zuerst noch hören, erst richtig verstehen, was sein Gegenüber von ihm will. Denn er begreift langsam, dass dies kein mitfühlend freundliches Gespräch ist, das einen Kranken ein wenig von seinem Leiden ablenken soll. Nein, das wird ihm immer klarer: hier wird eine Absicht verfolgt, hier wird ein Interesse vertreten. Leise sagt er, jetzt ganz demütiger Patient:
„Ja ja – aber deswegen weiß ich nicht mehr von Gott als jeder andere auch. Sie als Arzt, gerade als Herzchirurg, Sie sind ihm wahrscheinlich viel häufiger begegnet, sind mit ihm sicher auf Du und Du. Sie sind auch hier der Praktiker, bei mir ist da viel mehr Theorie dazwischen – ja… und das schafft manchmal Abstand.”
Doch der Arzt lässt sich den schwarzen Peter nicht zuschieben, beharrt auf der Fachkompetenz des Anderen, antwortet als klopfe er diesem auf die Schulter: „Das finde ich ja gerade so gut an den Theologen, die können diese Dinge mit wissenschaftlichem Abstand sehen, nüchterner.“
Aber der kranke Theologe wehrt sich, will sich noch immer nicht in diese Ecke drängen lassen, aus der heraus er Entscheidungen treffen muss, die angeblich anstehen und doch für ihn schon vorentschieden sind. Darum antwortet er, fast ein wenig heftig:
„Und kommen damit richtig in eine Diskussion, die dem Laien so gar nicht passieren kann: Auferstehung des Fleisches – und dann mit einem fremden Herzen, einem geliehenen? Nein, mir wird manchmal ganz anders bei diesem Gedanken. Und dann – Geh aus mein Herz und suche Freud… “
Der Piepser, an den Kittel des Arztes gesteckt, ertönt. Aber Dr. Schäffer ist routiniert genug, weiter zuzuhören und seinen Patienten dabei zu beobachten, der leise, mehr für sich, spricht:
„Vielleicht begehe ich eine furchtbare Sünde? Wollte mein Traum mich vielleicht warnen?“
Aber der Arzt lächelt nachsichtig, fast mitleidig.
„So wie wir als Jungens dachten, genau so – nach dem Onanieren, jedenfalls in unserer Generation noch. Aber heute denken wir anders darüber, schlicht und einfach weil wir es besser wissen. So ist es mit vielen Dingen. Auch Wertgefühle und Moralvorstellungen wandeln sich.“
Professor Kühn aber hat jetzt festeren Boden betreten, fühlt sich auf sichererem Terrain.
„Meinen Sie zu wissen, mein Lieber, meinen Sie! Bloße Doxa nannten das die Alten, diese Allerweltsmeinung, die keine Wahrheitsbedeutung hat. Sehen Sie doch… “
Doch der Arzt unterbricht ihn, will so nicht weitermachen. Etwas harsch sagt er noch:
„Ich werde gerufen, ins OP, Sie verstehen. Wir reden in Bälde weiter miteinander, ohne Störungen. Bis bald, Herr Kühn! Und – halten Sie sich tapfer!“
2
„Benito ist ein guter, ein stolzer Name, der die Freiheit und die Würde Mexikos wie kein anderer wiedergibt. Erinnert er doch an Benito Juarez, den größten Sohn Mexikos.“ Dies hatte sein Vater oft zu ihm gesagt. Und regelmäßig hatte er dann hinzugefügt: „Und er war einer von uns!“ Doch seinem Kind, seinem Sohn gegenüber war es weniger Stolz, den er empfand, sondern es war innige väterliche Liebe, die ihn mit seinem kleinen Sohn verband. Hart hatte er dafür arbeiten müssen, dass die junge Familie in einen etwas besseren Stadtteil ziehen und die kleine Wohnung einfach, aber doch freundlich einrichten konnte. Neben der zermürbenden Arbeit, zehn und mehr Stunden am Tag, hatte er eine Schulung zum Brückenbauingenieur absolviert, hatte das Examen mit Bravour bestanden und plante jetzt bereits die spätere Ausbildung seines begabten Sohnes. Immer wieder träumte er davon, wie dieser später an die Universität ginge und ein schöner und großer, ein erfolgreicher Mann würde. Doch dann geschah dieses furchtbare Unglück; es war kurz vor Benitos sechstem Geburtstag und der Spielzeugkran, wie er im Original auch beim Brückenbau eingesetzt wird, stand schon eingepackt für den schönen Tag bereit. Ein Kollege, der mit Benitos Eltern befreundet war, behauptete später, es wäre kein Unfall gewesen, sondern der junge Brückenbauingenieur wäre ein wenig zu aufmüpfig gewesen, hätte oft vor den Kollegen und auch vor den Arbeitern gesagt, dass es eine Schande sei, wenn nur ausländische Firmen die Brücken bauen würden, seien sie als Mexikaner denn nicht dazu in der Lage? Die Firmenleitung habe das gar nicht gemocht – und dann dieser Unfall! Dass es gerade Benitos Vater getroffen habe, nein, das sei bestimmt kein Zufall gewesen! Aber es war nur ein Gerücht und der Kollege sagte es nur heimlich, denn er hatte Angst um seinen Job. Auch nutzte es Benitos weinender Mutter nichts, die jetzt plötzlich ohne jegliches Einkommen dastand und als erstes die kleine Wohnung aufgeben, die mühsam ersparten Möbel für ein paar Pesos verkaufen musste. Wieder wohnten sie in diesem entsetzlichen Vorort und Benito spielte wieder im Dreck der manchmal verschlammten, manchmal staubigen Straße. Seine Mutter arbeitete so viel und so lange sie konnte, aber es reichte nicht dafür, sich aus dem Elend zu erheben. Das Wenige, was ihr aus dem kurzen besseren Leben geblieben war, das war ein Foto ihres Mannes, vor dem sie immer wieder betete und dann eine Kerze anzündete – und ihr Benito, den sie oft in den Arm nahm und ihre Tränen über sein schwarzes Haar fließen ließ.
Aus der besseren Ausbildung Benitos, wovon seine Eltern geträumt hatten und die in greifbare Nähe gerückt schien, wurde nichts. Er musste sich wie seine Mutter im Gewühl der großen Stadt durchschlagen. Einmal hatte ein Cousin seiner Mutter den beiden Hilfe angeboten, doch die erst vorsichtig und dann immer unverschämter geforderte Gegenleistung, nein, dazu war seine Mutter nicht bereit gewesen und als Benito später als Heranwachsender davon erfuhr, da brach er alle Beziehungen zu dieser Familie ab; doch diese hatte sich sowieso kaum noch um die armen Verwandten gekümmert. Aber Benito glitt nie in das Straßenkindermilieu ab, die Liebe seiner verzweifelt schuftenden Mutter, die Erinnerung an den Vater und an seinen Stolz – auch trug er schließlich den Namen des großen Mannes, der Mexiko seine Würde gegeben hatte – hielten den Heranwachsenden aufrecht, ließen ihn nicht vollends ins Elend und die Kriminalität abstürzen.
Doch dann hatte Benito beschlossen, eine richtig bezahlte Arbeit zu finden, koste es, was es wolle. Er will, er muss seiner Mutter zu einem besseren Leben verhelfen, schließlich ist er bereits achtzehn Jahre alt, kräftig und gesund. Sein Vater hatte es auch nur durch eigene Kraft geschafft; die Mutter hatte ihm früher oft davon erzählt. Und jetzt ist es seine von Gott gewollte Aufgabe, seinem Vater nachzueifern, seine Mutter endlich aus dem Elend zu erlösen, ihr Weinen zu beenden. Er zieht ein sauberes T-Shirt, frisch gewaschene Jeans an, ist auf dem Weg in den Stadtteil, in dem die großen ausländischen Firmen ihre Niederlassungen haben. Er hat sich genau überlegt, was er sagen, wie er es anfassen wird – es muss gelingen. Er betet zu seinem Gott, hat mit dem Priester vorher darüber gesprochen, der ihm zugesagt hat, dass der Allmächtige ihn nicht fallen lassen würde, wenn er es nur mit Vertrauen in die Güte Gottes und mit Fleiß und unerschrocken beginnen würde. Das hatte der Pater gesagt und er hatte mild dazu gelächelt, so wie sich Benito als Kind die Güte Gottes vorgestellt hatte.
Doch genutzt hatte es alles nichts. Was helfen die schönsten und wohl überlegtesten Formulierungen, wenn sie keiner hören, wenn kein Zuständiger das saubere T-Shirt, die gewaschenen Jeans sehen will. Bereits an den Pforten hatten ihn die Wächter und Pförtner abgewiesen; nur einer hat einmal nach einer Empfehlung gefragt, doch wo sollte er die her nehmen? Aber er hat sich nicht klein kriegen lassen, ist weiter gegangen, von Firma zu Firma, hat gebetet und Kerzen für den Altar versprochen, doch: keine Ausbildung, keine Empfehlung, keine Beziehung – kein Geld um Hilfe zu erkaufen! „Probier es bei den Gringos jenseits des Zauns!“ hat ihm einer höhnisch geraten – oder war es doch gut gemeint gewesen? Er denkt an die Mutter, die dann ganz allein ist – und versucht es weiter. Aber jetzt ist er am Ende, ist ohne Hoffnung, geht ziellos durch die Straßen, nähert sich automatisch wieder dem Slum, in dem er und die Mutter hausen, der Baracke, in der sie leben, ohne dass sie ihnen zu Hause, Heimat ist.
3
Der Mann ist ca. vierzig Jahre alt. Seine markante Hakennase wie der übrige Gesichtsschnitt zeigen seine indianisch-aztekische Abkunft auch dem ethnologisch nicht Bewanderten deutlich an. Seine Kleidung ist einfach, aber sauber und ordentlich; jedenfalls hebt sie sich von den zerlumpten Jeans und verdreckten T-Shirts dieses Slums am Rande von Mexico-City ab, allerdings nicht so deutlich, dass er angebettelt würde, denn Reichtum geht weder von dieser Kleidung noch vom Wesen ihres Trägers aus. Nein, das, was diesen Mann von seiner Umgebung, diesen armseligen Gestalten abhebt, ist kaum sein Äußeres, vielmehr ist es, sieht man ihn zuerst von ferne, seine Haltung, sein Gang. Obwohl er nur mittelgroß von Wuchs ist, so lässt ihn seine aufrechte Haltung, sein gerader Rücken doch deutlich größer erscheinen, als vergrößere eine Aura, die ihn beinahe sichtbar, ja fast greifbar umgibt, seine Gestalt. Nähert man sich diesem Mann dann mehr und mehr, so geht dieser Eindruck, der von seiner Gestalt ausgeht, über in die Ausstrahlung, mit der sein ernstes Gesicht jeden gefangen nimmt, der ihm begegnet. Der Mann ist sich seiner Wirkung wohl bewusst, denn in all dem, was von ihm ausgeht, ist herrisches Selbstbewusstsein, ja Stolz, totale Sicherheit ausstrahlender Stolz das Vorherrschende, das ängstliche Demut in seiner Umgebung auslöst.
Der Mann trägt eine einfache Strohtasche mit sich, aus der er jetzt eine indianische Flöte nimmt. Er hat sich an den Rand eines kleinen Platzes gestellt, der sich durch den chaotischen Verkehr gebildet hat, als habe der, sich hier stauend, die schmale, verdreckte Straße auseinander gedrückt, ein Aneurysma gebildet. Der Mann fängt an auf dieser Flöte zu spielen, erst verhalten, fast leise, doch mit dem vorsichtigen Lauterwerden der Töne kommt auch ein Rhythmus in die sich entwickelnde Melodie, die sich in auf- und abschwellenden Tönen wiederholt, einen magischen Takt gegen den formlosen Lärm dieses Slums setzt. Zuerst sind es ein paar alte Männer, die stehen bleiben, den Kern einer Kristallisation um diesen Magnetpunkt bilden, dessen anziehende Kraft, dessen Sog jetzt aber auch mehr und mehr Jugendliche festhält, die die Straße füllen wie der Fluss sein Bett. Und je mehr junge Burschen sich um den Schamanen scharen, desto rhythmischer werden die Töne, desto lockender klingt die lauter werdende, die sich unaufhörlich wiederholende Melodie.
Die Musik legt zunehmend einen Bannkreis um den Mann, dann auch um seine näher stehenden Zuhörer; der Bannkreis weitet sich aus, erreicht seine Grenze am Lärm und Gehupe des tosenden Verkehrs, zieht aber auch, als überschritten diese magischen Töne noch den hörbaren Bereich, weitere Zuhörer aus dem brodelnden Fluss der Straße an. Der Mann ist völlig in sich, in seine Musik versunken, scheint die Zuhörer gar nicht mehr wahr zu nehmen. Doch dann fällt sein Blick, der sich aus seinem Inneren zum ersten Mal nach außen wendet, auf einen jungen Mann, der sich ein wenig aus der Gruppe der Zuhörer gelöst hat. Mit all seinen Sinnen hängt er an der Flöte des musizierenden Mannes, hängt wie die Kobra an den Tönen des Schlangenbeschwörers. Der junge Mann ist einer der vielen, der viel zu vielen Jugendlichen, die die Elendsviertel überfüllen, hebt sich aber von denen ab, die immer nur auf der Suche nach ein paar Pesos, besser Dollars, sind, die nächsten Tage zu überleben, die nur noch ein Leben ohne Familie oder andere Bindungen führen, so frei und so arm, dass ein oder zwei Dollarscheine der Lebensentwurf, die Zukunft sind, eine Zukunft, die ungeplant nur ein paar Tage umfasst, die dafür aber für alles, einfach jede Möglichkeit offen ist.
Der Musiker winkt diesen anderen jungen Mann heran, mit einer knappen, einer herrischen Bewegung des Kopfes, hat aufgehört zu spielen. Er fragt nach dem Namen und bei dem Wort „Benito“ nickt er, sagt:
„Er war ein Indio – wie du und ich.“
Dann steckt er seine Flöte wieder in die Strohtasche, gibt diese dem jungen Burschen, dass er sie trage, und geht mit ihm zurück, wieder in die Richtung, aus der er gekommen ist. Schweigend gehen sie miteinander, der ältere etwas vor dem jungen. Sie erreichen eine bessere Gegend der Megastadt, Schuhputzer sitzen am Straßenrand, haben Kunden. Dann öffnet der Musiker einen VW, der am Straßenrand parkt, und fährt mit seinem jungen Begleiter durch die brodelnde Stadt. In der Nähe eines Indiomarktes halten sie, verlassen das Auto und sitzen bald in einem Straßencafé. Jetzt spricht der Ältere zu dem Jungen, redet mit ruhigen, mit bestimmenden Worten auf ihn ein; der hört nur zu, wagt nicht zu unterbrechen, nickt immer wieder mit dem Kopf. Dann erheben sich beide, der Musiker bezahlt und sein junger Begleiter folgt ihm. Nach wenigen Minuten stehen sie vor einem vielleicht hundert Jahre alten Gebäude, einem Haus, das wohl einmal die Heimstatt einer wohlhabenden Familie gewesen war, deren Wohnung heute aber als Geschäftsräume genutzt wird. Jedenfalls zeigen die Schilder neben der ehemals herrschaftlichen Tür verschiedene Büroräume und Praxen an: ein Rechtsanwalt, eine Export/Import-Firma, ein Steuerberater, eine Reederei, ein Internist.
Die beiden Männer verschwinden in dem dunklen Flur hinter der schweren Tür.
4
„Hallo Papa, wie geht es dir heute? Viele Grüße von Mama und Dorothee. Morgen sind sie auch wieder hier.“
Ingo Kühn steht am Krankenbett seines Vaters. Er hat diesen Mann immer als sein Vorbild verehrt, hatte nie wirklich gegen ihn aufbegehrt, war dem Wunsch seines Vaters, der auch sein eigener war, gefolgt und war wie dieser Theologe geworden. Dass er es bisher nur zum Gemeindepfarrer gebracht hat, stört ihn nicht weiter, nein, er hat sich immer wohl gefühlt im Schatten des anerkannten Theologieprofessors, standen sie doch beide „unter dem Wort", jeder auf seine Weise. Irgendwann hatte seine Mutter einmal angedeutet – nur so und im Scherz – eigentlich müsse es doch umgekehrt sein, der Sohn des Pfarrers steigt auf und wird zum theologischen Hochschullehrer. Aber es war ja nur ein Scherz gewesen und sie hatten freundlich darüber gelacht, hatten allerdings gelacht ohne sich zu amüsieren, wussten sie doch nicht so genau, weshalb sie gelacht hatten und auch nicht, was daran denn humorig sei. Ingo Kühn ist ein bescheidener Mensch und er ist sehr besorgt um seinen Vater, den er jetzt wieder ansieht, dem er Mut machen will.
„Geht es mit der Transplantation jetzt endlich vorwärts? Die müssten doch bei dir… “
Er zögert, fährt dann aber mit entschlossener Stimme fort:
„Ich meine - es ist doch wirklich angezeigt und außerdem bist du ja schließlich nicht irgendjemand. Der Chefarzt, dieser Dr. Schäfer, wollte doch mit uns reden. Es hörte sich so an, als habe er etwas Neues, zumindest die Möglichkeit einer guten Nachricht.“
Professor Kühn versucht sich ein wenig aufzurichten, will mit seinem Sohn einigermaßen auf Augenhöhe kommen bevor er mit ihm spricht. So fordert er ihn auf:
„Komm setz dich zu mir!“
Ein wenig Hoffnung glänzt in seinen Augen und durch die Anstrengung des Aufrichtens rötet sich sein Gesicht, kommt Leben in seine Züge.
„Ja, du hast Recht, der tat gestern so, als ob er etwas Wichtiges zu bereden hätte, aber – erst einmal – schön, dass du da bist!“
Ingo Kühn wird noch immer etwas verlegen, wenn sein Vater lobend mit ihm spricht; er sieht darum auf den Monitor, an den sein Vater angeschlossen ist und der dessen unregelmäßige und schwache Herzaktivitäten elektronisch widerspiegelt, blickt dann auf das Neue Testament, das in Griffhöhe auf dem Tisch neben dem Bett liegt, nicht nur, weil es sich für einen Theologen einfach so gehört, nein, Albert Kühn hatte darum gebeten, aber er liest kaum darin, denn alle Stellen, die für seine jetzige Situation Hoffnung und Geduld liefern könnten, kennt er auswendig, hat sie x-mal gelesen, sagt sie aus dem Gedächtnis her. So greift er manchmal nur nach dem kleinen Buch, wie er es in seinem Leben so oft getan hat, umfasst dieses Bündel Papier fest, faltet darüber seine Hände und es ist ihm, als ginge eine magische Kraft von dem feinen Leder des Buchdeckels aus.
Doch die Gedanken seines Sohnes laufen in eine andere Richtung, er fragt den Vater – ganz unüberlegt ist es aus ihm heraus gerutscht –:
„Soll ich dir nicht noch etwas anderes zu lesen bringen, vielleicht etwas Heiteres?“
Sofort ist er sich der Banalität seiner Frage bewusst, schämt sich aber nicht, steht dazu. Doch der Vater hat dem Sohn diesen Ausrutscher schon verziehen, übergeht ihn einfach, hat ihn schon vergessen. Er war immer nachsichtig mit ihm umgegangen, will auch jetzt das Gespräch mit dem Sohn anders nutzen.
„Weißt du, früher haben die Menschen in meiner Situation mit dem Leben abgeschlossen, jedenfalls die, die über sich, Gott und die Welt – und den Tod nachgedacht haben. Mir aber will das nicht so recht gelingen.“
Er zögert; jetzt ist er derjenige, der an der Bedeutung seiner Worte zweifelt, will aber seine Gefühle trotzdem einem anderen, einem Vertrauten mitteilen.
„Es gibt heute in der Kardiologie immer wieder neue Möglichkeiten. Die haben in den letzten Jahren so richtig Fortschritte gemacht, die immer wieder neue Hoffnung… “
Doch bei diesem letzten Wort durchzuckt es ihn, er stockt. Glaube, Liebe, Hoffnung – ist das tatsächlich die Hoffnung, von der der Apostel spricht, eine Hoffnung, die aus einer gerade aktuellen Medizintechnik entspringt. Nein, nie und nimmer! Er reißt seine Gedanken von diesem ihm jetzt banal erscheinenden Optimismus hinweg. Nein, Hoffnung findet er nur in seinem Gott und in dessen Auferstehung; das hatte er sein Leben lang gelehrt. Und doch… Nicht, dass ihm im Angesicht des Todes Zweifel kämen, nein, ganz sicher nicht. Er ruht fest in seinem Glauben. Aber da kommt doch eine Unruhe hinzu, eine ängstliche Unruhe. Und dann ist es ihm, als könne er nur noch mit einer Hand sein Neues Testament, die Hand seines Gottes, halten und müsse mit der anderen nach diesem Arzt, seinen Geräten – und einem neuen, einem fremden Herzen greifen. So hört er gerne die Worte seines Sohnes.
„Das bringen die wieder hin mit dir. Es ist zwar immer noch schwierig, auch heute noch, aber glaube mir, es ist machbar; die medizinische Technik wird immer wunderbarer und außerdem – wir sind alle in Gottes Hand.“
Und mutig fährt der Sohn fort, ist sich dessen bewusst, dass seine Worte an Blasphemie grenzen:
„Warum sollte er dir nicht mal gesondert helfen?“
Und fast trotzig sagt er weiter, fasst die abwehrende Hand des Vaters, drückt sie fest:
„Nein, ich meine das ernst. Wir beten doch alle für dich – auch in meiner Gemeinde, sogar die Damen von der Frauenhilfe. Ich weiß, die hast du immer alte Schachteln genannt, mit Helfersyndrom als Ersatz“,
Ingo Kühn lächelt amüsiert,
„na ja, für alles Mögliche.“
Sein Vater versteht, greift den kleinen, so liebevoll ablenkenden Scherz gerne auf, lächelt seinen Sohn dankbar an.
„Ach ja, die werden es mir verzeihen.“
Doch dann wird er wieder ganz ernst; diese Diskrepanz zwischen der Hoffnung seines Glaubens und dem Optimismus, den moderne medizinische Technik hervorrufen kann, die lässt ihn nicht los. Er nimmt einen neuen Anlauf, mehr Klarheit in seine Gefühle zu bringen.
„Weißt du, eigentlich habe ich mich mit dieser Situation doch häufiger auseinander gesetzt, zumindest jedes Mal, wenn ich den Vers sagte: Mitten wir im Leben stehen, von dem Tod umfangen. Doch jetzt ist alles so anders, ich weiß auch nicht wie.“
Mit einem fast hilflosen Lächeln sieht er den Sohn an, bittet ihn damit um Verzeihung für seine Schwäche und es gelingt ihm dann doch, auch diese Schwierigkeit in ein biblisches Wort zu bringen:
„Ja ja, der alte Adam, der hängt eben doch am Leben.“
Das Gespräch zwischen Vater und Sohn erstirbt, findet keinen Ausweg aus dem Dilemma, in das neue Gefühle und alte Gedanken geführt haben. So betritt Erleichterung zugleich mit Dr. Schäffer das Krankenzimmer. Das forsche Auftreten des jungen Chefarztes, seine sichere, intellektuelle Art bringen Mut und Zuversicht zugleich in den Raum, wehen sich verknotende Gespräche hinweg, lassen frisch und tief durchatmen.
Der Arzt begrüßt Vater und Sohn mit festem Händedruck, wirft einen prüfenden Blick auf alle Geräte, legt dann seine linke Hand auf die Stirn des Patienten während seine rechte den Puls ertastet. Als er, zu Ingo Kühn gewandt, anfängt zu sprechen, belässt er noch seine Linke auf der Stirn des Vaters und dem Sohn erscheint es, als wolle der Arzt seinen Vater segnen, wende seine ganze emotionelle Kraft dem Kranken zu.
„Herr Kühn, ich habe mit Ihrem Vater bereits darüber gesprochen; um es klar zu sagen, es steht nicht gut, die konventionelle ärztliche Kunst ist hier einfach am Ende, das ist nun mal so und wir – auch Sie – müssen das einfach klar sehen.“
Er zieht seine Hand zurück und fährt an beide gerichtet fort.
„Oder eben doch nicht! Denn die Transplantationsmedizin ist heute eine phantastische Möglichkeit, sie kann auch hier zum Geschenk eines neuen Lebens werden.“
Er wartet die Wirkung seiner Worte ab, bis Ungeduld auf den Gesichtern seiner Zuhörer auftaucht, fährt dann zielsicher fort:
„Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Der Haken ist hier, wie so oft, die Bürokratie: Einer nach dem anderen – und da ist es für manchen eben zu spät. Und, mein lieber Kommilitone,“
er lächelt über seinen kleinen Scherz, der aber doch einen Hauch von Solidarität, zwar nicht zwischen den recht unterschiedlichen Fakultäten aber doch zwischen Arzt und Patient herstellt und fährt dann fort:
„diese Gefahr besteht auch bei Ihnen – und zwar hochgradig.“
Er fasst erneut die Hand des Kranken, spricht wie zu sich selbst:
„Manchmal ist das einfach zum Verzweifeln. Da hat man noch recht junge Patienten – ja ja, das gilt auch für Sie! –, da hat man Patienten mit den besten Chancen, noch erfüllte Jahre zu erleben, sinnvolle Jahre, wertvoll auch für andere Menschen, nicht nur so einfach dahingelebt – und dann muss man gerade bei denen mit gebundenen Händen zusehen.“
Er atmet tief durch, schüttelt den Kopf, sieht seine beiden Zuhörer an, als wolle er sie dafür um Verzeihung bitten und sagt dann leise:
„Nur weil ein Spenderherz fehlt! Glauben Sie mir, das geht mir nahe! Da will man etwas tun – und kann nicht. Nur weil die Bürokratie im Wege ist. Ja, ich muss das so und in aller Deutlichkeit sagen!“
Jetzt sieht er seine beiden Zuhörer fast treuherzig an.
„Es ist schwer für uns, für mich – manchmal kaum zu ertragen.“
Ingo Kühn hat sich schnell von der Wirkung dieser Worte erholt; ans Herz gehende Gespräche ist er durch seine Gemeindearbeit gewöhnt. Er spürt, dass das nicht alles ist, was der Arzt zu sagen hat, sagen will; er weiß sofort, dass hier noch etwas kommt, kommen muss, etwas, das erfragt, heraus gefragt werden will, etwas, das nicht in irgendwelchen Leistungskatalogen erfasst ist, und so fragt er drängend:
„Und da gibt es einfach keine Möglichkeit, ich meine… “
Er stockt, weiß selbst nicht so richtig, auf was er hinaus will, findet aber instinktiv weiter.
„Unsere Familie ist nicht unvermögend, ich meine – wir könnten eine großzügige Spende aufbringen.“
Ingo Kühn ist fast erleichtert, dass es heraus ist, ja, er ist stolz darauf, dass jetzt er zum ersten Male seinem Vater gegenüber die Initiative ergriffen hat: jetzt will er, er der Sohn, helfen.
Doch Albert Kühn hat schnell in seine Vaterrolle zurückgefunden; Nachsicht und Güte sind in seiner Stimme, seinen Worten, mit denen er den Sohn zurückhält und sich vor dem Arzt wieder in die richtige Position bringt.
„Ingo, du meinst es gut. Aber ich glaube, dass ich den Doktor schon richtig verstehe. Auch seine Kunst unterliegt in wichtigen Bereichen staatlich verordneten Grenzen.“
Er blickt abwartend auf den Arzt. Doch der interessiert sich nur für die Herzaktionen auf dem Monitor, und so fährt Professor Doktor Kühn mit etwas mehr Nachdruck fort:
„Für Spenderherzen gibt es eben Wartelisten. Das ist doch auch richtig so. Stell dir mal vor… “
Er unterbricht sich, spürt die Überflüssigkeit dessen, was er sagt, horcht dann aufmerksam auf das, was der Arzt erklärt, der, die Worte des Vaters überhörend, sich an den Sohn wendet.
„Ihr Vater ist ein bescheidener und gütiger Mensch, ja, ich möchte ihn weise nennen, ein Mann, der das Leben kennt und es auch in schwierigster Situation meistert.“
Er lächelt, beendet dann aber dieses Lächeln abrupt und fährt in einem harten, fast geschäftsmäßigen Ton fort:
„Meine Herren, ich bitte Sie über das, was ich Ihnen jetzt sagen werde, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Es besteht nämlich eventuell die Möglichkeit, die Warteschlange zu umgehen. Ich sage bewusst eventuell, aber ich sehe da vielleicht eine Möglichkeit.“
Diesmal ist es Professor Kühn, der zuerst reagiert und mit einem gewissen Stolz, der sich als Demut darstellt, würdevoll antwortet:
„Und dann würde da irgend so ein armer Mensch um seine Chance betrogen, die er unter Leiden erwartet hat.“
Er atmet tief durch, unterstreicht und genießt die Wirkung seiner Worte nochmals indem er weiter spricht:
„Lieber Doktor, Sie meinen es gut, ich weiß, aber das möchte ich nicht! Irgendwann muss ich ja doch vor meinen Schöpfer treten – und dann? Nein nein!“
Zuerst ein wenig steif, dann verständnisvoller und danach ungewohnt engagiert antwortet der Arzt:
„Oh nein, lieber Herr Kühn, Sie haben mich missverstanden. Das ist kein Trick, die Bürokratie zu umgehen, Sie in der Warteschlange nach vorn zu bringen; kein anderer Patient, kein Wartender hätte den geringsten Nachteil dadurch. Im Gegenteil, die nach Ihnen Wartenden würden um eine Position aufrücken, kämen schneller an die Reihe – es wäre für alle ein Gewinn. Das kann ich Ihnen fest versichern, glauben Sie mir!“
Albert Kühns Herz ist in einem äußerst schlechten, in einem miserablen Zustand, kann sich kaum noch physiologischen Veränderungen anpassen, doch jetzt schlägt es schneller, jedermann kann es auf dem Monitor sehen – und der Arzt hat dies sofort erfasst. Doch dies ist zuerst einmal der Augenblick des Sohnes; spontan fasst er den Arzt am Arm, fragt drängend:
„Bitte Herr Doktor, es gibt also doch eine Möglichkeit?“
Und dann fährt er mit ruhiger, mit fester Stimme fort:
„Natürlich halten wir den Mund, wenn Sie das so wünschen. Auf uns können Sie sich ganz sicher verlassen, wir vertrauen uns Ihnen völlig an.“
Der Würfel ist längst gefallen. Was auch immer für Zeichen auf seinen Seiten stehen mögen, jedes ist recht, ist die Möglichkeit eines Ausweges, wo es sonst kein Entrinnen gibt. Doch Albert Kühn, ordentlicher Professor für systematische Theologie, taucht noch einmal in die Rolle, die er so gut begonnen hat, die Balsam für seine durch den Glauben zur Duldung verpflichtete Seele ist. Er genießt es geradezu, ist jetzt fröhlich im Glauben, als er noch einmal in aller Deutlichkeit betont, vor den beiden anderen und auch in ganz besonderem Maße vor sich selbst:
„Also, eines muss ganz klar sein: Ich will auf gar keinen Fall, dass irgendjemand durch mich Schaden nimmt; ich meine das sehr ernst.“
Er lächelt nun fast fröhlich.
„Todernst!“