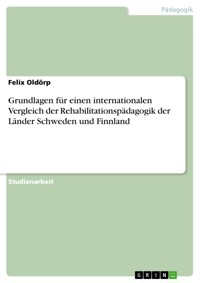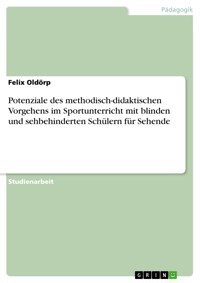Das inklusive Potenzial des Parasports. Empowerment von Menschen mit Behinderung im Leistungssport E-Book
Felix Oldörp
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Sport ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Mit Sport werden Eigenschaften wie Stärke, Fitness, Dominanz, Wohlbefinden und Leistungsvermögen assoziiert. Zugleich geben die Medien uns immer mehr vor, wie der normale Körper auszusehen hat und welche sportlichen Fähigkeiten als angemessen gelten. Wie verhält es sich jedoch für Menschen mit Behinderung, die einen Leistungssport ausüben? Behinderung wird mit Schwäche, Abhängigkeit, Unfähigkeit und mangelnder Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. In seiner Publikation zeigt Felix Oldörp, dass der Sport enorm zur Inklusion von Menschen mit Behinderung beitragen kann. Organisationen wie das Internationale Paralympische Komitee oder die Special Olympics haben sich das Ziel gesetzt, für mehr Empowerment und Inklusion von Menschen mit Behinderung im Leistungssport zu sorgen. Er zeigt auf, wie der Behindertenleistungssport die Inklusionschancen für Menschen mit Behinderung verbessert. Aus dem Inhalt: - Paralympics; - Leistungssport; - Menschen mit Behinderung; - Inklusion; - Empowerment; - Integration
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Behinderung
2.2 (Behinderten-) Leistungssport
2.3 Paralympische Spiele
2.4 Special Olympics
2.5 Deaflympics
3 Theoretischer Ansatz
3.1 Inklusion
3.2 Menschenbild im Sport
3.3 Ansätze für ein ganzheitliches Menschenbild
3.4 Darstellung von Behinderung und Sport in den Medien
3.5 Zusammenfassung
4 Inklusion im und durch Leistungssport
4.1 Inklusion und Empowerment
4.2 Segregation und Disempowerment
4.3 Zusammenfassung und Kategorisierung der Variablen
5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Quellenverzeichnis
Zusammenfassung
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Bewegung ist ein elementarer Bestandteil der menschlichen Existenz. Körperliche Aktivität, Sport und Spiel bestimmen seit Jahrtausenden Leben und Kultur des Menschen. Sport ist ein vielschichtiges Phänomen, universell und erreicht in seinen unterschiedlichen Abstufungen jeden – vom Kind bis zum Senioren, als Zuschauer oder selbst aktiven Sportler in organisierten Strukturen oder privat.Das macht Sport zu „one of the most prominent, pervasive, and important cultural institutions“ (Butler & Bissell, 2015, S. 231).Sport ist ein mächtiges System in Bezug auf Meinungsbildung, Identitätsbildung und Konstruktion bestimmter Normvorstellungen. Körperliche Schönheitsideale werden genauso entworfen, gefestigt und publiziert wie Männlichkeit, Weiblichkeit oder Fähigkeit/Können. Spitzensportler sind Vorbilder nicht nur für die Ausübung einer Sportart, sondern auch für Mode, Lebensstil und kulturelle Werte. Sport ist Teil der Gesellschaft, wird durch sie konstruiert und spiegelt somit gesellschaftliche Werte wider (vgl. DePauw, 1997, S. 418). Wettbewerb, Sieg und Niederlage sind allgegenwärtige Begriffe. Leistung und Wettbewerb bilden Hierarchien innerhalb einer Gesellschaft. Hierarchien lassen sich auch im Sport wiederfinden (z. B. im Kadersystem oder in Bezug auf Platzierungen). Der binäre Code des Gewinnens und Verlierens wird v. a. im Leistungssport auf die Spitze getrieben. Die Historie des Sports besteht zu einem Großteil aus Statistiken, Messungen und Rekorden. Dabei werden nicht nur die Leistungen der Athleten gemessen, sondern auch die Athleten selbst vermessen.
Bestimmte Ausprägungen des menschlichen Daseins werden als normal, natürlich und perfekt bestimmt. Normalität ist eine soziale Konstruktion, die sich an der Idealvorstellung einer Merkmalsausprägung orientiert. Dabei werden dichotome Kategorien gebildet, die ein Individuum als entweder-oder einstufen (normal/abnormal, behindert/nicht behindert, ...). Diese Merkmale sind relativ verfestigt und die Zuschreibungen sind stabil. Dabei sind Körper keine starren Gebilde, sondern sind in ihrer physischen Form, ihrem Erscheinungsbild und ihren Fähigkeiten von Person zu Person verschieden, ändern sich im Laufe des Lebens und in verschiedenen Kontexten. Normen werden von denen geteilt, gerechtfertigt und kontrolliert, die sich selber als normal ansehen. Die Aufrechterhaltung dieser binären Begriffe geschieht innerhalb gesellschaftlicher Systeme (vgl. Butler & Bissell, 2015, S. 229f.; S. 232f.).
Die Gesellschaft als Ganzes besteht aus verschiedenen sozialen Systemen (z. B. Wirtschaft, Politik, Sport, Medien, …). Die einzelnen Systeme innerhalb der Gesellschaft sind funktional voneinander abgegrenzt und bilden eine autopoietische Geschlossenheit, das heißt, die Systeme reproduzieren sich mithilfe systemeigener Methoden und erhalten sich damit am Leben. Trotz ihrer Selbstreferenz und Differenz stehen die einzelnen Systeme im Austausch miteinander (Systemtheorie nach Luhmann (1997)). Einzelne Personen sind mal mehr und mal weniger in die einzelnen Systeme inkludiert (Ahrbeck, 2014, S. 24f.). Bei der Betrachtung von Normen, Systemen und Handlungen liegen immer Menschenbilder zugrunde. Es gibt eine Vielzahl an Menschenbildern, abhängig von der Kultur oder dem sozialen System. Menschenbilder sind idealisierte und generalisierte Vorstellungen, wie der Mensch ist oder sein sollte. Sie haben eine Orientierungsfunktion und sind handlungsleitend. Sie besitzen auch eine ästhetische, innovative und kritische Funktion. Unter anderem transportieren Medien diese Menschenbilder (vgl. Drexel, 2003, S. 300f.). Medien haben großen Einfluss auf die Meinungsbildung. Systeme nutzen diese Möglichkeit, um ihre Werte und Ziele in der Gesellschaft zu verbreiten, Aufmerksamkeit zu bekommen oder um Sponsoren und Einfluss zu erhalten (vgl. Counsell & Agran, 2012, S. 250). Die Systeme Sport und Medien stehen in einem engen Austausch. Der Sport wird von den Medien auf bestimmte Art und Weise inszeniert. Der Körper nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Die Bedeutung des Körpers und seine Ästhetik nehmen gesellschaftlich zu. Das wird nicht nur im Fitnessboom deutlich, sondern auch in der medialen oder persönlichen Präsentation des Körpers als identitätsstiftendes Merkmal. Diese Körpervorstellungen und -ideale sind gesellschaftlich konstruiert und bestimmen, wie der normale Körper auszusehen hat und welche (sportlichen) Bewegungen und Fähigkeiten als angemessen gelten. Dabei sind körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten nichts, was gesellschaftlich konstruiert werden müsste, da sie biologisch und physikalisch determiniert sind. Diese Konstruktion normativer körperlicher Werte birgt die Gefahr, dass bestimmte Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn sie die vorgegeben Werte nicht erfüllen (sei es auf der funktionalen oder der ästhetischen Ebene). Davon können nicht nur Menschen mit Behinderung betroffen sein (vgl. Giese & Ruin, 2016).
Behinderung wird mit Schwäche, Abhängigkeit, Unfähigkeit und mangelnder Leistungsfähigkeit assoziiert, Sport dagegen mit Stärke, Fitness, Dominanz, Wohlbefinden und Leistungsvermögen (vgl. Kauer-Berk & Bös, 2015, S. 89; Steadward, 1996, S. 26). So wird Behinderung als das genaue Gegenteil verstanden, also nicht als etwas Multifaktorielles, sondern als etwas nicht Können können und greift damit eine längst veraltete medizinische Definition auf.
„Ability is at the center of sport and physical activity. Ability, as currently socially constructed, means 'able' and implies a finely tuned 'able' body'“ (DePauw, 1997, S. 423).
Ableismnennt man im englischsprachigen Raum die Diskriminierung von Menschen aufgrund von (nicht vorhandenen) Fähigkeiten und ihres atypischen Körpers. Sport ist vornehmlich von nichtbehinderten Menschen für nichtbehinderte Menschen konstruiert. Behindertensport scheint daher zwei unvereinbare Konstrukte (Sport und Behinderung) zu beinhalten.
Der deutsche Behindertensport in seiner organisierten Form hat seine Ursprünge in der Nachkriegszeit der 1940er Jahre. Davor wurde er eher informell an den Blinden- und Gehörlosenschulen betrieben. Einzig der Gehörlosensportverband gründete sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach dem 2. Weltkrieg organisierten sich Kriegsversehrte in Sportvereinen und gingen einem geregelten Sportbetrieb auch auf leistungssportlicher Ebene nach. Die kriegsversehrten Sportler bildeten eine homogene Gruppe, die sich teilweise schon sehr lange kannten und sie blieben in den Vereinen meist unter sich. „Alle empfanden sich trotz ihrer Verwundung als sportliche und nationale Elite. Sie hatten ein entsprechendes (sportliches) Selbstbewusstsein, und sie verhielten sich auch so" (Krüger & Wedemeyer-Kolwe, 2012 S. 118). Erst gesellschaftliche Entwicklungen verdrängten den Behindertensport ins Abseits (vgl. ebd. 119f.). In den 1970er Jahren fand eine Öffnung der Vereine für alle sport- und bewegungsinteressierten Menschen mit Behinderung statt, da das ursprüngliche Klientel in die Jahre gekommen war. 1972 wurde der Deutsche Behindertensportverband (DBS) vom Deutschen Sportbund (DSB) als ordentlicher Verband aufgenommen. Der DBS ist heute bundesweit für den Leistungssport verantwortlich. Er setzt sich aus den einzelnen Landesverbänden sowie dem Deutschen Schwerhörigen-Sportverband (DSSV) und dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband (DRS), die eigene Dachverbände darstellen, zusammen. Special Olympics Deutschland (SOD) ist außerordentliches Mitglied. Der DBS ist gleichzeitig das Nationale Paralympische Komitee (NPC) und somit Mitglied des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC). Der Behindertensport ist ein differenziertes System, das für alle Altersgruppen ein Angebot in unterschiedlichen Sportgruppen (allgemein und behinderungsspezifisch) anbietet; es gibt Angebote im Rehabiliations-, Breiten- und Freizeit- sowie Leistungssport. Neben den bestehenden separaten Sportmöglichkeiten bildeten sich auch integrative Projekte, die v. a. im Freizeitsport schnell ausgebaut wurden (vgl. Doll-Trepper, 2015, S. 18ff.; Scheid, Rank & Kuckuck, 2003, S. 13; Wedemeyer-Kolwe, 2015, S. 100f.).
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK), die die allgemeinen Menschenrechte für Menschen mit Behinderung präzisiert und ihre uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel hat, sieht gerade deshalb die Teilhabe im Sport explizit vor. Allerdings erwähnt Artikel 30, Absatz 5a[1] nur den Breitensport und nicht den Leistungssport. Leistungssport ist ein Bereich des Sports, der sich v. a. in seiner Zielsetzung und betriebenen Intensität vom Freizeit- und Breitensport unterscheidet. Behindertenleistungssport hat eine individuelle und eine soziale Dimension. Die individuelle Dimension beinhaltet u. a. das Selbstkonzept, Motivation und Ziele, Kontrollüberzeugungen und Coping. Beide Dimensionen sind nicht immer klar voneinander zu trennen, da Selbstkonzept und Kontrollüberzeugungen das Selbstbewusstsein beeinflussen und somit das Auftreten in der Öffentlichkeit bestimmen (vgl. Wegner, 2000, S. 64ff.).
Dem Sport wird ein enormes Potential unterstellt, wenn es um Integration und Inklusion geht. Die komplexen Mechanismen und multifaktoriellen Einflussgrößen sind jedoch noch nicht ausreichend untersucht. Eindeutige empirische Befunde für das inklusive Potential gibt es nicht (vgl. Giese, 2016a). Das Verhalten oder die Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung auf sportlicher Ebene sind ebenso wenig untersucht. Mögliche Gründe könnten die schwierige Vorhersage von Verhalten bzw. die Messung von Einstellungen sein. Generell liegt der Schwerpunkt der Forschung im (Behinderten-)Leistungssport nicht im sozialen Bereich, sondern in der Trainingswissenschaft und der Sportmedizin (vgl. Scheid et al., 2003, S. 9f.; Wegner, 2000, S. 70). Forschung in Bezug auf Inklusion und Behindertenleistungssport wird gering betrieben (vgl. Brittain, 2010, S. 1; Edwards & McNamee, 2011, S. 97; McConkey, Dowling, Hassan & Menke, 2013, S. 924f.). In der deutschsprachigen Literatur wird das Thema Inklusion durch Behindertenleistungssport kaum aufgegriffen. Neben dem eigenen Interesse ist das einer der Gründe des Autors, sich mit der Thematik in dieser Arbeit zu befassen.
Inklusion kann im Sport allgemein oder sportartspezifisch betrachtet werden, bzw. in den Kategorien aktiv und passiv. Die passive Rolle ist die des Publikums. Dieses Teilsystem ist sehr niederschwellig, also für jede Person zugänglich. Der aktive Sportbereich nimmt in seiner Zugänglichkeit vom Freizeit- über den Breitensport bis hin zum Spitzensport stark ab (vgl. Wansing, 2013, S. 11ff.). Inklusion im und durch Leistungssport kann auf zwei Ebenen untersucht werden: sportbezogen und gesamtgesellschaftlich. Inklusion im Leistungssport bedeutet, dass innerhalb des Leistungssport Athleten mit und ohne Behinderung gemeinsam trainieren und gefördert werden. Es geht dabei um das Nutzen von Synergien, Ressourcen und Sachverstand im Bereich Trainings- und Bewegungswissenschaft. Inklusion im Leistungssport heißt auch, dass Athleten mit und ohne Behinderung in Wettkämpfen gemeinsam antreten. Diese Debatte wird zwischen Verbänden und Funktionären intensiv geführt. Das jüngste populärste Beispiel ist der Weitspringer Markus Rehm.[2] Inklusion durch Leistungssport hat die gesamtgesellschaftliche Perspektive im Blick. Organisationen wie das Internationale Paralympische Komitee oder die Special Olympics treten nach eigenen Angaben mit ihrem Handeln und Programmen für Empowerment und Inklusion für Menschen mit Behinderung ein. Doch können Forschungsergebnisse diese Anliegen stützen? Die vorliegende Arbeit soll anhand einer Literaturanalyse klären, ob der Behindertenleistungssport zu Empowerment von Menschen mit Behinderung beitragen kann und ob Menschen mit Behinderung mithilfe des Leistungssports bessere Inklusionschancen innerhalb der Gesellschaft haben. Welche inklusiven Potentiale liegen somit im Behindertenleistungssport?
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Behinderung
In diesem Kapitel wird der Begriff Behinderung im Allgemeinen sowie auf sportrechtlicher Ebene definiert. Des Weiteren soll der Begriff geistige Behinderung[3], der v. a. im Zusammenhang mit den Special Olympics von Bedeutung ist, beschrieben werden.
Der Behinderungsbegriff wandelte sich in den letzten Jahrzehnten von einem statischen zu einem dynamischen. Das heißt, Behinderung wird nicht mehr als Schicksal und medizinische Abweichung des Individuums von der Norm betrachtet. Dem modernen Behinderungsbegriff liegt ein bio-psycho-soziales Model zugrunde, das nicht nur die medizinische Seite der Beeinträchtigung betrachtet, sondern auch Wechselwirkungen zwischen Umwelt- und Personenfaktoren einbezieht, so dass Ressourcen der Person mit in den Fokus gelangen (Kompetenzorientierung). In der UN-BRK ist Behinderung wie folgt definiert:
„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 2014, Art. 1).
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) nennt drei Ebenen, die für die Funktionsfähigkeit des Menschen von Bedeutung sind: Körperstrukturen und -funktionen, Aktivitäten, Teilhabe an Lebensbereichen (vgl. WHO, 2015, S. 4). Sport ist ein Teilbereich des gesellschaftlichen Lebens. Die Zugangskriterien zum Sportbetrieb für Menschen mit Behinderung werden von den jeweiligen Organisationen und Dachverbänden festgelegt. Um bei einem internationalen Wettkampf starten zu dürfen, muss eine permanente Beeinträchtigung in mindestens einer der zehn vom IPC definierten Behinderungsbereiche (Sehbehinderung, intellektuelle Beeinträchtigung, Kleinwüchsigkeit, ...) vorliegen. Diese Beeinträchtigung muss die sportliche Leistung negativ beeinflussen. Als Beispiel sei eine Person genannt, der zwei Finger amputiert wurden. Sie würde in die Gruppe der Amputierten fallen, ist in ihrer sportlichen Aktivität durch die Amputation aber nicht eingeschränkt und erfüllt somit nicht das minimum impairment criteria. Die Kriterien müssen laut IPC konsistent mit der ICF sein (vgl. Tweedy & Howe, 2011, S. 22; S. 27).
Wie behindert man sein muss, um starten zu dürfen, ist eine Kernfrage, die alle Wettbewerbe des Behindertenleistungssports begleitet. Eine andere Frage betrifft die Art der Behinderung, denn wenn die Person die „falsche“ Behinderung hat, darf sie auch nicht starten (z. B. ist Judo bei den Paralympischen Spielen nur für sehbehinderte Athleten offen) (vgl. Hughes & McDonald, 2008, S. 143f.). Für die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen hat das IPC einen Klassifizierungscode herausgegeben, der allgemein und sportartspezifisch festlegt, welche Athleten starten dürfen. Die einzelnen Sportfachverbände (z. B. INAS-FID oder IBSA) legen Mindeststandards für die Teilnahme an der jeweiligen Sportart fest. Danach richtet sich auch der DBS (vgl. Internationales Paralympisches Komitee, 2015, S. 2).
Eine geistige Beeinträchtigung – „ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten“ (DIMDI, 2015) – wird mithilfe standardisierter Intelligenztests festgestellt. Abhängig von der Schwere werden Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten beeinträchtigt. Eine geistige Beeinträchtigung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Behinderung auftreten. In der ICD-10 werden vier Schweregrade unterschieden:
leichte Intelligenzminderung: IQ-Bereich 50 – 69 (Intelligenzalter bei Erwachsenen von 9 bis 12 Jahren),
mittelgradige Intelligenzminderung: IQ-Bereich 35 – 49 (Intelligenzalter von 6 bis 9 Jahren),
schwere Intelligenzminderung: IQ-Bereich 20 – 34 (Intelligenzalter von 3 bis 6 Jahren),