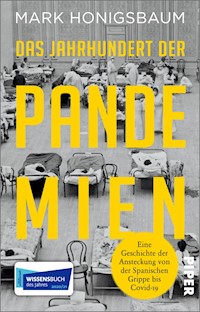
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine lehrreiche Medizingeschichte über ein Jahrhundert voller Krankheiten und wissenschaftlichen Fortschritts Medizinhistoriker und Journalist Dr. Mark Honigsbaum blickt auf 100 Jahre Pandemiegeschichte zurück und präsentiert dabei medizinische Höchstleistungen "Wer sich nicht an seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen." Dieser Satz des spanischen Philosophen George Santayana muss heute fast ironisch wirken: Medizinhistoriker Mark Honigsbaum blickt in seinem Sachbuch "Das Jahrhundert der Pandemien" auf die Epidemien der vergangenen 100 Jahre zurück. Er beschreibt die Ausbrüche der Spanischen Grippe, der sogenannten Papageienkrankheit, der Legionärskrankheit, und verfolgt die Entwicklung von AIDS in Amerika und Afrika, von Ebola und Zika. Mit Covid-19 reicht seine Schilderung bis ins Heute hinein. Dabei fördert er immer wieder interessante wie tragische Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zutage. Zu jeder Zeit lassen sich nämlich engagierte Forscher finden, die bei ihrer Bekämpfung einer Seuche durch frustrierende bürokratische Verwaltungsapparate und andere Hindernisse ausgebremst werden. »Honigsbaum ist nicht bloß ein gründliches Werk jüngerer Medizingeschichte gelungen, sondern auch ein Page-Turner.« NZZ Wie in einem spannenden Roman beschreibt Mark Honigsbaum in "Das Jahrhundert der Pandemien" die immer wiederkehrende Suche nach neuen Krankheitserregern. Die Beteiligten bringen sich dabei sogar selbst in Gefahr, um das Leben Millionen anderer Menschen zu retten – manchmal mit fatalen Folgen. Ausbruch, Verbreitung und Bekämpfung – die Lehren eines Jahrhunderts voller Epidemien in einem Buch vereint »Mark Honigsbaum hat ein faszinierendes Buch über ein gerne beiseitegeschobenes Thema geschrieben: Wenn uns die vergangenen 100 Jahre – und nicht nur sie – etwas gelehrt haben, dann, dass neue Krankheiten und Virenstämme uns unweigerlich heimsuchen werden, egal wie hoch entwickelt die Wissenschaft wird.« ― Deutschlandfunk "Auslese"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür Mary-LeeAus dem Englischen von Monika Niehaus und Susanne Warmuth© Mark Honigsbaum, 2019Kapitel 10 und Epilog © Mark Honigsbaum, 2020Titel der englischen Originalausgabe: »The Pandemic Century. A History of Global Contagion from the Spanish Flu to Covid-19« bei WH Allen, Ebury Publishing in der Penguin Random House Group, London 2020Deutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2021Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
PrologHaie und andere Prädatoren
1Der blaue Tod
2Die Pest in der Stadt der Engel
3Die große Papageienkrankheits-Pandemie
4Der »Philly Killer«
5Legionärskrankheit, zweiter Akt
6AIDS in Amerika, AIDS in Afrika
7SARS und der »Superspreader«
8Ebola an den Grenzen
9Z wie Zika
10»Disease X«, eine neue Infektionskrankheit, heute bekannt als COVID-19
EpilogDas Jahrhundert der Pandemien
Dank
Abkürzungen
Glossar
Register
PrologHaie und andere Prädatoren
In den gemäßigten Gewässern des Nordatlantiks greifen Haie Badende niemals an. Und ein Hai kann das Bein eines Schwimmers auch nicht mit einem einzigen Biss abtrennen. So dachten die meisten Haiexperten im glühend heißen Sommer des Jahres 1916, als die Bewohner von New York und Philadelphia an die Strände im Norden von New Jersey strömten, um dort vor der drückenden Hitze im Inland Abkühlung zu finden. Im selben Sommer hatte an der Ostküste eine Polio-Epidemie gewütet, und das hatte zu Warnhinweisen geführt, es bestehe das Risiko, sich in öffentlichen Schwimmbädern mit »Kinderlähmung« zu infizieren. Die Küste von Jersey galt jedoch als prädatorenfreie Zone.
»Das Risiko, von einem Hai angegriffen zu werden«, erklärte Frederic Lucas, Direktor des American Museum of Natural History, im Juli 1916, »ist ungleich geringer, als vom Blitz getroffen zu werden … die Gefahr eines Haiangriffs an unseren Küsten liegt praktisch bei null.« Als Beweis verwies Lucas auf die Belohnung von 500 Dollar, die der Millionär und Bankier Hermann Oelrichs »für einen authentischen Fall« ausgesetzt hatte, »dass ein Mensch in gemäßigten Gewässern [in den Vereinigten Staaten nördlich von Cape Hatteras, North Carolina] von einem Hai attackiert wird« – eine Summe, die niemals eingefordert worden war, seit Oelrichs dieses Angebot 1891 in der New York Sun gemacht hatte.[1]
Aber Oelrichs und Lucas irrten sich, und das galt auch für Henry Fowler und Henry Skinner, zwei Kuratoren der Academy of Natural Sciences in Philadelphia, die 1916 kategorisch festgestellt hatten, dass einem Hai die Kraft fehle, einem Menschen ein Bein abzubeißen. Das war die bekannte Faktenlage – bis zur ersten Ausnahme am Abend des 1. Juli 1916. Damals entschloss sich Charles Epting Vansant, ein reicher junger Börsenmakler, der mit Frau und Familie in New Jersey Urlaub machte, vor dem Abendessen in der Nähe seines Hotels in Beach Haven noch mal kurz ins Wasser zu gehen. Vansant oder »Van«, wie er von seinen Freunden genannt wurde, hatte 1914 an der University of Pennsylvania seinen Abschluss gemacht; er war ein Nachkomme einer der ältesten Familien des Landes – niederländische Einwanderer, die sich 1647 in der Neuen Welt niedergelassen hatten – und berühmt für seine Sportlichkeit. Wenn er irgendwelche Sorgen gehabt haben sollte, sich an diesem Abend in die kühlen Wasser des Atlantiks zu wagen, so wurden sie vom vertrauten Anblick des Rettungsschwimmers Alexander Ott, Mitglied des amerikanischen olympischen Schwimmteams, und eines freundlichen Chesapeake Bay Retriever vertrieben, der auf ihn zurannte, als er in die Brandung eintauchte. Nach Art junger edwardianischer Männer jener Tage schwamm Vansant aus dem mit Leinen abgetrennten Bereich direkt aufs offene Meer hinaus, bevor er sich umdrehte, um Wasser zu treten und den Hund zu sich zu rufen. Inzwischen waren sein Vater, Dr. Vansant, und seine Schwester Louise an den Strand gekommen und bewunderten vom Rettungsschwimmerhäuschen aus seine gute Form. Zu ihrer großen Belustigung weigerte sich der Hund, ins Wasser zu gehen. Wenige Augenblicke später wurde der Grund dafür klar – im Wasser tauchte eine schwarze Flosse auf, die sich von Osten her auf Vansant zubewegte. Verzweifelt winkte der Vater seinem Sohn zu, zurück an Land zu schwimmen, doch Vansant erkannte die Gefahr zu spät, und als er sich noch rund 50 Meter vom Strand entfernt befand, spürte er einen plötzlichen heftigen Ruck und einen schrecklichen Schmerz. Als sich das Wasser um ihn rot verfärbte, griff Vansant nach unten und stellte fest, dass sein linkes Bein nicht mehr da war, glatt am Oberschenkelknochen durchtrennt.
Inzwischen war ihm Ott zu Hilfe geeilt und zog ihn durch das Wasser in die Sicherheit des Engleside Hotels, wo sein Vater verzweifelt versuchte, die Blutung zu stillen. Aber es war zwecklos – die Wunde blutete zu stark –, und zum Entsetzen seines Vaters und seiner jungen Frau starb Vansant an Ort und Stelle, das erste bekannte Opfer eines Haiangriffs im Nordatlantik. Von diesem Moment an würde keiner von beiden jemals wieder auf den Atlantik am Strand von New Jersey blicken können, ohne sich das mörderische Gebiss vorzustellen, das unter der Oberfläche lauerte.
Sie waren nicht allein. Innerhalb von zwei Wochen wurden vier weitere Schwimmer an der Küste von New Jersey angegriffen und drei getötet, was eine geradezu hysterische Furcht vor »menschenfressenden« Haien[1] auslöste, die bis heute anhält.[2] Dabei spielt es kaum eine Rolle, dass Sichtungen von Weißen Haien und anderen großen Haiarten im Nordatlantik selten und Angriffe auf Schwimmer noch seltener sind. Strandbesucher wissen inzwischen, dass sie sich beim Schwimmen besser nicht zu weit von der Küste entfernen, und sollten sie die Risiken unterschätzen oder die Gefahr mit einem Achselzucken abtun, so gibt es stets eine Wiederholung von Der weiße Hai oder eine Folge von Shark Week auf Discovery Channel, um ihnen den Kopf zurechtzurücken. Daher fürchten sich viele Kinder und auch zahlreiche Erwachsene davor, in der Brandung zu spielen, und selbst diejenigen, die sich hinter die Brecher wagen, wissen, dass es ratsam ist, die Wasseroberfläche immer wieder nach einer verräterischen Rückenflosse abzusuchen.
***
Auf den ersten Blick scheinen die Haiangriffe in New Jersey wenig mit der Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 oder der Zika-Epidemie zu tun zu haben, die im Folgejahr in Brasilien ausbrach. Doch das ist ein Irrtum, denn genauso, wie sich die meisten Biologen keinen Haiangriff in den kalten Gewässern des Nordatlantiks vorstellen konnten, konnten sich die meisten Experten für Infektionskrankheiten im Sommer 2014 nicht vorstellen, dass Ebola, ein Virus, dessen Vorkommen sich zuvor auf abgelegene Waldregionen in Zentralafrika beschränkt hatte, eine Epidemie in einer Großstadt in Sierra Leone oder Liberia auslösen könnte, noch viel weniger jenseits des Atlantiks, in Europa oder den Vereinigten Staaten. Aber genau das geschah, als das Ebolavirus kurz vor Januar 2014 aus einem unbekannten Tierreservoir auftauchte, im Dorf Méliandou im Südosten von Guinea einen zweijährigen Jungen infizierte und von dort auf dem Landweg nach Conakry, Freetown und Monrovia und weiter auf dem Luftweg nach Brüssel, London, Madrid, New York und Dallas gelangte.
Und etwas sehr Ähnliches geschah 1997, als ein bislang obskurer Stamm aviärer Influenzaviren namens H5N1, der zuvor in Entenvögeln und anderem wilden Wassergeflügel zirkuliert hatte, plötzlich begann, große Mengen an Geflügel in Hongkong zu töten, und eine weltweite Panik vor der Vogelgrippe auslöste. Auf die Furcht vor der Vogelgrippe folgte 2003 die Panik vor dem Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom (SARS), auf das 2009 wiederum die Schweinegrippe folgte – ein Ausbruch, der in Mexiko begann und Angst vor einer weltweiten Influenza-Pandemie auslöste, die die Lagerbestände antiviraler Arzneimittel schrumpfen ließ und zur Produktion von Impfstoffen im Wert von vielen Milliarden Dollar führte.
Die Schweinegrippe entwickelte sich nicht zu einem »Menschenfresser« – die Pandemie tötete weltweit weniger Menschen, als gewöhnliche Influenzastämme in den Vereinigten Staaten und Großbritannien in den meisten Jahren an Opfern fordern –, im Frühjahr 2009 wusste das aber noch niemand. Während sich Infektionsfachleute auf das Wiederauftauchen der Vogelgrippe in Südostasien konzentrierten, hatte tatsächlich niemand mit dem Auftauchen eines neuartigen Schweinegrippevirus in Mexiko gerechnet, geschweige denn eines Virus mit einem ähnlichen genetischen Profil wie dem des Erregers der sogenannten Spanischen Grippe von 1918 – einer Pandemie, die Schätzungen zufolge mindestens 50 Millionen Menschen weltweit tötete und zu einem Symbol für ein virales Armageddon geworden ist.[2]
***
Im 19. Jahrhundert gingen medizinische Experten davon aus, ein besseres Verständnis der sozialen und umweltspezifischen Bedingungen, die zu Infektionen führten, würde sie in die Lage versetzen, Epidemien vorherzusagen und »die Panik zu bannen«, wie es der viktorianische Epidemiologe und Sanitärexperte William Farr 1847 ausdrückte. Als Fortschritte in der Bakteriologie jedoch zur Entwicklung von Impfstoffen (Vakzinen) gegen Typhus, Cholera und Pest führten und die Furcht vor den großen epidemischen Seuchen der Vergangenheit allmählich nachließ, gerieten andere Erkrankungen ins Blickfeld, und neue Ängste entwickelten sich. Ein gutes Beispiel ist die Poliomyelitis, kurz Polio genannt. In dem Monat, bevor die Haiangriffe auf Badende an den Stränden von New Jersey begannen, war in der Nähe des Hafengebiets in South Brooklyn eine Polio-Epidemie ausgebrochen. Mitarbeiter der New Yorker Gesundheitsbehörde beschuldigten sofort italienische Immigranten, die kürzlich aus Neapel eingewandert waren und in einem Bezirk namens »Pigtown« in höchst beengten, unhygienischen Mietskasernen lebten, für den Ausbruch verantwortlich zu sein. Als sich die Poliofälle häuften und die Zeitungen sich mit herzzerreißenden Berichten über gelähmte oder verstorbene Kinder füllten, führte diese öffentliche Aufmerksamkeit zu einer wahren Hysterie und der Flucht wohlhabender Einwohner aus der Stadt (viele New Yorker machten sich an die Küste von New Jersey auf). Innerhalb von Wochen hatte die Panik auch die Nachbarstaaten an der Ostküste ergriffen, was zu Quarantänemaßnahmen, Reiseverboten und Zwangseinweisungen in Krankenhäuser führte.[3] Diese hysterischen Reaktionen spiegelten zum Teil die damals vorherrschende medizinische Überzeugung wider, dass es sich bei Polio um eine Atemwegserkrankung handele, die durch Husten und Niesen sowie Fliegen weiterverbreitet werde, die sich inmitten von Abfall vermehrten.[3]
In seiner Geschichte der Poliomyelitis beschreibt der Epidemiologe John R. Paul die Epidemie von 1916 als »den Höhepunkt bei den Versuchen zur Durchsetzung von Isolations- und Quarantänemaßnahmen«. Als die Epidemie mit den sinkenden Temperaturen im Dezember 1916 allmählich abklang, zählte man in 26 Bundesstaaten insgesamt 27 000 Fälle und 6000 Tote, was die Epidemie zum größten Polio-Ausbruch der damaligen Zeit machte. Allein in New York wurden 8900 Fälle und 2400 Tote registriert; die Mortalitätsrate betrug also rund eins von vier Kindern.[4]
Die Größenordnung des Ausbruchs ließ Kinderlähmung als ein spezielles amerikanisches Problem erscheinen. Was die meisten Amerikaner aber nicht wussten, war, dass Schweden fünf Jahre zuvor einen ähnlich verheerenden Ausbruch erlebt hatte. Während dieses Ausbruchs hatten schwedische Wissenschaftler wiederholt Polioviren aus dem Dünndarm der Opfer isoliert – ein wichtiger Schritt zur Erklärung der wahren Ursachen der Entstehung (Ätiologie) und Krankheitsverläufe (Pathologie) der Krankheit. Den Schweden gelang es überdies, das Virus in Tieraffen zu kultivieren, die den Absonderungen von asymptomatischen menschlichen Trägern des Virus ausgesetzt worden waren. Das nährte den Verdacht, das Virus könne die Zeit zwischen den einzelnen Ausbrüchen in »gesunden Überträgern« überdauern. Diese Erkenntnisse wurden jedoch von führenden Polio-Experten ignoriert. Deshalb sollte es bis 1938 dauern, bis Forscher der Yale University die schwedischen Studien aufgriffen und bestätigten, dass asymptomatische Überträger häufig Polioviren mit dem Stuhl ausschieden und die Viren bis zu zehn Wochen in unbehandelten Abwässern überleben konnten.
Wie wir heute wissen, bestand in der Ära vor Entwicklung eines Poliovakzins die größte Hoffnung, Lähmungserscheinungen zu vermeiden, darin, bereits in früher Kindheit eine immunisierende Infektion durchzumachen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Polio schwere Komplikationen hervorruft. So gesehen war Dreck ein Freund der Mütter, und man konnte es als rationale Strategie ansehen, Babys mit poliokontaminiertem Wasser und Lebensmitteln in Kontakt zu bringen. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren die meisten Kinder aus Nachbarschaften, in denen arme Einwanderer lebten, auf genau diese Weise immun gegen den Erreger geworden. Das höchste Risiko, die paralytische Form der Erkrankung zu entwickeln, trugen die Kinder aus gepflegten Mittelklassewohngegenden – Menschen wie Franklin Delano Roosevelt, der künftige 32. Präsident der Vereinigten Staaten, der dem Polio-Erreger in seinen Teenagerjahren entkam, nur um sich 1921 als 39-Jähriger bei einem Urlaub auf Campobello Island, New Brunswick, mit dem Virus zu infizieren.
***
In diesem Buch geht es darum, wie wachsendes Wissen über Viren und andere Krankheitserreger (Pathogene) medizinische Forscher blind für diese ökologischen und immunologischen Erkenntnisse sowie für die Epidemie, die direkt um die Ecke lauert, machen kann. Seit der deutsche Bakteriologe Robert Koch und sein französischer Kollege Louis Pasteur in den 1880er-Jahren die »Keimtheorie« von Krankheiten aus der Taufe gehoben hatten, indem sie zeigten, dass Tuberkulose eine bakterielle Infektion war, und Impfstoffe gegen Anthrax (Milzbrand), Cholera und Tollwut entwickelten, haben Wissenschaftler – und die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, deren Arbeit auf den Methoden der Forscher fußten – davon geträumt, alle pathogenen Mikroorganismen zu besiegen. Aber während die medizinische Mikrobiologie und damit verknüpfte Gebiete, wie Epidemiologie, Parasitologie, Zoologie und in letzter Zeit auch Molekularbiologie, neue Möglichkeiten schufen, die Übertragung und Ausbreitung neuartiger Pathogene zu verstehen und sie für Kliniker sichtbar zu machen, stellten sich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden allzu oft als nicht ausreichend heraus. Das liegt nicht einfach nur daran, dass Mikroorganismen ständig mutieren und sich weiterentwickeln, was unsere Fähigkeit überfordert, mit ihrer sich pausenlos wandelnden Genetik und ihren Übertragungsmustern Schritt zu halten, wie manchmal argumentiert wird. Tatsächlich liegt es auch daran, dass Medizinforscher dazu neigen, Gefangene bestimmter Paradigmen und Theorien zu Krankheitsursachen zu werden, was sie blind für die Gefahren bekannter und unbekannter Pathogene macht.
Nehmen wir zum Beispiel Influenza, das Thema des ersten Kapitels. Als in der Endphase des Ersten Weltkriegs, im Sommer 1918, die Spanische Grippe ausbrach, nahmen die meisten Ärzte an, sie werde sich ähnlich wie vorangegangene Grippe-Epidemien verhalten, und taten sie als lediglich lästig ab. Nur wenige glaubten, der Erreger könne eine tödliche Bedrohung für junge Erwachsene darstellen, noch viel weniger für Soldaten auf dem Marsch zu den alliierten Linien in Nordfrankreich. Schließlich hatte niemand Geringerer als Kochs Schützling Richard Pfeiffer die Ärzteschaft darüber informiert, dass Influenza von einem winzigen, gramnegativen Bakterium übertragen werde und es nur eine Frage der Zeit sei, bis in deutschen Labormethoden ausgebildete Bakteriologen einen Impfstoff gegen den Influenza-Bazillus liefern würden, genauso wie es ihn schon gegen Cholera, Diphtherie und Typhus gab. Aber Pfeiffer und all diejenigen, die auf seine experimentellen Methoden vertrauten, irrten sich: Der Erreger der Influenza ist kein Bakterium, sondern ein Virus, zu klein, um durch die Linse eines normalen Lichtmikroskops gesehen zu werden. Überdies passierte das Virus problemlos die Porzellanfilter, die damals verwendet wurden, um Bakterien zu isolieren, wie man sie häufig im Nasen- und Rachenraum von Grippekranken fand. Auch wenn einige britische und amerikanische Forscher bereits früh den Verdacht hegten, der Influenza-Erreger könne ein »Filterpassierer« sein, sollte es viele Jahre dauern, bis Pfeiffers Fehleinschätzung korrigiert und die virale Ätiologie des Influenza-Erregers deutlich wurde. In der Zwischenzeit wurde viel Forschungszeit verschwendet, und Millionen junger Menschen starben.
Es wäre jedoch ein Irrtum zu glauben, dass es ausreicht, die Identität eines Erregers und die Ätiologie einer Krankheit zu kennen, um eine Epidemie unter Kontrolle zu bringen, denn auch wenn die Präsenz eines Infektionserregers eine notwendige Bedingung für Krankheit ist, ist sie selten hinreichend. Mikroorganismen interagieren auf verschiedene Weise mit unserem Immunsystem, und ein Erreger, der bei einer Person zu einer Erkrankung führt, lässt eine andere vielleicht unbeeinflusst oder löst nur leichte Symptome aus. Tatsächlich können viele bakterielle und virale Infektionen jahrzehntelang in Zellen und Geweben »schlafen«, bevor sie durch äußere Ereignisse oder Prozesse (re-)aktiviert werden, ob durch eine Koinfektion mit anderen Mikroorganismen, durch einen plötzlichen systemischen Schock aufgrund eines äußeren Stressors oder durch ein Nachlassen der Immunabwehr im höheren Alter. Noch wichtiger ist aber: Indem wir uns auf spezifische mikrobielle Prädatoren konzentrieren, riskieren wir, das größere Ganze aus dem Blick zu verlieren. Beispielsweise gehört das Ebolavirus vielleicht zu den tödlichsten Erregern, die uns bekannt sind, doch nur wenn tropische Regenwälder abgeholzt und die Fledermäuse, die vermutlich das Reservoir des Virus zwischen den Epidemien bilden, aus ihren Unterschlüpfen vertrieben werden oder wenn Jäger Schimpansen töten und zerlegen, um sie als »Bushmeat« (Fleisch von Wildtieren) zu verkaufen, kommt es dazu, dass Ebola auf Menschen überspringt und sich verbreitet. Und nur wenn die via Blut übertragene Krankheit durch schlechte Krankenhaushygiene weiteren Schub erhält, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich weiter ausbreitet und schließlich auch urbane Regionen erreicht. Unter solchen Umständen lohnt es, sich an das zu erinnern, was George Bernard Shaw 1906 in Des Doktors Dilemma ausdrückte: »Es war auch klar, dass die charakteristische Mikrobe einer Krankheit ebenso gut ein Symptom wie eine Ursache sein kann.« Wenn man Shaws Axiom aktualisiert, könnte man in der Tat sagen, dass Infektionskrankheiten fast immer breiter gefächerte umweltbedingte und soziale Ursachen haben. Solange wir die ökologischen, immunologischen und verhaltensbiologischen Faktoren, die das Auftauchen und die Verbreitung neuartiger Pathogene beeinflussen, nicht mitberücksichtigen, wird unser Wissen um solche Erreger und ihre Verbindungen zu Krankheiten zwangsläufig bruchstückhaft und unvollständig bleiben.
Um fair zu sein, hat es immer medizinische Forscher gegeben, die bereit waren, einen nuancierteren Blick auf unsere komplexen Wechselbeziehungen mit Mikroorganismen zu werfen. Beispielsweise wetterte René Dubos, Forscher am Rockefeller Institute, auf dem Höhepunkt der Antibiotikarevolution 1959 heftig gegen kurzsichtige technische Lösungen medizinischer Probleme. Zu einer Zeit, als die meisten seiner Kollegen die Überwindung von Infektionskrankheiten für selbstverständlich hielten und glaubten, die Ausrottung der häufigen bakteriellen Infektionsursachen stehe kurz bevor, warnte Dubos, der 1939 das erste kommerzielle Antibiotikum isoliert hatte und wusste, wovon er sprach, vor der allgemeinen medizinischen Hybris. Er verglich die Menschheit mit dem »Zauberlehrling« und mahnte, die medizinische Wissenschaft habe »potenziell zerstörerische Kräfte« in Gang gesetzt, die eines Tages den Traum von einem medizinischen Utopia zunichtemachen könnten. »Der moderne Mensch glaubt, dass er sich zum fast völligen Herrscher der Naturkräfte aufgeschwungen habe, die seine Evolution in der Vergangenheit geformt haben, und dass er nun sein eigenes biologisches und kulturelles Schicksal kontrollieren könne«, schrieb Dubos. »Aber das könnte sich als Illusion erweisen. Wie alle anderen Lebewesen ist er Teil eines ungeheuer komplexen ökologischen Systems und durch unzählige Verbindungen mit all seinen Komponenten verknüpft.« Ein vollständiges Freisein von Krankheiten, so Dubos, sei eine »Fata Morgana«, und die Natur werde »zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt und in unvorhersehbarer Weise zurückschlagen«.[5]
Aber obwohl Dubos’ Schriften in den 1960er-Jahren in der amerikanischen Öffentlichkeit ungeheuer populär waren, wurden seine Warnungen vor einem kommenden Krankheits-Armageddon von seinen wissenschaftlichen Kollegen weitgehend ignoriert. Daher war die medizinische Welt auch völlig überrascht, als die Centers for Disease Control and Prevention (CDC, eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums, die sich auf Infektionskrankheiten konzentriert) kurz nach Dubos’ Tod 1982 das Akronym AIDS für eine ungewöhnliche Autoimmunkrankheit prägten, die plötzlich in der Homosexuellengemeinschaft in Los Angeles aufgetaucht war und sich nun auf andere Teile der Bevölkerung auszubreiten begann. Aber die CDC hätten eigentlich nicht überrascht sein sollen, denn etwas ganz Ähnliches war erst acht Jahre zuvor geschehen: Damals hatte der Ausbruch einer untypischen Lungenentzündung (Pneumonie) bei einer Gruppe von Kriegsveteranen, die an einem Treffen der American Legion in einem Luxushotel in Philadelphia teilgenommen hatten, eine allgemeine öffentliche Hysterie ausgelöst. Epidemiologen bemühten sich verzweifelt, den »Philly Killer« zu identifizieren. Zunächst verblüffte der Ausbruch die Infektionsdetektive der CDC, und erst einem Mikrobiologen gelang es, den Erreger, Legionella pneumophila, zu identifizieren, ein winziges Bakterium, das in wässriger Umgebung gedeiht, so auch in den Kühltürmen einer Klimaanlage des Hotels. In diesem Jahr (1976) kam es nicht nur zu einer Panik aufgrund der Legionärskrankheit, sondern auch wegen des plötzlichen Auftretens eines neuen Schweinegrippestamms auf einer Basis der US-Armee in New Jersey – ein Ereignis, auf das die CDC und die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden gleichermaßen unvorbereitet waren und das schließlich zu der unnötigen Impfung von Millionen Amerikanern führen sollte. Und etwas ganz Ähnliches wiederholte sich 2003, als ein älterer chinesischer Professor für Nephrologie im Metropole Hotel in Hongkong eincheckte und damit für grenzüberschreitende Ausbrüche einer schweren Atemwegserkrankung sorgte, die anfangs dem Vogelgrippevirus H5N1 zugeschrieben wurde, doch, wie wir inzwischen wissen, von einem neuartigen, SARS-ähnlichen Coronavirus[4] ausgelöst wurde. In diesem Fall wurde eine Pandemie durch raffinierte mikrobiologische Detektivarbeit und eine beispielhafte Kooperation zwischen Netzwerken von Wissenschaftlern verhütet, die ihre Informationen miteinander teilten, aber es war eine knappe Sache, und seitdem gab es noch mehrere weitere unerwartete – und anfangs fehldiagnostizierte – kritische Infektionsereignisse.
In diesem Buch geht es um diese Ereignisse und Prozesse und um die Gründe, warum sie uns immer wieder überraschen, obwohl wir uns doch nach Kräften bemühen, sie vorherzusagen und vorbereitet zu sein. Einige dieser Geschichten, wie die Panik im Rahmen der Ebola-Epidemie 2016–18 oder die AIDS-Hysterie in den 1980er-Jahren, werden den Lesern bekannt sein; andere, wie der Ausbruch einer Pneumonie-Seuche im mexikanischen Viertel von Los Angeles 1924 oder die große Psittakose-Panik, die ein paar Monate nach dem Wall-Street-Crash von 1929 über die Vereinigten Staaten fegte, wohl weniger. Aber ob vertraut oder nicht – all diese Epidemien zeigen, wie rasch das anerkannte medizinische Wissen durch das Auftauchen neuer Pathogene auf den Kopf gestellt werden kann und wie ungewöhnlich erfolgreich solche Epidemien beim Verbreiten von Panik, Hysterie und Furcht sind, solange es keine Laborergebnisse, effektiven Impfstoffe und wirksamen Arzneimittel gibt.
Statt die Panik zu bändigen, können besseres medizinisches Wissen und eine bessere Überwachung von Infektionskrankheiten aber auch neue Ängste schüren und Menschen übersensibel auf epidemische Gefahren reagieren lassen, deren sie sich zuvor gar nicht bewusst waren. Genauso, wie Rettungsschwimmer das Meer nach bedrohlichen Rückenflossen absuchen, um Badende warnen zu können, durchsucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nämlich routinemäßig das Internet nach Berichten über ungewöhnliche Ausbrüche und testet Mikroorganismen auf Mutationen, die das Auftauchen des nächsten Pandemievirus signalisieren könnten. Bis zu einem gewissen Grad ist diese Hypervigilanz sinnvoll, aber der Preis, den wir zahlen, ist ein Zustand ständiger latenter Angst vor dem nächsten »Big One«, der nächsten großen Pandemie. Die Frage ist nicht, ob es zur Apokalypse kommt, hören wir immer wieder, sondern wann. In dieser fiebrigen Atmosphäre ist es nicht überraschend, dass sich Experten für öffentliche Gesundheit manchmal irren und den Panikknopf drücken, wenn tatsächlich gar kein Anlass zur Panik besteht. Oder sie verstehen die Bedrohung, wie im Fall der westafrikanischen Ebola-Epidemie, völlig falsch.
Um es deutlich zu sagen: Die Medien sind Teil dieser Prozesse – schließlich verkauft sich nichts so gut wie Furcht –, aber auch wenn Nachrichtenkanäle, die 24 Stunden lang sieben Tage die Woche senden, und die sozialen Medien dazu beitragen, Panik, Hysterie und die Stigmatisierung zu schüren, die mit dem Ausbruch von Infektionskrankheiten einhergehen, sind Journalisten und Blogger meistenteils lediglich Boten. Ich argumentiere, dass die medizinische Wissenschaft – und insbesondere die Epidemiologie –, die uns auf neue Infektionsquellen aufmerksam macht und bestimmte Verhaltensweisen als »riskant« bezeichnet, letztendlich auch die Quelle dieser irrationalen und oft schädlichen Urteile ist. Niemand bestreitet, dass ein besseres epidemiologisches Verständnis für die Ursachen von Infektionskrankheiten zu großen Fortschritten geführt hat, was das Vorbereitetsein auf Epidemien angeht, oder dass sich unsere Gesundheit und unser Wohlergehen dank technischer Fortschritte in der Medizin immens verbessert haben; dennoch sollten wir nicht vergessen, dass aus diesem Wissen ständig neue Sorgen und Ängste erwachsen.
Jede in diesem Buch diskutierte Epidemie illustriert einen anderen Aspekt dieses Prozesses und zeigt, wie der Ausbruch jedes Mal das Vertrauen in das vorherrschende medizinische und wissenschaftliche Paradigma untergrub, was die Gefahr von blindem Vertrauen in bestimmte Technologien auf Kosten eines umfassenderen ökologischen Verständnisses für die Ursachen von Krankheiten unterstreicht. Dabei stütze ich mich auf soziologische und philosophische Einsichten in die Struktur naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und argumentiere, dass sich das, was vor dem Auftauchen (Emergenz) der neuartigen Infektion »bekannt« war – dass Kühltürme und Klimaanlagen kein Risiko für Hotelgäste und Krankenhauspatienten darstellen, dass Ebola nicht in Westafrika zirkuliert und keine Großstadt erreichen kann, dass Zika eine relativ harmlose, von Stechmücken übertragene Krankheit ist –, als falsch herausstellte, und ich erkläre, wie all diese Epidemien in der Rückschau eine intensive Gewissenserforschung über »bekannte Bekannte« und »unbekannte Unbekannte«[5] auslösten und was Wissenschaftler und Gesundheitsexperten tun sollten, um solche erkenntnistheoretisch blinden Flecken in Zukunft zu vermeiden.[6]
Die in diesem Buch diskutierten Epidemien unterstreichen überdies die Schlüsselrolle, die umweltbedingte, soziale und kulturelle Faktoren dabei spielen, die Prävalenz- und Emergenzmuster einer Infektion zu verändern. Eingedenk von Dubos’ Erkenntnissen über die Ökologie von Pathogenen argumentiere ich, dass sich die Emergenz von Krankheiten in den meisten Fällen auf Störungen des ökologischen Gleichgewichts oder Veränderungen der Umwelt zurückführen lässt, in der der Erreger gewöhnlich heimisch ist. Das gilt besonders für Viren tierischen Ursprungs oder zoonotische Viren (die von Tier zu Mensch und umgekehrt übertragen werden können) wie das Ebolavirus, aber auch für kommensale (schmarotzende, aber nicht schädigende) Bakterien wie Streptokokken, die Hauptursache für ambulant erworbene Pneumonie. Der natürliche Wirt des Ebolavirus ist vermutlich ein Flughund. Aber obwohl Antikörper gegen das Ebolavirus in verschiedenen in Afrika heimischen Fledertierarten gefunden wurden, sind aus ihnen noch nie vermehrungsfähige Viren isoliert worden. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das Ebolavirus, wie andere Viren, die sich im Lauf einer langen gemeinsamen Evolution an ihren Wirt angepasst haben, vom Immunsystem der Fledertiere sehr rasch aus dem Blutstrom eliminiert wird, aber vermutlich nicht, bevor es auf ein anderes Fledertier übertragen wurde. Das führt dazu, dass das Virus ständig in Fledertierpopulationen zirkuliert, ohne dass Virus oder Wirt geschädigt werden. Etwas Ähnliches geschieht bei Viren, die sich im Lauf ihrer Evolution ausschließlich auf den Befall von Menschen spezialisiert haben, wie Masern- und Polioviren: Eine Erstinfektion in der Kindheit führt gewöhnlich nur zu einem leichten Verlauf der Erkrankung; anschließend erholen sich die Betroffenen und sind lebenslang immun. Aber von Zeit zu Zeit wird dieser immunologische Gleichgewichtszustand gestört. Das kann natürliche Ursachen haben, zum Beispiel wenn eine genügend große Anzahl von Personen in der Kindheit nicht erkrankt, sodass die Herdenimmunität schwindet, oder wenn das Virus plötzlich mutiert – wie es beim Influenzavirus häufig vorkommt – und es zur Zirkulation eines neuen Virenstamms kommt, gegen den die Population kaum oder gar keine Immunität besitzt. Aber so etwas kann auch passieren, wenn wir uns unabsichtlich zwischen das Virus und seinen natürlichen Wirt stellen. Das war vermutlich beim Ebolavirus 2014 der Fall, als Kinder in Méliandou begannen, Angola-Bulldoggfledermäuse zu necken, die in einem hohlen Baum in der Mitte des Dorfes lebten. Und vermutlich löste ein sehr ähnliches Ereignis in den 1950er-Jahren den Spillover[6] (»Übersprung«) des HI-Vorläufervirus von Schimpansen auf Menschen im Kongo aus. Im Fall von AIDS besteht kaum Zweifel, dass die Einführung des Dampfschiffsverkehrs auf dem Kongo um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und der Bau neuer Straßen und Schienenwege in der Kolonialzeit eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Virus spielten, ebenso die Gier von Holzfällern und Holzfirmen. Aber auch soziale und kulturelle Faktoren hatten Einfluss: Wäre es nicht allgemein üblich gewesen, Bushmeat zu verzehren, und hätte die Prostitution rund um die Lager der Schienen- und Holzarbeiter nicht derart floriert, hätte sich das Virus wahrscheinlich nicht so weit verbreitet und so rasch vervielfältigt. Und hätte es nicht so tief verwurzelte kulturelle Überzeugungen und Gepflogenheiten in Westafrika gegeben – vor allem das Festhalten der Einheimischen an traditionellen Begräbnisriten und ihr Misstrauen gegenüber wissenschaftlicher westlicher Medizin –, hätte sich das Ebolavirus wohl kaum zu einer großen regionalen Epidemie entwickelt, geschweige denn zu einer globalen Gesundheitskrise.
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis, die uns die Medizingeschichte vermitteln kann, ist jedoch die lange und enge Verbindung zwischen Epidemien und Krieg. Spätestens seit der attische Staatsmann Perikles den Athenern befahl, die spartanische Belagerung ihrer Hafenstadt 430 v. Chr. »auszusitzen«, gelten Kriege als Vorläufer tödlicher Ausbrüche von Infektionskrankheiten (was zweifellos auch 2014 in Westafrika der Fall war, wo ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg und bewaffnete Konflikte dazu führten, dass die Gesundheitssysteme in Liberia und Sierra Leone am Boden lagen und völlig unzureichend ausgestattet waren). Auch wenn der Erreger, der für die Seuche in Athen verantwortlich war, niemals identifiziert wurde und vielleicht auch niemals identifiziert werden wird (zu den Kandidaten zählen unter anderem Anthrax, Pocken, Typhus und Malaria), bestehen kaum Zweifel, dass der entscheidende Faktor die drangvolle Enge war, die hinter den Langen Mauern der griechischen Stadt herrschte, denn dort suchten bis zu 300 000 Athener und Flüchtlinge aus ganz Attika Schutz. Dieses erzwungene Zusammenleben auf engstem Raum schuf ideale Bedingungen für die Verbreitung des Virus – wenn es denn ein Virus war – und verwandelte Athen in ein Leichenhaus (wie Thukydides schreibt, gab es keine Häuser, um die Flüchtlinge aus dem Umland zu empfangen, daher »mußten sie in der heißen Jahreszeit des Jahres in stickigen Kabinen untergebracht werden, wo die Sterblichkeit ungehemmt wütete«[7]). Das führte dazu, dass Athen nach der dritten Infektionswelle um 426 v. Chr. ein Viertel bis Drittel seiner Bevölkerung verloren hatte.[8]
Im Fall der Attischen Seuche verschonte die Krankheit aus ungeklärten Gründen die Spartaner und breitete sich offenbar auch nicht weit über die Grenzen Attikas aus. Doch vor 2000 Jahren waren Städte und Dörfer stärker isoliert, und es gab weitaus weniger Ortsbewegung von Menschen und damit von Pathogenen zwischen Ländern und Kontinenten. Leider ist das heute nicht mehr der Fall. Dank des weltweiten Handels und Reiseverkehrs überqueren neue Viren und ihre Überträger (Vektoren) ständig Grenzen und Zeitzonen, und an jedem Ort treffen sie auf eine andere Mischung von ökologischen und immunologischen Bedingungen. Das galt ganz besonders für den Ersten Weltkrieg: Damals boten das Zusammentreffen von zigtausend jungen amerikanischen Rekruten in Ausbildungslagern an der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie ihre anschließende Überfahrt nach Europa und wieder zurück ideale Bedingungen für den bislang tödlichsten Ausbruch einer Pandemie in der menschlichen Geschichte.
1Der blaue Tod
Es war ein verschlafenes Provinznest, wie man es um 1917 auf einer Tour durch das ländliche New England überall hätte finden können. Ein Blinzeln, und Sie wären vielleicht schon daran vorbei gewesen. Ayer, 56 Kilometer nordwestlich von Boston in graubraunem Buschland gelegen, bestand aus weniger als 300 kleinen Cottages sowie einer Kirche und ein paar Geschäften. Wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass Ayer an der Schnittstelle der Boston and Maine Railroad sowie der Worcester, Nashua and Rochester Railroad lag und zwei Bahnhöfe besaß, hätte wenig für dieses Dorf gesprochen. Doch im Frühjahr 1917, als sich Amerika auf den Kriegseintritt vorbereitete und sich Militärplaner nach geeigneten Standorten umzusehen begannen, um Tausende von frisch eingezogenen Rekruten auszubilden, machten die Bahnstation und das umliegende freie Feld Ayer zu etwas Besonderem, gar Ungewöhnlichem. Vielleicht steckte jemand in Washington, D. C., im Mai 1917 genau aus diesem Grund eine Nadel mit einer roten Flagge in eine Landkarte von Massachusetts und bestimmte Ayer als Standort für das Quartier der neuen 76. Infanteriedivision der US-Armee.
Anfang Juni wurden Pachtverträge mit den Besitzern von rund 9000 Morgen baumlosem Grünland unterzeichnet, das an den Nashua River angrenzte, und zwei Wochen später begannen Pioniere, das Gelände in ein Lager für Major General John Pershings Infanteristen zu verwandeln. Innerhalb von nur zehn Wochen errichteten die Pioniere 1400 Baracken, installierten 2200 Duschen und verlegten fast 100 Kilometer an Heizrohren. Das Ausbildungslager, das rund 11 mal 11 Kilometer maß, hatte ein eigenes Restaurant, eine Bäckerei, ein Theater und 14 Aufenthaltsräume, in denen man lesen und zusammenkommen konnte, dazu eine Post und ein Telegrafenamt. Das Erste, was die frisch eingezogenen Rekruten sahen, die von Ayer kamen – ein kurzer Marsch von 2,5 Kilometern, der über die Schienenstränge der Bahnstrecke Boston–Fitchburg führte –, waren das riesige YMCA-Auditorium (Young Men’s Christian Association, Christlicher Verein Junger Menschen) und die Baracken der Pioniere des 301. Regiments. Rechts lagen die Baracken der 301., 302. und 303. Infanterieregimenter und ganz in der Nähe die von Feldartillerie, Depotbrigade und Maschinengewehrbatallion. Jenseits dieser Baracken befanden sich Exerzierplätze, um Drill und den Umgang mit dem Bajonett einzuüben, sowie ein 800-Betten-Lazarett, das ebenfalls vom YMCA geleitet wurde. Alles in allem konnte das Camp 30 000 Männer beherbergen. Im Lauf der nächsten Monate, als neue Rekruten aus Maine, Rhode Island, Connecticut, New York, Minnesota und sogar aus so südlichen Gefilden wie Florida eintrafen, füllten sich die einfachen hölzernen Baracken mit mehr als 40 000 Männern, und die Pioniere waren gezwungen, für die überzähligen Ankömmlinge Zelte zu errichten. In Würdigung seiner Bedeutung für das nordöstliche Militärkommando wurde das Lager Camp Devens getauft, zu Ehren von General Charles Devens, einem Bostoner Rechtsanwalt, der Kommandant im Bürgerkrieg gewesen war und dessen Unionstruppen die ersten gewesen waren, die nach dem Fall der Stadt 1865 Richmond besetzt hatten. Wie Roger Batchelder, ein Propagandist des Verteidigungsministeriums, meinte, als er im Dezember 1917 Camp Devens von einem Hügel außerhalb von Ayer bewunderte, ähnelte das Ausbildungslager einer »riesigen Soldatenstadt«.[1] Was der Beobachter verschwieg, war, dass Camp Devens auch ein beispielloses immunologisches Experiment darstellte. Nie zuvor waren so viele Männer mit ganz verschiedenen Lebensgeschichten – Fabrikarbeiter und Landarbeiter, Maschinisten und Hochschulabsolventen – in solcher Zahl zusammengebracht und gezwungen worden, auf engstem Raum zusammenzuleben.
Camp Devens war nicht das einzige Lager, das in diesem Sommer hastig errichtet wurde, und es war auch nicht das größte. Alles in allem wurden die frisch eingezogenen Rekruten, die für die American Expeditionary Forces (AEF), das Expeditionskorps der Vereinigten Staaten, bestimmt waren, zur Ausbildung in 40 große Lager geschickt, die sich über das ganze Land verteilten; beispielsweise beherbergte Camp Funston, das an einem früheren Kavalleriestandort errichtet worden war, 55 000 Männer. Unterdessen hatten die Briten auf der anderen Seite des Atlantiks in Étaples in Nordfrankreich ein noch größeres Truppenlager errichtet. Das Lager Étaples, auf tief liegenden Wiesen neben der Bahnstrecke von Boulogne nach Paris gelegen, hatte Schlafplätze für bis zu 100 000 Soldaten aus Großbritannien und dem Britischen Empire sowie Lazarettbetten für 22 000 Personen. Im Lauf des Krieges kamen Schätzungen zufolge rund eine Million Soldaten auf dem Marsch an die Somme oder zu anderen Schlachtfeldern durch Étaples.
Die Ausstattung vieler dieser Lager war jedoch keineswegs so gut, wie Kriegsunterstützer suggerierten. In vielen Fällen war die Mobilisierung tatsächlich so rasch erfolgt, dass es den Pionieren nicht gelungen war, Lazarette und andere medizinische Einrichtungen rechtzeitig fertigzustellen, und die Baracken waren oft so zugig, dass die Männer gezwungen waren, sich abends um die Öfen zu drängen, um sich warm zu halten, und nachts in zusätzlichen Kleiderschichten zu schlafen. Einige, wie Batchelder, sahen dies als Möglichkeit an, die Rekruten abzuhärten und sie auf die Strapazen des Grabenkriegs in Nordfrankreich vorzubereiten. »In Ayer ist es kalt, aber … das kalte Wetter ist belebend; es härtet die Männer, die stets in warmen Behausungen gelebt haben, für das Leben draußen ab.«[10] Andere kritisierten das Kriegsministerium jedoch für die Wahl eines Standorts so weit im Norden und meinten, es wäre besser gewesen, Camp Devens weiter im Süden zu errichten, wo das Wetter freundlicher war. In Wahrheit war weniger die Kälte als die drangvolle Enge die größte Gefahr. Dadurch, dass die Mobilisierung Männer mit so vielen verschiedenen immunologischen Vorgeschichten zusammenbrachte und sie zwang, wochenlang auf engstem Raum zusammenzuleben, erhöhte sich das Risiko für die Ausbreitung übertragbarer Krankheiten ganz beträchtlich. Kriege waren natürlich schon immer Brutstätten für Krankheiten. Was 1917 von anderen Kriegszeiten unterschied, war die Größenordnung der Einberufung und das Vermischen von Männern, die unter sehr unterschiedlichen ökologischen Bedingungen aufgewachsen waren. In städtischen Gebieten, wo die Bevölkerungsdichte höher ist, ist die Wahrscheinlichkeit, schon in der Kindheit mit Masern oder häufigen Atemwegspathogenen, wie Streptococcus pneumoniae und Staphylococcus aureus, in Kontakt zu kommen, viel höher als in dünner besiedelten Regionen. Kinder, die in einer Zeit ohne Autos und Busse auf dem Land aufwuchsen und meist in der Nähe zur Schule gingen, hatten hingegen oft keine Bekanntschaft mit Masernerregern oder Streptococcus pyogenes und anderen hämolytischen Bakterien gemacht, die zu Hals-Rachen-Entzündungen führen. Als die US-Armee von 378 000 Mann im April 1917 auf 1,5 Millionen um die Jahreswende 1917/18 wuchs (bei Kriegsende im November 1918 lag die kombinierte Truppenstärke von US-Armee und US-Marine bei 4,7 Millionen), brachen daher überall in den Lagern längs der Ostküste wie auch in mehreren südlichen Bundesstaaten Masern- und Lungenentzündungsepidemien aus.[11]
Vor dem Aufkommen von Antibiotika gingen rund ein Viertel aller Todesfälle in den Vereinigten Staaten auf Lungenentzündungen zurück. Diese Pneumonien konnten von Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten ausgelöst werden, aber die bei Weitem wichtigste Quelle für Ausbrüche ambulant erworbener Pneumonien war Streptococcus pneumoniae. Unter dem Mikroskop sehen diese Bakterien wie alle anderen Streptokokken aus. Eines der ungewöhnlichen Merkmale von S. pneumoniaeist jedoch, dass es eine Polysaccharid-Kapsel aufweist, die es davor schützt, an der Luft auszutrocknen oder von Phagozyten verschlungen zu werden, die zu den wichtigsten zellulären Verteidigern unseres Immunsystems gehören. Daher können Pneumokokken in feuchtem Auswurf (Sputum) in einem dunklen Raum auf Oberflächen bis zu zehn Tage überleben.
Weltweit gibt es mehr als 80 Subtypen von Pneumokokken, die sich alle im Bau ihrer Kapsel unterscheiden. Meistens residieren diese Bakterien in der Nase und im Rachenraum, ohne Krankheiten hervorzurufen, doch wenn das Immunsystem eines Menschen geschwächt oder durch eine andere Krankheit, wie Masern oder Influenza, beeinträchtigt ist, können die Bakterien die Oberhand gewinnen und eine potenziell tödliche Lungeninfektion auslösen. Typischerweise beginnen diese Infektionen als Entzündung der Lungenalveolen, der mikroskopisch kleinen Bläschen, die den Sauerstoff in der Lunge aufnehmen. Wenn die Bakterien in die Alveolen eindringen, werden sie von Leukozyten und anderen Immunzellen verfolgt; überdies sammeln sich dort Flüssigkeiten an, die Proteine und spezielle Enzyme enthalten. Je mehr sich die Lungenbläschen füllen, desto stärker »verdichten« sie, was es ihnen erschwert, Sauerstoff ans Blut abzugeben. Gewöhnlich äußert sich diese Verdichtung (Konsolidierung) im Röntgenbild in Flecken rund um die Bronchien – die Passagen, die von einem Bronchus abzweigen, der röhrenartigen Struktur, die Luft aus der Luftröhre in den rechten und den linken Lungenflügel transportiert. Wenn die entzündliche Verdichtung herdförmig um den Bronchus liegt, wird sie als Bronchopneumonie bezeichnet. Bei schwereren Infektionen kann sich die Verdichtung aber auch über alle Lungenlappen (der rechte Lungenflügel hat drei, der linke zwei Lappen, medizinisch Lobus) ausbreiten und die Lunge in eine feste, leberartige Masse verwandeln. Die Auswirkungen auf das Lungengewebe sind dramatisch. Eine gesunde Lunge ist schwammartig und porös und ein guter Schallleiter. Wenn ein Arzt mit einem Stethoskop die Lunge eines gesunden Patienten abhört, ist wenig zu vernehmen. Bei einer »verstopften« Lunge (Lungenkongestion) werden die Atemgeräusche hingegen an den Brustkorb weitergeleitet, und es kommt zu typischen Rasselgeräuschen.
In der Spätphase des Viktorianischen und Edwardianischen Zeitalters war Lungenentzündung vielleicht die Krankheit, die nach der Tuberkulose am meisten gefürchtet war und fast immer tödlich endete, vor allem bei den Älteren, deren Immunsystem bereits durch andere Krankheiten geschwächt war. Zu den prominenten Opfern gehörten der neunte Präsident der Vereinigten Staaten, William Henry Harrison, der einen Monat nach seiner Amtseinführung 1841 starb, und der Konföderiertengeneral Thomas Jonathan »Stonewall« Jackson, der, acht Tage nachdem er in der Schlacht von Chancellorsville 1863 verwundet worden war, an den Komplikationen einer Lungenentzündung starb. Ein weiteres Opfer war Königin Viktorias Enkel, der Duke of Clarence, der, nachdem er sich in Sandringham im Winter 1892 eine sogenannte Russische Grippe zugezogen hatte, an den Folgen einer Lappen- oder Lobärpneumonie verstarb. Kein Wunder, dass Sir William Osler, der »Vater der modernen Medizin«, die Lungenentzündung als »Kapitän der todgeweihten Männer«[12] bezeichnete.
Wer sich in der Kindheit mit Masern ansteckt, leidet gewöhnlich unter Hautausschlag und hohem Fieber, begleitet von heftigem Husten und Lichtempfindlichkeit, doch im Fall der im Lager erworbenen Masern waren die Symptome deutlich schwerer. Die Ausbrüche führten zu den höchsten Infektionsraten, die die Armee in 97 Jahren erlebt hatte, und gingen oft mit einer aggressiven Bronchopneumonie einher. Das führte dazu, dass zwischen September 1917 und März 1918 mehr als 30 000 amerikanische Truppenangehörige mit Lungenentzündung ins Krankenhaus mussten, fast alle infolge von Masernkomplikationen, und rund 5700 Männer starben. Das Ausmaß der Ausbrüche erstaunte selbst kampferfahrene Ärzte wie Victor Vaughan, Dekan der School of Medicine der University of Michigan und Veteran des Spanisch-Amerikanischen Krieges. »Kein Truppenzug kam im Herbst 1917 nach Camp Wheeler (in der Nähe von Macon, Georgia), ohne einen bis sechs Fälle von Masern mitzubringen, die sich bereits im eruptiven Stadium befanden«, schrieb er. »Diese Männer hatten die Infektion von zu Hause mitgebracht und ihre Keime im Feldlager und im Zug verbreitet. Keine Macht der Erde konnte die Ausbreitung von Masern im ganzen Lager unter diesen Bedingungen stoppen. Pro Tag kam es zu hundert bis fünfhundert neuen Fällen, und die Infektion lief so lange weiter, wie es im Lager empfängliches Material gab.«[13]
Im Frühjahr 1918 wurde das Kriegsministerium vom Kongress heftig attackiert, weil es Rekruten in Ausbildungslager verlegte, bevor die Anlagen völlig fertiggestellt waren, und dies unter Bedingungen, die nicht einmal hygienische Mindeststandards erfüllten. Daher hatte das Ministerium im Juli eine Pneumonie-Kommission eingesetzt, die die ungewöhnliche Prävalenz der Krankheit in großen Lagern untersuchen sollte. Die Kommission las sich wie ein zukünftiges Who’s who der amerikanischen Medizin; zu ihr gehörten Eugene L. Opie, ein zukünftiger Dekan der Washington University School of Medicine, Francis G. Blake, ein zukünftiger Professor für Innere Medizin an der Yale University, und Thomas Rivers, der einer der weltweit führenden Virologen und Direktor des Rockefeller University Hospital in New York werden sollte. Unterstützt wurden sie im Büro des Surgeon General von Victor Vaughan und William H. Welch, dem Dekan der Johns Hopkins School of Medicine und damals der wohl berühmteste Pathologe und Bakteriologe in ganz Amerika, sowie Rufus Cole, dem ersten Direktor des Rockefeller University Hospital und Spezialisten für Pneumokokken-Erkrankungen, alles Männer im Rang von Kommandeuren. Gemeinsam mit seinem Assistenten Oswald Avery leitete Cole die Laboruntersuchungen der Pneumonieausbrüche und brachte Sanitätsoffizieren die richtigen Techniken zur Kultivierung der Bakterien und Herstellung von Seren und Vakzinen bei. Überwacht wurden ihre Bemühungen von Simon Flexner, dem Leiter des Rockefeller Institute for Medical Research und früheren Studenten und Protegé von Welch.
***
Während sich amerikanische Ärzte wegen der im Lager erworbenen Masern und Lungenentzündungen sorgten, bereitete ihren britischen Kollegen eine andere Atemwegserkrankung Kopfzerbrechen. Mangels eines besseren Begriffs als »eitrige Bronchitis« bezeichnet, war die Krankheit im bitterkalten Winter 1917 in Étaples ausgebrochen, und bis Februar waren 156 Soldaten gestorben. Die Anfangsstadien ähnelten einer gewöhnlichen Lobärpneumonie – hohes Fieber und blutiger Auswurf. Diese Symptome wichen aber bald einem rasenden Puls, begleitet von der Absonderung dicker, hellgelber Eiterklümpchen, was für eine Bronchitis sprach. In der Hälfte der Fälle trat kurz danach der Tod durch Lungenversagen ein.
Ein weiteres auffälliges Merkmal war die Blaufärbung (Zyanose). Dazu kommt es, wenn der Patient keine Luft mehr bekommt, weil seine Lunge das Blut nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen kann, und dieser Zustand ist gekennzeichnet durch eine dunkle, purpurfarbene Verfärbung von Gesicht, Lippen und Ohren (denn der Sauerstoff ist es, der das Blut in den Arterien rot färbt). Im Fall der Étaples-Patienten war die Atemnot jedoch so akut, dass sie in ihrer Verzweiflung ihre Bettwäsche wegrissen. Bei der Autopsie stellte der Pathologe William Rolland schockiert fest, dass dicker, gelber Eiter die Bronchien verstopfte. In den größeren Bronchien war der Eiter mit Luft gemischt, doch als Rolland die kleineren Röhren durchtrennte, beobachtete er: »Der Eiter trat spontan aus …, mit kaum oder ganz ohne Beimischung von Luft.«[14] Das erklärte, warum der Versuch, den Patienten Sauerstoff per Schlauch zuzuführen, kaum etwas genutzt hatte. Étaples war nicht das einzige Armeelager, in dem diese seltsame Erkrankung auftrat. Im März 1917 war es zu einem ähnlichen Ausbruch in Aldershot, der »Heimat der britischen Armee«, in Südengland gekommen. Wieder erwies sich die Erkrankung für die Hälfte der Betroffenen als tödlich, und das kennzeichnende Merkmal war die Absonderung (Exsudation) von gelblichem Eiter, gefolgt von Atemnot und Blaufärbung. Was ihre zyanotischen Patienten anging, so notierten die Ärzte: »Keine Behandlung, die wir entwickelt haben, scheint irgendetwas zu nützen.« Einige erinnerte das kurze, flache Atmen der Betroffenen an die »Wirkungen von Gasvergiftungen«,[15] doch die Bakteriologen und Pathologen, die die Fälle in Étaples und Aldershot untersuchten, kamen später zu dem Schluss, dass es sich um eine Art Influenza gehandelt haben müsse.[16] Grippe war seit Langem als Auslöser von Bronchialinfektionen bekannt. Epidemiologen waren bislang gewohnt, bei Grippe-Epidemien und den saisonalen Ausbrüchen der Infektion im Herbst und Winter eine Steigerung bei den Todesfällen durch Atemwegserkrankungen zu sehen, die vor allem Kleinkinder und den älteren Teil der Bevölkerung betraf. Für junge Erwachsene und unter Siebzigjährige galt Grippe hingegen eher als lästig denn als lebensbedrohlich, und Rekonvaleszenten wurden häufig mit Misstrauen betrachtet.
***
Wir werden vielleicht nie wissen, ob es sich bei den Ausbrüchen in Étaples und Aldershot um Influenza handelte, doch im März 1918 kam es in einem großen Armeelager zu einem weiteren Ausbruch einer ungewöhnlichen Atemwegserkrankung, diesmal in Camp Funston in Kansas. Anfangs glaubten die Ärzte, es handele sich um eine weitere Welle einer im Lager erworbenen Pneumonie, doch schon bald änderten sie ihre Meinung.
Das erste Opfer war vermutlich ein Koch des Lagers. Am 4. März wachte er mit heftigem Kopfweh sowie Schmerzen in Nacken und Rücken auf und meldete sich im Lazarett. Bald hatten sich 100 weitere Mitglieder der 164. Depotbrigade zu ihm gesellt, und in der dritten Märzwoche standen mehr als 1200 Männer auf der Krankenliste, was den obersten Sanitätsoffizier von Fort Riley dazu zwang, einen benachbarten Hangar mit Beschlag zu belegen, um alle Patienten unterzubringen. Die Krankheit ähnelte der klassischen Influenza: Schüttelfrost, gefolgt von hohem Fieber, Halsweh, Kopf- und Bauchschmerzen. Viele Patienten waren jedoch so stark angeschlagen, dass sie nicht aufstehen konnten, was der Krankheit den Namen »knock-me-down fever« eintrug. Die meisten Männer erholten sich innerhalb von drei bis fünf Tagen, doch besorgniserregenderweise entwickelten einige anschließend eine schwere Lungenentzündung. Im Gegensatz zur Lungenentzündung nach einer Maserninfektion, die sich in der Regel in den Bronchien manifestierte, dehnten sich diese Post-Influenza-Pneumonien häufig auf einen ganzen Lungenlappen aus. Insgesamt hatten 237 Männer, rund ein Fünftel der eingewiesenen Patienten, solche Lobärpneumonien entwickelt, und bis Mai 1918 gab es 75 Todesfälle. Wie Opie und Rivers im folgenden Juli, als die Pneumonie-Kommission endlich eintraf, um eine Untersuchung durchzuführen, entdeckten, kamen noch weitere besorgniserregende Faktoren hinzu: Nachdem die anfängliche Epidemie im März ausgelaufen war, war es im April und Mai zu weiteren Ausbrüchen gekommen, die jedes Mal mit der Ankunft neuer Rekruten zusammengefallen waren.[17] Und nicht nur das: Männer, die in Lager im Osten verlegt wurden, schleppten die Krankheit offenbar mit sich, und als viele von ihnen dem Expeditionskorps zugeteilt wurden und sich unter die Soldaten mischten, die nach Europa verschifft wurden, lösten sie an Bord der Truppentransportschiffe weitere Ausbrüche aus. Das Muster setzte sich fort, als die Transporter in Brest, dem größten Hafenstützpunkt der amerikanischen Truppen, vor Anker gingen und ihre Ladung ausspien. »Epidemie eines akut infektiösen Fiebers unbekannter Natur«, berichtete ein Sanitätsoffizier in einem Lazarett der US-Armee am 15. April. Im Mai war die »Grippe« in den französischen Linien ausgebrochen, und zahlreiche britische Soldaten in Étaples waren an PUO – »pyrexia of unknown origin« (Fieber unbekannten Ursprungs) – erkrankt. Wie in Funston verliefen die Fälle anfangs mild, doch bis zum Juni lagen Tausende alliierte Soldaten im Lazarett, und bis zum August war die Lage alarmierend geworden. »Diese sukzessiven Ausbrüche zeigten die Tendenz, zunehmend schwerer in Charakter und Ausmaß zu werden, was für eine steigende Virulenz des Erregers spricht«, wie Alan M. Chesney, ein Sanitätsoffizier im AEF-Trainingslager der Artillerie in Valdahon, beobachtete.[18]
Chesney gehörte zu den wenigen, die sich deshalb sorgten. Im Sommer 1918 hatte seit 28 Jahren niemand mehr eine Influenza-Pandemie erlebt. Im Vergleich zu Typhus, einer tödlichen, durch Blut übertragenen Krankheit, die von Kleiderläusen in der Uniform der Soldaten verbreitet wurde, oder zur Sepsis (Blutvergiftung), deren Erreger sich in Schuss- oder Schrapnellwunden vermehrten, war Influenza in den Augen der Sanitätsoffiziere der Armee eine triviale Infektion. Zivile Ärzte betrachteten Influenza mit ähnlicher Verachtung, vor allem die Briten, die sie lange als einen suspekten italienischen Begriff für eine schlimme Erkältung oder einen Katarrh angesehen hatten.[7] Nach rund vier Jahren eines brutalen Grabenkrieges, der bereits zigtausend Europäer das Leben gekostet hatte, und mit zwei Millionen alliierten Soldaten, die sich nun in Nordfrankreich und Flandern eingegraben hatten, hatten die Offiziere zudem mit dringenderen Problemen zu kämpfen. »Rund ein Drittel des Bataillons und etwa 30 Offiziere sind von der Spanischen Grippe befallen«, meinte der Dichter Wilfred Owen im Juni in einem Brief aus einem britischen Armeelager in Scarborough, North Yorkshire, an seine Mutter Susan geringschätzig. »Die Sache erscheint mir allzu gewöhnlich, um daran teilzunehmen. Ich habe mich definitiv dagegen entschieden! Stell Dir doch nur die Arbeit vor, die die nicht betroffenen Offiziere nun zu bewältigen haben.«[19]
Owen irrte sich, was seine Geringschätzung der Gefahr betraf. Zwischen Sommer 1918 und Frühjahr 1919 sollten Zehntausende von Soldaten und Millionen von Zivilisten von der Spanischen Grippe (so genannt, weil Spanien das einzige Land war, das Berichte über die sich ausbreitende Epidemie nicht zensierte) niedergemäht werden, während die Krankheit zwischen Nordamerika und Nordeuropa hin- und hersprang, bis sie schließlich den ganzen Globus ergriff. Allein in den Vereinigten Staaten sollten rund 675 000 Menschen den aufeinanderfolgenden Grippewellen zum Opfer fallen, in Frankreich waren es vielleicht 400 000, in England 228 000. Weltweit forderte die Spanische Grippe Schätzungen zufolge 50 Millionen Leben – fünfmal mehr, als bei den Kämpfen im Ersten Weltkrieg umkamen, und zehn Millionen mehr, als in 30 Jahren an AIDS starben.
Ein Grund, warum Owen und andere die Influenza so sehr unterschätzten, war, dass sich Medizinexperten 1918 sicher wähnten, sie wüssten, wie die Krankheit übertragen wird. Schließlich hatte Richard Pfeiffer, Schwiegersohn von Robert Koch, dem deutschen »Vater« der Bakteriologie, 1892 verkündet, er habe den »Erreger« der Krankheit identifiziert, ein winziges, gramnegatives Bakterium, das er Bacillus influenzae taufte. Pfeiffers »Entdeckung« fiel mit dem Höhepunkt der sogenannten Russische-Grippe-Pandemie zusammen und machte Schlagzeilen rund um die Welt, und sie schürte Erwartungen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis in deutschen Labormethoden geschulte Wissenschaftler einen Impfstoff entwickeln würden. Da spielte es keine Rolle, dass es anderen Forschern nicht immer gelang, »Pfeiffers Bazillus«, wie das Bakterium allgemein genannt wurde, aus Rachenspülungen und dem bronchialen Auswurf von Influenzapatienten zu isolieren. Oder dass es notorisch schwierig war, das Bakterium auf künstlichen Medien zu kultivieren, und es oft mehrerer Versuche bedurfte, um Kolonien von ausreichender Größe zu züchten, um die kleinen, runden und farblosen Körperchen mit speziellen Färbungen im Lichtmikroskop nachzuweisen. Oder dass es Pfeiffer und seinem Berliner Kollegen Shibasaburo Kitasato trotz Impfung (Inokulation) von Tieraffen mit dem Bazillus bislang nicht gelungen war, die Krankheit zu übertragen – womit sie an Kochs viertem Postulat scheiterten.[8] Was die meisten medizinischen Autoritäten anging, war Pfeiffers Bazillus das ätiologische Agens der Influenza – Ende der Diskussion. Nur selten gab es Wissenschaftler, die es wagten, die Autorität von Koch und seinen Schülern anzuzweifeln und ihr Unbehagen darüber auszudrücken, dass es nicht gelang, den Bazillus bei allen Influenzafällen nachzuweisen.
Vielleicht erklärt das, warum Opie, Blake und Rivers, als sie im Juli in Camp Funston eintrafen, die Tatsache ignorierten, dass es Forschern in 77 Prozent aller Pneumoniefälle nicht gelungen war, Bacillus influenzae zu isolieren, oder dass der Bazillus auch im Mund eines Drittels der gesunden Männer gefunden worden war, d. h. bei Männern, die keinerlei Influenza-Symptome gezeigt hatten.[9] Stattdessen versuchten sie, die höheren Pneumonieraten, die bei afroamerikanischen Rekruten aus Louisiana und Mississippi zu beobachten waren, mit rassischen Unterschieden zwischen weißen und »farbigen« Soldaten zu erklären. Zu diesem Schluss kamen sie trotz der Beobachtung, dass die Einheiten, die am schwersten unter Post-Influenza-Pneumonie gelitten hatten, diejenigen waren, die neu im Lager waren und sich nur drei bis sechs Monate in Fort Riley aufgehalten hatten, und dass ein größerer Anteil afroamerikanischer Wehrpflichtiger aus ländlichen Gebieten stammte.[20] Größtenteils bestand die Untersuchung aus langweiligen, sich wiederholenden Erhebungen, und Blake wünschte sich schon bald einen Tapetenwechsel. So beklagte er sich am 9. August bei seiner Frau: »Seit zwei Tagen kein Brief von meinem Schatz. Keine kühlen Tage, keine kühlen Nächte, keine Drinks, keine Filme, kein Tanz, keine Clubs, keine hübschen Frauen, keine Dusche, kein Poker, keine Leute, kein Spaß, überhaupt nichts außer Hitze und stechender Sonne und glühend heißen Winden und Schweiß und Staub und Durst und langen und stickigen Nächten und Arbeit rund um die Uhr und Einsamkeit und ganz allgemein die Hölle – das ist Fort Riley, Kansas.«[21]
Sehr bald darauf sollten Opie, Blake und Rivers den Befehl erhalten, Kansas zu verlassen, nur um vom Regen in die Traufe, sprich in eine noch schlimmere Hölle zu geraten: In Camp Pike, Arkansas, wohin sie versetzt wurden, wütete gerade eine Influenza- und Pneumonie-Epidemie. Die schlimmste Hölle blieb ihnen jedoch erspart.
***
Im August 1918 bestieg Clifton Skillings, ein 23-jähriger Farmer aus Ripley, Maine, einen Zug nach Boston in Richtung Süden. Wie viele Tausend andere Amerikaner im wehrfähigen Alter hatte Skillings seinen Einberufungsbefehl ein paar Wochen zuvor erhalten und war nun angewiesen worden, sich in Camp Devens zum Dienst zu melden. Nach seiner Ankunft in Ayer schloss er sich anderen Rekruten an, die ihren besten Sonntagsstaat trugen, und begann, Richtung Lager zu marschieren, begleitet von berittenen Soldaten, die den Neulingen den Weg wiesen. In den Augen der Bostoner Männer war Ayer ein »Bauernkaff«.[22] Ob Skillings auch so dachte, ist nicht bekannt, aber nach seinen Briefen und Postkarten zu urteilen, schmeckte ihm das Essen nicht. »Zu Mittag gab es Bohnen, aber sie schmecken nicht wie die Bohnen zu Hause«, beklagte er sich am 24. August bei seiner Familie. »Sie erinnern mich an Hundefutter.« Er schloss sich sofort einer Gruppe aus Skowhegan, Maine, an, erfuhr jedoch bald zu seinem Erstaunen, dass sich auch Männer aus Staaten des Mittleren Westens wie Minnesota im Lager befanden. »Im Lager leben mehrere Tausend Männer. Es ist wirklich ziemlich komisch, rundum nur Männer zu sehen …, ich wünschte, Ihr könntet vorbeikommen und Euch hier umschauen.« Vier Wochen später waren die Größe des Lagers und die Qualität des Essens jedoch seine geringste Sorge. »Eine Menge der Jungs sind krank und im Lazarett«, schrieb er am 23. September nach Hause. »Es ist eine Krankheit, so etwas wie die Grippe …, ich glaube nicht, dass ich sie kriege.«[23]
Wir wissen nicht, wo die Herbstwelle der Influenza ihren Ausgang nahm. Möglicherweise war sie im Lauf des Sommers in Amerika »ausgebrütet« worden, wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie von Truppen eingeschleppt wurde, die aus Europa zurückkehrten. Aus ökologischer Sicht fand in Nordfrankreich ein riesiges biologisches Experiment statt – dort trafen Männer von zwei Kontinenten in großer Zahl aufeinander und mischten sich freizügig mit Männern aus einem breiten Spektrum anderer Nationen, darunter indische Soldaten aus dem Punjab, afrikanische Regimenter aus Nigeria und Sierra Leone, chinesische Tagelöhner und indochinesische Arbeiter aus Vietnam, Laos und Kambodscha. Einer Theorie zufolge begann die zweite Welle mit einem Ausbruch Ende August an einer Bekohlungsanlage in Sierra Leone und breitete sich von dort rasch auf andere westafrikanische Länder und via britische Militärschiffe nach Europa aus.[24] Einer anderen Theorie zufolge weilte der Erreger bereits in Europa, daher die präpandemischen Wellen, die im Juli aus Kopenhagen und anderen nordeuropäischen Städten gemeldet wurden.[25]
In den Vereinigten Staaten kündigte sich die zweite Welle gegen Ende August am Commonwealth Pier in Boston an, einem der wichtigsten Häfen für rückkehrende AEF-Truppen, als mehrere Seeleute plötzlich erkrankten. Bis 29. August waren fünfzig Erkrankte ins Chelsea Naval Hospital verlegt worden, wo sich Kapitänleutnant Milton Rosenau um sie kümmerte, vormals Direktor des Hygienelabors des United States Public Health Service (PHS, eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums) und Mitglied der Harvard Medical School. Um den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen, isolierte Rosenau die Seeleute, doch Anfang September meldeten Marinestützpunkte in Newport, Rhode Island, und New London, Connecticut, ebenfalls signifikante Zahlen an Influenzafällen.[26] Etwa um dieselbe Zeit kam es in Camp Devens zu einem Anstieg der Pneumoniefälle. Dann, am 7. September, wurde ein Soldat aus Kompanie B, 42. Infanteriedivision, mit »epidemischer Meningitis« (Hirnhautentzündung) ins Lazarett eingeliefert. Tatsächlich passten seine Symptome – laufende Nase, rauer Hals und Entzündung der Nasengänge – zu einer Influenza, und als am folgenden Tag zwölf weitere Männer derselben Kompanie erkrankten und ähnliche Symptome zeigten, zögerten die Ärzte nicht, eine »milde« Form der Spanischen Grippe zu diagnostizieren.[27] Sie sollte nicht lange »mild« bleiben.
Wenn ein parasitischer Organismus zum ersten Mal auf einen anfälligen Wirt trifft, löst dies ein Wettrüsten zwischen dem Erreger und dem Immunsystem des Wirtes aus. Das Immunsystem, das noch nie zuvor mit dem Erreger in Kontakt gekommen ist, ist anfangs blind für ihn und braucht Zeit, um seine Abwehr zu organisieren und einen Gegenangriff zu starten. So lange arbeitet sich der Erreger ungehindert durch das Gewebe des Wirtes, dringt in seine Zellen ein und vermehrt sich ungehemmt. In diesem Stadium ähnelt der Parasit einem Kind, das einen Wutanfall hat. Ohne dass jemand es zur Ordnung weist, können seine Wutanfälle leicht eskalieren, und sein Verhalten kann zunehmend virulent werden. In extremen Fällen kann es vorkommen, dass seine Wut alles verzehrend wird. Das ist gewöhnlich eine schlechte Nachricht für den Wirt. Aus darwinistischer Sicht liegt es jedoch nicht im Interesse des Parasiten, seinen Wirt zu töten; vielmehr ist sein wichtigstes Ziel, lange genug zu überleben, um zu entkommen und einen neuen Wirt zu infizieren. Mit anderen Worten: Der Tod des Wirtes ist eine schlechte Strategie für einen Parasiten, ein biologischer »Unfall«, wenn man so will. Langfristig ist es eine viel bessere Überlebensstrategie, sich in die andere Richtung zu entwickeln, in Richtung Avirulenz, sodass Infektionen beim Wirt mild oder kaum wahrnehmbar verlaufen. Aber damit es so weit kommt, muss dessen Immunsystem zunächst einmal einen Weg finden, den Parasiten zu bändigen.
Es dauerte nicht lange, bis die Infektion von der 42. Infanteriedivision auf Nachbarbaracken übersprang, und als das geschah, zeigte sich die Influenza nicht so mild wie bei der Frühjahrswelle. Sie war vielmehr geradezu explosiv. Bis zum 10. September lagen in Camp Devens mehr als 500 Männer im Lazarett. Innerhalb von vier Tagen hatte sich diese Zahl verdreifacht, und am 15. September wurden 705 weitere Patienten aufgenommen. Die nächsten drei Tage waren jedoch die schlimmsten. Am 16. September mussten Betten für weitere 1189 Männer gefunden werden, und am Folgetag nochmals 2200 Betten. Bald darauf begann auch die Zahl der Pneumoniefälle zu steigen, aber diese Fälle unterschieden sich deutlich von den Bronchopneumonien im Gefolge von Masern. Vielmehr ähnelten sie den schwereren Versionen der lobulären Pneumonien, die einige Influenzafälle in Camp Funston im Frühjahr entwickelt hatten. »Die Männer beginnen mit etwas, das so aussieht wie eine gewöhnliche Grippe- oder Influenza-Attacke, und wenn sie ins Krankenhaus gebracht werden, entwickeln sie sehr schnell den aggressivsten Typ der Pneumonie, den man jemals gesehen hat«, erinnerte sich ein schottischer Arzt namens Roy, der zugegen war, als die Lungenentzündung durch die Station fegte. »Zwei Stunden nach der Aufnahme haben sie über den Wangenknochen die typischen mahagonibraunen Flecken, und ein paar Stunden später kann man beobachten, wie sich die Zyanose von den Ohren über ihr ganzes Gesicht auszubreiten beginnt, bis man Farbige kaum noch von Weißen unterscheiden kann … Man könnte es aushalten, einen, zwei oder zwanzig Männer sterben zu sehen, aber all diese armen Teufel wie die Fliegen umkommen zu sehen … ist schrecklich!«[28]
Wie der Autor John M. Barry 2004 in seinem Buch The Great Influenza schrieb, waren die Zyanosen 1918 so ausgeprägt, dass der ganze Körper eine dunkle, purpurfarbene Schattierung annahm, was »zu Gerüchten« führte, »bei der Krankheit handele es sich nicht um Grippe, sondern um den Schwarzen Tod«.[29] Die Sanitätsoffiziere der britischen Armee, von denen viele wie Welch und Vaughan im Zivilleben erfahrene Ärzte und Pathologen waren und bei Kriegsausbruch ihren Dienst beim Militär angetreten hatten, waren von diesen Fällen, die sie an die Zyanosen im Winter 1917 in Étaples und Aldershot erinnerten, genauso beeindruckt und beauftragten einen Künstler der Royal Academy, Patienten im letzten Stadium der Krankheit zu malen. Der Künstler bezeichnete dieses Endstadium nach der tief blauvioletten, bei englischen Gärtnern so beliebten Vanilleblume (Heliotropium arborescens) als »heliotrope Zyanose«.[30]





























