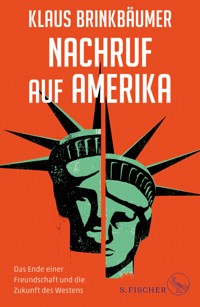9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Es sind die ganz großen Fragen: Wie lebt man ein erfülltes Leben? Was in diesem Leben können wir beeinflussen – und wie? Worauf sind Menschen, die sehr alt werden, am Ende stolz? Und was bedauern sie? Wie prägen Beziehungen unser Leben, welchen Einfluss haben Kultur und Ernährung, Bewegung, die Gene, aber auch Bildung und Wohlstand? Klaus Brinkbäumer und Samiha Shafy sind auf ihrer Weltreise nach Sardinien, Okinawa (Japan) und Loma Linda (Kalifornien) gefahren, um herauszufinden, warum dort sehr viel mehr Menschen sehr viel älter werden als anderswo. Die Reise führte weiter nach Russland, China, Thailand, Hawaii, auf afrikanische Inseln und an die amerikanische Ostküste – und ganz in die Nähe, nach Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark und kreuz und quer durch Deutschland. Wie gelingt das Leben? Wissenschaftler und Hundertjährige können all die großen Fragen beantworten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Ähnliche
Klaus Brinkbäumer / Samiha Shafy
Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben
Die Weisheit der Hundertjährigen. Eine Weltreise
Über dieses Buch
Die einen rauchen und werden 100, die anderen treiben Sport und werden auch 100. Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Klaus Brinkbäumer und Samiha Shafy haben Hundertjährige auf der ganzen Welt besucht, um hinter dieses Geheimnis zu kommen. Sie erzählen deren bewegte Geschichten und ergänzen sie durch wissenschaftliche Erkenntnisse der Altersforschung. Sie fragen nach dem Einfluss von Kultur und Armut, Beziehungen und Krankheit, Ernährung, Bewegung und nicht zuletzt der Gene. Wie schafft man es, so lange zu leben? Indem sie alles Wissen zusammentragen und der Weisheit der Hundertjährigen lauschen, zeigt sich, dass am Ende alles auf die entscheidende Frage hinausläuft: Wie gelingt das eigene Leben?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Klaus Brinkbäumer, geboren 1967, ist Programmdirektor des MDR in Leipzig und Autor. Zuvor arbeitete er 26 Jahre lang für den »Spiegel«, u.a. als dessen Chefredakteur, danach als »Zeit«-Autor, »Tagesspiegel«-Kolumnist, Podcast-Moderator und Filmemacher. Er hat zahlreiche Preise erhalten, u.a. den Egon-Erwin-Kisch-Preis, den Henri-Nannen-Preis und den Deutschen Reporterpreis.
Samiha Shafy, geboren 1979, studierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich und Lausanne Umweltnaturwissenschaften und ist Journalistin. Sie arbeitete 14 Jahre lang als Redakteurin und Korrespondentin für den »Spiegel«, zuletzt in New York. Heute ist sie »Zeit«-Redakteurin und schreibt über Geopolitik und die Klimakrise.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Des Rätsels Lösung, I.
Mit 70 bist du nur ein Kind
Die Reise beginnt
Der Schwimmlehrer
Rogers Reise, I.
Des Rätsels Lösung, II.
Wenn Eltern Kinder werden
La famiglia
Des Rätsels Lösung, III.
Rogers Reise, II.
Stärker als die Männer, hundertmal stärker
Die Jahre sind einfach vergangen
Tanzen und fühlen
Schmerzen aushalten, weitermachen
Ein Neuanfang nach 70 Jahren
»Die Älteste im Land«
Die Kraft der Wut
Rogers Reise, III.
Die Überwindung der Kindheit
Des Rätsels Lösung, IV.
Das Ja und Nein des Lebens
Rogers Reise, IV.
Der weibliche und der männliche Weg
Ein Interview im Schlaf
Des Rätsels Lösung, V.
Rogers Reise, V.
Die Väter, die Mütter, die Kinder
Spielend hundert werden
Der Menschenliebhaber
Arbeiten, weiter und immer weiter arbeiten
Des Rätsels Lösung, VI.
»Gott, wo willst du mich haben?«
Der Sinn von allem
Die Farbe der Erinnerung
Die Ferne und die Heimat
Des Rätsels Lösung, VII.
Rogers Reise, VI.
Die rettende Harfe
Überleben, 72 Jahre nach Auschwitz
Die vorderen und die hinteren Beine des Elefanten
Des Rätsels Lösung, VIII.
Die Regeln der Ehe
Rogers Reise, VII.
Die Omma wird 112
Des Rätsels Lösung, IX.
Rogers Reise, VIII.
Ohne Frechheit geht es nicht
Ein Todesfall, ein Geburtstag
Des Rätsels Lösung, X.
Hilf, dann wird dir geholfen
Beruf oder Liebe
Die vielen Toten
Rogers Reise, IX.
Zucker, Zucker und … der Krieg
Rogers Reise, X.
Die Heilkraft der Natur
Des Rätsels Lösung, XI.
Dank
Bibliographie
Für Alexej, geboren im Februar 2019
We have to hope … that the people who love us and who know us a little bit
will in the end have seen us truly. In the end, not much else matters.
ALI SMITH,»Autumn«
When it’s over, I want to say: all my life
I was a bride married to amazement.
I was the bridegroom, taking the world into my arms.
When it’s over, I don’t want to wonder
if I have made of my life something particular, and real.
MARY OLIVER,»When death comes«
Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer, von außen gesehen, und wie dumpf und besinnungslos, von innen empfunden, das Leben der allermeisten Menschen dahinfließt. Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebenalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Willst du dich des Lebens freuen,
So musst der Welt du Werth verleihen.
GOETHE AN SCHOPENHAUER
Des Rätsels Lösung, I.
Lange schon könnte er tot sein, lange schon müsste er tot sein, weshalb er heute zwar viele Dinge ahnt (weil er sich auskennt) und noch mehr Dinge weiß (weil er sie bewiesen hat), aber diese brüllend ungerechte Sache mit dem Glück hat er gefühlt und erlebt. Er ahnte es, wusste es, dann erfuhr er es: Ohne Glück geht es nicht, knapp genug war es zweifellos.
52 Jahre jung war Dr. Makoto Suzuki, als er seinen Herzinfarkt hatte. Er fiel einfach um, bei der Arbeit. Die Knie knickten ein, er sackte zu Boden, sieben Tage lang lag er im Koma. Und wie so oft im Leben muss man deshalb heute sagen: Das alles hätte ganz leicht auch ganz anders kommen können.
Aber er hatte Glück.
Und darum sind wir am Ende der langen Reise in die Welt der sehr, sehr alten Menschen tatsächlich bei Makoto Suzuki auf Okinawa angekommen, im Süden Japans.
Dr. Suzuki, im Dezember 2018 ein 85-jähriger Wissenschaftler, noch immer täglich im Büro, in der Klinik, im Labor, noch immer auf der Suche nach Erkenntnis – dieser Dr. Suzuki ist jener Wissenschaftler, der einst entdeckte, dass Okinawa, dieser stets wohlig warme Archipel aus 161 Inseln im Süden Japans, ein geradezu gesegnet glücklicher Ort ist: Die Menschen hier werden älter als andere Menschen. Sehr viel älter. Und es sind sehr viele Menschen, die hier sehr viel älter werden.
Wieso nur?
»Ikigai«, sagt Makoto Suzuki.
Und dann: »Mein ikigai ist die Suche nach eben diesem Geheimnis.«
Es ist ein großes japanisches Wort, dieses »ikigai«. Es meint den Grund zu leben, es meint wahre Erfüllung. Warum stehen wir morgens auf?
Was wollen wir wirklich?
Was trägt uns, was hält uns, was ist uns wahrhaft wichtig?
Ikigai meint unsere Leidenschaft, unsere Berufung, unsere Mission, unseren Beruf (hoffentlich), und es meint unsere Liebe. Ikigai ist die Kunst, zugleich bedingungslos und entspannt genau das zu tun, was uns etwas bedeutet, was uns glücklich macht; und damit ist ikigai auch die Kunst, nicht gestresst und nicht abgelenkt zu sein. Ikigai hört nicht auf: In Japan gibt es kein Wort für »Rente« oder »Ruhestand«, denn es liegt im Wesen des »ikigai«, dass eine Berufung niemals endet – nicht vor dem Tod jedenfalls. Ikigai, das ist unsere raison d’être, so würden es die Franzosen sagen.
Der Mann also, der das Geheimnis von Okinawa zunächst entdeckt hat und seither erforscht, sitzt in einem unscheinbaren Flachbau zehn Kilometer nördlich von Naha, dem Verwaltungssitz der Präfektur Okinawa; man muss den Parkplatz hinter dem Haus finden, den Hintereingang, die Treppe, den ersten Stock, und dann muss man die Schuhe ausziehen wie in den meisten Räumen auf Okinawa.
Suzuki ist ein kleiner, schmaler, gebeugter Mann, der eine runde Brille und ein blaues, weites Hemd mit offenem Kragen trägt. Im Regal sammelt er seine Akten, Hunderte, Tausende Akten, von all den Hundertjährigen Okinawas. Ganz ruhig sitzt er da, seine Hände allerdings kneten sein Mobiltelefon.
Heute, sagt er, sei er zu alt, um noch in den Norden zu fahren, aber heute wohnen ja auch viele dieser Alten und sehr, sehr Alten in den Pflegeheimen von Naha. 40 Jahre lang tat er allerdings genau dies: Er fuhr in den Norden.
Wenn man über Okinawa, also die Hauptinsel dieses Reiches aus mitunter winzigen, immer wieder auch überspülten Inseln redet, sollte man korrekterweise »Okinawa Hontō«, Okinawa-Hauptinsel, sagen, was wir der Lesbarkeit halber in diesem Text unterlassen: Okinawa also. Dieses Okinawa, einst ein eigenes Königreich namens Ryūkyū, gehört erst seit 1871 zum 515 Kilometer entfernten restlichen Japan; es hat 1,2 Millionen Einwohner und ist exakt 107 Kilometer lang und zwischen drei und 31 Kilometern breit. Noch immer gibt es hier einen riesigen Militärstützpunkt der USA, der noch immer umstritten ist: Bei nahezu jeder Wahl geht es darum, wie den Amerikanern zu begegnen sei, wie schroff oder milde, und auch darum, warum Okinawa im fernen Tokio so wenig ernst genommen wird.
Das Klima: subtropisch. Bei rund 23 Grad liegt die Durchschnittstemperatur, denn im Sommer sind’s meist 27 oder 28 Grad und im Winter 17 oder 16. »Etwa die Hälfte des Jahres fällt Regen, insgesamt über 2000 mm. Im Herbst wird Okinawa regelmäßig von Taifunen heimgesucht.« Das weiß Wikipedia.
Für Makoto Suzuki kam das Projekt seines Lebens Anfang der 70er Jahre eher zufällig daher. Er war damals Herzmediziner in Tokio, und die Unikarriere begann gerade, als er nach Melbourne, Australien, eingeladen wurde. Und wie das Leben so spielt: Eine Einladung nach Okinawa folgte, als er gerade in Melbourne war. Es war kompliziert, herzukommen, denn noch war Okinawa von den US-Streitkräften besetzt. Für zwei Tage nur durfte er bleiben, doch er mochte diese tropengleiche Insel, und wenig später fiel Okinawa zurück an Japan. Dr. Suzuki durfte nun wiederkommen und blieb und gründete eine medizinische Schule.
Ein Assistent sagte ihm: Im Norden sollen angeblich Menschen leben, die hundert Jahre alt sind. Dr. Suzuki nahm sein Stethoskop und stieg in den Bus nach Norden und fuhr nach Tokuno Shima. Dort verstand er die Sprache kaum, diesen nach Auskunft aller Experten ungeheuer eigentümlichen Dialekt. Einsam stand er auf einem Marktplatz herum. Niemand da. Dann doch ein paar Leute. »Und eine Frau mit Bambuskorb kam, sie lud mich in ihr Haus ein. Gab mir Tee. Sie sah aus wie eine Siebzigjährige, und ich sagte ihr, ich suche Hundertjährige. Sie sei hundert Jahre alt, sagte sie.«
Das ist selten, sagte Suzuki zu ihr.
Nein, das ist nicht so selten, wir haben hier viele Hundertjährige, zwei, drei weitere sogar in diesem Dorf, das sagte die Alte.
Das war der Anfang. 1975 entschloss sich das Ministerium für Gesundheit und soziale Leistungen in Tokio, die »Okinawa Centenarian Study« zu finanzieren; und es ernannte Suzuki zum Projektleiter.
32 Hundertjährige gab es damals, vor knapp 45 Jahren, auf Okinawa, 660 in ganz Japan. Da Japan 47 Präfekturen hat, hätten es auf Okinawa, der Bevölkerungszahl entsprechend, nur sechs Hundertjährige sein dürfen. Und, das eigentliche Wunder: 28 jener 32 waren vollkommen gesund. Hellwach. Und zufrieden.
Wieso? War es das Zauberwort: ikigai?
Der Grund des Lebens?
»Ja, ikigai«, sagt Suzuki, »sie alle hatten einen Grund. Einen Sinn. Glück, wenn es das gibt. Damals aber wusste ich noch nichts davon. Ich wusste nur: was für ein Rätsel, was für ein Geheimnis! Wie besonders! Darum beschloss ich, mit dieser Arbeit anzufangen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Zeit verschlingen, dass sie mein eigenes Leben so komplett ausfüllen würde.«
Heute, im Dezember 2018, leben genau 1197 Menschen in Okinawa, die mindestens 100 Jahre alt sind. Vieles ist anders als vor 45 Jahren. Mehr als die Hälfte lebe inzwischen einsam im Heim, liege im Bett oder sei sogar dement, sagt Suzuki. Nicht einmal die Hälfte sei noch wirklich aktiv, »Familiensinn und Ernährung haben sich auch hier verändert, wie überall auf der Welt«.
Es ist widersinnig, es ist absurd. Die Welt wird klüger, und die Welt wird dümmer, zur selben Zeit. Viele Menschen wissen, wie man zufrieden 100 Jahre alt werden könnte, und verhalten sich doch so, dass sie es auf keinen Fall schaffen werden. Dr. Suzuki ist mittendrin in dieser glückseligen Zone, wo alles blüht und alles wächst, was gut tut und schmeckt, aber er sieht junge Menschen, die heute zu »McDonald’s« rennen und morgen zu »Kentucky Fried Chicken«; »sie essen viel zu viel Fleisch, trinken zu viel, bewegen sich zu wenig, auch hier«. In all den harten Jahren, im Krieg und danach, aßen die Leute hier die Süßkartoffeln vom eigenen Feld – der Wohlstand hat die amerikanische Fast-Food-Ernährung nach Okinawa gebracht.
Und sind Männer vielleicht doch dümmer als Frauen?
Eine Erkenntnis der vergangenen zehn Jahre ist, dass die Lebenserwartung der Frauen von Okinawa weiter steigt, die der Männer aber nicht. »Junge Männer mögen den Sake. Sie sind nicht so sehr interessiert an der Länge des Lebens, leben im Heute, ausschließlich«, sagt Suzuki, »und natürlich wollen sie auf gar keinen Fall auf dem Land leben.«
Wenn man es nun zusammenfasst, dann hat Makoto Suzuki in den viereinhalb Jahrzehnten seiner Arbeit diese zehn Lektionen gelernt:
Die richtige Ernährung ist wichtig; eine Art Diätkultur. Gemüse, Tofu, Obst: Auf Okinawa wächst alles, was gesund ist. Tabak, Alkohol und Koffein sind tabu.
Kleine Portionen sind schlau, auf Okinawa sind daher kleine Teller üblich. »Hara hachi bu« heißt das hier: Iss nur so lange, bis dein Magen zu 80 Prozent gefüllt ist. Der durchschnittliche Erwachsene nimmt auf Okinawa knappe 1900 Kalorien pro Tag zu sich; in den USA isst er das Doppelte.
Bewegung ist wichtig. Es muss nicht Sport sein, aber der Mensch hat Beine, damit er geht. Und der Mensch kann schwimmen, und wenn nicht, kann er’s lernen.
Mentale und soziale Gesundheit sind wichtig. Bleiben wir, ehe wir in die Details einsteigen, vorerst bei dem japanischen Wort: ikigai. Man muss in der Lage sein, Niederlagen und Trauer irgendwann hinter sich zu lassen. Das führt dann zu spiritueller Gesundheit. Suzuki traf eine Hundertjährige, die ihren Mann und ihre vier Kinder im Krieg verloren hatte. Die Frau sagte ihm: Ich bin erschöpft. Ich kann nicht mehr über den Krieg reden. Aber heute habe ich etwas zu essen, zu trinken, und all das gab es im Krieg nicht. Es ist nicht nötig, immer nur betrübt an gestern zu denken. Es geht mir gut.
Niemals gestresst, aber immer sinnvoll beschäftigt zu sein … dieses Gleichgewicht ist gesund.
Neugieriges Lernen ist zentral. Der Mensch versteht und lernt das, was er tut, und wenn es immer das Gleiche ist, stumpft der Mensch irgendwann ab und langweilt sich. Auch Hirnzellen altern (schon zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr beginnt dieser Prozess). Eine neue Sprache, ein neues Spiel, ein neues Hobby oder neue Details der alltäglichen Aufgaben – »wir müssen uns auch im geistigen Sinne bewegen«, sagt Suzuki.
Familie und Freunde sind wichtig. Auf Okinawa gibt es das Moai-System: Die Menschen kommen zusammen, essen gemeinsam, diskutieren, versuchen, Probleme zusammen zu lösen. Noch heute wird die Moai-Tradition in Naha gepflegt: Gruppen von Menschen mit gemeinsamen Interessen treffen sich einmal im Monat; sie alle zahlen einen kleinen Beitrag, mit welchem dann jenen im Kreis, die Sorgen haben, geholfen werden kann. Moai ist die moderne Familie, denn Einsamkeit ist schlimm, und Isolation tötet.
Konzentration ist ein neuer Schlüssel zum Glück im Alter. Der moderne Mensch ist allzu abgelenkt. Multitasking gilt ihm als Begabung. »Das Telefon wegzulegen und sich voll und ganz einer Sache hinzugeben ist sehr, sehr gesund«, so Suzuki.
Wir müssen so oft wie nur möglich so lange wie möglich das tun, was wir wirklich tun wollen. Und wir sollten so selten so kurz wie möglich das tun, was wir tun müssen. Und: Humor hilft.
Nicht zu vergessen: Der Mensch sollte schlafen – und auch dies voll und ganz, hingebungsvoll, ohne Smartphone auf dem Nachttisch. Die Zellen und damit der ganze komplizierte Körper erholen sich im Schlaf. In der Nacht sollte nichts als der Schlaf unser ikigai sein.
Die Menschen von Okinawa haben seltener – und später – Krebs und Herzinfarkte als andere Menschen; im Vergleich zu den USA gibt es fünfmal weniger Herz- und Gefäßerkrankungen und viermal weniger Prostata- und Brustkrebs. Sie werden seltener und später dement. Ihre Sexualhormone sind auch im Alter noch zahlreicher.
Im Westen, so sagt es Suzuki, würden Krankheiten erst dann wahrgenommen und behandelt, wenn sie eben da seien; die Menschen von Okinawa hätten vorgebeugt.
1986 stellte Suzuki seine ersten Ergebnisse und Thesen auf einem Gerontologen-Kongress in Hamburg vor. Deutsche, Italiener, Amerikaner waren dort, viele Pathologen, und die Wissenschaftler bekamen eine erste Vorstellung davon, dass es diese wenigen besonderen Orte gibt, an denen Menschen anders, nämlich womöglich glücklicher, jedenfalls nachweisbar länger leben als anderswo. Ein Journalist malte blaue Kreise um Okinawa und um Sardinien, und so entstand der Fachbegriff »Blue Zones«.
Warum dort, warum nicht anderswo? Was ist das Erfolgsgeheimnis der blauen Zonen?
Das interessierte uns, als wir unsere Weltreise zu den ältesten Menschen begannen, und vor allem interessieren uns die noch größeren Fragen: Wie lebt man ein langes, vor allem ein gutes, erfülltes Leben?
Was lässt sich beeinflussen – und wie?
Worauf sind Menschen, die sehr alt werden, stolz, und was bedauern sie?
Wie also blicken sie ganz am Ende zurück auf ihre rund 100 Jahre – und was können wir daraus lernen?
Nach seinem Herzinfarkt konnte Suzuki nicht mehr so viel reisen, aber die Welt war neugierig geworden, weshalb die Welt nun zu ihm kam. Zwei junge Wissenschaftler aus Kanada, Bradley und Craig Willcox, besuchten ihn, waren begeistert, stiegen 1994 in seine Projekte ein, und zu dritt schrieben sie das Buch »The Okinawa Program«, das ein Weltbestseller wurde. Von den Willcox-Brüdern werden wir später noch hören.
Makoto Suzuki sagt, er könne durchaus 100 Jahre alt werden. Er weiß zweifellos, wie es geht: Er isst Gemüse, Tofu, Fisch, er nennt sich »Semivegetarier«. Und er liebt seine Familie, die Ehefrau, die zwei Töchter, die zwei Enkel, er hat ohne Frage sein ikigai und hält Vorlesungen, arbeitet noch immer in der Kardiologie, befragt (wenn er nicht zu weit fahren muss) noch immer die Hundertjährigen Okinawas. Er hält sich viel draußen auf, denn auf Okinawa ist es hell, und das Licht der Sonne ist gesund für uns: Vitamin D stärkt Immunsystem und Knochen und schützt vor Diabetes, hohem Blutdruck und angeblich, so jedenfalls sagt es Suzuki, sogar vor mancher Krebsart. Sport macht er nicht, aber am Wochenende arbeitet er auf seinem Bauernhof, wässert, sät, erntet.
»Das könnte doch reichen«, sagt Dr. Suzuki.
Mit 70 bist du nur ein Kind
Ogimi, Okinawa
Es sei immer warm hier, angenehm stressfrei für den Körper.
Die bittere Melone, Goya, habe heilende und übrigens auch im sexuellen Sinne wundersame Wirkungen.
Die Menschen gingen zu Fuß.
Sie würden einander helfen.
Grünen Tee würden sie trinken.
»Yuimaaru« sei natürlich wichtig, das bedeutet Teamgeist und Zusammenspiel.
Und »ichariba chode«, das heißt, dass man Fremde wie den eigenen Bruder oder die eigene Schwester behandeln solle.
Das sind Sätze, die wir an den Ständen und in den Restaurants von Makishi Nobu hören, dem großen Markt von Naha. Viele Achtzig-, Neunzig-, Hundertjährige arbeiten hier, helfen ihren Söhnen und Töchtern beim Verkaufen, entkommen dadurch der Einsamkeit in dieser Großstadt, in der riesige Coca-Cola- und Samsung-Schilder blinken wie überall auf der Welt, und in der Pizza-Hut neben Burger King residiert.
Wir brechen auf und fahren nach Norden. Aus der Hauptstraße wird eine Autobahn, und aus der Autobahn wird die schmale Landstraße 58, drei Stunden lang geht es voran, Häuser verschwinden, der Yanbaru-Regenwald wird dichter, und weit sind die Strände. Unser Ziel ist Ogimi, 3000-Seelen-Dorf, weltberühmtes Ziel aller Forschung über die ältesten Menschen der Erde. In Ogimi sind wir verabredet.
Wenige Autos gibt es hier. Die Menschen fahren Rad oder gehen zu Fuß. Am Strand findet sich ein steinernes Willkommensschild: »Mit 70 bist du nur ein Kind, mit 80 wirst du langsam zum Jugendlichen, und wenn dich – wenn du 90 bist – deine Angehörigen in den Himmel einladen, dann bitte sie so lange zu warten, bis du 100 bist … dann könntest du langsam darüber nachdenken.«
Die Häuser und Hütten stehen weit voneinander entfernt. 17 Nachbarschaften gibt es, sie alle haben einen Präsidenten bzw. meist eine Präsidentin, und jede Nachbarschaft ernennt Verantwortliche für Themen wie Kultur, Feste, Langlebigkeit. Und wenn man nun hier herumwandert, hört man schnell jenes Wort, das alle hier für das Geheimnis von Ogimi zu halten scheinen: basho-fu.
Basho-fu ist das eine, das gleichfalls weltberühmte Produkt der Menschen von Ogimi. »Basho-fu«, das meint jene Kleider, Hüte, Taschen und kleinen Utensilien, die aus den Fasern der hier wachsenden Bananen-Staude entstehen. Basho-fu, das bedeutet zugleich eine, man kann’s nicht anders sagen: extrem filigrane, extrem langwierige Tätigkeit. Basho-fu ist die Aufgabe aller hier, auch und vor allem die der Alten, denn die Alten gelten als die Bewahrer der Tradition des basho-fu; sie mischen mit, arbeiten mit, jede und jeder an dem Ort, an dem sie noch effektiv helfen können.
Drei Jahre dauert es, bis die Bananenstaude gewachsen und bereit ist. Mit der Machete wird sie gefällt, mit Messern werden die Fasern herausgetrennt, »u« heißen die Fasern. Und »u-daki« heißt das Kochen der Fasern in riesigen Töpfen, »chingu« das Aufrollen der Fasern zu Bällen. Dann wird getrocknet, gesponnen, gefärbt, gestreckt und endlich verwoben. Es sind viele, viele Schritte, viele Monate, und heute, an einem Dezemberdonnerstag 2018, arbeiten zwei Dutzend Frauen summend und singend im ersten Stock des flachen Baus im Zentrum des Dorfes.
Sie reden nicht viel.
Sechs Tage pro Woche seien sie hier, sagen sie, von acht bis 17 Uhr.
Und ja, sagt eine, das hier ist unser Leben, wir machen das zusammen, Entschuldigung, sagt sie, ich muss jetzt weitermachen.
Die Älteste ist die Anführerin: Toshiko Taira, 98 Jahre alt. Sie hockt hinten rechts auf dem Boden, webt, ein Kleid entsteht, eines wie jenes, das sie selbst trägt: ein blaues, leichtes, gleichsam schwebendes basho-fu-Kleid.
Toshiko Taira: »Ich weiß nicht, wie man lange lebt.«
Wir müssen warten, Toshiko muss ihre Arbeit beenden. Wir sitzen unten im Erdgeschoss, reden mit ihrer Enkelin Nao, die auch hier arbeitet, trinken Wasser und Tee, und nun kommt Toshiko Taira langsam an unseren Tisch, den Rücken gebeugt, mit erstaunlich großen Ohren und strahlend lächelnden braunen Augen, und erzählt in ruhigen, freundlichen Sätzen ihre Geschichte.
Gelernt hat sie das, was sie heute tut, von ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Das ganze Dorf habe von Zuckeranbau, Bananen und eben basho-fu gelebt, immer schon, wobei basho-fu nach dem Zweiten Weltkrieg auszusterben schien, ehe die Regierung in Tokio ein nationales Kulturerbe daraus machte, inklusive Werbung, inklusive Renovierung der Gebäude, was basho-fu wieder zum Sinn des Daseins, zum ikigai und profitabel werden ließ.
Zehn Geschwister hatte Toshiko, sie ist die Älteste, sechs Brüder und Schwestern leben noch. Die Eltern ließen sich früh scheiden, Toshiko musste sich viel um die Kleinen kümmern. Sie ging in die Grundschule, liebte das Lesen und das Rennen, sie war die Schnellste der Klasse.
Es war ein armes Dorf, aber die Großeltern waren Heiler, sie heilten mit den Kräutern, die in Okinawa wuchsen, die Familie hatte immer genug zu essen. Toshiko war noch sehr jung, das genaue Alter weiß sie nicht mehr, als sie nach Naha geschickt wurde, um dort als Hausmädchen zu arbeiten. Sie war noch immer jung, als sie zurückbeordert wurde, hierher, um sich wieder um die Geschwister zu kümmern, da die Mutter krank war; und jung war sie, 16 Jahre alt erst, als sie in den Süden Japans geschickt wurde, um wieder Hausmädchen zu sein. Aufregend war es dort. Die große Welt! Und dann erst Tokio! Dort kochte sie. Über zwei Jahre lang blieb sie in der großen Welt, und dann holte die Familie sie zurück nach Ogimi.
Ist das nicht zum Verzweifeln? Diese ewigen Fesseln? Eine Familie, die die eigenen Wünsche erstickt?
Toshiko Taira lächelt noch immer, aber sie scheint nicht recht zu verstehen, was wir sagen wollen. Sie sagt: »Niemand kann etwas dagegen tun. Man muss sich umeinander kümmern. Man muss helfen. Man muss das Leben akzeptieren.«
Die Eltern wählten einen Ehemann für sie aus, doch der musste zur Armee, und sie hatte zu warten; mit 23 oder 24 heiratete sie dann doch. Aber die Kriegsjahre warfen alles durcheinander, Toshiko Taira landete noch einmal in Japan, diesmal in Okayama, es ging immer nur darum, irgendwie zu überleben, Arbeit zu finden, Sicherheit auch. Sie fertigte Kimonos, lernte Nähen, Handarbeit. Ihren Ehemann vermisste sie nicht, den kannte sie ja kaum, aber sie vermisste die Heimat, die Familie.
Und so kam sie also wieder her und begann mit basho-fu. Sie trennte sich von Yoshimasa, ihrem Ehemann, sie hatte ihren Sohn, Hiroshi (der bald auch schon 70 Jahre alt ist), sie hatte ihre Aufgabe, ihr Dorf, ihre Gemeinschaft, ihr ikigai, und nun blieb sie. Denn das Wetter ist besser als im übrigen Japan, so warm, ohne Schnee, und die Menschen helfen einander.
Sie heiratete nie wieder. »Ich habe hart gearbeitet. Da war keine Zeit, Männer zu treffen«, so sagt es Toshiko Taira. Und die Jahre vergingen. Und ja, es war ein gutes, ein glückliches Leben, sagt diejenige, die es geführt hat. »Ich habe eine jüngere Schwester in der Hauptstadt, in Naha. Bis ich 90 war, habe ich sie gern besucht, da bin ich immer mit dem Bus gefahren, vier Stunden lang, die Familie hat sich immer Sorgen um mich gemacht.«
Über das Geheimnis des langen Lebens, sagt sie, habe sie nie nachgedacht. »Ich weiß nicht, wie man lange lebt. Es passiert.«
Sie hatte eine Herzoperation, als sie 80 Jahre alt war, sie ist wenig später eine Treppe hinabgefallen, sie braucht ein Hörgerät, sie hat manchmal Kopfschmerzen und manchmal Rückenschmerzen, aber schlimm sei nichts davon. Sie lebt. Und ein Tag ist wie der andere, aber genau so, wie die Tage eben sind, scheinen sie gut zu sein.
Morgens um vier oder fünf Uhr steht Toshiko Taira auf, wäscht sich, kleidet sich an, isst ein wenig Gemüse, trinkt Tee, liest zwei Zeitungen. Um sieben Uhr kommt sie her: früher per Fahrrad oder zu Fuß, jetzt fährt ihr Sohn sie, mit dem Auto sind es nur zwei Minuten. Sie hat eine Lunchbox dabei, Reis, Bananen, Süßkartoffeln, Tofu, bis um 17 Uhr arbeitet sie. Abends essen alle Familienmitglieder zusammen, sie wohnt natürlich im Haus ihres Sohnes, und dann sehen sie fern, und um 21 Uhr schläft Toshiko Taira.
Basho-fu, sagt sie, bedeute täglich neue Fragen, neue Aufgaben. Konzentration auf Details. Variationen dessen, was gestern war.
Darum geht es hier immer: um die Mischung zwischen Stabilität und Abwechslung, Sicherheit und Vielfalt. Darum geht es auch und vor allem bei der Ernährung.
Dr. Suzuki und seine beiden kanadischen Forschungspartner Craig und Bradley Willcox haben die sogenannte Okinawa-Diät ergründet. Ihre Ergebnisse:
Die Hundertjährigen Okinawas essen pro Tag sieben verschiedene Obst- und Gemüsesorten oder fünf verschiedene kleine Gerichte mit Obst und Gemüse. Sie essen 206 verschiedene Lebensmittel regelmäßig. Beliebt ist der »Regenbogen«: Pfeffer, Karotten, Blumenkohl, Spinat, Aubergine, Gemüse in allen denkbaren Farben also; Soja-Produkte wie Tofu kommen hinzu, zudem ein bisschen Reis, dreimal die Woche Fisch, etwas seltener Schweinefleisch und kaum Zucker und nur 7 Gramm Salz pro Tag (12 Gramm sind der Durchschnitt im restlichen Japan).
»Oh«, das sagt Toshiko Taira, »ich kann sagen, womit man 100 Jahre alt wird: Jasmintee, Süßkartoffeln, Sojasprossen, Sojabohnen, Pfeffer, Zwiebeln, Kohl, Kürbis, Thunfisch, Karotten, Miso, Tofu, Goya.« Goya, wir erinnern uns, ist die bittere Melonensorte.
Aber nun entschuldigt sich Toshiko Taira. Es ist 11.30 Uhr, sie hat einen Termin: Massage.
Draußen parkt ein Taxi. Toshiko Taira greift nach einem kleinen Turnbeutel, handgefertigt aus den Fasern der Bananenstauden von Ogimi, und geht.
Wir sagten es bereits: Erst ganz am Ende unserer Reise in die Welt der sehr, sehr alten Menschen sind wir nach Japan geflogen.
Es war eine Reise, die zufällig anfing: mit einem Besuch bei einer uralten ehemaligen Hochspringerin; mit einem Konzert in New York und dem anschließenden Gespräch mit dem Komponisten; mit einer Begegnung mit drei über 100 Jahre alten Geschwistern in New York, die auf ein aufregend erfülltes Jahrhundert zurückblickten und immer noch kraftvoll agil waren.
Durch diese letzte Begegnung mit den Geschwistern Kahn wurden wir entflammt. Wer möchte das nicht: beschwingt und glücklich alt werden? Und so begann unsere Reise, die bald schon viel mit dem eigenen Dasein und den großen Fragen zu tun hatte: Worum geht es in der knappen Zeit, die wir haben?
Und was ist das: ein erfülltes Leben?
Die Reise beginnt
Drei Geschichten
Gretel Bergmann-Lambert war eine hochbegabte Fleißige gewesen, die perfekte Athletin also. Aber sie war eine Jüdin in Deutschland – zur auf fatale Weise falschen Zeit.
Als Klaus sie besuchte, in ihrem Häuschen in der Avon Street im New Yorker Bezirk Queens, 2009 war das, ging es uns noch nicht um hohes und höheres Alter; es ging in diesem Gespräch um jene schicksalhaft fürchterlichen Jahre, damals im »Dritten Reich«.
Margaret Bergmann-Lambert blätterte durch alte Fotos und Zeitungstexte, durch jene rote Kladde mit Erinnerungen, die ihr Vater angefertigt hatte; und sie sagte: »Ich war ein Naturtalent.« In Laupheim hatte sie mit Laufen, Werfen, Hochsprung begonnen, ehe sie aus dem Ulmer Fußballverein ausgeschlossen wurde, weil sie Jüdin war. Sie ging nach England, wurde britische Hochsprung-Meisterin und kehrte heim, um 1936 in Berlin Olympiasiegerin zu werden. Aber sie durfte nicht starten, weil sie Jüdin war – und die Deutschen trieben diese Geschichte so weit, dass sie einen Mann ins Damentrikot steckten und für den Hochsprung der Frauen nominierten, was aber dennoch nicht zum Gold für Deutschland führte, sondern lediglich zu einem fulminanten Skandal.
Margaret Bergmann wiederum floh in die USA, wo sie nur zweimal pro Woche trainieren konnte, da ein drittes Training eine weitere U-Bahn-Fahrt durch New York City und weitere fünf Cent bedeutet hätte. Was sie sich nicht leisten konnte. Trotzdem wurde sie dreimal amerikanische Meisterin, 1937 in Hochsprung und Kugelstoßen, 1938 im Hochsprung, sie hieß »The German Mädel«.
Nun war sie 95 Jahre alt und sagte: »Gold, nichts anderes wäre es geworden. Ich wollte den Deutschen und der Welt beweisen, dass Juden nicht diese schrecklichen Menschen waren, nicht so fett, hässlich, widerlich, wie sie uns darstellten. Ich wollte zeigen, dass ein jüdisches Mädchen die Deutschen besiegen kann, vor 100000 Menschen.« Ihr Ehemann Bruno schlief oben, es ging ihm nicht gut, er war 99 Jahre alt.
Und sie sagte auch dies: »Ich hätte so glücklich sein können in all den Jahren, wenn ich nicht so gehasst hätte.« Sie meinte die Nazis, vielleicht auch die Deutschen, ganz gewiss nicht ihren Bruno.
Sechs Jahre später redeten wir am Telefon, Gretel Bergmann war 101 Jahre alt, Bruno war 103 geworden, doch inzwischen gestorben. »Mir geht es aber gut«, sagte sie, »nur meine Beine wackeln etwas.«
In den Jahren, die folgten, ging es Gretel Bergmann-Lambert dann nicht mehr gut, sie verlor ihre Kraft, ihre Klarheit. Telefonieren mochte sie nicht, besuchen durften wir sie auch nicht mehr, sie wollte einfach nicht, oder unser Wunsch erreichte sie nicht mehr. Am 25. Juli 2017 starb sie in New York, ebenfalls 103 Jahre alt.
»Now it’s good«, hatte Margaret Bergmann-Lambert zum Ende unseres ersten Gesprächs gesagt.
Der erste Hundertjährige, den wir je erlebten, ebenfalls 2009, ebenfalls lange bevor wir die Idee und das Konzept für diese konzentrierte Recherchereise zu den ältesten Alten hatten, betrat eines Abends tapsig und fröhlich die Bühne der New Yorker Carnegie Hall. Das Orchester hatte eines seiner Werke gespielt, und auf einmal erschien er persönlich, Elliott Carter, damals exakte 100 Jahre alt, einer der größten Komponisten des vergangenen und auch des aktuellen Jahrhunderts. Er lachte und winkte und ließ sich vom Publikum bejubeln, für seine Musik natürlich, aber mindestens ebenso sehr für seine ungebändigte Lebenskraft.
Wir staunten. Was für ein beglückender Moment in diesem so ehrwürdigen Saal.
So energisch, so vergnügt, so schöpferisch konnte ein Mensch von hundert Jahren sein? Elliott Carter komponierte noch immer, so erfuhren wir, er war sogar fleißiger denn je; rund die Hälfte seines umfangreichen Werks war nach seinem 80. Geburtstag entstanden.
Wie machte er das? Was war sein Geheimnis?
Samiha bemühte sich um ein Interview, und so kam es im Herbst 2009, kurz vor seinem 101. Geburtstag, zu einer Begegnung in Carters New Yorker Wohnung.
Elliott Carter saß auf einem zerbeulten Sofa im achten Stock eines Backsteinhauses im Greenwich Village; gekauft hatte er diese Wohnung vor über fünf Jahrzehnten für 15000 Dollar. Er war ein kleiner, weißhaariger Mann mit wachen blauen Augen und feinen Gesichtszügen. Und Carter, geboren am 11. Dezember 1908 auf der Upper West Side, erzählte von dem stillen New York seiner Kindheit: »Mein Großvater war einer der Ersten, die ein Automobil mit nach Hause brachten. Es war auf eine seltsame Weise wunderschön, mit großen Hupen, und auf der Straße zog es alle Blicke auf sich. Damals gab es in New York nur Pferde und Kutschen. Heute ist diese Stadt ja so vollgestopft mit Automobilen, dass man kaum noch vorwärts kommt.«
Carters Musik ist virtuos und eigenwillig, entdeckungsvergnügt und darum sprunghaft, manchmal spröde und natürlich modern. Sie missachtet, scheinbar, alle Regeln. Rhythmen überlagern sich, es gibt keinen einheitlichen Takt, weshalb Instrumente in verschiedenen Geschwindigkeiten gegeneinander anspielen oder auch übereinander hinweg, geschwind, bremsend, ein Mosaik aus Klängen, das irritierend und zugleich inspirierend klingt. Carter sagte: »Ich würde sagen, ich bin permanent inspiriert, aber nicht verrückt.«
Carter hatte das Textilgeschäft seines Vaters übernehmen sollen, aber er wollte immer nur Musik machen. Sein Erweckungserlebnis hatte er am 31. Januar 1924, als er in der Carnegie Hall Igor Strawinskys »Le Sacre du printemps« hörte, gespielt vom Boston Symphony Orchestra; für Carter war es »das Größte, was ich je gehört hatte«. Er ging nach Harvard und studierte englische Literatur, Griechisch, Philosophie und Musik, weil seine Eltern ihn eben dort, in Harvard, studieren sehen wollten; und »weil das Boston Symphony von Koussevitzky dirigiert wurde und viel zeitgenössische Musik spielte«, so erzählte er.
Er rebellierte gegen die konservative Musikausbildung in Harvard, aber er spielte Oboe und Klavier. Nach dem Studium ging er nach Paris, um bei Nadia Boulanger das Komponistenhandwerk zu lernen. Sein Vater stellte enttäuscht die Unterstützung ein, doch mit den 1000 Dollar pro Jahr, die seine Mutter heimlich über den Atlantik schickte, konnte sich Elliott Carter im Paris der frühen dreißiger Jahre durchschlagen.
Der Durchbruch kam spät, mit 42 Jahren, in Arizona. Dort lebte Carter mit seiner Ehefrau, der Bildhauerin Helen Frost-Jones, zusammen, die die eigene Kunst aufgegeben hatte, um seine Kunst zu unterstützen. 2003 starb sie nach schwerer Krankheit; Carter pflegte sie bis zuletzt. »Das ist sie, das ist meine Frau«, sagte er und deutete auf einen filigranen Frauenkopf aus Stein, »sie hat wunderbare Kunstwerke gemacht. Später wurde dann ich ihre Skulptur.«
Samiha fragte ihn, wie es sich anfühle, 101 zu werden? Carter schnaubte. »Die Antwort ist, dass ich nicht die geringste Vorstellung von meinem Alter habe«, sagte er. Es sei vermutlich eine Frage von Glück, aber darüber denke er nicht nach. Dann sagte er: »Ich will einfach nur jedes Stück beenden, das ich anfange.«
Am 5. November 2012 starb Elliott Carter, er wurde 103 Jahre alt.
Unsere Neugierde war geweckt, die schiere Freude an Gesprächen wie diesem sowieso. Und wie das so ist, wenn man selbst älter wird: Wir dachten ohnehin über die eigenen, alt werdenden Eltern nach, über Samihas Mutter, die Pianistin war, humorvoll, lebensgierig und doch an Parkinson erkrankt. Warum gerade sie? Und was bedeutete diese Diagnose für Dora, für die Familie?
Wir sprachen mit unseren Eltern oft und immer öfter über das Alter, über den Tod, über das Schrumpfen von Möglichkeiten, das Schrumpfen von Freundeskreisen, das Schrumpfen der Kraft und doch auch über den Stolz auf all das Geschaffte.
Und wir sprachen über die Trauer über Ausgelassenes, dieses so schmerzhafte Bedauern verpasster Möglichkeiten, die niemals mehr wiederkehren, wir sprachen über jene wenigen, aber so gewichtigen Fehler, die zu stechendem schlechten Gewissen im Alter führen und doch zum Leben dazugehören.
Und ja, wir sprachen mit unseren Eltern über die größte aller Fragen: Wie gelingt das Leben?
In New York besuchte Samiha 2010 die Familie Kahn, um im »Spiegel« über diese drei Geschwister zu schreiben. Drei sehr, sehr alte Geschwister.
Helen, damals 108, verachtete Salat, Gemüse, frühes Aufstehen und das ganze verdammte gesunde Leben überhaupt. Sie liebte kurzangebratene Hamburger, Schokolade und Cocktails und ganz besonders das Nachtleben von New York: die Oper, den Broadway, all die Restaurants. Und sie hatte 80 Jahre lang geraucht, warum auch nicht? Helen wurde seit Kindertagen nur »Happy« genannt, »die Glückliche«. Diese Helen Faith Keane Reichert also, geboren am 11. November 1901 auf Manhattans Lower East Side und die Tochter polnisch-jüdischer Einwanderer, war Psychologin, Modeexpertin, einstige Fernsehmoderatorin und emeritierte Professorin für Marketing an der New York University.
Happy war zum Fall für die Wissenschaft geworden, da eben auch ihre beiden Brüder uralt waren: Irving, 104, und Peter, 100; und erst im Jahr 2005 war ihre Schwester Lee gestorben, damals 102 Jahre alt.
Wie schaffen es manche Glückspilze, 100 Jahre und länger zu leben – und dabei auch noch geradezu unverschämt gesund und aktiv zu bleiben? Diese Frage interessierte die Wissenschaftler, und diese Frage begann nun uns zu interessieren.
Happys kleiner Bruder Irving ging an Arbeitstagen noch immer in sein Büro im 22. Stock eines Wolkenkratzers an der Madison Avenue. »Kahn Brothers« hieß die Investmentfirma, die er 1978 zusammen mit zwei Söhnen gegründet hatte; der ältere Sohn, heute 72, war allerdings vor fünf Jahren in Rente gegangen. »Ich interessiere mich für viele verschiedene Branchen und Technologien«, sagte Irving, »und ich lese leidenschaftlich gern. Deshalb ist Investor der perfekte Job für mich.« Seit dem Tod seiner Frau vor 14 Jahren arbeite er sogar noch mehr als zuvor. »Ich habe einfach niemanden mehr gefunden, der so interessant wäre wie die Frau, mit der ich 65 Jahre lang das Bett geteilt habe«, sagte er und begann ein wenig zu flirten.
Samiha fragte: Wie wird man glücklich alt?
»Erstens muss man sich gesund ernähren, mit viel Gemüse und Salat. Zweitens: viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Drittens: nicht trinken, nicht rauchen. Ich trinke höchstens alle drei Monate ein Glas Wein. Viertens, man muss immer in Bewegung bleiben, offen sein, Menschen von überall auf der Welt kennenlernen. Und fünftens viele Interessen haben und Dinge lernen, die man noch nicht kann – das hält jung!« All das sagte Irving Kahn.
»Ich habe ehrlich keine Ahnung, warum ich so alt geworden bin«, erklärte anschließend der Kleine, Peter, nur 100 Jahre alt, das Nesthäkchen also. Er habe »absolut normal« gelebt, nie groß auf seine Gesundheit geachtet und auch nie groß über sein Alter nachgedacht. Aber unter dem Namen Peter Keane machte er im Showbusiness Karriere – als Fotograf und Kameramann in Hollywood. Er war dabei, als Ende der dreißiger Jahre »Vom Winde verweht« gedreht wurde. Und als die junge Judy Garland am Set von »Der Zauberer von Oz« ihr legendäres »Over the Rainbow« sang, sei er wie alle Kollegen am Set in Tränen ausgebrochen, sagte er.
Im September 2011 starb Happy. Peter starb im Februar 2014. Und im Februar 2015 folgte ihnen ihr Bruder Irving; er wurde 109 Jahre alt. Bis zum Ende rief er Samiha in Hamburg an und schlug ihr Reportagen vor, die zufälligerweise allesamt in New York spielten.
Und damit also begannen wir, uns auf dieses Thema einzulassen, das ganz beiläufig zu unserem eigenen Thema wurde.
Wir wurden ja ebenfalls älter. Das Leben veränderte sich, weil sich Freundschaften veränderten oder sogar endeten (was man in der Jugend meist für unmöglich hält). Auch die Liebe verändert sich mit den Jahren. Berufliche Einschnitte kamen hinzu: diese Trauer, die im Kern schierer Unglaube war, über die Kälte der Lügen scheinbar Vertrauter, das Staunen über die Intrigen durch Menschen, die gestern noch Freunde gewesen waren. Auch das gehört zweifellos zum Leben: Beziehungen, private wie berufliche, die wichtig und stabil schienen, zerbrechen dann doch. Große Fragen stellen sich damit, das ist die logische Konsequenz:
Worum geht es wirklich im Leben?
Was wollen wir mit den Jahren und den Möglichkeiten, die wir haben, anfangen?
Wir mussten dann, auch das gehört leider dazu, mit dem Tod von Verwandten, dem Tod von Samihas Mutter umgehen – und im Frühjahr 2019 wurden wir Eltern eines Sohnes. Diesen Sohn werden wir in eine westliche Welt entsenden, die lange robust schien, eine Welt der Möglichkeiten – und die in diesen Jahren nun bedroht und brüchig ist, da ihre großen Probleme, der Klimawandel, die Überbevölkerung, die Massenmigration und die Überforderung der Demokratie in den kommenden Jahrzehnten kaum kleiner werden dürften.
Und wieder sind sie da, die größten aller Fragen:
Wie führen wir unser Leben so, dass wir glücklich oder zufrieden sein können?
Was in unserem Leben lässt sich überhaupt lenken, was können wir entscheiden; und was ist vorbestimmt, was ist Zufall?
Welche Veränderungen sind die richtigen: Woran sollten wir festhalten, und was sollten wir loslassen – und wann?
Wie wichtig ist Arbeit, Erfolg – und wie können wir mit Niederlagen umgehen?
Welche Wendepunkte zählen wirklich; was in unserem Leben ist am Ende tatsächlich wesentlich?
So haben wir diese Reise angelegt: Sie wird in die Ferne führen, in die ruhmreiche Heimat von Hundertjährigen auf Sardinien, Okinawa oder in Loma Linda, Kalifornien. Und sie wird uns nach China, Thailand, Hawaii, auf afrikanische Inseln, nach Russland oder an die amerikanische Ostküste bringen.
Aber natürlich fahren wir auch nach Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark und quer durch Deutschland. In die Nähe also. In unsere Städte und Dörfer, zu unseren Familien.
Und in die Hauptstadt führt die erste Etappe.
Der Schwimmlehrer
Berlin
Leopold Kuchwalek steht am Rand des Schwimmbeckens und schaut an sich herab. Die Haut wirft am ganzen Körper Falten, fast so, als sei sie im Laufe seines Lebens zu groß geworden. Unter seinem Bauch klemmt ein roter Badeslip. Darunter beginnen die Beine, auf deren Kraft er einst stolz war. Unter Kuchwaleks Füßen führt eine Treppe ins Wasser, aber Kuchwalek will nicht die Stufen nehmen.
Leopold Kuchwalek: »Meine Frau war jut.«
Er will springen.
Langsam hebt er beide Arme über den Kopf und streckt den Rücken durch. Er lässt sich nach vorne fallen, kerzengerade, wie ein Bungeespringer an einer Klippe. Die Kinder im Becken kreischen. Als Kuchwalek auftaucht, liegt das weiße Haar platt auf seinem Gesicht. Er wischt mit den Händen die Strähnen aus den Augen und streckt die Arme nach einem blonden Jungen aus, der lachend davonrudert. »Ach, du kannst ja doch schon schwimmen!«, ruft Kuchwalek und paddelt ihm hinterher.
Seit Leopold Kuchwalek in Rente gegangen ist, arbeitet er als Schwimmlehrer. Die ersten jener einstigen Jungen und Mädchen, die bei ihm schwimmen lernten, bringen heute ihre eigenen Kinder in seinen Unterricht: Leopold Kuchwalek ist jetzt, 2018, 100 Jahre alt. Zweimal in der Woche kommt er ins Primavita-Bad in Berlin-Zehlendorf, um zusammen mit seinen Freunden Dieter und Dieter Schwimmunterricht zu geben.
Als Leopold Kuchwalek ein Junge war, hatte er nie Schwimmunterricht. Sein Onkel führte ihn zum Hohenzollernkanal in Charlottenburg, griff den Jungen und warf ihn ins Wasser. Danach konnte Leopold schwimmen. Damals nannte man Charlottenburg »Schlorndorf«. Kuchwalek nennt es noch heute so, weil so viele Erinnerungen in diesem Wort stecken:
Im Erdgeschoss des Mietshauses, in dem er aufwuchs, betrieb ein Mann eine Gemüsefabrik. Gurken aus dem Spreewald wackelten über Laufbänder durch den Innenhof, wurden gewaschen und schließlich in Gläser gesteckt. Das beobachtete Kuchwalek gerne, vom Fenster aus, und ab und zu klaute er eine Gurke. Kuchwalek sagt nicht Gurke, sondern »Jurke«. Das »r« liegt schwer im Rachen, als wolle er es verschlucken.
Als Leopold Kuchwalek 14 Jahre alt war, war es mit der Kindheit vorbei. Die Schule dauerte nur acht Jahre, und nun sollte er, halb Kind, halb Mann, einen Beruf erlernen. Ob er einen Traumberuf hatte? Da muss er lachen. »Ich wusste gar nicht, was das heißt: zu arbeiten.« Wünsche hatte er nicht, die Arbeit kam einfach zu ihm. Eines Tages besuchte ein Freund des Vaters die Familie, ein Ingenieur der AEG. Sie brauchten junge Burschen, sagte er. Und Leopold wurde Maschinenschlosser.
In jener Zeit, Anfang der dreißiger Jahre, formierten sich in Berlin die Nationalsozialisten. Kuchwalek sagt, er könne sich kaum daran erinnern. Vielleicht mag er auch nicht. 1933 trat er nicht in die Partei ein, sondern in den Paddelclub Viking, in dem er noch heute Mitglied ist. Politik interessierte ihn nicht. »Wenn Aufmärsche waren, war ich im Wasser«, sagt er.
Es war Frühling, die AEG feierte ein Fest, und da sah er Hilde zum ersten Mal.
Er schweigt ein paar Sekunden lang, guckt in die Luft und denkt nun wohl an das Mädchen mit den schicken Lederschuhen. Sie tanzten. Einige Tage später holte er sie mit seinem Motorrad ab und brachte sie ins »Paresüd«, zum Tanztee. Hildes Mutter saß am Rand und beguckte den jungen Mann. Sie muss zufrieden gewesen sein. »Ach«, sagt Kuchwalek nur, »meine Frau war jut.«
Vor drei Jahren starb Hildegard Kuchwalek, da hatten sie 78 Jahre miteinander verbracht. Seit Hilde nicht mehr da ist, hat sich sein Körper verändert. Als seine Frau noch für ihn kochte, habe er 75 Kilo gewogen, sagt er, heute seien es 62. Sein Ernährungsplan: »Morgens ’ne Stulle, abends ’ne Stulle und zwischendurch Pellkartoffeln oder Suppe aus der Büchse.«
Leopold Kuchwalek hätte seine Hilde gern sofort geheiratet. Aber 1939 wurde er eingezogen. Er war 22 Jahre alt, als die Wehrmacht ihn nach Frankfurt an der Oder schickte, als Kanonier. Mit seiner Truppe rückte er Richtung Osten. Drei Jahre lang. Er erzählt wortkarg vom Krieg, wie so viele Männer seiner Generation. »Alles war gleichgültig«, sagt Kuchwalek, »ich habe einfach funktioniert.« Solange, bis ihn ein Brief der AEG erreichte: Er werde gebraucht. Kuchwalek musste auf Montage, um Turbinen zu reparieren. »Die haben mich dann hin und her geschickt, überallhin, wo’s brenzlig war.«
Kuchwalek hatte also Glück: Er musste kein Maschinengewehr mehr tragen, und ab und zu durfte er sogar nach Hause, zu Hilde. Am Valentinstag 1942 heirateten sie. Auf einem Foto, aufgenommen in ihrer ersten Wohnung in Berlin-Mitte, sitzt sie auf seinem Schoß, die Haare wellig, das Gesicht glatt, in Karobluse mit Puffärmeln. Kuchwalek hält sie am Rock fest. Am Ringfinger glänzt der Ehering. Stolz sieht er aus. Glücklich, das auch.
Wenige Wochen später musste er wieder an die Front, in den Ural. Doch die Truppen rückten nicht mehr vor, sondern zurück. »Ich ging zum Regimentskommandeur, um mich zu melden. Vor der Hütte waren die Toten aufgeschichtet. Das war mein erster Eindruck.«
Seine Augen werden jetzt rot, seine Gesichtszüge starr. Hinter ihm tauchen die Kinder nach Ringen. Und Kuchwalek steht dort im Wasser, streckt die Arme seitlich aus und legt seine Hände auf die Wasseroberfläche und schließt die Augen. Dann kann er weitererzählen.
»Ich kam nach Bryansk. Wir hatten so viele Verluste. Wir mussten uns zurückziehen. Also ab in den Graben. Da war ein Unterstand. Ich sagte: Hier können wir schlafen. Aber die anderen riefen: Weiter! Weiter! Also sind wir weiter durch die Gräben gezogen. In dieser Nacht ist eine Bombe auf genau diesen Unterstand gefallen. Alle, die darin lagen, waren tot. Ich hätte darin gelegen. Eigentlich hätte ich darin liegen müssen.«
Das Wasser gleitet Kuchwalek über die Lippen, es gluckert, dann verschwindet auch die Nase. Kurz steht er atemlos im Wasser. Dann lässt er die Arme nach unten schnellen, sein Körper schießt nach oben, sein Mund schnappt nach Luft. Wieder schwimmt er zum Beckenrand und stützt sich ab. »Sehen Sie die weißen Flecken?«, sagt er und streicht sich über die Unterarme. »Das war Stalingrad. Die Sonne. Meine Haut hat sich nie wieder erholt.«
Und auf einmal sind da all die Erinnerungen, die Bilder.
»Wir standen im Gegenfeuer. Ich dachte, der erschießt mich. Ich habe den genau gesehen. Was macht der jetzt nur, denk ich. Ich habe mein Gewehr in hohem Bogen weggeschmissen. Dann haben die russischen Soldaten uns umzingelt. Die Sache war erledigt. Wir haben für drei Tage Brot gekriegt, und dann war Schluss. Es war furchtbar. Wir haben so gehungert. Sie können sich das nicht vorstellen. Ich habe so gehungert. Aber die anderen ja auch, die ja auch. Die Russen haben uns Knochen gegeben. Die sollten wir verbuddeln. Und da ist mir der Gedanke gekommen, die Knochen aufzuschlagen. Ich habe das Mark da rausgekratzt. Einen Becher voll. Den Becher habe ich heut noch. Und wenn wir doch mal Brot hatten, dann hatte ich was zum Draufschmieren.«
Knochen? Wir fragen nicht nach.
Leopold Kuchwalek kam frei, weil er gebürtiger Österreicher war. Er durfte nach Wien ausreisen. Doch er wollte nach Hause – und zuhause, das war Berlin. Also gab er sich auf dem Wiener Hauptbahnhof als Helfer aus, half den Passagieren mit den Handkarren und versteckte sich schließlich zwischen Kisten in einem Zug nach Berlin. An Weihnachten 1945 kehrte er zurück.
Doch sein Zuhause gab es nicht mehr. Die Wohnung, in die er mit Hilde gezogen war, war durch die Bombenangriffe zerstört worden. Hilde hatte überlebt.
Ihr erstes Kind nicht.
Leopold Kuchwalek war 26 Jahre alt, hatte eine Tochter bereits verloren, und sein eigenes Leben war ihm nun mehrfach geschenkt worden. Bis dahin, sagt er, war ja irgendwie immer alles zu ihm gekommen: die Arbeit, die Liebe, der Krieg. Aber als er Berlin sah und spürte, dass nichts mehr von allein kommen würde, setzte er sich ein Ziel: »Ich wollte meiner Familie ein gutes Zuhause bauen.«
Er fand Arbeit als Klempner. Morgens um fünf stand er auf, und abends ging er in die Schule, um sich zum Techniker weiterzubilden. Am Wochenende streifte er durch die Trümmer der Stadt, sammelte Steine und Holzlatten und schleppte sie in den Garten seiner Eltern. Vor dem Krieg waren sie nach Lichterfelde gezogen, in ein Neubaugebiet mit Holzhäusern und weitläufigen Gärten. Das Haus war ausgebombt. Aber im Garten war Platz. Also trug Leopold Kuchwalek das Baumaterial für sein erstes Haus dort zusammen. Tag für Tag wuchs die Hütte: In der Küche verlegte er Linoleumfußboden, das Wohnzimmer bekam einen Kachelofen, und schließlich baute Kuchwalek sogar eine Veranda, für den Sommer. Der Wasseranschluss im Keller der Eltern funktionierte noch, und als er in den Ruinen ein paar Rohre fand, nahm er sie mit und baute sich einen Gasanschluss.
Hilde gebar zuerst einen Sohn und dann eine Tochter. Zehn Jahre verbrachte die Familie in der Laube. »Das war eigentlich ganz schön, da im Garten«, sagt Kuchwalek. Aber er hatte versprochen, seiner Hilde und den Kindern ein gutes Zuhause zu bauen. Und die Laube war nicht gut genug.
Nach dem Schwimmunterricht warten vier Frauen vor den Umkleidekabinen: drei Mütter und Kuchwaleks Tochter.
Monika Gesirich, blondgrauer Bob, freundliches Lächeln, ist auch schon Rentnerin. Gemeinsam fahren sie in eine Doppelhaushälfte in Lichterfelde, ein schlammbraunes Haus, zwei Stockwerke, eingezäunt mit Maschendraht. Als Leopold Kuchwalek sich 1961 in dieses Haus verguckte, sah es noch ganz anders aus: Es stand nur noch eine Außenmauer, von oben führte eine Treppe durchs Freie in den Schutt hinein. Wie ein Puppenhaus – hinten zu, vorne offen.
Niemand in der Familie glaubte daran, dass dieses Haus ein Zuhause werden könne. Die Schwiegereltern, die versprochen hatten, die junge Familie beim Hausbau zu unterstützen, zogen ihr Versprechen für ein Darlehen zurück. »Dit schaffste nie, hat meine Frau gesagt. Hab ich aber«, sagt Kuchwalek und lacht. Er bestand darauf, das Haus zu kaufen. Monika Gesirich, die Tochter, hat die Fotos von damals behalten und in einer Stadtteil-Chronik veröffentlicht.
Die Großeltern, die mit stummen Gesichtern die Baustelle besichtigen.
Ihre Mutter, die im Kleid Steine in eine Schubkarre sortiert.
Ihr Vater, der mit krummem Rücken einen Sack Mörtel über die Baustelle schleppt. Und schließlich wieder die Großeltern, nun mit einem Spaten in der Hand. Stein für Stein baute Kuchwalek damals seine Gartenlaube ab, trug die Steine nach Lichterfelde und setzte sie dort wieder aufeinander. Zwei Jahre später zogen sie ein, und heute, ein halbes Jahrhundert später, sieht es so aus wie damals: dänische Teakmöbel, sonnengelbe Blumentapete, Linoleum. Hier sitzt Leopold Kuchwalek nun an seinem Esstisch und schaut durch rüschige Gardinen in den Garten.
Damals machte er sich selbständig. »Nur ich und mein VW-Bus«, sagt er, »ich bin sogar nachts noch losgerannt, wenn Kunden anriefen.« Er stellte erst einen Gesellen ein, dann einen zweiten, und schließlich leitete er eine Sanitärfirma. Er habe immer mehr Zeit bei der Arbeit als zu Hause verbracht, sagt er. Die Kuchwaleks konnten in den Urlaub fahren, nach Italien oder an die Ostsee, und irgendwann reichte das Geld für ein Ferienhaus in Schleswig-Holstein.
»Ich musste immer vorwärtsschauen«, sagt er und klopft mit dem Handrücken auf den Tisch, »das war jut.«
Am liebsten macht er noch immer alles selbst. So wie an dem Tag, als ein Gutachter vorbeikam, um seinen Antrag auf eine Pflegestufe zu prüfen. Der Gutachter kam einen Tag zu früh. Als er klingelte, öffnete niemand. Also ging er ums Haus herum. Im Garten stand Kuchwalek, 98 Jahre alt, auf einer Leiter in der Krone eines Apfelbaumes, mit einer Kettensäge in der Hand. »Ich schaffe halt gerne«, sagt er und grinst.
Und doch: Wenn die Zukunft mehr verspricht als die Vergangenheit, lernt jeder Mensch, hoffentlich, nach vorne zu schauen – irgendwann aber werden die Aussichten kürzer und die Schatten länger.
Leopold Kuchwalek hat den Krieg überlebt, zwei Häuser gebaut, zwei Kinder bekommen und eine Firma geleitet. Als wir ihn fragen, welche Pläne er noch habe, schweigt er kurz, und dann sagt er: »Im Sommer geht’s wohl wieder an die Ostsee.« Es gibt Menschen, die genau dies genießen: die Ruhe. Für Kuchwalek ist das nichts. Er sagt: »Früher konnte ich immer schlafen. Heute grübele ich. Den Schlaf kannst du nicht bescheißen.«
»Ich sage immer: Kinder, ich mach das schon, ich erledige das.«
Leopold Kuchwalek
Rogers Reise, I.
Der alte Mann ist schon sehr lange alt; lange her, folglich, dass er jung war. Das ist eine banale Erkenntnis, einerseits. Schockierend ist es aber doch auch, andererseits. Wie schnell das alles vergeht, wie schnell so vieles für alle Zeiten vorbei ist.
Der alte Mann erinnert sich exakt an das Kind, das er war, an die Scheidung der Eltern auch; da war er acht Jahre alt, und danach musste er bei seinem Vater bleiben, der Anwalt war und keine Ahnung hatte, wie das eigentlich ging: Vater sein.
»Ewig her, so unendlich ewig und doch so nah«, sagt der alte Mann und berichtet von seinen elf Haustieren, von seiner Schwester Nancy, die längst tot ist, genau wie natürlich all die Haustiere und leider auch all die anderen Menschen. Lang ist diese Liste der Toten, und beinahe täglich verlängert sie sich.
Grüne Hosen, einen blauen Pullover, ein blaues Hemd und eine runde Brille trägt der alte Mann, der weiße Haare und einen weißen Schnauzbart hat, geschwollene Finger, geschwollene Knie, der gebeugt geht und gebeugt sitzt, aber wach ist, schlagfertig, sarkastisch und scharfsinnig, ein New Yorker Beobachter seit Jahrzehnten, überhaupt ein New Yorker durch und durch: Roger Angell, 95 Jahre alt, als wir uns erstmals begegnen.
Wird er 100 werden?
Er würde gern.
Er muss nicht.
Er weiß sehr genau, wie gesagt, dass sie alle längst weg sind, die Familie, die Freunde, sogar eine Tochter, und auch all die Hunde, einer nach dem anderen; nun liegt also Andy, der neue Foxterrier, auf der Couch und schmatzt und grunzt. Und sein Herrchen weiß, dass es durchaus passieren kann, dass er, Roger, morgen früh nicht aufwacht, oder dass bei einem Spaziergang im Central Park der Herzinfarkt kommt, oder dass er stürzt, einfach so, und dass nach einem solchen Sturz der Verfall sich beschleunigt.
»Professionelle Athleten werden vom eigenen Stolz angetrieben«, sagt Angell, »mich aber treibt nichts mehr. Am Leben zu bleiben wäre eine gute Idee. Aber Stolz beschäftigt mich nicht mehr. Meine Augen beschäftigen mich, sie lassen nach, das ist ein großer Verlust.« Er denkt ein wenig vor sich hin, sagt dann: »Ach, was auch immer passieren wird, wird passieren.«
Wir sind hier, weil Angell über das ganze, verdammte Altern und womöglich sogar über das Sterben reden und schreiben kann wie kein Zweiter, so komisch und so schonungslos, der alte Mann schreibt schließlich seit über sechs Jahrzehnten für das Wochenmagazin »The New Yorker«. Wir besuchen ihn in seiner Wohnung in der Madison Avenue auf der Upper East Side in Manhattan, weil wir darauf hoffen, dass er 100 Jahre alt werden wird, und wir ihn auf dieser Reise begleiten möchten.
Ein Flügel steht in der Wohnung, Noten von Schubert und Schumann liegen darauf. Bücher und CDs in den Regalen. Parkett. Weiße Sessel.
»In Wahrheit war ja der ›New Yorker‹ mein Leben. Mein Halt. Meine Identität. Meine Heimat. Er war immer da. Und ich wollte nie etwas anderes tun, als für den ›New Yorker‹ zu schreiben.« Autor und Redakteur war Roger Angell, immer im Wechsel. Als Literatur-Redakteur betreute er Alice Munro, Vladimir Nabokov und John Updike, als Reporter schrieb er über alles, was sich halt ergab. Auch als Schriftsteller versuchte er sich, einige Kurzgeschichten entstanden, doch »ich hatte für Romane oder Kurzgeschichten nicht genug zu sagen«, sagt er.
All die großen Chefredakteure des »New Yorker« hat er erlebt, zuletzt Tina Brown, die ihm riet, persönlicher und direkter zu schreiben, und nun David Remnick, der so präsent und kraftvoll ist, der das Blatt um Podcasts, Blogs, den ganzen täglichen Digitaljournalismus erweitert hat; und sie alle, all die Chefredakteure, gaben Roger Angell Zeit und Raum für Recherchen und Texte: was ein Reporter halt braucht, selbst wenn dieser Reporter 95 Jahre alt ist.
Sein erster Text für das Blatt seines Lebens war kurz: über einen Flugzeugabsturz, er war zufälligerweise in der Nähe gewesen. Angell wurde danach nicht sofort eingestellt, was er als Frechheit vom »New Yorker« empfand, weshalb er zum Magazin »Holiday« ging und sich Bekanntheit erschrieb; und nach zehn Jahren rief der »New Yorker« an, und Roger Angells eigentliches Leben begann. Jenes mit Inhalt und Sinn.
Ein zweites gab es auch noch, das als Fan der New York Yankees; eher als Liebhaber, das Wort klingt feiner als »Fan«. Und weil Angell ja persönlich schreiben sollte, mit Leidenschaft und Gefühl, schrieb er wunderzarte Baseball-Geschichten, zuletzt über den irren Selbstzerstörer Alex Rodriguez, über den niemals hibbeligen Mariano Rivera, über den Manager Joe Torre vor allem, den Roger Angell verehrte, »weil er niemals die eigenen Spieler bloßstellte. Joe war ein Redner, ein Erzähler. Ich habe in meinem Reporterleben vor allem die Redner und Erzähler gesammelt, weil diese dein Notizbuch füllen.« Als Baseball-Autor wurde Angell dann berühmt.
Als es den letzten Streik gab, die Spieler wollten mehr Geld, die Besitzer der Clubs hielten dagegen, verfasste Angell eine Geschichte über Väter und Söhne: Die Väter liebten das Spiel so sehr und konnten es doch nicht spielen; die Söhne hingegen hatten die jungen Frauen, den Ruhm, und elegant, kraftvoll, jugendlich droschen sie den Ball aus dem Stadion. Es war eine Erzählung des Neids: Die Söhne, das waren natürlich die Baseball-Profis, und die Väter, das waren die Clubbesitzer. In Wahrheit ging es, auch da, um Vergänglichkeit, um Jugend und Altwerden.
Der alte Mann sagt, er sei nie ein schneller Schreiber gewesen. Immer nur ein Projekt, eine Recherche, ein Text zur selben Zeit, und dann die zweite, die dritte Fassung, Wort für Wort und Satz für Satz. Linear, so nennt er diese Arbeitsweise, die durchaus dem Wesen des Baseballs entsprach. »Beim Baseball vergeht viel Zeit, und es passiert immer nur eine Sache, der Wurf, der Schlag, strike oder hit, vielleicht fünf Sekunden Action, dann vergeht wieder Zeit. Beim Eishockey passiert sehr viel mehr im selben Moment, aber der Fehler wäre, deshalb zu denken, dass Baseball schlicht und simpel wäre. Oder das Schreiben.«
Es gab Wendepunkte im Leben des alten Mannes, entscheidende Momente.
Irgendwann, als Schüler, beschloss Roger, den Nachmittagsunterricht auszulassen und ins Kino zu gehen. Eine Erleuchtung. Und von da an täglich: nachmittags blau machen und ab ins Kino, am liebsten gleich zwei Filme. Gebeichtet hat er es nie jemandem, und gelernt hat er auf diese Weise, wie man Geschichten erzählt.
1942 schloss er das College ab, wurde sofort eingezogen, war im Pazifik, aber nicht in Gefahr.
Dann die erste Ehe, zu schnell, zu früh, eine junge Frau in der Redaktion des »New Yorker«, Evelyn. Eine mutige Frau, trotz des Diabetes war sie die Chefin der jungen Familie, knappe 20 Jahre lang. Zwei Kinder. Und schließlich die Scheidung.
Der Suizid der älteren Tochter, viel später, ohne Erklärung, ohne Ankündigung.
Die zweite Ehe. Es ist das Privileg der Hundert- oder Nahezu-Hundertjährigen, dass einer 20-jährigen Ehe noch eine 48-jährige Ehe folgen kann; mit Carol, Frau seines Lebens, beim »New Yorker« kennengelernt, erkannt, gehalten. »Wir waren großartig zusammen. Carol war zugleich sehr bescheiden und durch und durch selbstbewusst«, sagt er. Carol war Opernliebhaberin, weshalb Roger fürchtete, sie würde ihn für Pavarotti verlassen … ach, Carol fehlt ihm bis heute.
Trotz Peggy. Peggy bringt den Tee herein, Peggy ist die dritte Ehefrau und Roger auf keinen Fall unterlegen. Eine Englischlehrerin, die auch noch ein Kunstmagazin redigiert und vollschreibt. Getroffen haben sich die beiden schon vor vielen Jahren erstmals, da waren sie aber beide verheiratet. Dann starb Peggys Ehemann Harvey. Dann starb Carol. Roger schrieb eine Postkarte an Peggy. Peggy brachte Roger ein gebackenes Huhn. Seit zwei Jahren sind sie in diesem Januar 2016 unserer ersten Begegnung nun verheiratet, sie lächeln, natürlich war diese späte Hochzeit richtig, sagen sie, jeder einzelne Tag ist nun schöner als er es wäre, wären sie allein.
Dürfen wir fragen, wie alt Sie sind, Peggy?
Peggy: »67.«
Roger: »Was?«
Peggy: »Ich hab vergessen, dir das zu sagen.«
Das Gekicher der Liebenden.
Ach, ein Leben voller Wegmarken, so viele Entscheidungen, es gab in Wahrheit ja Hunderte dieser Augenblicke, in denen auch eine ganz andere Richtung möglich gewesen wäre.
Nur einen Karriereplan gab es nicht, die Karriere passierte einfach, der alte Mann hatte, als er jung war, diese Sehnsucht nach dem »New Yorker«, und als er endlich dort angekommen war, tat er das, was er gern tat.
Wichtige Menschen aber, die gab es. Die Mutter, den Vater, den Stiefvater.