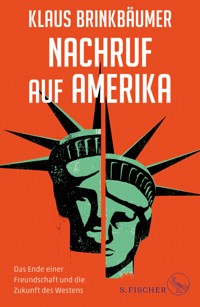
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die USA sind uns fremd geworden. Zwar waren sie immer schon ein Land der Widersprüche, doch mit Donald Trumps Präsidentschaft wurde klar: Fundamentales verschiebt sich, was gerade noch verlässlich schien, bricht entzwei. Auch nach Donald Trump wird es nicht wieder so werden wie zuvor. Warum das so ist, zeigt uns Klaus Brinkbäumer in seinem großen Buch über Amerika. Als Chefredakteur und langjähriger USA-Korrespondent des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« kennt er das Land wie wenige andere. Er hat über die Jahre mit Barack Obama, Dick Cheney oder Hillary Clinton, mit George Clooney oder Bruce Springsteen, mit zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft gesprochen und mit Donald Trump ein etwas anstrengendes Telefongespräch geführt. In seiner so leidenschaftlichen wie analytischen Schilderung von Menschen, Orten, Stimmungen, Geschichte und Geschichten zeichnet er das faszinierende Porträt einer Nation, die für Jahrzehnte wegweisend für uns war und nun im Begriff ist, sich selbst zu verlieren. Das Ende dieser einst so verlässlichen Beziehung wird unsere Zukunft wesentlich bestimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Ähnliche
Klaus Brinkbäumer
Nachruf auf Amerika
Das Ende einer Freundschaft und die Zukunft des Westens
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine Eltern, Anne und Bernard Brinkbäumer, die mich zu Beginn in Santa Barbara und Jahrzehnte später in New York City besuchten und über die so ganz und gar nicht vereinigten Staaten nicht weniger staunten als ich.
Prolog
Und nun also war Donald Trump am Telefon, morgens um zehn, pünktlich.
»My friend«, sagt er zur Begrüßung, »here is the Donald«, und dann: »Es geht New York blendend. Wir haben einen glänzenden Polizeichef, einen glänzenden Bürgermeister, wir sind in glänzender Verfassung. Reicht dir das Zitat?« Trump hatte nicht viel Zeit, vielleicht musste er zum Friseur, vielleicht Geld zählen, aber ich sagte: »Nein, noch nicht.« Es war im Herbst 2008, ich recherchierte für eine Reportage über New York und die Folgen der Wirtschaftskrise und wollte Trump in der Leitung halten und fragte ihn, woher die Kraft dieser Stadt komme.
Er schnaubte, sagte: »Warte einen Moment«, ging kurz weg.
Ich wartete, blickte aus dem Fenster auf das East Village hinab, er kam zurück und sagte: »This is the Donald. Dies ist die Comeback-Stadt. Jeder Mensch, der denken kann, jeder, der einen Willen hat, will hier leben. Diese Stadt kommt immer zurück, mein Freund, so wie dieses Land immer zurückkommen wird. This is America, my friend, the greatest country on earth, glaubst du, wir sind Schwächlinge, Feiglinge, glaubst du, wir geben in einer kleinen Krise einfach auf? Sorry, ich habe einen Termin, reicht dir das jetzt? Amerika ist großartig, aber es kann noch viel großartiger werden. Wenn du mehr brauchst, deutscher Reporter, lies meine Bücher, sie sind phantastisch.«
Und weg war er.
I.Der atlantische Graben
Wenn Deutsche über ihr Verhältnis zu den USA schreiben oder diskutieren, wird es schnell emotional: Glaubensfragen eben. Es gibt Verklärung und Dämonisierung, Amerikaromantik und Antiamerikanismus. Die USA haben Deutschland besiegt und befreit, sie waren Freund und doch ganz schön besserwisserisch, natürlich hatten sie Ideale, aber sie waren immer auch brutal im Durchsetzen eigener Interessen. Aus ebendiesen Gründen ist es möglich und gesund, eine zugleich sympathiegetragene und eigenständige Haltung einzunehmen. Ich halte eine solche Haltung sogar für zwingend: Wir müssen uns emanzipieren, da die Welt komplizierter geworden ist und die USA kein verlässlicher Partner mehr sind (und auch nach Trump nicht wieder zu einem werden dürften); die Zeiten, in denen wir auf die USA bauen und den USA alle großen, vor allem alle schmutzigen Aufgaben überlassen konnten, sind vorbei.
Wir sollten uns gleichwohl noch immer gestatten zu mögen, was mögenswert ist, diese amerikanische Phantasie und Vielfalt, all die Musik, die Literatur oder die Stadt aller Städte, New York City; und natürlich dürfen wir die USA trotzdem kritisieren, müssen es sogar. Emanzipation bedeutet nicht Verdammung des einstigen Partners. Wir brauchen den veränderten Partner USA weiterhin. Europa darf die Verbindungen nicht von sich aus abreißen lassen, sollte sogar neue aufbauen, zu Städten, Gouverneuren, Firmen, Verlagen, Universitäten, Schulen.
Europa muss nur wissen: So wie es war, wird es nicht wieder werden. Aber das ist kein Grund, beleidigt zu sein. Es ist die neue Wirklichkeit, die sich durch uns gestalten lässt.
Um den Westen also, um die transatlantischen Beziehungen, um uns und unseren fremd gewordenen Freund USA, soll es in diesem Buch zuerst und zuletzt gehen. Um unser Bild von Amerika, unser Verständnis der USA soll es zwischendurch gehen (und um Missverständnissen gleich zu Beginn vorzubeugen: Im folgenden Text wird das Wort »Amerika« mitunter als Synonym für die USA eingesetzt werden, weil dies in den USA so gelernt und üblich ist – auch wenn mir bewusst ist, dass sowohl »Amerika« als auch »Nordamerika« im geographischen Sinne mehr umfassen als die USA). Um New York City, die Heimat des Präsidenten Donald Trump, wird es gehen, danach um das ganze große, weite Land USA und vor allem dessen Inneres, zu Beginn und am Ende um den transatlantischen Bruch und dessen Folgen. Weite Bögen sollen geschlagen werden, doch ganz klein möchte ich beginnen, mit einer Frage, die den Alltag betrifft: Was unterscheidet die und uns, was das Leben in den USA vom deutschen? Was ist dort anders als hier, und was haben die Amerikaner von uns und wir von ihnen übernommen?
Kleinigkeiten:
Wie überflüssig die halbe Stunde Werbung im deutschen Kino ist, wie unlogisch, wenn man doch gerade erst zehn Euro für den Film bezahlt hat.
Wie wunderbar die Bionade im deutschen Kino schmeckt. Oder das Beck’s.
Und wie verblüffend sich Sprache verhält, wenn sie einen Ozean überquert. Wenn sie hier geboren und dort erwachsen wird oder auch umgekehrt. Oder wenn wir hier hören, was dort gesagt wird.
Umlaute zum Beispiel.
Umlaute gelten in den Vereinigten Staaten als enorm europäisch, darum als exotisch und cool. Die Speiseeis-Firma Häagen-Dazs wurde von einem amerikanischen Ehepaar erfunden und deshalb Häagen-Dazs genannt, weil das »äa« skandinavisch lässig klang; so begann die Erfolgsgeschichte. Diverse Rockbands der siebziger und achtziger Jahre benutzten Umlaute: Blue Öyster Cult, Mötley Crüe, Motörhead. Es funktionierte immer. Umlaute lassen manche Amerikaner (oder ihre Computersysteme) aber natürlich auch verzweifeln. Auf Adressaufklebern steht mein Name auf wunderschönste Arten: Klaus Brinkb Mer. Oder, ständig: Brinbau Mr.
Und munter wird eingemeindet. »Shvitz« sagt man im russischen Bad in der 10. Straße in New York. Es dampft und blubbert und zischt dort, man geißelt sich schwitzend selbst mit Zweigen, und hinterher jubiliert man: »great shvitz«. Wenn dort übrigens die Begleiterin bezahlt, ist der breitschultrige Russe hinter dem Tresen schwer irritiert und zeigt auf den Mann neben der Begleiterin und sagt: »He doesn’t speak any English, right?«
Das Wort »Dollar« ist von »Taler« abgeleitet.
»Schmaltz« kommt natürlich auch aus dem Deutschen. »A schmaltzy marriage proposal.« Und andersherum: Deutsche Menschen »messengern« seit Jahren schon. Deutsch und Englisch gehen ja prima zusammen.
Da ist nämlich, dort wie hier, das primitive Element. Auf der Straße in New York: »Well, man, I was, like, fuck, man.« In Berlin klingt das ähnlich.
Da sind aber auch Unterschiede, da ist die amerikanische Entschlossenheit. »Buckle-up-enforcement unit« steht auf einem Polizeiwagen in Miami. Deutschland ist weniger scharf, eine Anschnalldurchsetzungseingreiftruppe wurde glücklicherweise noch nicht erfunden. Wir haben auch weniger schöne Abkürzungen als unsere amerikanischen Freunde.
Und da ist noch etwas: der reine Klang des amerikanischen Englisch, dem Deutschen himmelweit überlegen.
Hohe Absätze? »Punishing heels.« Barbara Bloom, Fotografin, sagte: »A drink before, and a cigarette after are the three best things in life.« Purer Sex eben. Das schwingt und klingt leider nur in einer jener beiden Sprachen, um die es hier geht.
Im Flughafenbus belausche ich zwei Teenager. »Do you know a German word?« »Yeah: Hallo.« »Means what?« »Hallo means Hi.« »One more German word?« »Juice.« »Juice?« »Yeah, juice. The Germans say that whenever they have got something and walk away with it.« Ich überlegte eine Weile. Sie können nur »Tschüs« gemeint haben, nicht wahr?
Die Deklination deutscher Substantive fällt den Amerikanern schwer. Mark Twain hat sich darüber in seinem Essay The Awful German Language beschwert: »Every noun has a gender, and there is no sense or system in the distribution; so the gender of each must be learned separately and by heart. There is no other way. To do this one has to have a memory like a memorandum-book.« Begriffe wie »Stadtverordnetenversammlungen«, so Twain, seien »keine Wörter, sondern alphabetische Prozessionen«.
Und das deutsche Lautsystem verfügt über 17 sogenannte Monophthonge (einfache Vokallaute) und 21 sogenannte Konsonantenphoneme. Im zu sprechenden Wort werden Vokale überwiegend mit etwas, das unter Sprachwissenschaftlern »Glottalverschluss« genannt wird, neu angesetzt; der Glottalverschluss heißt manchmal auch »harter Stimmeinsatz« bzw. »harter Vokaleinsatz«. »Sch«, »ch«, »chr«, nein, kein Amerikaner mag diese Klänge. Welcher Deutsche wiederum kann schon New Orleans, Los Angeles, Chicago richtig aussprechen?
Noch einmal zurück zu den Anglizismen: Einmal im Jahr kürt der Verein Deutsche Sprache den Sprachpanscher des Jahres. 2011 gewann René Obermann den Preis, da fast sämtliche Tarife der Deutschen Telekom englische Namen hatten: Weekend Flats, Entertain Comfort, Call&Surf Comfort, Call&Surf Mobile Friends, CombiCard Teens, Extreme Playgrounds …
Aber was hilft’s, dieser Kampf ist verloren, Anglizismen sind überall: E-Mail, Computer, Laptop, Shoppen, Bodyguard, Sound, Trend, Highlight, Recycling, Surfen, Party, Meeting, Googeln, Lifestyle, easy, Talkshow, cool, Flyer, Bowling, Airlines, Feedback, Casting, Manager, Event, Fitness, Workaholic, Team, Relaxen, Rating, Portfolio, One-Night-Stand, Holding, Marketing, online – alles Deutsch. Leider auch: Das macht keinen Sinn (that doesn’t make sense), nicht wirklich (not really), Liebe machen (to make love). Dem Sprachforscher Jannis Androutsopoulos ist aufgefallen, dass sich die deutsche Sprache besonders für die amerikanisierte Slangbildung eigne: Entlehnte englische Verben würden grammatikalisch angepasst, damit sie in die deutsche Syntax passten. Aus flipped out wird ausgeflippt, aus chill out abchillen, aus hang out abhängen.
Und sogar Schein- und Pseudoanglizismen haben sich durchgesetzt: Handy (mobile phone), Mobbing (bullying), Body Bag (wäre im Amerikanischen ein Leichensack) und Wellness (Amalgam aus wellbeing und fitness) tun zwar so, als seien sie Englisch, sind aber Deutsch, und kein gutes.
Die Amerikaner übrigens haben uns natürlich auch schöne Wörter geklaut. Realpolitik, Hintergrund, Poltergeist, Schadenfreude, Kindergarden, Zeitgeist, Angst, Wanderlust, kaputt, Meister, Doppelgänger, Bildungsroman, Gemütlichkeit, Kitsch, Leitmotif, Rucksack, Delikatessen, Blitz, Weltanschauung, Wunderkind, Sauerkraut, Schnitzel. Alles reines Amerikanisch.
Deutsche sind direkt und Amerikaner freundlich. »Don’t you think, it might be a good idea if you cleaned up in here?«, sagt in Deutschland kein Mensch. Stattdessen: »Räum’ auf.« Auch »nice to see you«, »nice talking to you«, »see you later«, all diese scheinzarte Höflichkeit, gibt’s nur jenseits des Atlantiks. Dort nämlich simuliert man Anteilnahme und hier nicht, dort ist Smalltalk eine Kunst und hier Quälerei, und diese Unterschiede zwischen der deutschen Direktheit und der amerikanischen Freundlichkeit müssen geradezu zu Missverständnissen führen.
Und wenn man einander schon nicht versteht, dann kommt es zu Filmtiteln wie »Tödliches Kommando« (»The Hurt Locker«), »Zwei glorreiche Halunken« (»The Good, The Bad and The Ugly«), »Schwanger! Na und?« (»Juno«) oder »Durchgeknallt« (»Girl Interrupted«).
Es gibt in den USA die Steuben-Parade, benannt nach einem deutschstämmigen General. Jahr für Jahr feiern Amerikaner, die deutsche Vorfahren haben, in den Straßen New Yorks mit deutschen Touristen. Grönemeyer kommt, Kohl war einst auch da. Marschmusik. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wickede spielt auf der 5th Avenue »Hoch auf dem gelben Wagen«. Lederhosen. Mercedes-Cabrios. Dudelsäcke, auch Henry Kissinger ist Stammgast, er liebt seine einstige Heimat Fürth ja immer noch.
General Friedrich von Steuben übrigens gilt heute als deutschamerikanischer Held, weil er die zusammengewürfelten Truppen der amerikanischen Kolonien in eine richtige Armee verwandelte. So etwas gab es in der amerikanischen Geschichte mehrfach: deutsche Disziplin für das amerikanische Militär. Dwight D. Eisenhower, Nachfahre des 1741 nach Pennsylvania emigrierten Rheinländers Hans Nicholas Eisenhauer, ließ die Normandie erstürmen. General George Custer, seine Vorfahren hießen noch Küster, besiegte viele, viele Indianer, General John J. Pershing, einst Pförschin, war Oberbefehlshaber der US-Truppen im Ersten Weltkrieg. Und General Norman Schwarzkopf gewann 1991 den Zweiten Golfkrieg, ließ Saddam Hussein allerdings im Amt, so dass es zwölf Jahre später einen erneuten Golfkrieg gab, was wiederum eine ganz andere deutsch-amerikanische Geschichte ist.
25 Prozent aller Amerikaner haben deutsche Vorfahren. Der Autor David Sedaris hat festgestellt, dass die Deutschen »am glücklichsten sind, wenn sie keine Unterhose anhaben«. Lieber als jedes andere Volk der Welt lägen sie nackt am Strand herum, das behauptet Sedaris zu wissen.
Was die Amerikaner nicht hinkriegen: Erdnussflips.
Was Deutsche nicht hinkriegen: diese sich gleichsam organisch um das Gefäß fügende und damit sich selbst verschließende Klarsichtfolie.
Was Amerikaner niemals schaffen werden: Handwerk, wie wir es kennen. Der deutsche Glaser, nach 20 Jahren bei Schüco nun in New York, erzählt, er habe die Qualität dort um 40 Prozent heruntergefahren, aber alle in New York seien glücklich damit. »Made in Germany, wow, I can feel it«, sagen sie ihm, und er nicke dann wissend.
»Vergiss, woran du dich in Deutschland gewöhnt hast«, das sagt mir mein Freund Bernd gleich zu Beginn meiner New Yorker Jahre: »Wenn du einen Klempner anrufst, kann es halt sein, dass der seinen Beruf in einem Telefonkurs gelernt hat, für 19,90 Dollar. Letzte Woche war er noch Bäcker.« Trotzdem sind die Deutschen nicht besonders stolz und die Amerikaner umso mehr. Amerikaner halten sich bis zum Beweis des Gegenteils und bisweilen auch länger für revolutionär und für die Ersten, egal worin; anders können sie sich die Welt nicht vorstellen.
Auf der 9. Avenue, zwischen der 16. und der 23. Straße in New York, haben sie einen neuen Radweg angelegt, »die Straße der Zukunft«, so feiert sich die Stadt. Das Futuristische soll darin liegen, dass zwischen Radweg und Straße die parkenden Autos stehen, dass also der Parkstreifen die Radfahrer schützt. Ich berichte meinen Freunden, dass die Marktallee in Hiltrup bei Münster schon vor 40 Jahren so gestaltet war, doch meine Freunde halten mich für einen elenden Lügner.
Und was noch?
Amerikaner heiraten anders. Der Begriff »Bridezilla« wurde in den USA erfunden, und das dürfte kein Zufall sein: Kompliziertere Bräute als die amerikanischen kann es kaum geben. Rebecca Mead stellt in ihrem Buch »One Perfect Day« die Frage: Was sagt nun aber die amerikanische Hochzeit über Amerika selbst?
Amerikanische Hochzeiten geraten oft außer Kontrolle – der Sinn für Proportionen scheint zu fehlen, alles ins Extreme zu verrutschen. Wo ist die Liebe geblieben, wo die Romantik, wo das letzte bisschen Stille? Geblieben sind Druck, Zwang, Stress.
Sozialhistoriker datieren die Geburt der heutigen amerikanischen Hochzeitsindustrie auf die zwanziger Jahre. Juweliere, Damenschneidereien und Gastronomen verdienen, denn Bräute und Bräutigame nehmen Kredite auf, um die Hochzeit finanzieren zu können. 2200000 Paare lassen sich jährlich in den USA trauen, 72 Milliarden Dollar werden jährlich in diese Hochzeiten investiert. Es gelten strenge Regeln für Dating, Kleidung, den ersten Kuss, die Hochzeitsnacht, die Reise. Das Wichtigste: Der Verlobungsring muss mindestens drei Monatsgehälter des Gatten kosten, ansonsten taugt der Gatte nichts (dazu später noch mehr).
Nichts von alldem können Deutsche nachvollziehen, aber der Deutsche muss ja auch nicht alles verstehen.
Die neuen USA allerdings, all die Veränderungen, sollten wir verstehen.
»Was unsere amerikanischen Freunde erwarten: ein Wunder! – sie wollen gefürchtet werden und geliebt zugleich. Wenn uns das nicht gelingt, so empfinden sie es als Anti-Amerikanismus«, das schrieb der Schweizer Max Frisch. Und an anderer Stelle: »Amerika (USA) ist im Grunde nicht kriegerisch, sondern lediglich kommerziell; Krieg als die Fortsetzung des Geschäftes mit anderen Mitteln.«
»Let your doubt be your calling«, schreibt Denis Johnson in »Tree of Smoke«, lass dich von deinen Zweifeln leiten. Das wäre für uns Europäer eine erwachsene Position, eben gerade weil die derzeitige US-Regierung mit Zweifeln – den eigenen und denen anderer – so unreif umgeht: durch diese dröhnende Demonstration von Stärke, durch permanente Überkompensation. »Das Amerikanische war attraktiv, faszinierend, aber die Amerikaner waren am Ende doch nur die nächste Horde Puppenspieler.« So schrieb der Amerikaner Denis Johnson.
Wie also wollen wir künftig miteinander umgehen? Was ist zu tun?
Allzu oft kommt so etwas nicht mehr vor, aber im Winter 2018 erschüttert ein Buch die westliche Welt, verfasst von Michael Wolff: »Fire and Fury«, Feuer und Zorn. Wolff ist ein Reporter, der eher nach Hollywood als nach Washington D.C. passt, er liebt Stars, er liebt Klatsch, aber nun hat er ein Jahr im Weißen Haus verbracht, meist auf einem Sofa im West Wing oder auch »wie eine Fliege an der Wand«, wie er es sagt, und dieser Michael Wolff hat nun also die Regierung Trump beschrieben.
Ist Wolff seriös? Na ja. Er verwechselt Namen, verpasst mitunter politisch Bedeutendes, zitiert aus Hintergrundgesprächen, macht so Gerüchte zu Tatsachen. Und dennoch hat er ein großes Buch geschrieben, man kann es den Tatsachenroman unserer Zeit nennen: Denn »Fire and Fury« überführt die Regierung Trump. Es beschreibt einen Präsidenten, der im Bett Cheeseburger isst, fernsieht, jammert, dass niemand ihn liebe; der nichts lese und verstehe; der niemals habe gewinnen wollen und es dann, nach dem Sieg, vollkommen angemessen finde, Präsident zu sein, auch wenn ihn dafür nichts qualifiziere. Es beschreibt ein Weißes Haus, in dem alle Helfer diesen Präsidenten verachten und nur versuchen, den Schaden zu minimieren – und jene 60 Sekunden zu erwischen, in welchen der Präsident zuhört, ehe er wegdämmert. Es beschreibt diese schreckliche Familie Trump, die Söhne Eric und Donald Jr., die Tochter Ivanka und den Schwiegersohn Jared Kushner, die sich anmaßt, die USA zu regieren und die Welt zu gestalten, ohne Legitimation, ohne Kenntnisse. Nepotismus. Ein höfisches, monarchisches Gebaren.
Der Stratege hinter dieser absurden Präsidentschaft sei Stephen Bannon, der eine Faschisierung der amerikanischen Politik anstrebe und Trump für einen »großherzigen warmen Affen« halte. Bannon war auch die wesentliche Quelle des Reporters Wolff, unter anderem erklärt Bannon das Töchterchen Ivanka für »dumm wie ein Backstein«; und Wolffs Werk übersteht dieser Bannon am Ende dann nicht: Seine Gönner lassen ihn fallen, im Januar 2018 muss er als Chefredakteur der rechtsextremen Plattform Breitbart News zurücktreten.
Donald Trump wiederum antwortet auf »Fire and Fury« auf seine Art. »I’m, like, really smart«, twittert er und erklärt sich zum »sehr stabilen Genie«. Manchmal ist erst das Dementi die Bestätigung des Behaupteten. »Donald Trump steht nicht für eine Regierung, sondern für eine Seifenoper«, schreibt der »Zeit«-Herausgeber Josef Joffe, Kenner Amerikas.
Und das alles sollte uns deshalb interessieren, weil der atlantische Graben, anders lässt es sich nicht sagen, eines der großen Themen unserer Zeit ist. Zu Beginn also eine kleine Rundreise:
Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer wiederholt Wörter gern, die ihm wichtig sind. Eines seiner Wörter des Jahres 2017 ist »Westbindung«.
Als wir in Hamburg über die deutsch-amerikanischen Beziehungen sprachen, sagte Fischer: »Konrad Adenauer traf 1949 eine wahrhaft historische Entscheidung. Adenauer hatte nach dem verlorenen Krieg und der Teilung verstanden, dass neue Katastrophen nur durch die Westbindung Deutschlands zu verhindern sein würden.« In der »Zeit« sagte Fischer wenig später: »Deutschland musste raus aus dieser Rolle des schwankenden Halmes zwischen Ost und West. Dafür war er sogar bereit, die deutsche Einheit zurückzustellen. Und wenn wir das aufgeben, müssten wir unserer Sinne beraubt sein.«
Fischer möchte verhindern, dass das deutsche Leiden an Donald Trump die Bindung an die USA schwächen und damit eine Sehnsucht nach Russland stärken könne. Das sei gefährlich, findet er, Russland sei keine verlässliche Alternative.
Wir trafen uns hinter der Bühne des Hamburger Thalia-Theaters, Fischer saß vor einem Glas Wasser und beschrieb die Rückkehr des Nationalismus in vielen, allzu vielen Staaten: »Die Identitätspolitik ist zurück, doch die Demokraten schweigen dazu.« Darum sei längst auch der Rassismus wieder da: »Wir erleben in diesen Jahren das Verschwinden der Dominanz des Westens. Und das Ende der Herrschaft des weißen Mannes. Aus diesen Veränderungen gehen Unsicherheiten hervor, Unklarheiten. Und damit arbeiten Demagogen, so etwas wird ja immer an den schwächsten Stellen eingesetzt, also bei der unteren Mittelklasse. So entstehen Identitätsfragen, so entsteht der Nationalismus dieser Tage.«
Über die neue Lage Deutschlands sagte Fischer in seinem Gespräch mit der »Zeit«: »Ich habe das Gefühl des Verratenseins nicht, ich sehe da einfach das Ende der Pax Americana, die nach 1945 globale Wirkung hatte. Wir waren daran gewöhnt, und nun müssen wir uns umstellen. Die USA werden mit Abstand die größte wirtschaftliche und militärische Macht bleiben, auch wegen ihrer soft power. Aber sie haben nicht mehr die Bereitschaft und die Fähigkeit, im 21. Jahrhundert eine globale Ordnung durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Eine Weltmacht kann nicht einfach aufs Altenteil gehen, weil sie dann ein Vakuum kreiert. Schon was sich jetzt im Nahen Osten abspielt, gibt einen Vorgeschmack … Das internationale Staatensystem mit seinen Konkurrenzen wird weiterexistieren, aber wir sind an einen Wendepunkt gekommen, wo die großen Mächte sich fragen müssen, ob die alten Strukturen überhaupt noch Lösungsmöglichkeiten bieten.«
Dreimal konnte ich Ende 2017 mit dem seinerzeit geschäftsführenden Außenminister Sigmar Gabriel über die transatlantischen Beziehungen reden; wir arbeiteten uns immer weiter vor. Das erste Gespräch war telefonisch, ein Freitagmittag im November, Gabriel hatte eine halbe Stunde Zeit. »Diese Beziehungen verändern sich dramatisch«, das war sein erster Satz nach der Begrüßung, »und diese Veränderungen werden wiederum dramatische Veränderungen in Deutschland nach sich ziehen.«
Wir sprachen zunächst über Trump. Der sei, so Gabriel, »das Ergebnis einer sich über Jahre hinziehenden Entwicklung, hoffentlich ist er die Endphase, die Spitze, der Höhepunkt dieser Entwicklung, aber das weiß man noch nicht. Er symbolisiert den Sieg der Antimoderne im Land der Moderne.«
Für Gabriel besteht die wesentliche Ursache des Phänomens Trump weniger im amerikanischen Rassismus, sondern in der Chancenlosigkeit der vielen. »Ein Aufstieg durch Bildung ist für viele schlicht ausgeschlossen; wer heute Pakete ausfährt, weiß, dass er das auch in 30 Jahren noch tun wird. Diese Gefährdung des eigenen bescheidenen Wohlstands verbinden viele Trump-Wähler mit einer liberalen, postmodernen Oberschicht, die die Leute wahnsinnig wütend macht«, sagt Gabriel, der die Trump-Wahl darum eine »Can-you-hear-me-now-Wahl« nennt.
Wenn das stimmt, dann rufen nun also jene, die den Glauben an den amerikanischen Traum aufgegeben haben, ihr »can you hear me now?« aus reinem Protest in die Welt hinein, da sie, wenn nicht einmal mehr an ihren Traum, dann an überhaupt nichts mehr glauben können. Dann ist da nur noch Verachtung für die politische Klasse, die Medien, die Wissenschaftler, die sogenannten Eliten. Ist es so?
»Ja, das ist zumindest ein Teil der Erklärung. Das Gefühl nicht weniger, dass ‹die da oben› das Leben der normalen Menschen nicht mehr kennen, gibt es ja auch bei uns. Und sie haben ja durchaus Grund dazu. Wenn Krankenhäuser, Schulen und Apotheken in ländlichen Räumen verschwinden und sogar die Bushaltestelle noch geschlossen wird, fühlen sich Menschen zu Recht vergessen. Oder wenn Familien sich keine normale Wohnung mehr in der Großstadt leisten können und in der Nachbarschaft aus Multikulti längst eine Parallelgesellschaft geworden ist, in der die normalen Rechtsstandards nicht mehr gelten, dann entsteht daraus der Eindruck von Kontrollverlust und der Gleichgültigkeit der liberalen Eliten demgegenüber. Denn die wohnen und leben in anderen gesellschaftlichen Umständen«, sagt Gabriel.
Und die Konsequenzen?
»Der amerikanische Ausstieg aus der liberalen Ordnung, welche die USA selbst geschaffen haben, ist gefährlich. Trump betrachtet die internationale Arena als ebendies: eine Kampfbahn. Der Stärkere siegt. Jeder kämpft für sich.
Auf einmal sind die Chinesen die einzige Nation, die eine weltpolitische Strategie haben. Wir in Europa bräuchten eine USA-Politik, zum ersten Mal, aber wir haben keine. Wir haben uns auf etwas verlassen, von dem wir gedacht haben, das halte ewig.«
Wird aber Amerika, der Partner Amerika, ersetzbar sein?
»Nein. Wir müssen uns auf die Zeit nach Trump vorbereiten, aber auch diese Zeit wird kühler werden, wir werden selbständiger sein müssen. Uns Deutschen und Europäern fehlt aber die Machtprojektion der USA. Dort, wo die USA sich schon unter Obama zurückgezogen haben, zum Beispiel im Nahen Osten, haben sich die Länder nicht uns zugewandt, sondern Russland. Dort gibt es eine Machtprojektion. Europa wird also lernen müssen, sich nach außen aufzustellen. In der Vergangenheit haben wir die Einmischung in die Welt den Briten, Franzosen und den USA überlassen. Und wenn es schiefgegangen ist wie in Vietnam, Chile oder im Irak, hatten wir immerhin jemanden, auf den wir mit dem Finger zeigen konnten. So einfach werden wir es nicht mehr haben. Die Welt wird unbequemer. Und Europa wird sich einmischen müssen. Es ist an der Zeit, dass wir Europäer gemeinschaftlich auftreten, dass wir nicht nur so tun, als ob, sondern wirklich und endlich eine europäische Außenpolitik entwickeln«, so Gabriel.
Mehr Zeit hat er heute nicht, wir verabreden uns: demnächst.
Geht es konkreter: Welche Möglichkeiten haben wir?
Ich rufe Elisabeth Wehling an, eine norddeutsche Kommunikationswissenschaftlerin in Berkeley. »Wenn man mit jemandem zu tun hat, der die ganze Welt selbstbezogen wahrnimmt und der meint, dass Diplomatie nicht helfe, sondern schade, dann darf man sich darauf nicht einlassen«, sagt sie, »dann sollte man keine Konfrontation und kein Ringen innerhalb ebenjener Weltsicht eingehen. Wichtig ist, bei sich selbst zu bleiben und zu propagieren, was bedeutend ist, also die eigenen Vorstellungen greifbar zu machen. Man kann als progressiver Mensch nur gewinnen, wenn man auch progressiv lebt.«
Bedeutet das nicht, dass die liberale Demokratie alles geschehen lassen muss, was gegen die Spielregeln verstößt, und damit letztlich wehrlos gegen Trumps Wucht und Dreistigkeit ist?
Wehling zögert nicht, sie lacht. »Nein, wenn Sie die progressive, die fürsorgliche Weltsicht ernst meinen, dann greifen Sie natürlich in dem Moment ein, wenn Menschen oder Staaten zu Schaden kommen. Klare Kante zu zeigen ist immer das letzte Mittel der Diplomatie und natürlich legitim, natürlich auch gegen Trump.«
Elisabeth Wehling übrigens sieht etwas, das bisher öffentlich kaum wahrgenommen wurde: Parallelen zwischen Trump und Emmanuel Macron. »O ja«, sagt sie, »die beiden haben viel gemeinsam. Beide orientieren sich an einer Ideologie, gehen raus und brechen Konventionen, beide bringen das Boot zum Schaukeln. Der Unterschied liegt in der Ideologie selbst: Trump ist autoritär, Macron ist antiautoritär und streng progressiv.«
Falls wir übrigens den Demokratiegedanken ernst nähmen, mit diesem Gedanken fährt Elisabeth Wehling dann fort, »dann müssten wir auch Donald Trump ernst nehmen und ihm zugestehen, dass er eine eigene moralische Bewertung der Welt gefunden hat. Das ist schwer genug, da er für kernprogressive Menschen natürlich einen Affront und physischen Stress bedeutet, aber nur wer anerkennt, dass es diese seine Weltsicht gibt, kann die intellektuelle Auseinandersetzung bestreiten.«
Für ausgemacht hält Wehling noch nicht, was für die USA und damit für die Welt nach Trump kommen wird; ein Schwenk zurück ins fürsorglich Progressive sei ebenso denkbar wie eine weitere Steigerung ins ideologisch Strenge. »Wenn man erst so weit ist, dass alle Unwahrheiten durch die scheinbar hehre eigene Moral gerechtfertigt werden, weil ja alle anderen schlicht die falsche Weltsicht haben, dann gelten jedwedes eigene Verhalten und alle Steigerungen als ethisch gerechtfertigt.«
Im November 2017 dann ist Sigmar Gabriel in Hamburg, wir treffen uns im Literaturhaus an der Außenalster. Er isst Rinderbrühe, trinkt Tee, es ist unser zweites Gespräch über die und uns, die Amerikaner und die Deutschen.
»Die USA«, sagt er, »haben nach 1945 eingeführt, was wir die liberal order nennen, sie haben die Stärke des Rechts an die Stelle des Rechts des Stärkeren gesetzt. Oft genug haben sie selbst dagegen verstoßen, aber im Kern war dies die neue Weltordnung. So haben sie Europa mitgeschaffen und begleitet, weil sie wussten, dass diese Stabilität ihnen selbst nutzt. Was wir jetzt erleben, ist der Rückzug der Vereinigten Staaten aus der von ihnen selbst geschaffenen liberal order; das ist das Paradox unserer Zeit. Ausgerechnet das Land, das Deutschland (und andere)« – Gabriel spricht die Klammern mit – »vor dem Rückfall in die reaktionäre Vormoderne geschützt hat, erlebt nun eine reaktionäre Revolution, geht nun selbst den Sonderweg, vor dem es andere bewahren wollte.«
Ein Vakuum aber gebe es nicht in der Machtpolitik, das sieht Gabriel wie Joschka Fischer; »wenn jemand einen Raum verlässt, bleibt der nicht leer, er wird von den Russen, von China, von anderen gefüllt. All das ist nicht im amerikanischen Interesse, aber Trumps Regierung hofft, am Ende bei G2 zu landen, USA und China, um dann sogenannte Deals machen zu können. Was bedeutet das für uns? Wir müssen Europa zu einem weltpolitischen Akteur machen. Das ist für Europa ganz ungewohnt, weil Europa nach innen gegründet wurde und nicht nach außen – und weil Großbritannien und Frankreich bislang die außenpolitischen Aufgaben übernommen haben. Wir anderen, auch wir Deutschen, haben das nicht gelernt.«
Man spürte das, wenn man in jenem Winter mit Sigmar Gabriel diskutierte: Da hatte ein Politiker seine Aufgabe gefunden. »Trump bedeutet eine Radikalisierung und eine Beschleunigung, aber da passiert zugleich etwas ganz Normales: die Abkoppelung von einem Übervater. Wir erleben das Ende der von den Amerikanern dominierten Nachkriegsordnung«, sagte er, und er meinte das so epochal, wie es klang: Gabriel sah fundamentale Veränderungen, und mittendrin sah er ein Deutschland und ein Europa, die für diese Veränderungen nicht gerüstet waren. So sagte er es dann: »In einer Welt voller Unholde wird jemand, der keine Machtprojektion hat, nicht ernst genommen. Wir hatten gedacht, uns würden carrots genügen, aber wir brauchen auch sticks. Theodore Roosevelt hat einmal gesagt: Speak softly, but carry a big stick. Wir machen es eher umgekehrt.«
Die Peitsche neben dem Zuckerbrot, so sagt man’s im Deutschen. Und es ist ja richtig, die Gewichte verschieben sich. Ägypten wendet sich Russland zu, seit die Amerikaner sich aus Nahost verabschieden; in Syrien spielt Russland die alleinige Hauptrolle. »Keine Machtprojektion zu haben ist für die Deutschen eine ganz, ganz unangenehme Lage; da stehen uns enorme Auseinandersetzungen bevor, aber selbst wenn Europa es schafft, wird es ohne Amerika doch nicht gehen, wir werden die USA ja nicht ersetzen können«, so Gabriel.
Alles ganz schön unbequem, nicht wahr?
O ja. Er lachte. »Es ist schon deshalb blöd, weil wir es in der Vergangenheit immer den Amerikanern überlassen konnten, die Welt zu retten, und wenn es schiefging, hatten wir wenigstens einen, auf den wir schimpfen konnten. Jetzt schimpfen wir, weil sie gehen.«
Was Gabriel folgert, was er für den richtigen Weg in die Zukunft des Westens hält, ergibt sich kausal: »Parallel zur Stärkung der EU geht es darum, neue Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika aufzubauen.« Nie wieder werde es so werden, wie es war – »aber es muss auch nicht so bleiben wie unter Trump«, so Gabriel. Wie also kann es werden?
In Amerika, das erwartet Sigmar Gabriel, »ist der Moment nicht fern, von dem an eine Mehrheit der Bürger nicht mehr europäische Vorfahren haben wird, aber diese Mehrheit wird nicht zwingend das Trump-Amerika sein. Sie wird sich nach Asien oder Afrika ausrichten und die liberal order neu mit Leben füllen und von uns Europäern zu Recht erwarten, dass wir selbstbewusst unsere Aufgaben erfüllen.«
Wenn Gabriel an seine eigene amerikanische Prägung zurückdenkt, denkt er an die gewaltige Natur der Nationalparks, denn seine erste Reise führte ihn den highway number one hinab durch Kalifornien, dann ging es weiter durch Arizona. Er denkt an Musik, an die Rolling Stones vor allem, die, obwohl britisch, ihn doch mit Amerika verbanden. Er denkt an Coca-Cola. In der Schule machte er recht viel blau und wählte Sprachen ab, weshalb ihm amerikanische Literatur lange fremd blieb. Gabriel ist in Blickweite der Zonengrenze aufgewachsen, in Goslar, dort war er auch Soldat. Er sagt: »Ich habe immer verstanden, warum sich Menschen auf eine lebensgefährliche Reise begeben haben, um irgendwann die Freiheitsstatue zu sehen. Mich bewegte das zutiefst, Lady Liberty irgendwann selbst zu sehen.« Er nennt die USA seinen »Nordpol auf dem Kompass«.
Die Radikalisierung der Republikaner übrigens, ebenso die Abgehobenheit der Demokraten »sollten uns Deutschen und allen Demokraten ein warnendes Beispiel sein. Wer die Arbeiter im rust belt verliert, dem helfen die Hipster in Kalifornien auch nicht mehr. Wir haben eine Bewegung in der ganzen Welt, die sich gegen die Postmoderne und das anything goes der Eliten wendet. Ich habe in Deutschland das Gefühl, dass wir Sozialdemokraten zu grün und zu elitär geworden sind. Unsere Demokratie ist in Wahrheit ein Wohlstandsmodell, sie ist nicht wetterfest. Es gibt in unserer Gesellschaft wie in jeder anderen Gesellschaft Dämonen, und die dürfen wir nicht wecken. Wie gefährlich das alles ist, wie dünn der Firnis der liberalen Demokratie ist, all das sollte uns Donald Trump lehren.«
Und wenige Tage später kommt Wolfgang Ischinger zu Besuch. Ischinger ist eine der prägenden Figuren der deutschen Außenpolitik, er war Botschafter in Washington (2001 bis 2006) und London und übernahm 2008 die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz, die Jahr für Jahr, meist im Februar, all das schon ans Licht der Diskussionen zu holen versucht, was sich weltpolitisch im Dunkeln gerade erst anbahnt.
Über die Verbreiterung des transatlantischen Grabens, damit beginnt Ischinger, werde seit vielen Jahren geredet, schon aus demographischen Gründen: »Immer mehr Menschen in den USA sind hispanischer Herkunft, immer weniger haben den alten anglo-saxon background«; aber seit ebenso vielen Jahren halte die deutsch-amerikanische Verbindung trotzdem noch, »weil die wirtschaftlichen Pfeiler so robust sind. Die Verzahnung durch all die wechselseitigen Investitionen ist so enorm, dass 800000 bis eine Million Menschen wechselseitig in Lohn und Brot stehen.« Das sei Punkt eins.
Punkt zwei: Man müsse unterscheiden »zwischen sagen und entscheiden«. All die Tweets und das ganze Geschimpfe aus dem Weißen Haus seien fürchterlich, aber was wirklich Gesetz werde, das sei »halb so schlimm, durchaus mainstream Republican, damit fühlen sich große Teile der amerikanischen Gesellschaft gar nicht so unwohl, und damit sollten wir Europäer umgehen können«. Darauf habe zuerst der Politikwissenschaftler Ian Bremmer hingewiesen, und dessen Beobachtung stimme; und zugleich, so Ischinger, unterschätze Ian Bremmer doch die Lage.
Punkt drei nämlich: Bremmer und viele, viele andere verharmlosten das Ausmaß der bisherigen Zerstörungen. »Die USA«, so Wolfgang Ischinger, »haben an Respekt, Ansehen und Durchsetzungspower massiv verloren. Nehmen Sie allein die NATO-Frage: Sobald sie nur aufgeworfen wird, ist die NATO bereits geschwächt.« Jener Artikel 5 nämlich, der den Bündnisfall definiere, also die Verpflichtung, dem Partner im Ernstfall zu helfen, sei »natürlich eine Glaubensfrage: Er gilt dann und nur dann, wenn alle Partner daran glauben.« Dass Trump die NATO in Frage stelle, erzeuge diesen »immensen Schaden des lingering doubt«, des ständigen Zweifels, was »aus europäischer Sicht ein Riesenproblem darstellt«. Nicht alles aber, sagt Wolfgang Ischinger jetzt, sei Trumps Werk, denn schon Donald Rumsfeld habe von »old and new Europe« gesprochen, und auch Obama habe durch eine zögerliche Außenpolitik Zweifel entstehen lassen.
Das führt ihn zu seinem Punkt vier. »Briten und Franzosen gehen nun in sich und haben angesichts der Krise ein tragfähiges Bild ihrer selbst, und dieses Bild hängt nicht von Washington ab. Für uns Deutsche ist der Abschied von Amerika bedauerlicher, denn wir wollten unbedingt Teil des Westens sein, wir haben diesen langen Marsch nach Westen endlich tatsächlich hinter uns, und ausgerechnet jetzt ist das leuchtende Schloss am Ende des Waldes plötzlich weg. Für uns war der amerikanische Präsident eine Identifikationsfigur, das Symbol der Idee des Westens. Franzosen und Briten brauchen das nicht, wir aber haben einen echten Verlust erlitten, für uns bedeutet das eine Identifikationskrise.«
Was also jetzt? Die Nabelschnur durchschneiden? »Nein«, sagt Ischinger und fordert die politische Klasse, das Bürgertum, die Zivilgesellschaft zum Kampf um eine bedrohte Freundschaft auf: »Engage, engage, engage!« Es gebe ja reichlich Senatoren, Gouverneure, Konzerne, Medien, jede Menge Ansatzpunkte also. Es brauche allerdings, das sagt auch Ischinger, »eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Als relevant werden wir nur wahrgenommen, wenn wir mit einer Stimme sprechen. Zurzeit weiß noch jeder Amerikaner, dass er nur an irgendeiner Stelle Europas hineinstechen muss, und schon entweicht die Luft.« Apropos Luft: »Auch eine gesteigerte militärische Handlungsfähigkeit ist nötig, denn Außenpolitik ohne Unterfütterung durch militärische Stärke ist hohl und schwach.« Und in der EU brauche es das Ende des Vetos in der Außenpolitik: »Mehrheitsentscheidungen wären sinnvoll. Wenn 27 Staaten etwas wollen und einer will es nicht, sollte dieser eine es nicht blockieren können. Es wäre Gold wert, wenn Deutschland signalisieren würde, zu dieser Veränderung bereit zu sein.« Die unheilvollen Vorgänge in Washington jedenfalls würden gewiss weitergehen, wir sollten uns also wappnen, und darum müsse Europa seine Wachstumsschmerzen dringend überwinden.
Aus all diesen Gründen, so Wolfgang Ischinger, sei die Krise der Gegenwart eigentlich eine »ganz gute Gelegenheit, ein wake-up-call«.
Der New Yorker Autor Malcolm Gladwell spricht es aus: »Worüber haben wir eigentlich geredet, ehe wir über Trump geredet haben? Ich erinnere mich nicht.« Denn Trump ist das Thema der Welt in diesen Tagen. Als ich in Frankfurt den Schriftsteller Salman Rushdie treffe, kommt er von sich aus auf Trump: »Der ist gut im Zerstören, das ist das Einzige, was er kann.« Vor wenigen Jahren seien sie sich in der Metropolitan Opera begegnet, und von hinten habe Trump gerufen: »Du bist der Größte.« Da habe er, Rushdie, sich umgedreht und gesagt: »Nein, du bist der Größte.« Und Trump habe vor Glück gestrahlt.
»Ich hätte niemals mit dieser Konsequenz gerechnet«, das sagt in Berlin der SPD-Außenpolitiker Niels Annen, »dieser Konsequenz, mit der Donald Trump seine Wähler beglückt. Die ganze Welt rät ihm von einem Plan ab, stets ist der Plan offensichtlich falsch – Trump aber handelt doch, verantwortungslos und gefährlich, aber nicht irrational, denn er macht, was er seinen Wählern versprochen hat. Der Präsident zementiert die Spaltung der Gesellschaft, da er davon profitiert. Das ist ein ungekannter Radikalismus im Weißen Haus.«
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen beobachtet eine »Verletzung der Normen, die das Verhalten eines Präsidenten« definiere: so vulgär, so illoyal sei Trump. Schon die »stilistisch-kulturelle Wirkung« sei enorm, die politische aber auch: »Trump ist der Boss, und er zieht alles, was andere amerikanische Politiker sagen, permanent in Zweifel. Es gibt keine berechenbare Außenpolitik mehr, nur Unberechenbarkeit und neue Konflikte mit Europa wie beispielsweise in der Frage des richtigen Umgangs mit Iran. Was tun wir denn im Falle einer Eskalation? Europa ist da noch völlig ansatzlos.« China, sagt Röttgen, sei »der größte geopolitische Profiteur der Selbstverkleinerung der USA«.
Und Norbert Röttgen schließt an einen Gedanken Wolfgang Ischingers an: »Bei uns ist die Verletzung tatsächlich größer im Vergleich zu Frankreich. Großbritannien hatte Illusionen gepflegt, die Treue zu Amerika war dort gleichsam Staatsdogma. Bei uns aber ging es jahrzehntelang um elementare Sicherheitsfragen, unsere Existenz wurde durch die USA gewährleistet. Darum ist bei uns auch die Trauer am größten.«
Deutschland müsse nun Konsequenzen ziehen, sagt Röttgen: »Außenpolitische Selbständigkeit«, das sei leicht gesagt, das sei ein zu großer Begriff – »aber das Ausgeliefertsein und das Mitvollziehen amerikanischer Fehler können wir uns nicht länger leisten«. In den nächsten 15 Jahren allerdings – und weiter könne seriöserweise niemand vorausdenken – seien die transatlantischen Beziehungen nicht ersetzbar. »Wir bedürfen einander. Auch die USA wissen, dass sie ohne Europa kein einziges internationales Problem lösen können.«
Wie aber muss Deutschland sich nun für das Kommende wappnen?
»Unsere öffentliche Meinung hat keine Bedeutung für Trump«, sagt Röttgen, »Moralpredigten erreichen gar nichts. Wir müssen Stärke entwickeln durch soft power, also eine koordinierte europäische Außenpolitik, und auch durch hard power, also militärisch, sowie durch eine akzentuierte Handelspolitik.« Letztlich, so Röttgen, gehe es um eine gesunde Mitte zwischen zwei Extremen: »In Frankreich entscheidet der Präsident über Verteidigungseinsätze, und dieses Recht wird Frankreich niemals aufgeben. Auf der anderen Seite wird über einen europäischen Außenminister geredet, und das ist vorerst illusionär. Dazwischen aber liegen viele realistische Möglichkeiten, gemeinsame Positionen zu finden und das Gleiche zu sagen und durchzusetzen.«
Ach, und eines noch: »Dass Trump scheitern wird, damit rechne ich.« Europa dürfe auf dieses Scheitern allerdings nicht warten.
Ein Amerika-Flug führt mich nach Boston, von dort geht es wenige Meilen weiter nach Cambridge. Harvard wartet, Koryphäen der politischen Wissenschaften; die kleine Tournee beginnt in der Kennedy School bei David Gergen, dem Mann, der Obama und viele andere beriet, der hinund herpendelte zwischen der wirklichen Politik in Washington und der Welt sowie der Erklärung von Welt und Politik hier in Harvard. Gergen gestikuliert ausholend mit der Linken, er hat schütteres Haar, eine tiefe, kraftvolle Stimme.
Gergen berichtet mir davon, dass in den vergangenen Jahren diverse Studien ergeben hätten, dass in nichtdemokratischen Staaten der höchste Grad an Vertrauen in Regierungen und die Wirtschaft erreicht werde, während dieses Vertrauen in den meisten demokratischen Staaten schwinde. Das könne nur an Fehlern, mangelnder Effizienz, schwacher Kommunikation oder miserablen Politikern liegen. »Wenn das Vertrauen aber zerstört ist, kann eine demokratische Regierung nichts Großes mehr tun, dann kann sie nicht mehr innovativ sein. Es ist ja gerade die Verheiratung von den richtigen politischen Zielen mit exzellenter Führung, welche die Welt voranbringen kann.«
Zweierlei ist Gergen wichtig: »Wir leben in einer Zeitenwende, weil sich sehr geballt und sehr rasant sehr viele Probleme stellen, die nur langfristig zu lösen sein werden.« Und eines dürfe nicht vergessen werden, wer über den amerikanischen Riss, diesen Vertrauensverlust, diesen Hass nachdenke: »Das ist ein Generationenproblem. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir die greatest generation, unsere Helden aus der Normandie, wir waren stolz, das hielt die Nation zusammen. Heute nehmen unsere Bürger Führer wahr, die an sich und die eigene Karriere denken, dieser Nation fehlt die verbindende Idee.«
Cathryn Clüver, deutsche Direktorin des »Future of Diplomacy«-Programms der Kennedy School, erfindet erst einmal ein neues Wort: »Wir müssen einen gesunden Menschenabstand einnehmen«, sagt sie: »Wir dürfen uns nicht vom ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung dieses Präsidenten, mitreißen lassen, sondern müssen zwei, drei Schritte zurücktreten und die großen Linien sehen.« Sie diagnostiziert dann einen »Moral- und Ansehensverlust«, »den Verlust des Ankers USA für das westliche Wertesystem«. Erschreckend sei, »wie schnell wir über die Grundfesten des Westens nachdenken; die Bewegungen waren ja latent da, doch dieser eine Mann hat einen anderen Resonanzboden und eine andere Gangart.«
Vorhersehbar, kalkulierbar sei die Regierung Trump nicht; oder doch, in einem Punkt nämlich: »Sie betreibt kurzfristige Symbolpolitik, möglichst laut.« Europas erste Reaktionen auf Trump seien spät, viel zu spät gekommen, Deutschland und Frankreich hätten sich seit Frühjahr 2017 vorbereiten müssen. Würden nun »visionäre Strategien für Europa« entwickelt, so Clüver, dann »wären die Wähler dafür offen«, aber ließen die »diplomatisch verpackten Sprachstrukturen einer Angela Merkel« die dafür nötige Offenheit, den Diskurs zu? »Wir brauchen die Außenpolitik draußen auf den Marktplätzen, Deutschland muss seine Werte und seine Interessen erklären und kann das doch auch.«
In der Kennedy School, Büro Nummer L367, arbeitet Stephen Walt, einer der berühmtesten Politikwissenschaftler der Welt. Walt trägt eine rote Krawatte zum rosafarbenen Hemd, Dreitagebart, die Stirn ist hoch; ein Fahrradhelm liegt vor dem Bücherregal. »Deutschland ist ein Meister darin, seine Macht sehr still einzusetzen«, sagt er, und er meint das lobend. Überhaupt: Walt sagt andere Dinge als andere Gesprächspartner, er hat weniger Angst um die Welt, er sieht noch immer ganz schön viele Erwachsene am Werk. »Europa ist für die USA nicht mehr von strategischer Bedeutung«, sagt er, »und das ist eine gute Nachricht, denn Europa braucht den amerikanischen Schutz nicht mehr. Europa ist sicher, geeint, und es prosperiert leidlich. Darüber, dass die USA sich in andere Richtungen orientieren, sollte sich niemand aufregen.«
Walt verweist dann darauf, dass es über 60 Jahre lang immer mal Irritationen und Schwankungen wie die Suezkrise von 1956 oder Meinungsverschiedenheiten über Vietnam in den Sechzigern gegeben habe – allerdings vor allem eine stabile Grundhaltung auf beiden Seiten: Die NATO und das transatlantische Bündnis hätten im Zentrum der Außenpolitik gestanden, zweifelsfrei. »Die NATO konnte den Ostblock unter Kontrolle halten. Und nach dem Ende des Kalten Krieges passte sie sich den neuen Aufgaben an, wandte sich Friedensmissionen und der Stabilisierung brüchiger Nationen zu, beendete brutale Konflikte in Bosnien und im Kosovo«, so Walt.
Und es stimmt ja, man vergisst das nur leicht, wenn die Gegenwart so dröhnend laut ist: 2003 kam die größte Krise über das transatlantische Bündnis. Die USA wollten in den Irak einmarschieren, Europa verhinderte eine UN-Resolution und verweigerte die Unterstützung. »Amerika antwortete mit seiner Für-uns-oder-gegen-uns-Rhetorik und drohte mit der Bestrafung aller Alliierten, die den Kriegseinsatz verweigerten«, so Walt; zwischen 2000 und 2003 sei die Quote der Deutschen, die die USA schätzten, von 78 auf 25 Prozent gefallen.
Da habe sich etwas angebahnt, sagt Walt. Klar, unter Obama seien die USA wieder glorifiziert worden, aber auch Obama habe sich jahrelang kaum um Europa gekümmert. Sowieso: Die große Migrationswelle aus Europa liege mittlerweile weit über 100 Jahre zurück – »mein Großvater war Däne, und mich beschäftigte diese gemeinsame Geschichte sehr, aber schon meinen Kindern ist sie vollkommen gleichgültig«. Wenn sich der Resonanzboden derart verändere, dann verschiebe sich eben auch Aufmerksamkeit, so Walt. Aber muss das ein Problem sein?
Kurz vor Druck dieses Buches beginnen Stephen Walt und ich einen Mailwechsel. Vieles ist in den USA über Donald Trump inzwischen bekanntgeworden, und nicht wenige Diplomaten fürchten im Winter 2017/18 einen Atomkrieg mit Nordkorea. Mich interessiert, ob Walt tatsächlich noch immer so gelassen ist, so optimistisch gar.
Stephen, wie sollte die internationale Gemeinschaft diese veränderten USA behandeln? »Ich hasse es, das zu sagen, aber Kanzlerin Merkel hatte recht, als sie sagte, Europa und Deutschland müssten Verantwortung für ihr Schicksal übernehmen. Natürlich sollten sie die Kooperation mit den USA in kritischen Fragen anstreben, aber sie können nicht mehr davon ausgehen, dass sie damit Erfolg haben werden.«
Präsident Trump nannte Deutschland »schlecht, sehr schlecht« und meinte damit Handel und deutsche Exportüberschüsse. Ist das ernst? Ein kommender Handelskrieg? »Es ist dann ernst, wenn sensiblere Menschen es nicht schaffen, Trump zu erklären, warum er sich irrt.« Endet die Ära der Handelsabkommen? »Die Gefahr ist, dass Staaten überreagieren und dass sie der globalen Wirtschaftsordnung dann mehr Schaden als Gutes antun. Die momentane Ordnung ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber eine Rückkehr zu Protektionismus oder Handelskriegen würde nahezu allen Menschen schaden.«
Stephen, bei einer Sicherheitskonferenz in Washington D.C. klagten europäische Diplomaten darüber, dass es keine Kommunikation mit den USA mehr gebe. Verliert der Westen nun Stabilität und Stärke? Sind die Beziehungen bruchsicher aufgrund von Tradition und wirtschaftlichen Verflechtungen, oder ist die Bedrohung ernst? »Es gibt Gründe für Sorgen, besonders die Inkompetenz der Regierung Trump und ihr Desinteresse an Diplomatie. Aber das größere Problem ist, dass die strategische Grundlage transatlantischer Beziehungen heute schwächer ist als während des Kalten Krieges.«
Wie bewerten Sie Trump? Was überrascht Sie? Lernt er? Ist er gefährlich? »Mich überrascht, dass er noch immer die Unterstützung von mindestens 30 Prozent der Wähler hat. Er ist, wie befürchtet, ein inkompetenter Politiker und eine das Land zutiefst spaltende Figur. Sein erratisches Verhalten bringt andere Staaten dazu, nach Partnern zu suchen, denen sie vertrauen können. Ob er seines Amtes enthoben werden wird, kann ich nicht vorhersagen, aber er hat bereits jetzt beträchtlichen Schaden angerichtet.«
Stephen, was sollte Deutschland auf der internationalen Bühne tun? Kann Deutschland eine führende Rolle übernehmen? »Die absolute außenpolitische Priorität muss für Deutschland weiterhin darin liegen, die EU zu reparieren, nach der Finanzkrise und der Brexit-Entscheidung. Wenn die EU effektiv bleibt und ihre Legitimation wächst, wird Deutschlands politische und ökonomische Position stark und sicher bleiben. Wenn sie kollabiert, muss Deutschland in unsicherer Umgebung für sich selbst kämpfen. Darum sollte Deutschlands Außenpolitik sich im Moment auf die direkte Nachbarschaft konzentrieren.«
Amerikas Ausstieg aus der Weltpolitik reißt eine Lücke. Können Emmanuel Macron und Justin Trudeau diese schließen? »Nicht allein. Beide zeigen uns, dass energische und charismatische Anführer Unterstützung finden können, aber am Ende müssen auch sie die Lage ihrer Länder verbessern. Wenn es gelingt, werden sie der westlichen Demokratie wirklichen Rückenwind geben. Wenn es nicht gelingt, wird die gegenwärtige Misere verschlimmert werden.«
Was für ein wunderbarer Ort ist dieses Harvard, was für ein Reich der Gedanken. Man muss, wenn man von Stephen Walt kommt, nur um einige Ecken gehen, schon erreicht man das Büro von Nicholas Burns, und auch der ist einer der großen außenpolitischen Denker. Sein Büro ist ein Schlauch, lang und eng, Urkunden und Fotos hängen an den Wänden; Burns, der einst im Außenministerium gearbeitet hat und im Nationalen Sicherheitsrat, ist ein eleganter Mann im dunkelblauen Anzug, mit Seitenscheitel und Brille. »Ich sehe noch immer eine reife Beziehung zwischen den USA und Europa«, sagt er, »eine starke Beziehung unter Gleichen.«
Nicholas Burns, ein Bewunderer Helmut Schmidts, beachtet aktuelle Politiker schon auch, weil ihn die Machtspiele und die Tagestaktik interessieren, aber lieber denkt er über die großen Linien nach. »Wir haben globale Probleme«, sagt er, »und Europa muss sich darüber wirklich klarwerden. Europa war jahrelang zufrieden damit, ein regionaler Partner der USA zu sein, aber Europa muss global agieren. Ich hoffe auf Deutschland, denn Deutschland muss führen – Deutschland ist eine zutiefst vertrauenswürdige und selbstbewusste Nation geworden, und nun brauchen wir ein stärkeres Deutschland.«
Stimmt das? Braucht die Welt ein stärkeres Deutschland?
Im Januar 2018, zwischen all ihren Meetings und Auftritten, sitzt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der diskreten »Public Persons Lounge« des Weltwirtschaftsforums von Davos und plädiert für europäischen Realismus im Umgang mit den USA. »Obama hat uns zwar alle verzaubert, aber die Welt in Afghanistan und anderswo ganz schön allein gelassen. Anbetung ist ähnlich kindlich wie Verabscheuung – zur Reife zu kommen wäre besser«, so von der Leyen. Sie kennt Amerika bestens. Ihr Vater Ernst Albrecht war Transatlantiker und schwärmte von den USA; von der Leyen lachte über Mark Twain, träumte zu Leonard Cohen, war Austauschschülerin in Philadelphia und lebte und studierte vier Jahre lang in Stanford; »diese Energie, diese Kraft Kaliforniens«, sagt sie heute noch. Ihr Mann und sie hatten damals schon drei Kinder und waren trotzdem beide Mediziner, »und niemand nahm eine vorwurfsvolle Haltung ein. Alle fragten: How can we help? Da war Deutschland etwas anders.«
Wenn man nun mit Ursula von der Leyen über Trumps USA diskutiert, erinnert sie sich daran, wie sie auf Trumps Wahl spontan mit dem Satz »Ich bin geschockt« reagierte, was nicht allzu diplomatisch war und reichlich zitiert wurde. Auch heute sagt sie Wörter wie »Schock«, »Trauma« und »das Undenkbare«, aber sie möchte doch auf etwas anderes hinaus: politisches Handeln. »Dein großer Bruder ist nun einmal nicht ewig dein großer Bruder. Jaule und jammere also nicht, denn er bleibt ja dein Bruder – und nun werde erwachsen«, sagt sie. Genau das passiere gerade in Europa: »Wir sind in einer Geschwindigkeit in unserem Diskurs vorangekommen, die vorher undenkbar gewesen wäre, wir haben uns zusammengerissen. Verteidigungspolitisch wird Europa zu einer Einheit, und in vielen anderen Bereichen zeichnet sich Ähnliches ab.«
Dies sei ja ein Paradox der Politik: Gerade Rückschläge seien als Ermahnung und darum als das Gegenteil, nämlich als Chance und window of opportunity zu verstehen. Nun gebe es Emmanuel Macron »als Antithese«, diesen Mann, der »seine Reformen tatsächlich in großer Geschwindigkeit auf den Weg gebracht hat, er ist ja all over the place«.
Ursula von der Leyen wirkt kein bisschen deprimiert. »Vielleicht musste ja Amerika den Preis zahlen, damit Europa aufwacht und resilient wird.« Sie lacht. »Sollten wir nun also ›Danke, Donald!‹ rufen?« Aber so weit möchte von der Leyen doch nicht gehen.
Und zwei Tage später steht Donald Trump auf der Bühne von Davos und liest fehlerfrei von seinem Teleprompter ab. Er ist für seine Verhältnisse zahm und mild, möchte Investoren in die USA locken und sagt, »Amerika zuerst« bedeute nicht »Amerika alleine«.
Kurz vor Weihnachten treffe ich hinter der Bühne des Thalia-Theaters Herfried Münkler, den Historiker und Politologen, der gerade ein fulminantes Buch über den Dreißigjährigen Krieg veröffentlicht hat und darin Linien bis in unsere Gegenwart zeichnet. Weil territoriale und religiöse Konflikte verwoben gewesen seien, weil private und staatliche Einheiten miteinander gerungen hätten, sei der damalige Krieg in immer neuen Runden immer brutaler und gleichsam endlos ausgetragen worden – bis zur totalen Erschöpfung aller Beteiligten, schreibt Münkler.
Heute allerdings frage ich ihn nach Amerika und Europa, und er sagt: »Die USA haben realisiert, dass sie zu einer gleichzeitigen Machtprojektion im atlantischen und im pazifischen Raum nicht mehr in der Lage sind. Im atlantischen Raum konnten sich die USA nach 1945 ohne Kriege behaupten, im pazifischen haben sie zwei Kriege geführt. Dass sie sich heute auf den pazifischen Raum fokussieren, bedeutet, dass sie aus ihrer Erfahrung heraus großen Aufwand betreiben. Das bedeutet – sowohl aus amerikanischem Eigeninteresse heraus, wegen der ökonomischen Dynamik, als auch aufgrund von geostrategischen Überlegungen, eben weil sie ja im Atlantik die Europäer als vertrauten Machtfaktor haben – einen langsamen Prozess amerikanischen disengagements sowie die Entlassung Europas in die Eigenständigkeit.«
Münkler redet tatsächlich so, in solch wagemutig-wundervoll gebauten und am Ende immer schlüssigen Sätzen.
Und er fährt dann fort (eine Zwischenfrage ist nicht nötig): »Dann kam halt Trump in seiner rumpeligen Art – wie Knecht Ruprecht betrat er den Raum –, und jetzt haben selbst die Harmlosesten unter den strategischen Denkern begriffen, dass die Europäer in der Lage sein müssen, auf Selbstbehauptung umzustellen. Wie schwierig das ist, kann man sehen, wenn man sich die Rolle der USA im Jugoslawien-Konflikt der neunziger Jahre ansieht: Sie haben geführt und waren in hohem Maße bereit, sich militärisch zu engagieren. Mein Kollege Heinrich-August Winkler …« (wie Münkler lehrte Winkler an der Berliner Humboldt-Universität; Winkler hat mehrere Bücher über den Westen geschrieben) »… versucht ja immer noch zusammenzukleben, was nicht mehr hält.« Herfried Münkler jedenfalls scheint keinen Westen mehr zu sehen, keine Einheit mehr, er spricht vom Zerfall. »Es wird nie mehr so sein wie in der Zeit eines großen gemeinsamen Feindes.« Jenes Zeitalter, in dem das Zentrum des Westens irgendwo im Nordatlantik gelegen habe, gehe zu Ende, so Münkler.
Wir, sagt Münkler dann, müssen nun aufpassen, dass wir nicht nur »in Panzer und Equipment investieren, sondern auch in strategische Intelligenz«. Wenn er »wir« sagt, meine er Europa, aber wenn innerhalb dieses Wir-Europas Deutschland nicht führe, werde nichts passieren; es brauche dafür ein wenig Camouflage, damit deutsches Militär und deutsche Politik nicht wieder als übermächtig wahrgenommen würden.
Die Herausforderungen, denen sich die Europäer gegenübersehen, »beginnen ja an der gegenüberliegenden Mittelmeerküste, gehen weiter in der dahinterliegenden Sahelzone und im Nahen Osten. Der Pfeil der Instabilität ragt nach wie vor in den Balkan hinein. Politische und kulturelle Macht mit militärischer und ökonomischer Macht zu verbinden wird die große Herausforderung sein. Man betritt wirkliches Neuland.« Ein weiterer schöner Münkler-Satz: »Das erfordert die geschickte Kombination der unterschiedlichen Machtsorten, die man im Portfolio hat.« Er kommt dann wieder zum Thema seines Buches zurück und sagt: »Das größte Problem Europas werden die Kriege im Nahen Osten sein, Kriege vom Typus Dreißigjähriger Krieg, also die Mischung aus Hegemonial-, Religions- und Verfassungskriegen, die sich übereinanderschichten.« Man könne allerdings durchaus Hoffnung haben: »Europa hat schon so viel erlebt, dass es eine gewisse Grundmelancholie gibt, und Melancholie ist die Voraussetzung gründlicher Analyse.«
Justin Trudeau, kanadischer Premierminister, ist ein Gegenentwurf zu Donald Trump. So einladend. Angstfrei. So lustig und liberal. Er tritt für den Klimaschutz und für Migration ein; als Trump den Bau von Mauern verkündete, sagte Trudeau, dass Kanada die Welt willkommen heiße. Er will den Freihandel und geht die diffizile Aussöhnung mit Kanadas Ureinwohnern an; als er die Hälfte seines Kabinetts mit Frauen besetzte, wurde er nach dem Warum gefragt und sagte jenen einen Satz, für den er berühmt wurde: »Because it’s 2015.«
Trudeau ist der älteste der drei Söhne Pierre Trudeaus, der von 1968 bis 1979 und von 1980 bis 1984 Kanadas Premierminister war. Der kleine Justin spielte im Regierungsviertel von Ottawa, und vielleicht ist der große Mister Trudeau deshalb heute so sicher, so ganz und gar niemals nervös. Sein Auftreten erinnert ein wenig an Barack Obama, doch Trudeau riskiert mehr: Er macht Witze über sich selbst, trägt kunterbunte Socken, im Wahlkampf boxte er gegen einen Rivalen – was im Nachhinein coole Videos bedeutete, aber auch für blaue Augen oder einen K.o. hätte sorgen können.
Mit einer Rede auf seinen verstorbenen Vater wurde Trudeau im Jahr 2000 berühmt: So souverän und zugleich doch so bewegend sprach er, dass bald die politische Karriere begann, die ihn 2008 ins Parlament und 2013 an die Spitze der Liberalen Partei trug.
Zum G-20-Gipfel kam Trudeau nach Hamburg, und im Hotel Atlantic an der Außenalster konnten meine Kollegin Barbara Hans und ich mit ihm über einige der großen Fragen unserer Zeit diskutieren. Wir fragten nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen ihm und Trump. »Die Kanadier haben mich gewählt«, sagte Trudeau, »weil ich mich verpflichtet habe, für Wachstum zu sorgen, mich auf die Mittelklasse zu konzentrieren – und auf diejenigen, die hart arbeiten, um Teil der Mittelklasse zu werden. Das gleicht den Versprechen, derentwegen die Menschen Trump gewählt haben: Es geht um dieselben Probleme, auch wenn natürlich die Art und Weise, in der wir uns dem Thema nähern, sich sehr unterscheidet. Aber in den Gesprächen, die Donald Trump und ich geführt haben, waren wir uns sehr einig, dass es uns beiden darum geht, für die Menschen in unseren Heimatländern zu sorgen, etwas spürbar zu verändern.«
Ein Diplomat. Selbstverständlich. Wer ein solches Amt hat, verändert seine Sprache, muss sie verändern, wenn er nicht, wie Trump, permanent Brände legen will. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie erfuhren, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hatte? »Ich war überrascht. Ich glaube nicht, dass viele Menschen damit gerechnet hatten. Es war zugleich für mich eine Mahnung, dass die Wut und die Ängste, die viele Amerikaner umtreiben, offenbar sehr groß waren. Mir war klar: Es würde eine Herausforderung in unseren Beziehungen bedeuten, weil Trump Ideologien verfolgt, die nicht mit meinen übereinstimmen. Aber mir war auch klar: Wir müssen uns mit der Wut der Menschen beschäftigen. Mit dem Frust, den sie gegen die herrschenden Institutionen oder auch Eliten und politischen Parteien und Strukturen richten. Denn über die Jahre ist deutlich geworden, dass wir den Menschen nicht gut genug zugehört haben.«
Der Westen, das sagte uns Trudeau dann, habe durchaus die Wahl, und er meinte: zwischen der Demokratie und deren Unterwanderung. »Bei den Wahlen in Kanada im Jahr 2015 hat der Amtsinhaber die Ängste der Menschen befeuert, den Sozialneid. Viele dieser Themen haben ihre Verankerung in der rechten, populistischen Bewegung. Wir sind dem entgegengetreten. Statt zu sagen: Wir bewahren euch vor dem Schlimmsten, haben wir gesagt: Lasst uns versuchen, gemeinsam das Beste zu erreichen. Lasst uns eine positive Idee davon gewinnen, wie unser Zusammenleben aussehen kann, lasst uns eine Vision entwickeln.«
Man muss, bei Politikern wie Trudeau, hinhören auf das, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Andeutungen sind wichtig. Trudeau schimpfte nicht auf Trump; er schwärmte von Macron und Merkel. »Uns dreien«, sagte er, »Angela, Emmanuel und mir, ist es wichtig zu sagen: Wir können mit den bestehenden Systemen arbeiten und müssen sicherstellen, dass sie für alle Menschen funktionieren. Wir müssen Freiheiten und Chancen sichern, statt ängstlich zu sein – denn darauf zielen die Rechten. Oder wütend – denn darauf zielen die Linken. Die Mitte hat immer die Herausforderung zu bewältigen, vernünftig zu sein, ausgewogen. Die Rechten können weiter nach rechts ausholen, die Linken nach links. Die Mitte muss die Menschen erst einmal erreichen. Das hat in der Politik nicht immer funktioniert, denn die Botschaften passen nicht einfach als Slogan auf einen Aufkleber. Aber was wir merken, ist, dass die Menschen vernünftige Lösungen suchen und wir darum nicht nur negative Emotionen füttern dürfen.« Für die EU bedeute das, dass sie sich gut überlegen müsse, mit wem sie sich nun und künftig verbünde. »Viele Menschen«, so Trudeau, »fragen sich, warum gerade sie eben nicht vom Wachstum profitieren. Wenn der EU nicht einmal ein Freihandelsabkommen mit einem Staat wie Kanada gelingt – mit welchem Staat will die EU





























