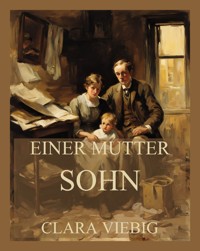Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Das Kreuz im Venn' ist einer der erfolgreichsten Romane Clara Viebigs. Eindrucksvoll weiß sie die Weite des Hohen Venns im Wechsel der Jahreszeiten zu beschreiben – und als Kontrast dazu die Kleinstadt im engen Flußtal. Diese Landschafts- und Naturbeschreibungen bilden den Rahmen und die Bühne der eigentlichen Handlung. Auf ihr läßt Clara Viebig Figuren aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten auftreten. In der Stadt (leicht als Monschau zu erkennen) lebt der reiche Fabrikbesitzer samt Familie und trifft sich mit seinen bürgerlichen Freunden im Gasthof 'Zum weißen Schwan', der von der attraktiven und offenherzigen Witwe Helene geleitet wird. Auch die in ihrem Standesdünkel befangenen Offiziere vom nahen Truppenübungsplatz zieht es dorthin. In Heckenbroich, dem nahegelegenen Eifeldorf auf der Höhe, sind die Bauern mit ihrer Arbeit noch voll eingebunden in den Ablauf der Jahreszeiten, und strenge religiöse Vorstellungen bestimmen wie seit altersher das Leben in den Familien. Jenseits der Dorfwiesen, hoch oben im Moor, liegt das Lager mit 40 Strafgefangenen, die dort das Land urbar machen sollen. Unter dem strengen Regiment des Aufsehers führen sie ein hartes, karges Arbeitsleben, in jeder Hinsicht am Rande der Gesellschaft. Clara Viebig hat im 'Kreuz im Venn' ein eindrucksvolles Bild der gesellschaftlichen Situation jener Zeit geschaffen. Ihre erzählerische Kraft zieht auch den Leser am Ende des 20. Jahrhunderts in seinen Bann. Mit dieser Ausgabe liegt der Roman endlich wieder in ungekürzter und unveränderter Form vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Das Kreuz im Venn
Roman aus der Eifel
RHEIN-MOSEL-VERLAG
1. Kapitel
In die Enge der Gassen war die Sonne noch nicht hinabgedrungen. Oben auf der Ley, wo das Kapellchen beim Kirchhof steht und Tannen ihre Wipfel über den Garten des Todes recken, glänzte sie schon; hell beschien sie die geweihten Ruhestätten derer, die man hier hinaufträgt in Frühlingsluft wie in Sommerglut, in Herbstschauern wie in Winterschnee. Jeden einzelnen auf den Schultern. Denn tief unten im Talspalt liegt die Stadt, neben den Fluß gequetscht, ein Haufen altersgedunkelter Schieferdächer. Zwei schmale Längsstraßen nur hat sie. Finster blickt der verfallene Wachtturm auf Kirche und Apotheke am Markt nieder. Und von der anderen Seite am jenseitigen Berghang schaut die alte Burg herunter auf die schieferigen, schlüpfrigen Treppenplatten, die aus dem Märchen des Mittelalters hinabführen in die enge Wirklichkeit: in den Alltag der Bürgerhäuser und der klingelnden Ladentürchen, der rauchenden Fabrikschlote und der gellenden Dampfpfeife; des murmelnden Betens der Lumpensortiererinnen und des regelmäßigen Geklappers vieler nägelbeschlagener Schuhe auf spitzigem Pflaster; des gemütlichen Schwatzens der Skatbrüder beim Schoppen, des Weibergeträtsches und des Sporenklirrens der Herren vom Schießplatz, die ihre freie Zeit benützen zu einer Flasche Sekt und einem guten Diner bei der schönen Helene im »Weißen Schwan«.
Der »Weiße Schwan« war heute so wie immer der Sammelplatz. Vor seiner verschnörkelten Barocktür, darüber der Schwan, künstlich aus Kupferplättchen gehämmert, schon ein Jahrhundert sich schaukelt, drängten sich die Herren. Alle in Zylindern und schwarzen Röcken; doch auch einige Uniformen waren unter dem feierlichen Schwarz.
Der Wirt vom Schwan war gestorben, noch ein junger Mann, der einen guten Wein und eine gute Küche geführt hatte.
»Armer Kerl«, sagte Adjutant von Scheffler, der eigens vom Platz herunterbeordert worden war, das Offizierkorps zu vertreten. »War immer höchst fidel und wußte sich doch dabei in den ihm zukommenden Grenzen zu halten. Und engherzig in keiner Weise – nee, wahrhaftig nicht!« Er lächelte flüchtig.
Der junge Leutnant Abeking lächelte auch. Die Augen halb schließend, blinzelte er in den jetzt schnell in die Gasse niedersteigenden Sonnenschein; er konnte das Lächeln nicht unterdrücken, das ihm kam, wenn er der vorigen Sonntagnacht gedachte, in der die schöne Helene bei einer fröhlichen Bowle ihm Blicke zugeworfen hatte – Blicke! Und ihr Fuß hatte den seinen gesucht, und neben ihn war sie gerückt, hatte sich gar nicht mehr um die anderen gekümmert, hatte ihm zugetrunken und ihr Knie an dem seinen gerieben! Noch jetzt fühlte er, wie der Strom Leben, der von ihr ausging, ihm durch den Körper rieselte. Und der dicke Wilhelm hatte sein behagliches Lachen dazu gelacht und listig geblinzelt und noch an kein Arg gedacht. Daß er so schnell hatte sterben müssen!
Ein plötzlicher Schauer überrann den jungen Offizier. Scheußlich, so aus dem vollen Leben und von einem so famosen Weibe weg zu müssen!
»Am Suff ist er gestorben«, sagte jetzt plötzlich jemand ganz laut. Das war der Tierarzt. Verschiedene lächelnde und auch einige unwillige Gesichter wendeten sich dem kleinen, untersetzten, immer echauffiert aussehenden Manne zu: natürlich, der Dreiborn konnte wieder seinen Mund nicht halten! Aber diesmal hatte er recht!
Und nun wußte der Apotheker auch Näheres: Herz und Nieren waren längst krank gewesen, der Doktor hatte ihm immer schon Wein und Bier verboten. Aber beides im Keller, und dann nicht davon trinken dürfen! Der dicke Wilhelm hatte eben weiter getrunken, bis ihn die Helene, als sie vergangene Sonntagnacht, sehr spät – na, eigentlich war ’s grauender Montagmorgen – nach oben kam, röchelnd im Bette fand.
»Pardon«, der junge Leutnant trat näher, »hat jemand von den Herren sie schon gesprochen? Ob sie sehr unglücklich ist?«
»Unglücklich?!« Der Tierarzt ließ ein Lachen vernehmen, so laut, daß Abeking verletzt zusammenzuckte. Er sah sich verlegen um, aber heute schien der Tierarzt keinen Anstoß zu erregen; überall gleichgültige, wenn nicht heitere Mienen. Man unterhielt sich zwanglos. Nur als jetzt der Landrat, vom Amt her, eilig über die Gasse schwenkte, zusammen mit dem Bezirkskommandeur, legten sich die Gesichter in ernstere Falten. Man grüßte.
Der Landrat dankte verbindlich. Aber es war eine gewisse Unsicherheit in seinem Gruß; sein kluges, vornehm-geschnittenes Gesicht zeigte einiges Unbehagen. Das war eine recht mißliche Geschichte, zu diesem Leichenbegängnis zu gehen! Der Landrat hinter dem Sarg eines notorischen Säufers! Aber die schöne Helene würde ihm sein Fernbleiben nie verzeihen und dann – er warf einen raschen Blick über die Gasse – sie waren ja alle gekommen! Da waren der Kreisphysikus und der zweite Arzt, der Bürgermeister, der Notar, der Amtsrichter, der Bauinspektor, der Apotheker und so weiter – ah, sieh da, selbst Schmölder von der Tuchfabrik! Und dann die Herren vom Militär.
Das gab ihm Sicherheit. Er richtete flüchtig ein paar Worte an die Ärzte, an den Bürgermeister, den Notar, den Amtsrichter, den Bauinspektor, den Apotheker und so weiter, um dann mit dem Fabrikanten, dem reichsten Mann des Orts, ein paar Schritte zur Seite zu treten. Sie unterhielten sich eine Weile halblaut, langsam dabei auf und nieder gehend. Sie mußten lange warten.
»Jeht et denn noch nicht bald los?« fragte plötzlich laut der Fabrikant. »Zum Donnerwetter, nu hab ich ’t aber bald satt, hier zu stehen!«
»St!«
In diesem Augenblick fingen die Glocken der Kirche dumpf an zu läuten; es öffnete sich die verschnörkelte Barocktür. Beide Flügel wurden weit aufgeschlagen, von innen drang ein Schluchzen heraus auf die Gasse. Die Herren vor der Tür gaben den Durchgang frei. Wie sich die Helene hatte!
Hinter der Geistlichkeit, die mit Kreuz und Weihrauchduft die Stufen des Schwans hinabschritt, schleppten die Träger den Sarg heraus. Er war lang und breit, kaum konnte er durch die Tür; der Verstorbene war groß und schwer bei Leibe gewesen. Die vier, die ihn trugen, blickten schier bänglich: würden sie ’s schaffen, bis die vier anderen sie ablösten? Sie hoben den Sarg auf die Bahre, der Zug setzte sich in Bewegung, Kinder mit Kränzen vorauf. Dicht hinter dem Sarg trug der Deputierte des Schützenvereins das Kissen mit sämtlichen Preisen und Ehrenzeichen; Wilhelm aus dem Schwan war, ehe noch seine Hand so zitterte, ein berühmter Schütze gewesen, totsicher hatte er allemal getroffen. Jetzt hatte der Tod ihn sicher getroffen. Die Witwe hatte laut aufgeschluchzt, als der Deputierte des Schützenvereins ihr mit diesen Worten, wohl gesetzt, seine Kondolation dargebracht hatte. –
»Gegrüßet seist du, Maria, Gebenedeite unter den Weibern –« »Heilige Maria, bitte für uns, Jetzt und in der Stunde unseres Todes!«
Unablässig, sich immer wieder erneuernd, klang das murmelnde Beten. Die Glocke dröhnte mächtig dazu, mit gemessenem, schwerem Anschlagen. Vor einer langen Reihe schwarzgekleideter Frauen her wankte die Witwe. Man konnte ihr Gesicht nicht sehen; sie hielt es verborgen hinter dem schwarzgeränderten Taschentuch, das sie sich vor die Augen preßte und hinter dem dichten Kreppschleier, der, vorn und hinten, lang bis zum Saum des schleppenden Kleides, niederfiel.
Sie schien wirklich aufrichtig betrübt! Der kleine Leutnant machte einen langen Hals, aber er konnte nichts von ihr erblicken, als über der Pelzboa ein Streifchen der Haut im Nacken, die trotz des schwarzen Schleiers weiß schimmerte, und ein Weniges von dem blonden Haar, das ein Strählchen der Morgensonne jetzt vergoldend küßte.
»Heilige Maria, bitte für uns, Jetzt und in der Stunde unseres Todes!«
Die Chorknaben schwangen den Weihrauchkessel. Der Sonnenglast drückte nieder, es war trotz früher Jahreszeit eine schwere Luft in der Gasse. Der Weihrauchdunst konnte nicht höher steigen als bis zum ersten Stockwerk der schieferbekleideten, hochgegiebelten Häuser, die in zwei gepreßten Reihen sich so nahe gegenüberstehen, daß sie sich bis ins Herz hineinsehen können.
An allen Scheiben Neugierige. Über Töpfe mit blühenden Zimmerblumen weg reckten sich Mädchenköpfe aus geöffneten Fenstern: »Ha, ’ne finge Liechezog, ’ne finge jruße!« Die Helene konnte sich wirklich was einbilden; wer da alles mitging! Sie machten sich gegenseitig aufmerksam auf den und jenen: »Jesses Maria un Jusep, nee, ooch der Landrat!« Ein hübscher Herr und sehr vornehm, der von Mühlenbrink! Ein schöner Mann! Beinahe so schön wie der von Scheffler mit dem aufgedrehten Schnurrbart. Der kleine Leutnant konnte dagegen nicht an, von den anderen gar nicht zu reden.
Als fühlte Landrat von Mühlenbrink alle auf ihn gerichteten Blicke, so ging er; behutsam, mit kleinen Schritten. Er sah nicht auf. Es genierte ihn doch etwas, hinter diesem Sarge herzugehen. Aber was tut man nicht! Hier hieß es, mit den Wölfen heulen, und des war er sicher, heute würde seine Popularität erheblich steigen. Auch hierdurch macht man sich Stellung. Und er wollte sich Stellung machen, um jeden Preis. Ein Landrat, der in seinem Kreise populär ist, ist wie ein König. Und dieser Kreis war interessant genug, er stellte Anforderungen, er brauchte eine ganze Kraft. Und war er denn nicht diese Kraft? Gewiß! Sonst hätte man ihn doch nicht hierhergesetzt. Er war noch jung, es war eine Auszeichnung – einen so großen Kreis! Es gab hier vieles zu schaffen; vorerst galt es einmal mit dem alten Schlendrian aufzuräumen, in diese teils kleinstädtische Enge, teils verdummte Bäuerischkeit Licht und Luft zu bringen. Und dann –?! Er hob den Kopf. Wenn es erst hieß: »Das hat unser Landrat ins Leben gerufen, das haben wir dem zu verdanken – unser Landrat, unser Landrat« – ah, was ließ sich auf diesem so lange verabsäumten Boden nicht noch alles schaffen, ins Leben rufen! Ein tiefer Atemzug wölbte seine Brust. Eine Fülle segensreicher Einrichtungen! Unwillkürlich reckte er sich: nein, er vergab sich nichts, hinter diesem Sarge herzuschreiten; das schaffte Vertrauen, und Vertrauen muß sich einer erwerben, der wirken will. Sie gingen ja auch alle mit – wahrhaftig, da hinten ja auch der Bürgermeister von Heckenbroich!
Er hatte sich flüchtig umgesehen, ihm war, als ruhe ein langer, fester Blick ihm im Rücken, und er hatte sofort den Mann bemerkt der die anderen, die vor und neben ihm schritten, um Haupteslänge überragte. Den mußte er doch gleich nachher einmal abfassen! Der machte sich ja so rar hier unten!
Der Zug, unter Gebet und Glockengeläut, war jetzt zur Stelle gelangt, wo der Weg sich teilt. Rechts steigt das Gäßchen zum Kirchhof hinan, links führt eine Straße zum Bahnhof hinauf. Hier, wo die Träger wechseln, pflegen die abzuschwenken, die der Höflichkeitspflicht Genüge getan haben; nur die nächsten Leidtragenden folgen in schmaler Prozession, wie ein schwarzer Wurm unter den fast überhängenden letzten ärmlichsten Häusern des Städtchens hinkriechend, der Leiche die steile Felsstiege hinan. Schon drückte sich da einer und dort einer; man pflegte das meist heimlich zu tun, aber heute verstellte ein Trupp Männer die rettende Ecke.
Sie standen da und gafften mit stumpfen Augen den Zug an. Fünfzehn Männer in Drillichkitteln; einer wie der Andere mit geschorenem Kopf. Und bei ihnen, mit dem Falkenauge sie überwachend, ein schwarzer Kerl, nicht vertrauenserweckender als sie; auch in einer ihren Kitteln ähnelnden Drillichjacke, in Militärhosen und mit einem Karabiner über dem Rücken. Das war der Aufseher, und das waren die Gefangenen.
Aha! Der Landrat kniff die Augen halb zu und trat dann rasch näher. Da war ja der avisierte Kolonisationstrupp! Schon?! Er hatte die Leute eigentlich etwas später erwartet. Aber auch gut so, das Wetter war ja fast frühlingsmäßig, als ob es schon April wäre und nicht erst März. Es konnte immerhin begonnen werden! Mit der Miene des Vorgesetzten musterte er den Aufseher. Der Mann gab ruhig seinen Blick zurück.
Mühlenbrink räusperte sich. »Ich bin der Landrat! Wie heißen Sie?«
»Bräuer.«
»Sie kommen soeben mit dem Morgenzug von Aachen?«
»Ich habe mich bei der Polizeibehörde zu melden.« Eine gewisse Unlust knurrte in des schwarzen Mannes Stimme, man merkte es ihm an, er liebte es nicht, ausgefragt zu werden.
»Ich bin die Behörde«, sagte der Landrat scharf. Er ärgerte sich über die knappe Antwort dieses Menschen und winkte hochmütig ab: »Sie können jetzt gehen. Ich werde mich bald davon überzeugen, wie die Sache vorangeht!«
»Zu Befehl!« Des Schwarzen scharfes Auge, das hell war, graugrün, mit einem dunklen Ring um den Augapfel wie bei einem Falken, flog über die Drillichkittel; mit einem einzigen Blick umfaßte er sie alle. »Marsch!«
Die fünfzehn, ohne einen Moment des Besinnens, schulterten ihre Bündel, die sie im Stehen hatten sinken lassen. Trapp, trapp. Hart klapperten ihre groben Schuhe auf dem Steinpflaster.
Wie ein bissiger Hund, der seine Herde bewacht, bald nebenher, bald hinterher, lief der Aufseher. Finster waren die Blicke, die er auf neugierige Gaffer in der Straße schoß. Was blieben sie denn stehen und glotzten ihn und seine Kerls an? Es lief mancher Halunke noch frei in der Welt herum, der eigentlich hier zwischen die Drillichkittel gehörte!
»Voran, marsch!« sagte er noch einmal und schlug einen noch schärferen Trab an. Gehorsam fiel seine Schar in den gleichen Tritt.
Der Landrat stand noch und besann sich, ob er den Mann nicht noch einmal zurückrufen und ihm noch einige Instruktionen geben sollte, als auch schon der Trupp um die Krümmung der Längsstraße verschwunden war.
»Stramme Kerls, was?« sagte der Platzkommandant und stellte sich neben dem Landrat auf. »Und gedrillt wie Rekruten. Der Schwarze ist natürlich Unteroffizier gewesen; merkt man gleich, noch gute militärische Zucht drin!«
»Mag sein, aber ein sackgrober Kerl!« Es war etwas Gereiztes in Mühlenbrinks Ton.
Der Andere lachte. »Alle Unteroffiziere sind grob, müssen grob sein, sonst sind sie nicht zu gebrauchen. Ich gehe jetzt zum Frühschoppen, kommen Sie mit? Fatal, mit dem Schwan ist ’s heute nichts, wir müssen uns schon mit der Gans begnügen!« Der gemütliche Herr belachte seinen Witz. »Sie sind ja heute so schlechter Laune, Mühlenbrink, was ist denn los?«
»Geschäfte!« Der Landrat krauste die Stirn.
»Äh was, Geschäfte! Adieu!« Der alte Major schwenkte hinüber in das andere Gasthaus, dessen Wirt schon in der Türe stand und sich heute, da der »Schwan« geschlossen blieb, viel Zuspruch erhoffte.
Einer der Leidtragenden nach dem anderen verschwand im Bierlokal. Nur der, auf den Mühlenbrink, langsam die Gasse hinabschlendernd, wartete, spazierte noch immer nicht in die Wirtshaustür. Wo steckte denn der Bürgermeister von Heckenbroich? War er am Ende mit bis zum Kirchhof hinaufgegangen?
Der Landrat war schon ein paarmal bis zum Gäßchen zurückgeschritten und hatte ungeduldig den Weg emporgesehen, der, teils in Treppenstufen, teils über schieferige Platten führend, zur Kirchhofsley ansteigt. Ein paar Eidechschen schlüpften, vom stechenden Frühlingsschein hervorgelockt, über die Gasse und verschwanden schwänzelnd in den Spalten des bröckligen Mauerwerks, über das das Obergeschoß der Häuschen weit vorspringt.
Mit rüstigem Schritt, den rauhhaarigen Zylinder in der Hand tragend, kam jetzt der Bürgermeister von Heckenbroich die Gasse herunter. Man sah es, er war mit bis oben gewesen, seine Stirn war feucht von Schweiß.
»Endlich! Na, wo stecken Sie denn so lange, lieber Herr Bürgermeister?« Der Landrat schüttelte ihm die Hand.
»Ich hab dem Wilhelm noch die letzte Ehre erwiesen«, sagte ernst Bartholomäus Leykuhlen.
»Eine halbe Stunde warte ich auf Sie. Sie machen sich ja so rar! Ich wollte doch nicht versäumen, Ihnen wenigstens einmal guten Tag zu sagen!«
»Zuviel Ehre für mich!« Der bäuerliche Mann wischte sich ruhig mit der flachen Hand den Schweiß von der Stirn und setzte dann den altmodischen Zylinder wieder auf. »Darf ich fragen, was der Herr Landrat von mir wissen möcht?« Das frische Gesicht unter dem schon ergrauenden Haar blieb ganz unbewegt. In den klaren Augen, die den anderen frei ansahen, konnte man nur eine gewisse erstaunte Frage bemerken, aber nichts von der Ironie, die doch das mißtrauische Ohr aus dem Ton der Stimme zu hören geneigt war.
»Ich – ich? Wissen?!« Mühlenbrink lachte ein wenig nervös. »Nein, wissen will ich gar nichts von Ihnen. Aber wie steht ’s denn eigentlich bei Ihnen oben? Was denken Sie, wird es viel Futter geben, dies Jahr? Und wie ist der Gesundheitszustand?«
»Sehen Sie, da wollen Sie ja als wat wissen!« Leykuhlen lachte ungeniert. »Und wat viel auf einmal. Herr Landrat, dat weiß nur der Himmel. Dat Frühjahr läßt sich trocken an, diesen Winter haben wir auch ausnahmsweis wenig Schnee gehabt; wird wohl knapp mit Wasser werden dies Jahr!«
»Aha, sehen Sie, lieber Freund! Sagte ich ’s Ihnen nicht längst? Wasserleitung müßten Sie anlegen!«
»Wat tut dat zur Sach! Wasserleitung – wat soll die wohl unserm Jras nützen?! Ob wir viel Futter kriegen oder wenig, da ändert kein Wasserleitung wat dran!«
»Aber für den Gesundheitszustand ist sie doch höchst wichtig. Ich bitte Sie, lieber Freund, diese veralteten Brunnen! Bauen, bauen, nicht so rückständig sein! Eine Wasserleitung bauen, schleunigst!«
»Wir haben kein Jeld«, sagte trocken der Bürgermeister.
Der Andere triumphierte. »Sie haben aber doch eine so große Kirche gebaut – ein Dorf solche Kirche – schöner Unsinn! Für die hundertfünfundsiebzigtausend Mark – oder wieviel war es doch gleich, was die Gemeinde vom Militärfiskus für Abtretung des Weidelandes bekommen hat? – na, eine anständige Summe jedenfalls. Die Gemeinde konnte auf einen grünen Zweig kommen. Statt dessen – zu dumm, zu dumm!«
»Sie waren eben damals noch nit unser Landrat, Herr von Mühlenbrink«, sagte Bartholomäus Leykuhlen mit einem Lächeln.
Der Andere nahm das als Schmeichelei.
»Übrigens ist die Kirch nit von dem Jeld jebaut, Sie irren, Herr Landrat! Dafür haben wir jespart, jespart seit Jahrzehnten. Aus freiwilligen Beiträgen ist sie erbaut. Et ist uns en Herzenssach jewesen. Dat Jeld vom Militärfiskus haben wir noch!«
»Sie sind wirklich der einzig vernünftige Mensch hier«, sagte der Landrat halblaut und legte vertraulich dem großen Mann seine Hand auf den groben Tuchrockärmel. »Kommen Sie ein bißchen mit mir, wir trinken ein Glas Wein bei mir zu Haus. Hier wird einem ja aus jedem Fenster zugehört!«
»Ich danke, Herr Landrat!« Leykuhlen machte sich frei und lüftete den Zylinder. »Aber ich bin heut zu sehr pressiert. Die beste Kuh will kalben, da muß der Uehm* selber zu Haus sein. Empfehle mich!«
Fort war er. Wie ein verdutzter Knabe sah der Andere ihm nach. Wieder ausgewichen! Eine Röte stieg ihm in die Stirn. Im Grunde ein eingebildeter Patron – wenn man ihn nur nicht so nötig brauchte! Kein Mensch hier, bei dem man sich bessere Informationen über Land und Leute holen konnte. Und keiner, der soviel Einfluß hätte bei diesen Bauern. Man mußte ihn für die Wasserleitung zu gewinnen suchen – diese war durchaus nötig. Das Geld hatte die Gemeinde also doch noch nicht ganz verplempert? – die Regierung würde zusteuern – es wäre wirklich ein kolossaler Erfolg, könnte man die Wasserleitung durchsetzen! – – – –
Mit starken Schritten weit ausholend hatte Bartholomäus Leykuhlen das Pflaster bald hinter sich. Gott sei Dank, da war er in der Au! Er schüttelte sich und atmete tief auf. Noch einmal schaute er zurück, wie etwas Unangenehmem glücklich entronnen.
Er schlug den Fußweg nach Heckenbroich ein. Zwischen gewaltigen Tannen, an deren Ästen lange Bärte von Moos hängen, führt der steinige Pfad jäh bergan, während die Fahrstraße noch unten im Tal bleibt, um erst bei der Schmölderschen Fabrik in großen Kehren langsamer nach oben zu steigen.
Unten im engen Tal in einem Felskessel eingepreßt blieb das Städtchen zurück mit seiner überragenden Burg, mit seinen Treppen und Treppchen, seinen Winkeln und Gäßchen, mit seinen hoch an den Felsen hängenden, auf Ziegenpfaden nur erreichbaren Gartenfleckchen, mit seiner ganzen mittelalterlichen Aufeinandergebautheit, mit seinem düsteren Blau und Grau von altersgedunkeltem Schiefer und verwittertem Felsgestein.
Der Landmann schüttelte den Kopf: wie man das nur schön finden konnte und malerisch! Ihm konnte das gar nicht gefallen. Wenn es nicht des Wilhelms wegen gewesen wäre, den er doch kannte, seit er als Junge mit seinem Vater selig zur Kirmes oben auf den Hof gekommen war, um ein Stück Reiskuchen zu essen, – weiß Gott, er wäre heut nicht da heruntergekrochen. An so einem lichten Tag erst recht nicht!
Der grauhaarige Mann fing an zu pfeifen wie ein Knabe. Wie warm das schon war! Wunderschön! Der Himmel rein blau, ohne Wolken, wie gefegt; und immer klarer der Sonnenschein, je weiter man von dem Neste abkam. Leidiges Pflaster! Und was dem Mühlenbrink nun schon wieder einfiel! Leykuhlens Stirn umwölkte sich. Fing der schon wieder an zu tripelieren?! Gesundheitszustand – veraltete Brunnen – jawohl! Leykuhlen lachte auf und fing dann an, laut zu sprechen, als ginge noch einer neben ihm: »Wat de sich denkt! So dumm sind wir nit, unser jut Jeld eso eraus zu schmeißen! Wasserleitung – ha, ha!« Er lachte wieder. »De is wohl jeck! Unsere Brunnen sind jut; Wasser drin kalt und klar. Un wenn et emal knapp is – no, Wasserleitungswasser würd doch kein Bauer trinken, wer weiß, wat da für ’ne Dreck drin is! Jesundheitszustand, Jesundheitszustand – jesund un krank, dat steht in Jottes Hand. Dat verjißt der Herr Landrat!«
Der Bürgermeister von Heckenbroich blieb stehen und ließ seine Augen mit Wohlgefallen schweifen. Wie schön war dieses Land, diese mißachtete Eifel! Und auch gesund. Fünfzig Jahre stand er nun schon auf dieser Erde, hatte die langen Winter und die noch längeren Regenzeiten über sich hingehen lassen, hatte vom einsamen Hof, weit draußen am Schieferbruch, wo er aufgewachsen war, täglich eine Stunde Marsch zur Dorfschule gehabt, und eine wieder zurück, sowohl im Sonnenbrand als wenn der Westwind schnaufte; war tropfnaß geworden und wieder trocken, und war doch alle Zeit gesund gewesen bis auf den heutigen Tag. Er streckte den Arm aus, an dem die Muskeln kraftvoll schwollen, und schlug sich dann auf die Brust. Das war ein Brustkasten! Noch einmal. Der Arm hier konnte frei in der Schwebe an die hundert Pfund halten, ohne zu zittern – das Mariechen war ihm auch nicht zu schwer! Er freute sich an der eigenen Kraft.
»Sie machen wohl Freiübungen?« sagte plötzlich eine Stimme.
Leykuhlen sah auf.
An der Wegseite, hinter einem großen Felsbrocken, den die Ley, deren Nase schroff über die Tannenwipfel ragte, heruntergespuckt zu haben schien, saß ein Mann. Dieser sprang jetzt lebhaft auf: »Tag, Leykuhlen! Kennen Sie mich noch? Ich habe Sie schon von weitem erkannt!«
»Tag, Josef!« Leykuhlen streckte seine Hand hin. »Biste wieder hier? Ich hatt et als jehört.«
Der Andere blickte einen Augenblick verwundert, das »Du« war ihm doch ungewohnt, nachdem man sich so viele Jahre nicht gesehen hatte. Aber er fand sich in den Ton. »Bärtes«, sagte er herzlich, und ein liebenswürdiges Lächeln verschönte sein Gesicht, »das ist wahrhaftig nett von dir, daß du mich noch kennst. Mich haben nicht viele mehr hier gekannt – oder sie wollten mich nicht kennen.« Das letzte sagte er mit einiger Verbissenheit. »Es ist eine verflucht schwere Situation, der Vetter eines reichen Mannes zu sein und selber kein Geld zu haben!« Er starrte zur Seite hinunter in das Tal, wo zwischen dem weißen Band der Chaussee und dem Bach, der mit starkem Gefälle die Au durchströmt, die Tuchfabrik aufragt. »Da hat der Heinrich nun mit seinem Kasten das schöne Tal schimpfiert – der Banause! Sieh an, Bärtes, wie der Schornstein sich frech gegen die Tannen reckt! Und der Rauch stinkt – stinkt nach Lumpen, pfui!« Er spuckte aus. »Und nach Geld!«
Leykuhlen nickte. »Dat is wahr, zur Verschönerung trägt die Fabrik jrad nit bei. Ich hab mich als oft jenug drüber jeärjert. De hätt können drinnen im Nest bleiben. Aber mer darf doch nix sagen –« er zuckte die Achseln – »so wat jibt Brot!«
»Brot, Brot – trauriges Brot das! Morgens um sieben anfangen, abends um sieben aufhören – Lumpen, Gestank, erstickender Rauch – nicht mal Zeit am Mittag, was Warmes essen zu gehen. Ich habe zugesehen von hier oben, schon seit ein paar Tagen lungere ich hier herum – siehst du, Bärtes? Jetzt, jetzt!« Aufgeregt ergriff er den anderen beim Ärmel und zerrte ihn bis dicht zum Rand.
Unten, gerade unter ihrem Standpunkt lag die Fabrik. Es hatte eben Mittag geläutet. Die Türe des Saales hatte sich geöffnet, heraus strömte ein ganzer Schwarm; ein Summen drang bis zu ihnen herauf.
»Siehst du, Bärtes, siehst du die Mädchen mit den roten Kattuntüchern um die Köpfe?« Er wies mit unruhigem Finger hinab »Da – eine, zweie, dreie! Da sitzen sie nun auf den Lumpenballen, und mit denselben Fingern, die eben noch Lumpen sortiert haben – fremde Lumpen, Gott weiß woher, Lumpen, an denen die Pest sitzt, Tuberkulose, Krebs, was weiß ich für scheußliche Krankheiten – mit diesen selben Fingern brechen nun die armen Dinger ihr Brot. Ich habe zu Heinrich gesagt: ›Du bist ein Volksvergifter!‹ Da hat er mich ausgelacht: ›Volksbeglücker, willst du sagen. Was sollten die Leute denn anfangen, wenn sie meine Fabrik nicht hätten? Aus allen Ortschaften, drei Stunden weit, kommen die Mädchen gerannt, sie reißen sich um den Verdienst. Laß sie sich doch waschen, wenn ihnen meine Lumpen nicht rein genug sind, ein Brunnen steht im Hof, und im Bach ist Wasser genug.‹ So spricht mein Vetter – was sagst du dazu, Bärtes?« Mit Dringlichkeit blickte der Aufgeregte dem andern ins Gesicht.
»Ja«, – Leykuhlens heiteres Gesicht war ernst geworden – »dat is freilich mit den Lumpen en schmierige Sach, un an et Waschen sind die Leut nit so recht dran zu kriegen. Sie sind et eben jewöhnt, mit Arbeitshänden ihr Brot zu essen. Dat macht auch nix, sie werden nit jleich Pest und Cholera dervon kriegen. Und der Heinrich hat auch janz recht, wenn der sagt, dat seine Fabrik Verdienst in die Dörfer bringt. Un doch wär et besser, sie ständ nit da. Et is wahr, nit alle können zu Haus bleiben, et sind Kinder und Alte jenug da, um et Vieh zu hüten. Aber mögen die Jungens jehen, meinswegen, laß die in die Fabriken zu Aachen, zu Düren und über die Jrenz nach Verviers jehen – um die Mädchens, die in die Fabrik jehen, um die is et mir leid!«
»Die Schwindsucht rennen sie sich an den Hals«, rief der Andere heftig. »Sieh dir die Mädchen an, sehen die etwa stark aus? Spitznasig, schmalwangig, engbrüstig. Nicht wie Landmädchen, deren Wangen leuchten sollen wie rote Äpfel, deren Brüste das Mieder schwellen sollen, fest und rund!«
»No, no!« lächelnd klopfte ihm Leykuhlen auf die Schulter. »Biste noch immer der alte, Josef? Immer noch derselbe Haselebaues*, der du in der Klass’ schon warst? Haben dich zwanzig Jahr noch nit kleinjekriegt? Wir haben aber doch hübsche Mädchens, wenn ich auch sagen muß: Fabriksarbeit taugt ihnen nix. Wat sie da lernen, is keine jute Sitt – un dat is dat Schlimmste!«
»Sitte hin, Sitte her! Aber sind das Mädel, die kräftige Kinder gebären können, die einem neuen Geschlecht das Leben geben sollen?«
»Oh, Kinder haben wir jenug im Dorf«, sagte trocken der Bürgermeister. »Beruhig dich, Josef! Und nette Kinder. Besuch du uns bald emal, da sollste wat zu sehen kriegen. In jedem Haus ihrer fünf, sechs – mindestens. Da is der Jörres Huesgen, der Weber, de hat en janze Heck voll. Acht Stück; un dat neunte is unterwegs!«
»Um Gottes willen!«
»No siehste! Die Eifel stirbt so bald noch nit aus. Und wat die Mädchens anbelangt, sie haben fast all en Schatz und werden auch schon –«
»Genug davon, Bärtes!« Josef Schmölder legte ihm hastig die Hand auf den Mund. »Ich mag nichts mehr davon hören. Es beelendet mich. Überall das gleiche. Und ich dachte, hier würde es anders sein – besser. Hier auf dieser Höhe, der der Himmel so nahe ist!« Mit Schwärmerei im Blick sah er sich um und breitete dann plötzlich beide Arme aus: »Mensch, was hast du es so gut, hier oben immer gelebt zu haben! Wie schön, wie unbeschreiblich schön!«
Sie waren im Gespräch weiter gegangen; nun hielten sie auf einer Lichtung, deren trockene Heidegräser versilbert standen in einer Flut von Licht. Kein Haus, kein höherer Berg hemmten hier die Aussicht. Wie verklärt vom ersten Sonnenschein des jungen Jahres zeigte sich rundum die Ferne, sie enthüllte sich schleierlos; und die Luft war leicht, von jeder irdischen Schwere befreit, und durchsichtig klar, klarer als das reinste Glas. Da lagen unendliche Züge einsamer Heide mit schweigenden Tannenwäldern und tief einschneidenden Schluchten; im Grunde der Schluchten flossen Bäche, man sah nicht bis zu ihnen hinab, aber man sah den von der Sonne vergoldeten Duft, der von ihnen zu den Schluchträndern aufstieg. Noch zeigten die Matten von Heckenbroich nicht ihr saftiges Sommergrün, noch stieß der braune Rücken des Venns schwer und tot gegen die Helle des Horizonts, aber doch regte sich schon heimlich neues Leben in der Natur. Jene Wälder, deren Blau den ganzen Winter kalt und stumpf die Wellenlinie des Hochlandes gesäumt hatte, zeigten nun tieferes, wärmeres, ein besonntes Blau. Die Weidenbüsche an den Moorlachen trugen weiche, grausilberige Kätzchen; der Haselstrauch schüttelte lange, goldbepulverte Blütenräupchen.
»Et will lenzen!« sprach der Landmann froh.
Josef Schmölder seufzte. Er stand in sich gekehrt; das was ihn eben noch so entzückt hatte, schien ihm jetzt nicht mehr zu gefallen.
»Du has’ höck keene jute Dag«, sagte Leykuhlen teilnahmsvoll. Ihn faßte plötzlich ein Mitleiden, als er den anderen betrachtete, der, vornübergeneigt, mit grauem Gesicht und gegen den Wind hüstelnd, neben ihm stand: arg mitgenommen sah der Josef aus, als ob er ebenso hoch in die Fünfzig zählte, wie er noch in den Vierzig war! Aber was sie im Städtchen über ihn klatschten, daß er sein Leben verlüdert, und daß er dem reichen Vetter recht zum Possen heimgekehrt sei, nein, das glaubte er nicht! Dem alten Kameraden, mit dem er ein paar Jahre unten in der Lateinschule zusammen gesessen hatte, die Hand auf die Schulter legend, sprach Leykuhlen herzlich: »Laß die Jrillen, Jung! Und wenn sie dir unten zuviel Fisematenten machen, dann kömmste erauf bei uns. Du bist herzlich willkommen, Josef. Mariechen wird sich auch sehr freuen!«
»Danke, danke!« Josef Schmölder drückte Leykuhlen die Hand, aber kein Lächeln der Freude erhellte sein abgespanntes, von vielen feinen Kritzchen frauenhaft verfältetes Gesicht. »Du bist ein guter Kerl, Bärtes! Aber ich glaube an Freundschaft nicht mehr. Du mußt mir das nicht übel nehmen. Ich habe viele Freunde in meinem Leben gehabt – wo sind sie?!« Er spitzte den Mund und blies in die Luft, wie man ein Stäubchen fortbläst. »Es mag an mir liegen. Ich tauge eben zu nichts. Ich kann mich nicht in den Alltag schicken. Ich möchte alles anders haben, als es ist, besser, schöner – nenn es Egoismus, nenn es Menschenliebe, wie du willst. Ich weiß es selber nicht. Jedenfalls gefällt es mir nicht auf der Welt. Ich habe mich da und dort versucht. Erst war ich in London, dann in New York, sollte Propaganda machen für Schmölder und Kompanie – damals lebte der Alte noch, und Heinrich war Kompagnon – ich konnte den Leuten nicht das Lumpentuch anschmieren. Tuch aus Lumpen gemacht! Haha! ’s ist nichts wert – ich glaube, das habe ich gesagt!«
Leykuhlen sah ihn ganz verdutzt an. »Aber, Josef, sie machen doch jar kein Hehl draus, dat sie Lumpen zur Fabrikation verwenden! Ihre Tuche sind eben drum billiger. Und manchem tun sie et doch auch.«
»Lug und Trug, darin wie in allem!« Heftig stampfte Josef Schmölder mit dem Fuß auf. »Ich tauge nicht zum Kaufmann. Das haben sie auch eingesehen. Gelernt hab ich nichts anderes, Talente hab ich auch weiter nicht, meine Gesundheit ist zum Teufel, nervös bin ich, ha, so nervös« – er faßte sich an den Kopf mit beiden Händen und hielt ihn sich – »Geld habe ich keins, nie habe ich was in der Tasche halten können, die Finger haben mich gejuckt, bis es raus war – rausgeschmissen, wenn du willst – nun bin ich untergekrochen. Nun esse ich das Gnadenbrot.« Er lachte bitter auf. »Wenig stolz, wirst du sagen! Hast recht, ich bin ein Lump, ein Feigling, ein – ein« – er suchte noch nach einem stärkeren Ausdruck, fand ihn aber nicht und sagte dann kleinlaut: »ein gänzlich reduzierter Mensch!«
Leykuhlen stand betroffen: also, es war doch wahr, was sie unten sagten? Verjuxt hatte der Josef alles, und nun war er heimgekommen. Schön war das weiter nicht und dem Heinrich Schmölder nicht zu verdenken, daß er ein schiefes Gesicht zog. Aber schlecht war der Josef nicht, nein, wahrhaftig nicht! Er hatte Herz; er hatte nur keine Willenskraft! Und sich selber in seiner ganzen bäuerischen Kraft reckend und die breite Brust frei gegen den hier oben stärker wehenden Wind kehrend schrie er laut: »Jung, du machst dich viel schlechter, als du bist! Du bist kein Lump und auch kein Feigling, dir fehlt nur dat, wat uns stark macht und frei und aufrecht – zu zufriedenen Leut! Und Du hast kein rechtes Zuhaus. Siehste, ich sag et ja immer: am jlücklichsten die, die derheim bleiben können. En eigen Haus, en eigen Stück Land – un sei et noch so jering – dat jibt ’ne Stolz: hier steh ich auf meinem Jrund; nur Jott über mir!« Er hatte sich in Feuer geredet. Es war etwas Leidenschaftliches über den ruhigen Mann gekommen; man sah es an seinen Augen, ihr Graublau war dunkler geworden, und es sprühte darin. »Weißte, Josef«, – er schlug dem Jugendfreund mit einem so kräftigen Schlag auf die Schulter, daß diesem fast die Knie einknickten – »besuch mich nächsten Sonntag. Da hab ich Zeit. Da wollen wir weiter über die Sach reden. Et interessiert mich, wat du derjegen zu sagen hast!«
»Ich habe ja gar nichts dagegen zu sagen!« Plötzlich erheitert, lachte der Andere fast. Aber sein Gesicht verdüsterte sich rasch wieder. »Es ist eben nicht jedem vergönnt, auf eigener Scholle zu sitzen. Man möchte hadern gegen den Gott – wenn es einen gibt – der die Lose so ungleich verteilt hat.«
»Nu hör aber auf!« Der Bürgermeister wurde grob. »Wenn du mit Philosophieren anfängst, dann haste verspielt. Da kömmt nix bei eraus. Du bist wohl rein jeck? ›Wenn et ’ne Jott jibt‹ – da schlag doch en Donnerwetter drein, jewiß jibt et ’ne Jott, wenn wir ihn uns auch nit eso vorstellen können, wie die Kinder sich ihn denken, mit ’m langen weißen Bart auf ’nem joldnen Stuhl. Jott ist über uns, er sieht uns und kehrt bei uns ein im heiligen Sakrament. Den Glauben soll mir keiner nehmen, nee!«
»Du Glücklicher!« Josef Schmölder lächelte trüb, und dann streckte er dem Jugendfreund die Hand hin: »Adjüs, Bärtes! Ich komme dich besuchen. Grüß deine Frau – und nichts für ungut!«
Sie schüttelten sich die Hände; lange genug hatten sie hier oben auf zugiger Höhe gestanden, der noch nicht an die starke Luft Gewöhnte fühlte, wie der Wind ihm erkältend alle Knochen durchblies. Sie wollten sich eben trennen, als sie von einem Mädchen gestreift wurden. Eiligen Schritts, fast im Lauf, stürmte die junge Person den Fußpfad herauf.
»No, Bäreb«, sagte Leykuhlen, »wo köst du dann här? Jehst du dann net mieh no ’r Fabrik?«
Die schwarzen Augen blickten nur rasch von der Seite. »Dag zusammen«, sagte das Mädchen atemlos.
»Wat löffst du dann esu der Berg erop?« Der Bürgermeister hielt sie auf. »Willste dir de Lunge us ’m Hals renne?«
Das Mädchen schien das für einen Witz zu nehmen, es kicherte in sich hinein; aber dann machte es sich, ernst werdend, rasch wieder frei: »Loßt mich jonn, Hähr! Mi Motter is arg krank, seit diese Morje. Do konnt ich nit no’r Fabrik jonn. Mir hant die Frau jehollt, do saat die: hollt der Dokter. Do bin ich geloofe, han en äwer nit ajetroffe, de wor no’m Begräfniß vom Hähr aus ’m Schwan, on dann bei der Witfrau, der war et kollig*. Do bin ich no’m angere jejange, de wor beim Fröhschoppe, äwer de wellt nu diese Vormittag komme!«
»Wie is et dann mit der Mutter, Bäreb? Es et Köngd als do?«
»Jo, ’ne düchtige Jong, Hähr Burjermeester«, sagte das Mädchen mit Stolz. »Äwer mi Motter es siehr schwaach. Se liegt janz still un säät nühst.«
»Wer es dann bei ihr?«
»De Tünnes on et Drückche, de Jilles on de Dores; de angeren sin no’r Scholl.«
»Biste jeck?« Ganz wütend fuhr Leykuhlen das Mädchen an. »Läuft dat fort und läßt die kranke Frau mit den kleinen Kindern janz allein liegen!«
Das Mädchen brach in Tränen aus: »Wat soll ich dan maache? Mi Vatter es in Aoche, der könt net bis Samstig Aowend. Oß Doresche krog jester de Krämp, doröwer hat de Motter sich esu erfirrt**, se hätt jut drin bliewe könne, hat de Frau gesaat!«
»Das es en Öwerläg!***« Der Bürgermeister wischte sich über die Stirn. »Loof ens flott, Bäreb, loof! Loof bei ming Frau, se soll jleich mit dich jonn; un aus dem Keller soll se de Flasch Champagner holln – Champagnerwein, Bäreb, verstehste mich – davon jebt der Motter alle halw Stund ’ne Löffel ein. Ich hollen der Doktor!«
»Laß mich ihn holen! Geh du mit dem Mädchen; das ist besser!« Rasch entschlossen hielt Schmölder den Freund zurück. »Ich möchte auch was tun – helfen! Ich bitte dich, geh mit ihr. In zwanzig Minuten bin ich schon unten – oh, ich kann rennen – adieu – ich schicke ihn sofort herauf!«
Er wartete gar keine Entgegnung mehr ab. Er hörte kaum mehr, daß der Andere hinter ihm drein schrie: »Huesgen, Weber Huesgen, am grünen Klee!« In elastischen Sprüngen, plötzlich jünger geworden, setzte Josef den steilen Pfad hinunter. Loses Geröll prasselte hinter ihm drein.
2. Kapitel
Es hatte lenzen wollen, zu früh im Jahr. Nun kam der Schnee noch nach. Kein tiefer, fester Winterschnee, der unter den Tritten knarrt und die breiten Äste der Tannen belastet mit glitzender Pracht, der für Wochen und Wochen Heide und Weide in flaumweiche schützende Decken einwickelt und erst schmilzt, wenn wahrhaftiger Fühling kommt und die Schneelasten zu tauenden, befruchtenden Quellen wandelt, die die Bäche füllen, die Brunnen versorgen, jede Graswurzel tränken. Flüchtig weilende Flocken wirbelten dahin, aber sie näßten, erkälteten, durchschauerten bis ins Mark. Atemberaubend fauchte der Wind in Stößen, zerrte an den Kleidern, raffte Schnee zusammen und warf ihn wütend denen ins Gesicht, die sich ihm entgegen zu stemmen wagten.
Hinter seinen hohen Hainbuchenhecken, die sich giebelhoch, mit mauerfestem Astgefüge schützend vor jedes Haus im Dorf stellen, duckte sich Heckenbroich. Aber weiter hinauf, oben auf dem Vennbuckel, gab ’s keine schützenden Hecken mehr. Überhaupt keinen Schutz. Einem Ungeheuer gleich, gierig, zischend, pfeifend, schnaufend, bellend, brüllend tobte der Nordweststurm. Gewaltige Wolkengebilde rollten ihre schweren Leiber übers raschelnde Kraut. Keine Ahnung von Himmelsblau, kein Durchblick in die Ferne; alles grau, erloschen, verhangen, stumpf, tot. Und trostlos.
Und doch bauten sie. Die fünfzehn unter Simon Bräuer. Wie aus Stein stand der schwarze Kerl, die Beine breit gesetzt, den Kopf steil aufrecht; der Wind tat ihm nichts, er zwinkerte nicht einmal, wenn ihm eine Ladung Schnee wie nasser Sand gegen die Augen flog und sich ihm an die Wimpern klebte. Mit dem Auge des Raubvogels, dem runden, weitsichtigen, stoßsicheren, beäugte er seine Leute. Und sein Ton war hart, wenn er kommandierte. Pah, so ein bißchen Windrumoren und Nebelspreuen, was machte das? Es konnte hier noch ganz anders blasen. Er kannte das. Nicht umsonst hatte er als verwaister Junge hier oben den Bauern das Vieh gehütet und Beeren zwischen den Mooren gesammelt und später Torf gestochen und aufgesetzt und, knöcheltief im Wasser stehend, das Vennheu gemäht. Hier war er herumgestoßen worden von einem zum anderen, hier hatte er gefroren und oft auch gehungert, und doch, obgleich es ihm beim Militär so gutgegangen war – satt Essen und Trinken, warme Montur, freie Wohnung in den Kasematten in Köln, nie Arrest – er hatte sich doch immer hierher zurückgesehnt. Hier war seine Heimat.
Simon Bräuer, dem langgedienten Unteroffizier, der dann Aufseher zu Siegburg gewesen war, hatte man es gern bewilligt, als Pionier voranzugehen; es hatten sich ohnehin nicht viele gemeldet zur Kolonisation oben im Venn. Er hatte sich dazu gedrängt. Seine Frau hatte zwar geweint, seine Kinder sich an ihn gehängt – nein, dahin wollten sie nicht mit ihm gehen – aber er hatte kurz gesprochen: »Ich geh!« Wenn die Geschichte hier oben erst ordentlich im Gang war, zum Sommer vielleicht, dann sollten sie nachkommen.
Und nun atmete Simon Bräuer wieder Vennluft. Die Nasenflügel gebläht, die unter dem Schnauzbart sonst so fest aufeinandergepreßten Lippen halb geöffnet, schlürfte er den feuchten Schneedunst ein. Das tat ihm gut. Er hatte nicht einmal den dicken Uniformrock angetan, er ging im Leinenkittel; ihm war warm. Was froren denn die Kerle, warum klapperten sie mit den Zähnen?! Er fuhr sie an: hier wurde nicht geschnattert, wie alte Weiber tun, und auch nicht gehustet. Hier wurde frisch drauf los geschafft, nicht in die Hände gepustet und mit den Füßen gestampft! Er lachte.
»Frieren dir die Pfoten ab?« sagte er zu einem jungen Menschen, der, blau vor Kälte, in seinen Holzschuhen schlotterte. »Wenn du arbeitest, frierste nit – voran!«
Einen bösen Blick unter gesenkten Lidern herauf schoß der Sträfling, nur einen einzigen, Sekunden dauernden, kurzen Blick, aber der Aufseher schrie ihn an: »Hier wird nit jemuckst!«
Nein, sie hätten ja auch kein Wort gewagt. Mit gesenkten Köpfen, wie eine Herde, betäubt von Unwetter mit Blitz und Donnerschlag, so duckten sie stumm unter. Vor ihnen lag das Venn, ohne Schranken, frei und offen; sie hatten zwei Beine, Füße zum Laufen, wer wollte sie hindern, davonzurennen, dahinzuschießen wie ein Pfeil, vom straffen Bogen geschnellt? Dieser einzelne Mann doch wohl nicht?! Und doch rannte keiner. Sie waren wie geschlagen, wie gelähmt.
Nun arbeiteten sie schon ein paar Wochen hier; vom ersten Tagesstrahl an bis in den sinkenden Abend, bis die Nebel so dicht übers Venn krochen, daß sie wie in Wolken standen, daß keiner zehn Schritt weit den andern sehen konnte. Es war jetzt über sie selber eine Hast gekommen, war es doch ein zu schlechtes Kampieren in dem alten Torfschuppen, der an der Chaussee steht, die das Venn quer durchschneidet.
Dort schloß der Aufseher sie des Nachts ein. Er selber schlief im nächsten Haus des Dorfes, machte nur dann und wann unvermutet einmal die Runde. Er hätte auch das nicht nötig gehabt. So oft er aufschloß und mit der Laterne die fernsten Winkel der Strohhütte beleuchtete, sie waren alle da, und keiner von ihnen rührte sich.
Man hatte die kräftigsten unter den Gefangenen zu der Arbeit im Venn ausgesucht. Es hatten sich auch viele unter ihnen dazu gemeldet, mancher mochte wohl gedacht haben: da oben kannst du gut weg. Jetzt aber jetzt lagen sie hier ganz gleichgültig, wie Hunde in sich zusammengekrochen und was sie sich auch gedacht und erwartet haben mochten von der größeren Freiheit, jetzt hatten sie nur das eine Verlangen: schlafen, schlafen. Sie waren todmüde und eiskalt. –
Ein Stück Land war schon gerodet und planiert, man hatte Strünke und Heidegestrüpp abgebrannt, einen Zaun darum aufgeführt, roh aus Fichtenstangen zusammengeschlagen. Nun erhob sich in halber Mannshöhe bereits der Bau.
Die Dörfler hatten etwas zu bereden und zu besehen auch; sie standen von weitem, halb neugierig, halb scheu. Man hatte den Frauen und Kindern verboten, nahe heranzugehen – rumorten nicht jene Gestalten da wie die bösen Geister des Venns, den Sümpfen entstiegen?! Mit unheimlichem Druck lastete diese Nachbarschaft auf Heckenbroich.
Der Bürgermeister bekam in der nächsten Gemeinderatssitzung etwas anzuhören: wofür war er denn Bürgermeister und hatte das Wohl der Gemeinde zu vertreten, wenn er so was zustande kommen ließ? Nicht sicher war man jetzt mehr im eigenen Haus, man mußte zuschließen. Und wie sollte das erst werden, wenn die Beeren reiften im Herbst? Konnte man dann noch Frauen und Kinder sammeln schicken auf das Venn, wo die Verbrecher, die Halunken – Mörder wohl gar – sich herumtrieben?! Lange Jahre hatte man in Frieden im Dorfe gelebt, nun hatte man zu einer Hand das Lager – schlimm genug, daß die Soldaten den Mädchen nachpfiffen, und daß man sich fürchten mußte auf dem eigenen Acker, wenn Scharfschießen war – aber schlimmer noch war das Haus, das sie einem da im Rücken bauten. Das würde man sich nicht gefallen lassen! Hundert Jahre und darüber hatte das Venn dem Bauer gehört, er hatte sich dort Holz gehauen, wenn ’s ihm beliebte – ganze Tannen waren verschwunden in den Öfen von Heckenbroich – Torf hatte man sich gestochen und Streu geholt, wenn ’s Stroh knapp war, und nun kam auf einmal die Regierung, die sich sonst einen Dreck um das Venn gekümmert hatte, und legte die Hand drauf und setzte einem Gesindel her, vor dem man sich grausen mußte. Steine sollte man den Kerlen nachwerfen, wenn sie sonntags durchs Dorf zur Kirche getrieben wurden – mochten sie beten, wo sie wollten, nicht hier!
Der Bürgermeister hatte viel zu beschwichtigen. War es etwa seine Schuld, daß man ihnen die Strafkolonie so auf den Hals gerückt hatte?! Da hätte man sich eben selber daran machen müssen, das Venn anzubauen. Ganz verschließen konnte man sich doch der Einsicht nicht, daß die Neu-Anforstungen, gegen die man auch erst sich so mächtig gewehrt hatte, jetzt schon das Klima verbessert hatten, dem Wild Schutz gewährten und dem Wanderer, der ohne diese Schonungen sich ganz und gar verloren haben würde, wenigstens in etwas die Richtung angaben?! Diese weiten, öden Strecken von Sumpf und Heide – verlorenes Land – konnten sie der nächsten Generation nicht schon vielleicht Wiesen und Kartoffel- und Roggenäcker bieten?!
Bürgermeister Leykuhlen machte viele Worte, aber er überzeugte nicht. Es gab ein dröhnendes Gelächter im Gemeinderat.
»Dat sin wohl ooch eso ’n neumodsche Ideen, Hähr Burjermeester? Für eso jet sin mir net zu han. Ihr sedd im Jrongd jo ooch net dofür!« sagte der Bauer Balthasar Adams vom Hof am grünen Klee, einer der gewichtigsten von Heckenbroich und der höchste Steuerzahler. Er wurde ganz energisch: »Nee, mir bliewe beim Alde. Mir trecke oß Vieh, mir mähe oß Jras, un wann mer zo wennig han, dann welle mir oß Venn behaalde für oß uszehelfe. Oß Äldere woren domit zofredde, oß Jrußäldere ooch – nu hammer als die Iserbahn, dat is mieh wie jenug!«
Wahrhaftig, da hatte der Adams ganz recht! Es war gar kein Glück, wenn immer alles anders wurde, als es früher gewesen war. Wenn die Regierung helfen wollte, sollte sie lieber dem armen Mann ein Sümmchen vorstrecken, bar, gegen geringe Zinsen oder gegen gar keine, daß er sich noch eine Kuh zukaufen und sein Anwesen ausbauen konnte. Und in Futtermangelzeiten sollte sie Heu liefern und der Gemeinde überhaupt von den Steuerlasten abhelfen. So war der Eifel gedient. Dann würde bald nicht mehr geschrieen werden: »Arme Eifel!«
»Aber wir sind ja jar nit arm!« Leykuhlen schlug mit der Faust auf den Tisch, daß der Federhalter, der beim Tintenfaß lag, zu rollen anfing. Er ärgerte sich: »Wie könnt ihr dat nur immer nachsprechen! ›Arm, arm‹ – wer dat saat, kennt unsre Verhältniss’ jar nit. Weil wir nit mit allem eso voranjejangen sind, darum sagen sie ›arm‹! Un wir wären rückständig!«
»Oho, nit mit voranjejangen? Rückständig?! Oho!« Nun wurde der Adams noch hitziger, und er war doch sonst ein ruhiger Mann. »Wer sät dann immer, oß Kinder solle nit no’r Fabrik jonn?!«
»Hm!« Der Bürgermeister räusperte sich; er war über sich selber einen Augenblick im Zweifel. Richtig war ’s, er hatte immer gegen das Fabrikenlaufen geredet, er war auch dem Landrat schroff begegnet, wenn dieser ihm von Wasserleitung und so weiter gesprochen hatte, er schätzte das Althergebrachte und hing an dem von Eltern und Voreltern Überkommenen wie nur einer. Und doch – er warf den Kopf in den Nacken – nun wußte er wieder, woran er war. Er mußte gegen das eigene Herz sprechen; von »rückständig« mußte er sprechen. Denn es war eine Kurzsichtigkeit, offenbar eine Dummheit, sich gegen die Kolonisation da oben zu sperren. Erstens gehörte das Venn ja gar nicht der Gemeinde, sondern dem Fiskus, so war also überhaupt nichts anzufechten. Zweitens hatten die Gefangenen den Simon Bräuer über sich, einen Aufseher, der mehr in Banden hielt als Schloß und Riegel; Mörder waren sowieso nicht unter ihnen. Drittens konnte es der Gemeinde nur von Vorteil sein, wenn kolonisiertes Land ihre Ländereien begrenzte. Ja, es mußte einem doch wohl einleuchten: hat man gutes Wiesenland neben sich, so ist die eigene Wiese auch besser, und hat man Ackerland neben sich, so weht einem der Wind keinen Unkrautsamen ins Korn. Es ging nicht anders, man mußte die Leute, die in harter Fron harte Arbeit taten, wohl dulden!
Aber er sprach vor tauben Ohren. Kaum konnte man sich erinnern, daß eine Gemeinderatsitzung je so stürmisch geendet hätte. Die Bauern schimpften. Ohne Handschlag ging der Bürgermeister von ihnen fort. Sie blieben noch stehen in einem Trüppchen vor der Schule und disputierten laut und heftig untereinander. Leykuhlen sah sich nicht mehr nach ihnen um, obgleich er wußte, daß sie ihn beredeten. Ja, wie sollte das hier noch einmal werden?! Oh, sie waren durchaus nicht dumm, sie hatten es auch gelernt, beim Viehhandel ihren Vorteil wahrzunehmen und sich durch den schlauen Käufer von auswärts nicht überlisten zu lassen. Aber war das wohl eine Klugheit, die nur das Naheliegende sieht und nicht auch weiter in die Zukunft?! Die Stirn gerunzelt ging er langsam heim.
»Mariechen!« rief er übers halb-offene Gatter in den Flur hinein.
Es war ein altes Haus, in das er trat. So war das schon zu Lebzeiten von Mariechens Eltern gewesen, und die Großeltern hatten auch so gewohnt, und deren Eltern schon; »1724« stand, aus hölzernen Buchstaben gefügt, über dem niedrigen Eingang, durch den vor nunmehr zwanzig Jahren sie selber eingegangen waren, ein junges, glückliches Paar. Er hatte nichts ändern mögen am alten Familienhaus der Endepohls. So wie einst reichte auch heute noch das Dach an der Seite fast bis zur Erde herab, nur daß man das dick-bemooste, grün-braun gewordene Stroh hatte entfernen müssen und statt seiner Schieferplatten gelegt hatte. Das war nun längst nicht mehr so schön wie früher, als die bunten Feldblumen, Weidenrose und Klatschmohn, Klee und die weißen Sterne der Wucherblume luftig auf dem alten Dach geblüht hatten, und nur ungern hatte sich Leykuhlen dazu entschlossen. Aber das Gatter war noch keiner modernen Haustür gewichen, es zeigte noch sein kräftiges Tiefgrün mit den weißen Schnörkelverzierungen und dem schweren eisernen Klopfer in der Mitte. Der Backofen bauchte sich noch aus der Wand heraus wie ein Bienenstock, Kapuzinerkresse und ein Centifolienstrauch klammerten sich im Sommer an ihn und putzten die zartblaue Tünche mit feurigem Gelbrot und sanftem Rosa. Noch so wie einstmals waren die Balken der Länge und Quere nach braun gestrichen und karierten die Außenwände. Stall- und Scheuertüren leuchteten in freudigem Tiefblau. Farbenfroh lag das alte Haus hinter der mehrhundertjährigen Hecke. Diese war die schönste im Dorf, Leykuhlen hatte sie nicht niedergelegt, obgleich sie ihm das Licht nahm; sie war der Stolz der Vorfahren gewesen. So hielt auch er sie sorglich, fein gerade geschoren auf den Strich ragte sie wie eine Mauer, nur oben das Giebelfensterchen, Dachfirst und Schornstein guckten über sie weg.
»Mariechen!« Leykuhlen war aus dem dunklen Flur in die Küche getreten; auch hier war die Frau nicht. Einsam standen die silberblanken Melkeimer auf der weißgescheuerten Bank; der große, weitbauchige Milchkessel glänzte wie Gold daneben. Zerstreut sah er die vielen buntblumigen Teller an der Wand – »Zum Andenken« – »Sei glücklich« – »Aus Freundschaft« – »Aus Liebe« – wo war sie denn nur?! Wenn sie doch käme! Er sehnte sich nach ihr, heute mehr noch denn sonst. »Bärtes«, würde sie sprechen und ihm die Hand auf den Ärmel legen, »was ärgerst du dich? Hast du dich nicht schon oft über sie geärgert? Aber ruhig, sie kommen dir schon wieder, sie können ja gar nichts machen ohne dich – oder ärgerst du dich am Ende über dich selber?!« Ja, da hatte sie recht, wie immer, wie in allem! Das Herz wallte ihm plötzlich auf, wie einem ganz jungen und noch verliebten Ehemann. Er rief noch lauter, noch ungeduldiger: »Mariechen!«
Die Seitentür öffnete sich, die aus der Küche gleich in den Kuhstall führte, aber es war nur die Magd, die den schwarzhaarigen, glattgescheitelten Kopf hereinstreckte. »Se is nor Huesgens gangen. De Dores hat als widder de Krämp; dat Kathrinche kam se hollen!«
Also bei Huesgens war sie? Nun, da ging er ihr eben dorthin nach!
Es litt den Mann nicht mehr allein im Haus: was sollte er so einsam in der Stube sich Gedanken machen, die sie mit einem Wort vertreiben konnte?! Rascher, als er gekommen war, ging er wieder zum Haus hinaus. Eben als er in den Heckenausschnitt trat, rasselte ein Wagen übers holperige Pflaster vorüber; so rasch der auch fuhr, er erkannte den Landrat im Fond und trat unwillkürlich hinter seine Hecke zurück. Jetzt mochte er den nicht sprechen. Wo fuhr der hin? Zur Strafkolonie natürlich! Schon ein paar Briefe hatte er vom Landrat erhalten, worin er ihn aufforderte, doch einmal mit ihm dorthin zu fahren. Der interessierte sich sehr für die Kolonisation – wie eben für alles! Mit einem Seufzer, der mehr nach Unlust als nach Befriedigung klang, trat Leykuhlen wieder hinter seiner Hecke hervor und sah dem Wagen nach. Nein, das war heute nicht die Hotelequipage vom Schwan, die der Landrat sonst immer zu seinen Ausfahrten benützte, es war der Krümperwagen oben vom Platz; sie hatten ihn wohl heruntergeschickt. Der Landrat fuhr zum Diner ins Offizierskasino. Richtig, die Pferde bogen links um, trabten nicht weiter die lange Dorfstraße hinunter.
Leykuhlen ging die Dorfstraße abwärts, die so lang ist, weil kein Haus dicht neben dem andern liegt, sondern jedes mit Weide und Gärtchen und Gemüseland ganz allein für sich hinter seiner bergenden Hecke. Er atmete auf: nun, der Landrat kam ihm heute nicht in die Quere! Aber, vielleicht, daß Mariechen Lust hatte, dann wollte er wohl einmal mit ihr zur Strafkolonie gehen und sehen, wie die Leute da voran kamen. Es war ja nicht weit, von Huesgens Haus nur eine halbe Stunde. Und das Wetter war heute lind, angenehmer als in all den letzten Wochen.
Schon schwollen die Knospen dick und braun und wie glänzend lackiert an den Hainbuchenhecken. Wo es ganz geschützt war, geduckt unter dem knorrigen Hauptstamm, wagte sich allerhand Kraut hervor. Noch schliefen die Farne, die im Sommer so üppig unter den Hecken emporschießen, zu braunen Schnecken zusammengerollt; es war nur Unkaut, was jetzt grünte, aber es hatte gelbe Blütchen, wie winzige goldene Sternchen, und jetzt kam ein Kind gelaufen, hatte die ganze Faust voll davon und streckte sie dem Manne entgegen: »Dag, Hähr Burjermeester!«
Er nahm die Blümchen aus der Kinderhand und sah die Kleine freundlich an. Sie war sehr hübsch, hatte ein rundes Gesichtchen mit großen, sanften, tiefschwarzen Augen. Aber das runde Gesichtchen war blaß, und die Augen hatten keinen blanken Glanz. Es war etwas Ernstes in dieser Kindheit. Dieses Kind kriegte sicherlich Kartoffeln und Kaffee und wieder Kaffee und Kartoffeln und ein Stück Brot, und weiter nichts.
»Ah, du bis et, Kathrinchen«, sagte Leykuhlen, die Kleine jetzt erkennend. Es war die Elfjährige von Jörres Huesgen.
Er griff ihr unters Kinn und hob so das blasse Gesichtchen zu sich auf: »Sag ens, kocht din Motter ooch alle Dag wat?«
Kathrinchen nickte stumm.
»Wat dann?«
»Kaffee«, sagte sie leise.
»On Erdäppel?«
Sie nickte wieder.
Aha, gerade so, wie er sich ’s gedacht hatte! »Nühst angersch?« Schade, dieses zarte Ding würde auch bald in die Fabrik laufen wie seine ältere Schwester, die Bäreb, und würde schmalbrüstig werden und den Husten kriegen beim Rennen durch Wetter und Wind. Schade! Der Huesgen Jörres, der seine Not hatte, eines satt zu kriegen, hatte ihrer acht – nein, neun lebendige Kinder, da war ja erst neulich wieder eins angekommen – und mancher wohlhabende Mann, der sein halbes Besitztum gern dafür hingegeben hätte, der hatte keins! Es zog eine schmerzliche Erinnerung über das kräftige Männergesicht. Wie in einen Traum verloren, sah Leykuhlen in das weiche Kinderantlitz.
Die Kleine stand starr da, das Gesichtchen durch seine Hand emporgehalten; sie wagte nicht, sich zu rühren. Da gab er sie endlich frei. Er holte tief Luft: »So is et!« Und dann, wie sich besinnend: »No, Kathrinchen, sag ens, wat kocht din Motter als noch?«
»Nühst!«Das Mädchen sah ihn ganz verwundert an: das war doch wohl gut, Kaffee und Kartoffeln und ein Stück Brot – wenn man nur immer genug davon hätte! »Mi Motter is immer krank«, sagte sie schüchtern und tief errötend. »On oß Bäreb jeht no’r Fabrik. Ich koche dat. Dat kann ich als!«
Leykuhlen strich ihr übers Haar. »Komm, Kathrinchen«, sagte er und nahm sie an die Hand. Er hielt sie so ganz fest; die kleinen kalten Finger erwärmten zwischen den seinen und fingen an zu schwitzen. Sie gingen miteinander immer weiter über die lange Straße, aber sie sprachen nicht mehr. Der Mann war in Gedanken, und das Kathrinchen traute sich kein Wort. Es wäre gern davongesprungen, aber erst vor der halb eingefallenen Hecke, hinter der ganz niedrig, wie zusammengesunken, das Huesgensche Häuschen lag, wagte es, sein Händchen dem festen Griff zu entziehen. Hurtig und lautlos wie eine Maus huschte es in die dunkle Hütte und war verschwunden.
Sich tief bückend, um den Kopf nicht zu stoßen, folgte Leykuhlen dem Mädchen. Die Tür der Stube stand offen, er konnte aus dem Flur, der als Küche diente, gerade dort hineinsehen. Dunstig wie in einem Stall war die Atmosphäre, eine überwarme, dicke Luft in selten gelüftetem Raum. Er konnte sich nicht zu seiner ganzen Größe aufrichten, die schiefe Balkendecke hing ihm dicht überm Scheitel; er fühlte, wie ihm das Blut in die Stirn schoß – oder machte ihm das, was er sah, so seltsam heiß!?
Drinnen in der Stube neben dem Ehebett, auf dem die Huesgen lag, saß Mariechen auf dem Schemel. Sie hielt das Kleinste auf dem Schoß, ausgebündelt, ganz splitterfasernackend, als sei es eben geboren, und blickte darauf nieder mit einem Lächeln, wie er es nur einmal an ihr gesehen hatte.
»Mariechen!« wollte er rufen, aber er hielt an sich: nein, er wollte sie nicht stören, er durfte sie nicht stören. So war sie ganz in ihrem Element. Auf den Zehen ging er langsam rückwärts hinaus und sah dabei noch immer hin, obgleich er eigentlich gar nicht sehen wollte. Sie selber würde ja niemals mehr ein Kind bekommen, das hatte ihnen der berühmte Arzt in Aachen gesagt, sie hatten sich auch drein geschickt – aber – er seufzte – es war doch schwer! Zögernd nur entfernte er sich, ihr Lächeln bannte ihn. Und als er schon längst draußen war, sah er noch immer sein Mariechen vor sich mit diesem stillen, seligen und zugleich doch ein wenig schmerzlichen Lächeln.
Ohne daß er es wußte, hatte er den Weg höher hinauf zum Venn eingeschlagen. Er wurde dessen erst inne, als er die letzten Hecken und auch das Weideland, das ein dunkler Tannenbusch begrenzt, hinter sich hatte. Er sank plötzlich tief in weichen, schwarzen Moorboden. Jetzt war alles naß hier; die verdorrten Heidekrautbüschel ragten wie Schöpfe aus den Lachen, man mußte Obacht geben, wohin man trat. Das stöberte ihn aus seinem Sinnen auf, er sah um sich. So oft er auch hier oben schon gestanden hatte, hinter sich die unermeßliche Weite des Venns, vor sich die Hecken des friedlichen Dorfes, hinter denen die Häuser zu schlafen schienen, er empfand immer wieder die Wohltat dieser Unbegrenztheit, die Beruhigung dieser ungeheueren weltentrückten Stille. Daß er so lange nicht hier gewesen war! Wie sah es jetzt hier aus? Nun, viel war noch nicht zu sehen! Es war nicht viel anders als sonst; nur daß sie dort, wo der einsame Baum steht, der Galgenbaum, der wie ein dürrer Pfahl ragt und nur im Sommer einen kurzen, nach der Seite gewehten Schopf zeigt, jetzt rohe Balken aufeinandersetzten. Ein primitiver Bau! Hui, mußte der Wind durch die Lücken pfeifen! Er ging darauf los.
Ein harter Zuruf hielt ihn an: »Halt!«
Mit starken Schritten kam der Aufseher heran: »Was wollen Sie?«
Das klang drohend, und selbst, als jetzt Simon Bräuer den Heckenbroicher Bürgermeister erkannte, wurde sein Gesicht nicht viel freundlicher. Der Landrat war so und so oft schon hier gewesen und hatte ihn aufgehalten mit seinen Vorschlägen und Verbesserungen, und nun kam der Bürgermeister auch noch angerannt! Widerwillig gab er Auskunft: nun ja, sie waren am Arbeiten, das mußte ja auch so sein, das kostete den Staat eine Masse Geld hier oben und würde noch mehr kosten, noch viel mehr. Drainiert mußte der Boden zu allererst ordentlich werden – wo sollte sonst all die Nässe hin?! Aber dann, dann – ein freundlicherer Strahl huschte jetzt über das finstere Gesicht –, dann konnte es hier wohl was werden. Es mußte was werden!
Leykuhlen hörte die große Energie heraus in Wort und Ton. Bräuer war ihm nie sonderlich angenehm gewesen – ein verschlossener, unzugänglicher, finsterer Mensch – er erinnerte sich seiner noch als Junge, und daß er andere Jungen, die ihn auf der Weide täppisch neckten, mit Steinen blutig geworfen hatte; aber jetzt interessierte er ihn. Das war doch ein Kerl, mit dem etwas auszurichten war! Wie kam dieser blutarme Junge, der nie ein Bröckelchen Land zu eigen besessen hatte, der seine zwölf Jahre in den Kasematten von Köln verbracht und dann noch ein paar dazu als Aufseher hinter den Mauern von Siegburg, zu diesem lebhaften landwirtschaftlichen Interesse?!