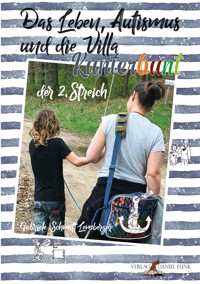
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Daniel Funk
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In der Villa Kunterbunt ist jeder Tag ein neues Abenteuer. Geleitet von einer Autistin mit ADHS und Hochbegabung, wird das Chaos kunstvoll jongliert, während sie gleichzeitig Mutter eines nonverbalen Autisten ist, der mit den Schatten schwerer Verluste kämpft. Doch das ist noch nicht alles - denn auch das tierische Rudel, bestehend aus einem selbstbewussten Kater, einem Schaf getarnt als Berner Sennenhund und einem Mini-Rottweiler im Körper eines Chihuahuas, bringt zusätzliche Farbe ins Leben. Abgeschieden am Waldrand, wo sich Fuchs und Hase "Gute Nacht" sagen, findet sich eine Familie, die trotz aller Widrigkeiten zusammenhält. Doch hinter den Worten "ausflippen" und "ausrasten" verbirgt sich weit mehr als nur oberflächliche Beschreibungen von Verhalten - es ist ein tiefer Einblick in die innere Welt eines Kindes, das seine Not auf seine eigene Weise ausdrückt. Als wäre der Alltag nicht bereits schwierig und chaotisch genug, gilt es dieses Mal auch noch die Traumata und posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) des Sohnes zu bewältigen. Die Autorin gibt wie im ersten Buch zahlreiche Tipps und Lösungsansätze, sie geht den Dingen auf den Grund und erklärt Ihre Herangehensweise an Beispielen aus ihrem Leben. Begleiten Sie diese außergewöhnliche Familie auf ihrer Reise durch Höhen und Tiefen, durch Lachen und Tränen. Durchleben Sie mit ihnen Momente der Offenheit, Toleranz und des Verständnisses, während sie sich den Herausforderungen des Lebens mutig stellen. Denn in der Villa Kunterbunt ist Langeweile ein Fremdwort, und Herausforderungen warten hinter jeder Ecke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Besuchen Sie uns doch auch im Internet!
www.verlag-daniel-funk.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar unter: https://dnb.dnb.de
Vielen Dank auch an The Astrid Lindgren Company, für die Erlaubnis den Begriff ‚Villa Kunterbunt‘ für dieses Buch nutzen zu dürfen.
© Verlag Daniel Funk | Söllmnitz 47 | 07554 Gera
1. Auflage Juni 2024
Autorin:Gabriele Schmitt-Lemberger
Illustrationen:Collin-Elias Benter
Lektorat & Korrektorat:Franca Peinel
Satz:Verlag Daniel Funk
Covergestaltung: Jean-Pierre Schwarze | JPS Werbung
Gabriele Schmitt-Lemberger
Das Leben,
Autismus
und
die Villa
Kunterbunt
… der 2. Streich!
Vorwort
Es geht munter weiter in der Villa Kunterbunt und langweilig wird es hier auch nie. Damit Sie wissen, mit wem Sie es im Verlauf dieses Buches zu tun haben, stelle ich Ihnen kurz die Bewohner unserer „Villa“ vor.
Ich bin diejenige, die tagtäglich versucht, das Chaos in unserer Villa zu bewältigen. Ich bin selbst Autistin, zusätzlich „beglückt“ mit ADHS und Hochbegabung. Ich bin Hypnosetherapeutin, Bloggerin und - wie unschwer zu erkennen ist - auch Autorin. Und in erster Linie natürlich Mama eines nonverbalen Autisten, der durch Schicksalsschläge und - nennen wir es einmal unschöne - Erlebnisse massive Traumafolgestörungen entwickelt hat. Als mein Sohn fünf Jahre alt war, ist mein großer Sohn tödlich verunglückt. Und mit zehn Jahren hat er seinen Papa verloren, der sich in einer schweren depressiven Episode suizidiert hat. Das ist schon ausreichend „Stoff“, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, aber da kommt noch mehr …
Dann lebt hier mit uns noch unser „Rudel“: der Kater, der - wie sollte es auch anders sein - den Ton angibt sowie unser „Mini-Rottweiler“ gefangen im Körper eines Chihuahuas und mittlerweile unsere „Blitzbirne“, ein Berner Sennen-Rüde, der unglaublich lieb, aber eben nicht immer sonderlich clever ist.
Gemeinsam leben wir recht abgeschieden und zurückgezogen am Waldrand, dort wo sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen, wie man so schön sagt.
Wenn Sie im Laufe des Buches Begriffe lesen wie „ausflippen“, „ausrasten“ und ähnliche Formulierungen, dann seien Sie sich gewiss, dass ich diese lediglich verwendet habe, um die Außenwirkung zu verdeutlichen. Denn diese Worte werden der inneren Not eines Kindes niemals gerecht, im Gegenteil, sie werten notwendige Verhaltensweisen auf sehr negative Weise. Und vorab: Ich danke meinem lieben Freund und Zeichner Collin, dass er für mich gezeichnet hat, obwohl er sich zu dieser Zeit, in der das Buch entstand, in einer extrem schwierigen Lebenssituation befand. Dadurch sind weniger Bilder entstanden, jedoch ich danke ihm von Herzen für jedes einzelne seiner Werke.
Ich hoffe, dass Sie die ein oder andere Erkenntnis aus diesem Buch gewinnen können, die zu mehr Verständnis, Offenheit und Toleranz führt.
1. Den Fokus ändern – und die Dinge ändern sich
Jaaaa, Moment, theoretisch klingt das ja ganz einfach, aber …
Aber … ich kenne die ‚Abers‘, … aber das ist ja anstrengend, aber da braucht man ja echt Zeit für, aber man kann ja nicht immer über seinen Schatten springen, aber das geht so nicht, aber, aber, aber …
Tatsächlich ist das zu Anfang echt anstrengend und mit Geduld, Arbeit an sich selbst, Selbstreflexion und auch nervenaufreibenden Aktionen verbunden. Aber (da ist es wieder dieses „Aber“), es ändert sich mit der Zeit wirklich so einiges.
Ich kenne selbst nicht wenige Situationen aus persönlicher Erfahrung, die einen schier an die eigenen Grenzen bringen, denn auch die eigenen Reserven sind endlich.
Und so musste ich mir überlegen, wie ich mit verschiedenen Situationen umgehen kann, wie ich Entspannung in den Alltag bekomme, wie ich den Stress für uns reduzieren kann.
Einige Alltagsbeispiele machen das wahrscheinlich etwas deutlicher:
Ergebnis: Tatsächlich geht er jetzt von sich aus zum Waschbecken, wenn er wieder heftig spucken muss und dadurch hat Mama weniger Stress, denn Meckern verursacht auch beim Meckerer Stress.
Seitdem werden beispielsweise Bilder noch immer von der Wand abgehängt, aber die bringt man dann zu Mama und die hängt sie wieder auf. Allerdings hat ‚Dinge werfen‘ seinen Sinn verloren und ist kaum noch notwendig.
Inzwischen kommt mein Sohn gerne an den Tisch zurück und setzt sich auch mal einen Moment, weil das Zurückkommen in freundlicher Atmosphäre stattfindet und das nächste Aufstehen nicht mit Meckern verbunden ist.
Der Drang aufzustehen kann so übermächtig sein, dass Sitzenbleiben einfach nicht funktioniert. Ist das Aufstehen dann doch nur wieder mit Meckern verbunden, bleibt man lieber gleich ganz weg vom Tisch und lässt das Essen sein.
Und ich höre schon die Frage: Was, wenn er es nicht aufhebt?
Zunächst stelle ich sicher, dass er meine Bitte verstanden hat, sowohl akustisch (Umgebungsgeräusche und so) als auch kognitiv (er kennt die Handlung ‚aufheben‘ und hat den Sinn des Gesagten verstanden). Also wiederhole ich meine Bitte so, dass er sie verstehen kann. Kennt er die Handlungsabfolge noch nicht, dann tue ich es mit ihm gemeinsam. Geht er stiften, weil er eben gerade keine Lust zum Aufheben hat, dann habe ich den längeren Atem. Das Bild bleibt zunächst einfach liegen. Und ich kann mir gaaaaaanz sicher sein, dass er früher oder später wieder auftaucht und etwas möchte. Essen, etwas trinken oder mit Mama spielen. „Klar, ich mach das gerne. Heb du schon mal das Bild auf, ich mache inzwischen das und das schon fertig.“ Ja, Mama ist da hartnäckig und das weiß mein Sohn.
Mir geht es hier darum, den Fokus vom Negativen weg zu lenken … weg von Gemeckere und Machtkämpfen (denn das resultiert zumeist daraus). Stattdessen lege ich den Fokus auf das, was meinem Kind gerade möglich ist und was er für sich erfolgreich umsetzen kann.
Wenn ich spucken muss, weil ich gerade eine mordsmäßige Spuckeansammlung im Mund habe, kann ich zum Waschbecken gehen.
Wenn ich etwas unbedingt von der Wand abhängen muss, kann ich es Mama bringen. Wenn ich beim Essen unbedingt aufstehen muss, kann ich stressfrei anschließend weiter essen. Wir sammeln lieber gute Erfahrungen und basteln daraus im besten Fall Strategien, die er für sich anwenden kann.
Und ja, das erfordert Geduld, das kann wochen- oder gar monatelang dauern, es kostet ganz viel innerlich von 1 bis 10 zählen … aber es lohnt sich, denn auf Dauer entspannt es alles.
„Den Fokus verlagern“ ist für mich jetzt nicht wirklich nur eine Technik, sondern eine innere Haltung. Ich komme weg von den Dingen, die nicht funktionieren, weg von Frust, innerem Stress und Gereiztheit. Mit der Zeit wird man gelassener und entspannter, was sich definitiv auf das Umfeld und somit auf mein Kind auswirkt. Es gibt hier noch so viele Beispiele dafür und mittlerweile ist das bei uns einfach Alltag. Es wird hier kaum gemeckert, wir schauen auf das, was man Positives daraus machen kann, denn so kann positives Verhalten stressfrei und im Alltag erlernt werden. Es ist nun mal so: Kinder lernen am Beispiel der Eltern und nicht durch Gemeckere.
2. „Non-verbal does not mean stupid!“
„Non-verbal (nicht sprechend), bedeutet nicht dumm!“
Ich sage es immer und immer wieder, weil es so wichtig ist. Nonverbale autistische Kinder werden viel zu oft von ihrem Umfeld völlig unterschätzt. Während sie zu Hause lesen, schreiben, rechnen und Englisch lernen, werden sie in Schulen dazu genötigt, bunte Wäscheklammern zu sortieren und Silben zu klatschen. Das ist völlig frustrierend und führt häufig zur völligen Verweigerung - zu Recht, ich würde mich da auch veräppelt fühlen -, was dann wiederum gerne zur Bestätigung genutzt wird, dass ja offensichtlich sei, dass das Kind nix versteht.
Gerne redet man mit non-verbalen Jugendlichen wie mit Kleinkindern oder man spricht lauter. So, wie manche Menschen Gehörlose „anschreien“, in der Annahme, sie würden das dann schon verstehen oder mit ausländischen Mitbürgern „gebrochenes Einfachdeutsch“ reden, als wäre das super sinnvoll. Das ist sehr respektlos und zeigt dem Gegenüber, dass man es nicht ernst nimmt! Die meisten autistischen Kinder hören sehr gut, denn die Ohren funktionieren meist prima - oft sogar zu gut. Autistische Kinder hören oft über große Entfernung Wort für Wort, was gesprochen wird und vor allem, was über SIE gesprochen wird. Auch verstehen die meisten Kinder sinnerfassend viel mehr, als ihr Umfeld glaubt oder sich vorstellen kann. Selbst dann, wenn die Kinder abwesend oder in sich selbst versunken zu sein scheinen, sind sie oft hochaufmerksam und speichern alles ab, was um sie herum gesagt wird.
Man redet dann ganz viel über sie, natürlich gerne in ihrem Beisein, denn sie verstehen ja nix. So reden viele Erwachsene, als sei das Kind gar nicht da, obwohl es direkt daneben sitzt. „Der bekommt ja eh nichts mit!“ Und Kinder müssen Dinge über sich hören, die sehr verletzend sind, ihr Selbstbild bis ins Mark erschüttern und tiefe Narben auf der Seele hinterlassen. Tiefe Wunden und Narben, die sie ein Leben lang mit sich herumtragen.
„Der ist wieder so anstrengend heute!“
„Mit dem kann man eh nicht arbeiten!“
„Das kann der nicht - versuch es gar nicht erst!“
„Das lernt der nie!“
„Das wird sich nicht mehr ändern!“
„Warum ausgerechnet ich?“
„Wenn er nur anders wäre, würde es uns allen besser gehen!“
„Wegen dem bin ich völlig eingeschränkt!“
„Ich wünschte, der wäre normal … Ich will auch ein normales Kind.“
Man wundert sich dann, wenn das Kind sich völlig verweigert oder aggressiv wird - muss wohl an der „geistigen“ Behinderung liegen!
Ich bin überzeugt davon, dass Verhalten IMMER Kommunikation ist. Dass dieses Verhalten zeigt, dass das Gerede um sich herum belastend ist. Alle reden und man kann nicht antworten und die Dinge berichtigen oder klarstellen … Dass Verhalten immer ein Gradmesser für Stress und nicht-verstanden-worden-sein ist. Gehen Sie mal so durchs Leben. Man erzählt ständig falsche Dinge über Sie, erzählt sich untereinander, was gut für Sie sei und wenn Sie sich dagegen wehren wollen, kommen Sie nicht zu Wort und es interessiert auch keinen! Und wenn Sie dann mit der sprichwörtlichen Faust auf den Tisch hauen, dann heißt es, Sie sind aggressiv und Pillen zum Ruhigstellen wären nicht schlecht, denn dann sind Sie weniger anstrengend. Na, wie fühlt sich das wohl an?!
Wenn non-verbale Autisten erst einmal einen Weg der Kommunikation gefunden haben - weil das Umfeld endlich verstanden hat, dass da wohl doch mehr in dem Kind steckt - sind viele Menschen oftmals völlig erstaunt, was da so „rauskommt“. Wie viele Gedanken, Bilder, Worte - wie viele Vorstellungen, Verletzungen, Träume und Hoffnungen. Wie viel sie doch zu sagen haben.
Mein Sohn schreibt sehr bildlich und direkt, manchmal sogar fast schon philosophisch. Für ihn war es eine Offenbarung, auf einem Talker schreiben zu lernen und zum Ausdruck zu bringen, was er braucht, was er möchte und was er fühlt.
„Non-verbal does not mean stupid!“ Ich sage es immer und immer wieder und werde nicht müde, das zu tun.
3. Das muss da weg!
Veränderungen sind blöd – also so richtig blöd. Vor allem ganz besonders blöd, wenn man nicht wirklich Einfluss darauf hat – wenn man eine Veränderung nicht einfach mal so wegmachen kann. Und wenn man dazu noch nonverbal ist und in seiner großen Aufregung und Entrüstung seinen Talker nicht wirklich bedienen kann, ist Veränderung noch blöder. Veränderung ist bei uns generell äußerst unerwünscht und wird nur in notwendigen Fällen geduldet.
Manche Dinge kapiert Mama nicht gleich, andere kann sie auch nicht beeinflussen.
Ein Mama-kann-da-was-machen-Beispiel:
Mein Sohn mochte Luftballons bisher immer total gerne. Schön bunt, sie knallen herrlich, wenn man sie zum Platzen bringt, sie sehen lustig aus, wenn sie hängen und man sie anschubst. Jedes Jahr zu seinem Geburtstag ist hier alles mit Luftballons dekoriert. Er mag Luftballons … eigentlich.
Er hatte glücklicherweise an einem Wochenende Geburtstag und Geburtstage sind hier sehr ‚entstresst‘. Oma und Opa kommen zum Kaffee, Mama – und ziemlich oft Oma – hat Kuchen gebacken, Geschenke gibt es in Geschenktüten oder unverpackt, müssen nicht gleich geöffnet werden, dürfen auch tagelang oder wochenlang stehen. Aber trotzdem ist irgendwie alles anders und macht Stress und es ist gut, wenn der Geburtstag vorbei ist. Das erste Mal seit Jahren fiel sein Geburtstag nicht in die Schulferien und er wurde quasi „genötigt“, in der Schule Geburtstag zu feiern. An und für sich schön, doch für meinen Sohn blöd, weil anders. Viel Aufmerksamkeit, kleine Geschenke bekommen und er will keine blöden Geschenke, denn Geschenke machen durcheinander im Kopf, Stress mit „alle wollen freundlich sein“ und gratulieren … also total blöd.
Als er an eben diesem Tag nach Hause kam, ist er wie ein Wilder durch das ganze Haus gerannt und hat völlig hektisch versucht, die Ballons von den Wänden zu reißen, alle zu zerbeißen und zum Platzen zu bringen … bis hin zum völligen Overload.
Okay, Mama merkte schon, dass da etwas gerade nicht gut läuft. Luftballons zerstören war bisher für ihn oft eine spaßige Angelegenheit, aber diesmal sah das so gar nicht nach Spaß aus. Vorsichtig fragte ich, ob die Luftballons weg sollen. Er bejaht, indem er mir die Luftballons entgegenhielt. Ich begann, die Luftballons zum Platzen zu bringen, einen nach dem anderen. Erleichterung trat ein. Er wurde ruhiger. Endlich verstanden. Als endlich alle Luftballons verschwunden waren, konnte er runterfahren und sich entspannen. Später können wir dann am Talker darüber reden. „Geburtstag soll fertig sein“.
Ahhhh … jetzt, ich verstehe … mit Luftballons weg, ist auch der Geburtstag weg, dieses stressige Anders-Gefühl, die ängstliche Erwartung, dass noch irgendetwas passiert … Also – das muss da weg, um den gewohnten Zustand wieder-herzustellen. Alter Zustand ist gut, der gibt Sicherheit.
Dann gibt es wiederum Zustände, an denen Mama auch nichts ändern kann. Ein Beispiel dafür war für mich recht prägend, weil es so deutlich war und ich es erst nicht sehen konnte.
Wir wohnen am Waldrand, auch viele Felder grenzen hieran. In den Sommerferien laufen wir täglich unsere bekannten Wege, und einer dieser bekannten Wege führt durch die Maisfelder in den Wald. Noch zu Anfang der Sommerferien konnten wir die Spaziergänge sichtlich genießen … entspannte Stimmung, entspanntes Tempo beim Laufen (ein wichtiger Indikator, denn bei Stress im Kopf ist nichts mehr mit entspanntem Tempo), entspanntes Kind. Also wirklich alles recht harmonisch, auch der Rest der Tage war mit Pool, Garten und in der Sonne liegen, recht entspannt.
Gegen Ende der Sommerferien wurden die Spaziergänge jedoch unruhiger. Der Mais stand höher und wuchs kräftig und schnell. Geändert hatte sich im Alltag nichts, Garten, Pool und Sonne waren noch immer mit Entspannung verbunden, aber rausgehen wurde immer schwieriger.
Zunächst dachte ich mir nicht wirklich viel dabei, als mein Sohn begann, an den Maispflanzen Blätter auszureißen und diese zu zerkauen – fühlt sich wohl gut an, denn eine Seite eines Maisblattes ist ganz rau, die andere recht weich. Ich ordnete dies als neue Erfahrung ein. Nur, dass diese Erfahrung scheinbar mit Stress verbunden war, denn mit jedem Tag riss er die Blätter hektischer und exzessiver aus, stoppte sie regelrecht in sich hinein und war da kaum zu bremsen. Auch die Bewegungen wurden hektischer, seine Körperspannung war bei unseren Spaziergängen enorm. Anziehen zu Hause war schon anstrengender als sonst. Schließlich war sein Stresslevel so hoch, dass er ganze Maispflanzen ausriss und versuchte, sie zu zerbeißen, und noch eine und noch eine, bis er im Overload ins Maisfeld rannte und sich dort auf den Boden warf. Erst langsam kam ich dahinter. Doch als erstes hieß es, meinen Sohn an einen sicheren Ort, nämlich nach Hause, zu bringen und mir das alles noch mal durch den Kopf gehen zu lassen.
Wenn der Mais hier sehr hochsteht, kann man nicht mehr weit sehen, das heißt, man sieht nicht, wer oder was einem entgegenkommt. Das Ganze ist also mit Unsicherheit und Kontrollverlust verbunden … keine Kontrolle, was nach der nächsten Biegung kommt, man kann sich innerlich nicht vorbereiten. Kontrollverlust bedeutet Panik. Panik führt hier manchmal direkt in den Meltdown. Das Ausreißen der Maispflanzen war der verzweifelte Versuch meines Sohnes, den alten Zustand wieder herzustellen, also Maispflanzen weg und die Übersicht wieder erlangen. Als er dann feststellen musste, dass er die vielen Pflanzen nicht alle „vernichten“ und somit nicht den gewünschten Zustand wiederherstellen konnte, hat das völlige Verzweiflung in ihm ausgelöst. „Nicht sehen was kommt Angst“. Der Meltdown war hier also eine logische Folge.
Wir sind dann andere Wege gelaufen, bis die ersten Maisfelder von den Bauern abgeerntet waren. Es hat einiges an Geduld und Überzeugungsarbeit gebraucht, um ihm zu zeigen, dass der alte Zustand wiederhergestellt ist und er wieder „gefahrlos“ dort laufen kann. Er hat so offensichtlich gezeigt, dass „das da wegsoll“, aber Mama hat etwas länger gebraucht, um zu verstehen.
Als er in diesem Jahr zum ersten Mal regelmäßig die Kugeln vom Weihnachtsbaum abgehängt und mir gebracht hat, dauerte es nicht ganz so lange, bis ich verstand was er wollte. Zunächst dachte ich, er macht sich einen Spaß mit mir und bringt die Kugeln, statt sie zu werfen. Aber relativ schnell verstand ich, dass er die Kugeln abhängte, um dieses ungewohnte Ding, das da nicht hingehörte – den Weihnachtsbaum – schnell loszuwerden. An Weihnachten ist ja auch irgendwie alles anders und Besuch kommt – wenn auch stark reduziert bei uns – und nicht wissen, wie lange diese komischen Tage noch anhalten. Den ganzen Baum konnte er nicht entfernen, aber die Kugeln und Mama so zeigen, dass das da wegsoll.
Der Baum stand in diesem Jahr ganze zwei Tage und wurde dann vor der Haustür im Vorgarten deponiert. Auch hübsch anzuschauen … also alles bestens.
Nicht jede Veränderung kann Mama beeinflussen, denn es gibt Dinge, die eben der Veränderung unterliegen. Im Herbst wollte er beispielsweise die Blätter weghaben, weil die da nicht hingehören. Aber dieser Widerwille gegen Veränderungen hat hier tatsächlich mit Angst und Überforderung zu tun und nicht mit bockig oder unkooperativ. In unseren Beispielen einmal die Angst, dass der Geburtstag noch eine Weile weiter geht und der Kontrollverlust im Maisfeld.
Einflüsse, die nicht änderbar sind, werden geübt oder wir nehmen einfach hin, dass Spaziergänge im oder am Maisfeld zu einer bestimmten Jahreszeit nicht möglich sind. Aber im sicheren zu Hause werden störende Veränderungen behoben, denn irgendwo muss man sich ja sicher fühlen können.
4. Arztsuche
Was wir auf der Suche nach Ärzten schon erlebt haben, ist eigentlich unglaublich. Eigentlich sollte gerade in Deutschland jeder Mensch das Recht auf eine angemessene ärztliche Behandlung haben, ohne darum betteln zu müssen. Wenn man jedoch „besondere Bedürfnisse“ hat, wird das verdammt schwierig.
Mein Sohn ist in Bezug auf Ärzte schwer traumatisiert. Auslöser war ein Wespenstich in die Zunge, als er sieben Jahre alt war. Wir wussten bis dato nicht, dass er hochgradig allergisch auf Wespen reagiert. Die Zunge war angeschwollen wie ein Ballon, passte nicht mehr in den Mund, er japste nach Luft, die Luftröhre schwoll zu und er hatte Angst zu ersticken, erlitt Todesangst. Beim Arzt angekommen, wurde er von zwei Ärzten, zwei Arzthelferinnen und zwei Sanitätern zwangsweise notversorgt.
Die Medikamente mussten rein, Zeit für Erklärungen gab es nicht und er hat in diesem Moment, als er festgehalten und versorgt wurde, um sein Leben gekämpft. Er hatte seine erste heftige Panikattacke. Dass dies so weitreichende Folgen haben würde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand erahnen.
Von diesem Tag an war jeder nachfolgende Arztbesuch eine Katastrophe. Jeder Gang in eine Praxis war begleitet von Beißen, Schreien, Schweißausbrüchen, Herzrasen, Fluchtverhalten. Ein Wartezimmer ging überhaupt nicht mehr, warten mit anderen Menschen auf engstem Raum wurde völlig undenkbar. Eine heftige Phobie, begleitet von Panikattacken, war geboren. Ein Besuch in einer Praxis ist seitdem nur sediert und zeitlich sehr befristet möglich, so kann er das Ganze halbwegs ertragen, von entspannt ist er dennoch weit entfernt. Jeder Arztbesuch ist für ihn mit dem Gefühl zu ersticken, Todesangst und Panikattacken verbunden.
Jetzt hatte mein Sohn vor einigen Wochen Zahnschmerzen. Ganz übel. Schmerzen, Praxis und dann auch noch der Mund. Gleich mehrere Trigger vom Feinsten, einfach mal zum Zahnarzt gehen, im Wartezimmer warten und den Mund aufmachen … unmöglich.
Die Suche nach einem Zahnarzt begann und um die Vollkatastrophe zu verhindern, schilderte ich gleich am Telefon, dass Warten im Wartezimmer unmöglich ist, dass er leicht sediert kommen müsse und der beste Termin gleich nach Öffnung der Praxis wäre, so ist der Patientenverkehr noch nicht allzu groß.
In zwölf Praxen habe ich angerufen, auch in Praxen, die auf Kinder und Menschen mit Behinderung spezialisiert sind.
„Tut uns leid, aber darauf sind wir nicht eingerichtet.“
„Ja, Wartezeiten lassen sich bei uns nicht vermeiden.“
„Da müssen Sie woanders hingehen.“
„Gleich zu Beginn? Also neee, das geht hier nicht.“
„Da müssen Sie in die Zahnklinik.“ (Genau DAS geht eben nicht! Zu groß, zu viele Menschen, zu lange Wartezeiten).
„Ach, der kommt sediert? Das können wir nicht verantworten.“
Die zwölfte Praxis hat sich mein Anliegen angehört, mit der Ärztin gesprochen und siehe da – wir durften zwanzig Minuten vor Praxisöffnung kommen, ohne Wartezeit direkt ins Arztzimmer. Die Ärztin fragte, was er jetzt bräuchte und wie man jetzt am besten untersuchen könne – und der Termin lief für alle Beteiligten ohne weitere Vorkommnisse … ES GEHT DOCH! Wenn das Praxis-Team nur will. Danke nochmals dafür.
Nach und nach haben sich immer mehr Ängste entwickelt und gefestigt. Ein Geräusch, ein Wort, eine Begegnung unterwegs reichten aus, um eine Panikattacke hervorzurufen.
Die Erklärung „reizüberflutet“ reichte hier bei Weitem nicht mehr aus.
Ich habe selbst einen therapeutischen Hintergrund und hatte einen Verdacht. Ich habe recherchiert und beobachtet – das können wir Autistinnen auch als Mütter sehr gut, also relativ objektiv beobachten und emotional Abstand nehmen, aber die allermeisten Ärzte glauben das nicht.
war (ich hatte eine mehrwöchige Amnesie) – also gefühlt Bruder und Mama verloren,
So viele Ängste und Diagnosen, aber nichts scheint wirklich zu all dem zu passen – zumindest nicht ausreichend. Das panische schrille Schreien mitten in der Nacht aus dem scheinbaren Nichts heraus – die Panikattacken selbst im geschützten Raum zu Hause – unvorhersehbare Attacken. Wie konnte ich das übersehen? … PTBS – posttraumatische Belastungsstörung. Die Erlebnisse und Extremerfahrungen, zusätzlich zur extremen Wahrnehmung und ständigen Reizüberflutung, sorgen dafür, dass traumatische Erlebnisse noch viel tiefer im Gehirn und im Unterbewusstsein abgespeichert werden … jeden Tag.
Unser damaliger Kinder- und Jugendpsychiater fühlte sich überfordert, das sei ihm zu komplex.
Mit der zuständigen Autismus-Ambulanz waren unsere Erfahrungen nicht die besten, aber keine, ich betone nochmals: KEINE EINZIGE Klinik im Umkreis mit Autismus-Ambulanz hat uns aufgenommen, obwohl ich die Symptome und unsere negativen Erfahrungen schilderte.
Also gut – in die zuständige Ambulanz. Ein Arzt in Ausbildung – das weiß er alles nicht, da kann er nichts entscheiden … Ich erklärte alles ausführlich – das hätte jedes Schulkind verstanden -, warum das Kind auf gar keinen Fall stationär gehen kann. Nonverbal und auf seine Struktur angewiesen, Verlustängste, schwer traumatisiert.
Stationär wäre er im Dauer-Meltdown, das heißt, man würde ihn dort im Time-out (Gummizelle) verwahren, ihn bei Bedarf – der wäre nach deren Ansicht gegeben – fixieren und zur Not sedieren (ruhigstellen). „Ah, Sie haben Angst vor den Zwangsmaßnahmen?!“ Gut erkannt, Arzt in Ausbildung. Denn das Ergebnis wäre ein zusätzliches Trauma und eine Medikation, die im häuslichen Umfeld überhaupt nicht nötig ist (nach wie vor sind wir zu Hause ein prima Team) und ein Kind, das das Vertrauen auch noch in Mama verliert, denn Mama hat ihn ja „dorthin“ gebracht.
Okay, Arzt in Ausbildung will Rück-sprache mit dem Chefarzt halten. Zwei Tage später der Anruf: Das Kind muss stationär, ansonsten wird er ihrerseits auch ambulant nicht weiter versorgt. Rummms – ein ganz tiefer Schlag in die Magen-grube und ins Mama-Herz.
Kann ich ihm das antun? Welche Schäden richte ich bei ihm an? Kann ich das überhaupt verantworten?
NEIN!!!
Durch langes Googeln, Suchen und auch ein Quäntchen Glück habe ich eine Adresse gefunden.
Der erste Arzt, der sich Zeit genommen hat, der mein Kind gesehen hat, und damit meine ich wirklich das Kind, nicht nur den Autisten und nicht nur eine Ansammlung von Symptomen.
Mein Sohn hat sich sogar anfassen lassen – freiwillig Kontakt aufgenommen. Es war unfassbar für diesen Arzt, dass keiner, und zwar wirklich keiner bereit war, ihn zu behandeln und die PTBS nicht wahrgenommen hat. Unverantwortlich, dass man ein so schwer traumatisiertes Kind stationär schicken und ihm den letzten Rest Sicherheit nehmen möchte – ohne Sicherheit und die Möglichkeit, Ruhe zu finden, ist überhaupt gar keine Stabilisierung möglich. Wir erfuhren Verständnis, Empathie und der Blick liegt auf dem Kind, das viel erleben und ertragen musste – er ist nicht nur eine Nummer und eine Diagnose.
Die Suche nach einem Arzt war für uns die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es fühlt sich wie Mobbing an und Ausgrenzung, weil mein Kind anders ist, für Ärzte schwierig ist, mehr Arbeit macht und Geduld erfordert.
Und immer wieder frage ich mich: Darf das sein?
Dass die ärztliche Versorgung für Kinder mit höherem Bedarf und mit komplexen Störungsbildern (so nennt man das nun mal) schwierig ist, war mir bewusst. Dass es jedoch fast unmöglich ist, hat mich zutiefst schockiert.
Mittlerweile ist unser Professor nur noch privatärztlich tätig, und als ich diese Nachricht erhielt, kam Panik in mir auf. Wie sollte es für meinen Sohn jetzt weitergehen? Nach monatelanger Suche musste auch unsere Krankenkasse zu dem Einsehen kommen, dass es keine geeignete und kompetente Alternative zu unserem Professor gibt. Mein Sohn wird privatärztlich versorgt, dank der Kostenübernahme durch die Krankenkasse. An dieser Stelle wirklich ein dickes und ernst gemeintes Dankeschön!
5. Autismus und Komorbiditäten – nur ein paar Gedanken
Wie ich immer wieder betone, schreibe ich nur von persönlichen Erfahrungen und habe weder den Anspruch noch die Kompetenz, alles zu erfassen und zu beschreiben.
Autismus und Komorbiditäten – ein Thema für sich, wie ich vor gut vier Jahren feststellen musste. Zu der Zeit keimte das erste Mal der Verdacht in mir auf, dass mit meinem Sohn „irgendetwas nicht in Ordnung“ ist. Ich ahnte, dass seine Ängste und die Meltdowns unterwegs, die irgendwie anders waren als die Meltdowns, die ich bisher von ihm kannte, eine andere Ursache haben mussten. Ich begann zu beobachten, Tagebuch zu führen, mein therapeutisches „Gehirn“ zu durchforsten und zu recherchieren, und ich muss sagen, die Recherchen waren mehr als enttäuschend und frustrierend. Ich erahnte bei meinem Kind eine PTBS, aber auf der Suche nach entsprechender Lektüre, um mich einzulesen, stieß ich auf genau: Nichts – gar nichts. Keine Bücher, keinerlei Literatur – einfach nichts. Fast so, als wären Komorbiditäten bei Autisten einfach nicht existent.
Also gut. Aufgrund meines therapeutischen Hintergrundes kenne ich die Symptomatik und konnte recht gut Zusammenhänge erkennen und ein „Bild“ zusammenfügen. Nun ist es aber so, dass mein Sohn nonverbal ist und somit der Weg, solche Symptome zu erkennen, wesentlich langwieriger und komplizierter. Es ist quasi reine Detektivarbeit. Die Voraussetzungen für eine PTBS waren mehr als erfüllt, die Meltdowns, die ich als völlig anders von außen erlebte, waren Flashbacks, seine Ängste wesentlich diffuser und sie kamen oftmals plötzlich aus dem Nichts. Es war mehr als offensichtlich, dass hier tatsächlich mehr dahintersteckte als „nur Autismus“.
Problem Nummer eins war also zunächst, entsprechende Literatur zu finden, denn die scheint es nicht zu geben.
Problem Nummer zwei: Finde einen Facharzt, der Autismus und die Symptome der PTBS auseinanderklamüsern kann, diese diagnostiziert und die Bedenken einer Mutter ernst nimmt.
Zu meinem damaligen Erstaunen war dies die größte Hürde. Damals war ich noch erstaunt – rund zwanzig KJP-Praxen (Kinder- und Jugendpsychiater), darunter zwei Kliniken mit Autismus-Ambulanz, lehnten die Diagnostik und die Behandlung direkt schon am Telefon ab, ohne meinen Sohn überhaupt gesehen zu haben und trotz meiner Schilderungen, dass es dringlich ist und mein Sohn dringend Hilfe benötigt. „Zu komplex“… „Auf solche Fälle sind wir nicht eingestellt“… „Zu viel Aufwand, wir haben schließlich noch andere Patienten“… „Das geht nur stationär“…
Ich war frustriert, wütend und traurig darüber, dass meinem Kind jede Hilfe verweigert wurde. Darüber, dass auch im medizinischen Bereich Ausgrenzung stattfindet. Darüber, dass Eltern, die um Hilfe suchen, abgewiesen und allein gelassen werden.
Beim weiß der Herrgott wievielten Anruf haben wir die berühmte „Nadel im Heuhaufen“ gefunden. Ein Arzt, der mich und meine Bedenken ernst nahm, der mein Kind ausgiebig beobachtet hat, der Autismus und die komorbiden Symptome und Erkrankungen auseinanderklamüsert bekommt, hilft und unterstützt. Der versteht, dass ein stationärer Aufenthalt ein zusätzliches Trauma verursacht und ich weiß, dass ein solcher Arzt ein Glückstreffer ist – quasi ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
Denn: Mit viel Glück findet man einen Fachmenschen, der sich mit Autismus und ADHS auskennt, aber Traumata??? Puh, nein, damit kennt er sich nicht aus. Oder man findet einen Traumatherapeuten, der dafür jedoch mit Autismus und dann noch mit einem nonverbalen Kind so gar nix am Hut hat. Und nun? Sie können es sich wohl denken – wir haben unseren eigenen Weg gefunden. Finden müssen, um mit den Herausforderungen im Alltag, den die PTBS zusätzlich mit sich bringt, umzugehen.
So, PTBS ist aber nicht die einzige Komorbidität, die sich bei Autisten gerne „einnistet“. Es gibt hier noch Depression, bipolare Störungen, Ängste in jeglicher Form, Zwangsstörungen, Psychosen, um nur einige wenige zu nennen. Und raten Sie mal – genau – zu nichts – zu gar nichts davon finden Sie Lektüre.
Lektüre für Eltern und Bezugspersonen, wie sie diese Situationen und Krisen mit ihren Kindern bewältigen können. Was bei Autisten in solchen Situationen anders läuft als bei NTs (=neurotypische Menschen). Wie sie unterstützen können. Dass viele Medikamente paradox wirken können und was dann zu tun ist.
Viele Ratschläge und therapeutische Interventionen, die für NTs wohl prima funktionieren, sind für Autisten nicht geeignet, kontraproduktiv, quasi für die Tonne. Und ich frage mich, warum findet man dazu nichts? Warum kam noch nie jemand auf die Idee, Eltern etwas an die Hand zu geben, wie sie mit ihren Kindern umgehen können, wie sie unterstützen können, was hilfreich sein könnte? Was zu beachten ist, weil das autistische Gehirn nun mal anders funktioniert und anders „gestrickt“ ist. Es scheint fast so, als seien Komorbiditäten bei Autisten nicht existent.
Es kann doch nicht sein, dass Eltern alle ein Psychologiestudium absolvieren müssen, um sich Wissen anzueignen, das sie dann mit Müh und Not auf ihre Situation anwenden können.
Ich bin in der glücklichen Lage, dass Psychologie mein SI (= Spezialinteresse) ist und ich einen recht guten therapeutischen Background habe. Ich kann die Verhaltensweisen während einer Depression einordnen. Ich weiß, wie ich mit einem psychotischen Kind umgehen kann und muss, um seine Symptomatik nicht noch zu verstärken und es wieder ins „Hier und Jetzt“ zu holen. Ich weiß, was Validierung (= grob gefasst: Mein Kind dort abholen, wo es steht, seine Wahrnehmung – gerade in der Psychose – ernst nehmen und anerkennen, nicht herunterspielen, aber auch nicht hochpuschen) ist. Aber mal ganz ehrlich: Man kann doch nicht ernsthaft von allen Eltern erwarten, dass sie das einfach so wissen.
Dass sie ohne fachliche Unterstützung ihr Kind begleiten können.
Dass es noch nicht mal Literatur zum Nachschlagen und Nachlesen gibt … Das gibt mir zu denken …
6. Autistische Kinder und Traumata…
Wie im vorherigen Kapitel bereits beschrieben, scheint in der Fachwelt die Kombination Autismus und PTBS noch nicht so ganz angekommen zu sein.





























