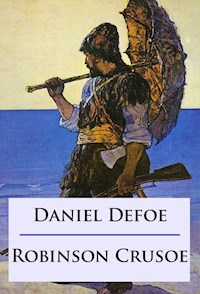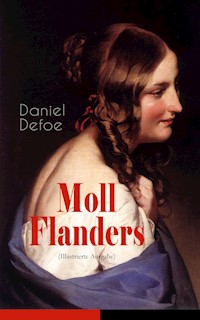Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Daniel Defoes Roman 'Das Leben, die Abenteuer und die Piratenzüge des berühmten Kapitän Singleton' erzählt die fesselnde Geschichte des jungen Seemanns Singleton, der sich auf ein Leben voller Abenteuer und Gefahren einlässt. Der Roman, der im 18. Jahrhundert veröffentlicht wurde, spiegelt Defoes realistischen Erzählstil wider und hebt sich von anderen Abenteuerromanen seiner Zeit ab. Singleton's mutige Reisen über die Weltmeere und seine Begegnungen mit Piraten und anderen exotischen Figuren faszinieren den Leser und lassen ihn in eine Welt voller Spannung und Intrigen eintauchen. Dieses Werk stellt ein wichtiges Beispiel für die englische Literatur des 18. Jahrhunderts dar und zeigt Defoes Geschicklichkeit im Erzählen von packenden Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Leben, die Abenteuer und die Piratenzüge des berühmten Kapitän Singleton
Inhaltsverzeichnis
Kapitän Bob Singleton
Große Männer, deren Leben merkwürdig gewesen und deren Taten auf die Nachwelt zu kommen verdienen, pflegen in ihren Aufzeichnungen hohen Wert auf ihre Abkunft zu legen und behelligen den Leser nicht nur ein Langes und Breites mit der Geschichte ihrer Familie sondern auch mit derjenigen ihrer Vorfahren, soferne von ihnen etwas zu erzählen ist. Wenn ich diesem Brauche folgen wollte, so müßte ich ein gleiches tun, allein ich kann meinen Stammbaum nicht weit zurückverfolgen, wie man bald ersehen wird.
Wenn ich der Frau glauben darf, die ich Mutter zu nennen gelehrt wurde, so nahm mich, als ich ein kleiner zweijähriger Knabe war, an einem schönen Sommerabende das Kindermädchen, die mich zu warten hatte, unter dem Vorwande mich in frische Luft zu bringen auf das Feld hinaus. Ich war gut gekleidet und hatte außerdem das Töchterchen eines Nachbars, ein zwölf- oder vierzehnjähriges Mädchen, zur Gesellschaft. Meine Wärterin – war es nun Zufall oder Verabredung – traf mit einem Burschen, wahrscheinlich ihrem Geliebten, zusammen, der sie mit sich in ein Gasthaus nahm, um sie mit Bier und Kuchen zu bewirten. Während sich das Pärchen in solcher Weise im Hause vergnügte, spielte draußen das Nachbarstöchterchen mit mir und führte mich, ohne etwas Böses dabei zu denken, durch den Garten hinaus aufs Feld, wo uns meine Wärterin bald nicht mehr sehen konnte. Wie es auch zugegangen sein mochte, kurz ich fiel einer Frau von dem Schlage derer, die sich kein Gewissen daraus machen, kleine Kinder zu rauben, in die Hände. Es war ein teuflisches Gewerbe, das in jenen Tagen besonders an gutgekleideten kleinen Kindern, bisweilen aber auch an größeren, die man nach den Plantagen verkaufen konnte, nicht selten geübt wurde.
Die Frau schien eine große Freude an mir zu haben: sie nahm mich auf ihre Arme, küßte mich, spielte mit mir, lockte meine Begleiterin immer weiter vom Hause weg, machte ihr endlich etwas weis und trug ihr auf, in das Haus zurückzukehren und meiner Wärterin zu sagen, wo sie mit dem Kleinen wäre: eine Dame von Stand habe Neigung zu dem Kinde gefaßt und lasse es auf ihrem Schoße spielen, die Wärterin brauche nicht besorgt zu sein, die Dame warte mit dem Knaben draußen. Das Nachbarmädchen ließ sich beschwatzen und kam dem Auftrage nach – und währenddessen machte sich die Dame mit mir aus dem Staube.
Nach dieser Zeit wurde ich, wie es scheint, an eine Bettlerin verhandelt, die zur Betreibung ihres Gewerbes eines ganz kleinen Kindes bedurfte, später kam ich zu einer Zigeunerin, bei der ich bis zu meinem sechsten Jahre blieb. Obgleich dieses Weib mich in allen Teilen des Landes mit herumschleppte, so ließ sie mich doch nie Mangel leiden, und ich nannte sie Mutter. Später sagte sie mir, daß sie nicht meine Mutter wäre, sondern daß sie mich für zwölf Schillinge von einer andern Frau gekauft hätte, welche ihr mitgeteilt, wie ich zu ihr gekommen wäre, und daß ich Bob Singleton hieße.
Es ist unnötig hier Vermutungen aufzustellen, in welchen Schrecken wohl die ungetreue Dirne, die mich vernachlässigt hatte, geraten war, welche Behandlung ihr in gerechtem Zorne von meinen Eltern zuteil wurde, und welches Entsetzen die Gemüter der letzteren bei dem Gedanken erfüllte, daß ihr Kind entführt sei. Ich habe, wie bereits erwähnt, nie erfahren, wer meine Eltern waren, und es wäre daher eine nutzlose Abschweifung, wenn ich hier davon reden wollte.
Es begab sich indes, daß meine gute Zigeunermutter – ohne Zweifel um einer ihrer wackeren Handlungen willen – im Laufe der Zeit gehängt wurde, und da sich dieser Vorfall zu einer Zeit ereignete, da ich noch nicht ganz in das Landstreichergewerbe eingeweiht war, so übernahm das Kirchspiel, in welchem sich dieses zutrug, auf dessen Namen ich mich jedoch nicht mehr besinnen kann, meine Versorgung. Meine frühesten Erinnerungen beschränken sich darauf, daß ich in eine Kirchspielschule ging, und daß der Geistliche des Ortes mir zu sagen pflegte, ich solle nur ein gutes Kind werden; denn wenn ich auch ein armer Knabe wäre, so könnte ich doch noch mein Glück machen, wenn ich nur meinen Katechismus fleißig lernte und Gott fürchtete.
Ich glaube, ich wurde etliche Male von einer Stadt zur andern geschickt – vielleicht, weil sich die Kirchspiele wegen der Herkunft meiner mutmaßlichen Mutter stritten – ich kann mich jedoch nicht erinnern, ob ich dabei zu Fuße gehen mußte oder fahren durfte. Die Stadt indes, in welcher ich endlich blieb, kann nicht weit vom Meere gelegen haben, denn ein Schiffseigentümer, der Neigung für mich faßte, brachte mich zuerst nach einem Orte unweit Southampton. Hier war ich bei den Zimmerleuten und anderen Handwerkern, die ein Schiff für ihn bauten, Handlanger, und als das Schiff fertig war, nahm er mich, ungeachtet ich noch nicht zwölf Jahre zählte, auf eine Seereise nach Neufundland mit. Ich lebte dort behaglich genug und wurde meinem Herrn so lieb, daß er mich wie seinen eigenen Sohn hielt, auch würde ich ihn gern Vater genannt haben, wenn er es mir verstattet hätte. Er wollte es aber nicht haben, weil er eigene Kinder hatte. Ich machte drei oder vier Reisen mit ihm und war bereits zu einem kräftigen Jungen herangewachsen, als wir auf dem Heimwege von Neufundland von einem algerischen Seeräuber abgefangen wurden. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, so fällt dieses Ereignis in das Jahr 1605, denn ich schrieb natürlich damals noch kein Tagebuch.
Dieser Unfall focht mich nicht besonders an, obgleich ich sah, daß mein Herr während des Kampfes eine Kopfwunde erhalten hatte und von den Sarazenen schwer mißhandelt wurde – ich sage, er focht mich nicht besonders an, bis mir unglücklicherweise ein paar Worte entfuhren, die, soviel ich mich erinnere, Bezug auf die barbarische Behandlung meines Herrn hatten, worauf man mir mit einem Stocke die Fußsohlen so unbarmherzig bearbeitete, daß ich mehrere Tage weder gehen noch stehen konnte. Doch auch bei dieser Gelegenheit war mir das Glück günstig, denn als der Korsar, unser Schiff als Beute im Schlepptau, angesichts der Bai von Cadix auf die Meerenge von Gibraltar lossteuerte, wurde er durch zwei große portugiesische Kriegsschiffe angegriffen, gefangengenommen und nach Lissabon geführte
Da mich meine Gefangenschaft wenig kümmerte, und ich überhaupt nicht wußte, welche Folgen mir daraus erwachsen könnten, so ließ ich mir meine Befreiung wenig angelegen sein, denn was hätte sie mir auch nützen können? Mein Herr, der einzige Freund, den ich auf Erden besaß, war in Lissabon an seinen Wunden gestorben, und es blieb mir daher in dem fremden Lande, wo ich niemanden, nicht einmal die Sprache kannte, nichts übrig als Hungers zu sterben. Jedenfalls war mein Los ein viel besseres als ich hoffen durfte, denn als die übrigen von unserer Mannschaft die Freiheit und das Recht erhalten hatten hinzugehen, wohin es ihnen beliebte, blieb ich, da ich nirgends ein Hin wußte, mehrere Tage auf dem Schiffe, bis mich endlich ein Leutnant sah und Erkundigungen einzog, was der junge englische Hund wolle, und warum man ihn nicht an Land bringe.
Ich hörte dies, verstand, wenn auch nicht gerade seine Worte, so doch den Sinn derselben und fürchtete mich sehr, denn ich wußte nicht, wo ich einen Bissen Brot hernehmen sollte. Unmittelbar darauf kam auch der Lotse des Schiffes, ein alter Matrose, der meine verdutzte Miene sah, auf mich zu und erklärte mir in gebrochenem Englisch, daß ich fort müßte.
Aber wohin soll ich gehen? fragte ich.
Wohin du willst, war seine Antwort, nach Hause, nach England!
Aber wie soll ich dahin kommen? versetzte ich.
Hast du denn niemanden hier? fragte er.
Auf der ganzen Welt keinen als jenen Hund dort, erwiderte ich und zeigte auf den Schiffshund, der kurz zuvor ein Stück Fleisch gestohlen hatte und damit in meine Nähe gekommen war, worauf ich es ihm abjagte und selber verzehrte, er ist mein Freund gewesen und hat mir mein Mittagessen gebracht.
Nun nun, sagte er, am Essen soll es dir nicht fehlen. Willst du mit mir gehen?
Von Herzen gerne, antwortete ich.
Der alte Lotse nahm mich mit nach Hause und behandelte mich ziemlich gut, obgleich es mit dem Essen karg genug herging. Ich wohnte ungefähr zwei Jahre bei ihm, während welcher Zeit er sich um eine Anstellung bewarb. Er wurde auch endlich Schiffsmeister auf einer Gallone, die nach Goa in Ostindien gehen sollte, und brachte mich, sobald er die Bestallung hatte, an Bord, um seinen Schiffsverschlag zu beaufsichtigen, in welchem er Vorräte von Branntwein, Zitronat, Zucker, Gewürze und dergleichen für den eigenen Gebrauch aufhäufte und später auch eine beträchtliche Menge europäischer Güter: als feiner Spitzen, Leinwand, Wollstoffe und ähnlicher Sachen, angeblich seinen Kleidervorrat, einlud.
Ich war zu jung, um ein Tagebuch über diese Reise zu führen, obgleich mein Herr, der für einen Portugiesen ein ganz tüchtiger Mann war, mich dazu aufforderte, allein meine Unkenntnis der Sprache war indes ein Hindernis oder galt wenigstens als Entschuldigung. Dessenungeachtet blickte ich aber nach einiger Zeit in seine Bücher und Karten, und da ich eine leidliche Handschrift schrieb, auch einiges Latein verstand und das Portugiesische zu radebrechen anfing, so lernte ich einiges von der Seefahrerkunst, obschon nicht soviel als wohl für ein so ereignisreiches Leben, wie das meinige werden sollte, hinreichend gewesen wäre.
Wir besuchten auf unserer Reise nach Ostindien die Küste von Brasilien. Nicht daß dies der gewöhnliche Weg gewesen wäre, aber unser Kapitän machte zuerst, sei es auf eigene Rechnung oder im Auftrage der beteiligten Kaufleute, einen Abstecher nach jener Gegend, wo wir in der Allerheiligenbai fast an hundert Tonnen Güter ablieferten und einen beträchtlichen Haufen Gold nebst einigen Kisten Zucker und über achtzig Rollen Tabak, jede mindestens einen Zentner schwer, einnahmen.
Im Auftrage meines Herrn mußte ich an der Küste die Geschäfte des Kapitäns besorgen, bei welcher Gelegenheit ich gar eifrig für den Vorteil meines Auftraggebers tätig war, und um ihn für sein Vertrauen zu belohnen, fand ich Mittel und Wege, mir ungefähr zwanzig Goldstücke, die von den Kaufleuten für Rechnung unseres Schiffes ausbezahlt wurden, zu sichern, das heißt zu stehlen, eine Kunst, die ich leider nur zu bald von den Portugiesen lernte, was ich hier offen gestehe, da ich entschlossen bin, dem Leser nicht bloß meine Abenteuer, sondern auch meine Verirrungen zu berichten.
Von hier aus hatten wir eine erträgliche Fahrt nach dem Kap der guten Hoffnung. Mein Herr hielt mich für einen tätigen und treuen Diener, wovon das erstere wohl richtig, das letztere aber ein ziemlich unverdientes Lob war. Infolge dieses argen Irrtums gewann mich der Kapitän so lieb, daß er mich häufig bei seinen eigenen Geschäften verwandte. Für meinen Diensteifer belohnte er mich durch manche Auszeichnung und gab mich als eine Art von Gehilfen für seine eigenen Tafelbedürfnisse dem Proviantmeister des Schiffes bei. Durch solche Mittel hatte ich Gelegenheit, für den Diener meines Herrn, das heißt für mich selbst, Sorge zu tragen und mich in einer Weise zu versehen, daß ich besser lebte als sonst einer auf dem Schiffe, denn der Kapitän verfügte selten über die Schiffsvorräte, ohne daß auch ein Teil für mich abfiel. Nach ungefähr siebenmonatlicher Fahrt, von Lissabon aus gerechnet, langten wir in Goa an, wo wir weitere acht Monate blieben. Mein Herr war die ganze Zeit über fast immer an Land, und ich hatte in der Tat nichts weiter zu tun, als den Portugiesen, die das treuloseste, schwelgerischste, anmaßendste und grausamste Volk der ganzen Christenheit sind, ihre Schuftigkeit abzulernen. Diebstahl, Lüge, Meineid und schändlichste Liederlichkeit gehörten unter der Schiffsmannschaft zur Tagesordnung, und so sehr die Matrosen mit ihrem Mute prahlten, so waren sie doch im Grunde die hasenherzigsten Memmen, die mir je vorgekommen sind, wie sich denn auch ihre Feigheit bei vielen Gelegenheiten offenbarte. Dessenungeachtet fanden sich auch hin und wieder minder schlimme unter ihnen, und da ich hauptsächlich mit diesen verkehrte, so kannte ich gegen die übrigen kein anderes Gefühl als die tiefste Verachtung, welche sie auch in jeder Hinsicht verdienten.
Ich paßte übrigens ganz gut in eine solche Gesellschaft, denn in meinem Herzen wohnte auch nicht das mindeste Gefühl für Tugend und Religion. Ich hatte davon niemals mehr gehört als was mir ein guter alter Pfarrer in meinem achten oder neunten Lebensjahre gesagt hatte. Aber selbst in diesem verderbten Zustande blieb mir ein so entschiedener Abscheu gegen die heillose Niederträchtigkeit der Portugiesen, daß ich nicht umhin konnte, sie von Anfang an von ganzem Herzen zu hassen, ein Gefühl, das ich in meinem ganzen späteren Leben nie verloren habe.
Einem englischen Sprichwort nach muß indes, wer mit dem Teufel an Bord geht, mit dem Teufel segeln. Ich war nun einmal unter ihnen, und so mußte ich denn eben mit ihnen zurechtkommen, so gut es ging. Wie schon oben erwähnt, hatte mein Herr mir erlaubt, daß ich dem Kapitän bei seinen Arbeiten behilflich sein sollte. Ich erfuhr später, daß der Kapitän meinem Herrn für meine Dienste monatlich einen halben Gulden bewilligt und daß er meinen Namen in der Schiffsliste eingetragen hatte. Ich erwartete daher, daß er bei der nächsten Löhnung, die alle vier Monate statthatte, auch mir etwas abgeben würde. Ich irrte mich jedoch in meinem Herrn, denn etwas der Art fiel ihm nicht entfernt ein. Er hatte mich im Unglück aufgenommen, weshalb es ihm gut dünkte, mich aufs beste auszubeuten. Anfangs glaubte ich freilich, er hätte mich bloß aus Menschenliebe und aus Mitleid mit meiner kläglichen Lage unterstützt, und als ich an Bord gebracht wurde, zweifelte ich nicht, daß mir für meine Dienstleistungen auch ein Lohn würde.
Er dachte jedoch, wie es scheint, ganz anders darüber, denn als ich einmal nach einem Löhnungstage einen Bekannten zu ihm schickte, um mit ihm über die Sache zu sprechen, geriet er in einen furchtbaren Zorn, nannte mich einen englischen Hund, einen jungen Ketzer, und drohte mich der Inquisition zu übergeben. In der Tat, von allen Ehrentiteln, die sich mit den Buchstaben des Alphabets schreiben lassen, verdiente ich den eines Ketzers am allerwenigsten, denn da ich gar nichts von Religion wußte, weder von der protestantischen noch der katholischen noch der mohammedanischen, so konnte ich wohl unmöglich ein Ketzer sein. Es fiel übrigens etwas Unbedeutendes vor, was mich beinahe in die Hände der Inquisition gebracht hätte, und hätte man mich da nach meinem Glauben gefragt, so würde ich mich sicherlich zu dem ersten besten bekannt haben, und ich würde mich zu einem Märtyrer für eine Sache gemacht haben, die mir ganz und gar ein böhmisches Dorf war.
Aber der Priester, den wir bei uns hatten, der Schiffskaplan, wie man ihn nannte, rettete mich; als er sah, daß ich in Glaubensfragen ganz unwissend war und alles tat oder sagte, was man von mir verlangte, legte er mir einige Fragen vor, die ich so einfältig beantwortete, daß er versicherte, er bürge dafür, daß ich ein guter Katholik sei, und er hoffe das Mittel zu werden, meine Seele zu retten. Er suchte auch ein Verdienst darin, seinen Worten Ehre zu machen, und so stutzte er mich in etwa einer Woche zu einem so guten Katholiken zurecht, als nur einer auf dem Schiffe war.
Ich erzählte ihm sodann den Vorfall mit meinem Herrn und teilte ihm mit, es sei wohl wahr, daß er mich unter den allerkläglichsten Umständen auf dem Lissaboner Kaper gefunden und aufgenommen, daß ich ihm nicht genug für die Wohltat, mich an Bord eines Schiffes gebracht zu haben, danken könne, da ich in Lissabon hätte Hungers sterben müssen und in Anbetracht dergleichen Wohltaten erklärte ich, wollte ich ihm gern dienen, aber ich hoffte, daß er meinem Eifer eine kleine Anerkennung zuteil werden oder daß er mich wenigstens wissen lassen würde, wie lange er meine Dienste noch unentgeltlich verlangen wollte.
Aber das alles war umsonst. Weder der Geistliche noch sonst jemand konnte ihn überzeugen, daß ich nur sein Diener nicht aber sein Sklave war. Er behauptete das letztere auf den Grund hin, daß er mich von einem algerischen Schiffe genommen hätte: ich also ein Muhammedaner wäre, der sich für einen Engländer ausgäbe, um die Freiheit zu erlangen, und wollte mich daher als einen ungläubigen Hund den Händen der Inquisition überliefern.
Dies schüchterte mich über alle Maßen ein, denn ich hatte niemanden, der mir bezeugen konnte, wer ich wäre und woher ich käme, aber der gute Pater Antonio beruhigte mich in dieser Hinsicht auf eine Weise, die ich damals aber noch nicht verstand. Er kam nämlich des Morgens mit ein paar Matrosen zu mir und erklärte, er wolle mich untersuchen und sich überzeugen, ob ich ein Muhammedaner sei oder nicht. Ich war ebensosehr verwundert wie erschrocken, denn ich verstand von allem nichts und konnte mir nicht denken, was man mit mir vorhabe. Man zog mir die Hosen herunter und schien zufrieden zu sein, daß ich kein Mohammedaner wäre. So entging ich wenigstens diesmal der Grausamkeit meines Herrn. Diese grausame Behandlung und die Möglichkeit, seinen Händen zu entfliehen, ließen mein Gehirn alle Arten von Unheil ausbrüten, und ich kam endlich, nachdem ich alle andern Mittel überlegt und als unausführbar gefunden hatte, zu dem Entschlusse ihn zu ermorden. Mit diesem höllischen Vorhaben im Herzen sann ich ganze Tage und Nächte über die Möglichkeit es zu bewerkstelligen nach, aber ich hatte weder ein Schießgewehr noch einen Degen noch sonst eine Waffe, womit ich ihm hätte ans Leben gehen können. Ich dachte an Gift, wußte aber nicht, woher ich welches bekommen sollte, oder wenn dies auch der Fall gewesen wäre, so konnte ich nicht einmal die Landessprache soweit, um es fordern zu können. Ich mußte daher in seinen Banden bleiben, bis das Schiff, nachdem es seine Ladung eingenommen hatte, den Heimweg nach Portugal antrat.
Ich kann nichts von dieser Fahrt erzählen, da ich kein Tagebuch führte, ich erinnere mich nur noch, daß wir auf der Höhe des Kaps der guten Hoffnung durch einen gewaltigen Sturm aus West-Süd-West zurückgeschlagen wurden und sechs Tage und sechs Nächte lang ostwärts trieben und endlich an der Küste von Madagaskar Anker warfen.
Der Sturm war so heftig gewesen, daß das Schiff starken Schaden genommen hatte und der Ausbesserung bedurfte. Während das Schiff vor Anker lag, brach unter der Mannschaft wegen Nichtbezahlung des Heuerrückstandes eine Meuterei aus, und man stand im Begriffe, den Kapitän ans Ufer zu setzen und mit dem Schiffe nach Goa zurückzukehren. Ich wünschte von ganzem Herzen, daß dies geschehen möchte, denn mein Gehirn brütete Rachepläne, und ich war entschlossen das Äußerste zu wagen. Man gab indes auf mich wenig acht, denn ich galt nur als ein Knabe, sonst hätte mir mein aufrührerisches Treiben, das ich ziemlich offen zur Schau trug, schon in diesem frühen Alter einen Strick um den Hals eintragen können. Einige von den Meuterern gingen sogar damit um, den Kapitän zu ermorden, dieser erhielt jedoch Wind davon und brachte einige von der Bande zum Teil durch Geld und Versprechungen, zum Teil durch Drohungen und gewaltsame Maßregeln zu einem Bekenntnis der Einzelheiten der Verschwörung. Die Beteiligten wurden augenblicklich festgenommen, und da immer der eine vom andern aussagte, so befanden sich bald sechzehn Leute, unter ihnen auch ich, in Ketten und Banden.
Der Kapitän geriet über den Vorgang, der ihn mit so ernstlicher Gefahr bedroht hatte, in große Wut, und da er im Sinn hatte das Schiff von seinen Feinden zu säubern, so wurde Gericht über uns gehalten und wir allesamt zum Tode verurteilt. Ich war zu jung, um auf den Gang des Prozesses zu achten, und erinnere mich nur noch, daß der Zahlmeister und einer der Kanoniere auf der Stelle gehangen wurden, während ich mit den übrigen demselben Schicksal entgegensah. Ich kann nicht gerade sagen, daß diese Aussicht einen besonders tiefen Eindruck auf mich machte, denn ich kannte wenig von dieser und nichts von der andern Welt, obgleich ich mich noch entsinne, daß ich viel weinte.
Der Kapitän begnügte sich jedoch mit der Hinrichtung dieser beiden. Einige von den übrigen krochen zu Kreuze, versprachen sich ordentlich zu verhalten und wurden begnadigt, aber über fünf, zu denen ich gehörte, lautete das Urteil dahin, daß sie an irgendeinem Eiland ausgesetzt werden sollten. Es lag im Interesse meines Herrn, mir Gnade zu erwirken, was jedoch von dem Kapitän rundweg abgeschlagen wurde, welcher erklärte, daß ich, soferne ich an Bord bliebe, gehangen werden müßte, denn es wäre ihm hinterbracht worden, ich sei unter denen gewesen, welche hauptsächlich auf seine Ermordung gedrungen hätten, es stünde daher meinem Herrn frei für mich zu wählen, was ihm am besten dünke. Der Kapitän schien mir meine Beteiligung an dem Komplott besonders übel zu nehmen, weil er mir soviel Güte erwiesen und mich vorzugsweise zu seinem persönlichen Dienst verwandt hätte. Die Wahl wäre ihm [meinem Herrn] wohl nicht schwer gefallen, wenn er meine wohlwollende Gesinnung gegen ihn gekannt hätte, die in nichts Geringerem bestand, als ihn bei der ersten Gelegenheit zu ermorden.
Ich sollte nun einem unabhängigen Leben anheimgegeben werden, allerdings ein Zustand, für den ich übel genug vorbereitet war, denn ich war ganz und gar unfähig von der Freiheit einen vernünftigen Gebrauch zu machen. Meine Jugend oder meine Dummheit ließen jedoch keinen Kummer in mir aufkommen, da ich die Folgen nicht abzuschätzen verstand.
Freilich hatte diese gedankenlose Unbekümmertheit auch ihr Gutes, denn wenn sie mich waghalsig und zu jedem Unheil fähig machte, so hielt sie auch die Sorge und Traurigkeit fern, welche sonst gern die Begleiterinnen des Unglücks sind und den Geist so bedrücken, daß ihm nicht die nötige Freiheit bleibt auf Mittel zu sinnen, welche imstande sind die Lage des Augenblicks zu verbessern. Dies war auch wirklich bei meinen Gefährten der Fall, die sich im Augenblicke der Not so verzagt benahmen, daß die Furcht, verhungern zu müssen, von wilden Tieren gefressen, umgebracht, vielleicht von Kannibalen verzehrt zu werden, keinem andern Gedanken mehr Raum gab.
Ich mochte kaum siebzehn oder achtzehn Jahre zählen, als mir mein Schicksal angekündigt wurde. Ich vernahm es, ohne eine Spur von Entmutigung zu zeigen. Ich fragte allerdings, was mein Herr dazu sage, und erfuhr dann, daß er alles aufgeboten hatte, um mich zu retten. Ich wußte ihm aber für seine Fürbitte beim Kapitän wenig Dank, denn es war mir wohl bekannt, daß der Grund nicht in seiner Liebe zu mir sondern in seiner Eigenliebe lag, er hätte nämlich gar zu gern den Lohn, mit dem ich auf der Schiffsliste stand, und der sich nebst dem, was mir für den persönlichen Dienst bei dem Kapitän berechnet wurde, auf sechs Dollar monatlich belief, für mich eingestrichen.
Auf die Nachricht von der wohlwollenden Fürsprache meines Herrn bat ich um eine Unterredung mit ihm, und als man ihm meinen Wunsch hinterbrachte, besuchte er mich.
Auf meine Bitte, mir meine Kleider verabfolgen zu lassen, meinte er, ich würde wohl wenig Kleider brauchen, denn es sei geringe Hoffnung für mich vorhanden lange am Leben zu bleiben, er hätte gehört, auf der Insel, auf der wir ausgesetzt werden sollten, wohnten Menschenfresser, und wir würden ihnen wohl als leckere Braten gelegen kommen. Ich erklärte hierauf, dies mache mir nicht so viele Sorge als die Gefahr des Verhungerns, denn wenn die Einwohner in der Tat Menschenfresser wären, so dürften sie wohl eher uns als wir ihnen als Speise dienen, falls man ihnen nur beikommen könnte. Die Gefahr bestände für uns nur darin, daß wir keine Waffen hätten, um uns zu verteidigen, weshalb ich ihn um weiter nichts bäte, als daß er mir ein Gewehr, einen Säbel, Pulver und Kugeln geben möchte. Er lächelte und sagte, er wisse nicht, ob der Kapitän meinem Gesuche willfahren werde, er wolle indes tun, was er könnte, um meiner Bitte geneigtes Gehör zu verschaffen. Er hielt Wort und schickte mir des andern Tags eine Flinte mit der Nachricht, der Kapitän wolle uns die Munition erst zugehen lassen, wenn wir alle am Strande, und seine Anker gelichtet wären. Auch sandte er mir das wenige an Kleidern, die ich noch auf dem Schiffe hatte.
Als wir auf der Insel an Land gesetzt wurden, erschraken wir nicht wenig über das wilde Aussehen der Bewohner, obschon ihr Äußeres nicht ganz so entsetzlich war, wie es uns die Matrosen geschildert hatten. Als wir jedoch in nähere Berührung mit ihnen kamen, sahen wir, daß es keine Kannibalen waren, denn es fiel ihnen nicht ein sogleich über uns herzufallen und uns zu verzehren. Im Gegenteil, sie kamen auf uns zu, setzten sich zu uns nieder und betrachteten mit neugieriger Verwunderung unsere Kleider und Waffen. Auch versahen sie uns mit Nahrungsmitteln, die gerade zur Hand waren und vornehmlich aus Wurzeln bestanden, später brachten sie uns Fleisch und Geflügel in Menge.
Dies hob den Mut meiner Gefährten wieder merklich. Waren sie anfangs ganz niedergeschlagen gewesen, so wurden sie jetzt ganz zutraulich gegen die Eingeborenen und gaben ihnen durch Zeichen zu verstehen, daß wir bei ihnen bleiben würden, wenn wir uns einer freundlichen Behandlung vermutet sein könnten. Diese Erklärung schien ihnen Freude zu machen, obgleich sie weder die Notwendigkeit kannten, die uns zwang, noch die Furcht ahnten, die wir vor ihnen hatten.
Das Schiff blieb noch vierzehn Tage in der Bucht, um die im letzten Sturm erlittenen Beschädigungen auszubessern und Holz und Wasser einzunehmen. Während dieser Zeit kam das Boot öfter an Land und brachte uns verschiedene Erfrischungen. Die Eingeborenen glaubten, wir gehörten zum Schiffe, und waren ziemlich höflich. Wir wohnten in einer Art von Zelt oder vielmehr Hütte, die wir aus Zweigen gemacht hatten, und zogen uns nachts zuweilen in einen Wald zurück, der etwas abseits lag, um ihnen die Meinung beizubringen, wir seien an Bord gegangen. Indessen verrieten sie doch einen rohen, heimtückischen und bösartigen Charakter. Furcht war die Quelle ihrer Höflichkeit, und sie schienen entschlossen, sobald das Schiff abgesegelt sein würde, über uns herzufallen. Diese Beobachtung flößte meinen Leidensgefährten die größten Besorgnisse ein. Einer derselben, ein Zimmermann, ging in seiner Angst so weit, daß er bei Nacht nach dem Schiffe schwamm, obgleich es eine Seemeile entfernt lag, wo er so kläglich um Aufnahme flehte, daß sich der Kapitän endlich bewegen ließ seinem Ansuchen zu willfahren, nachdem er ihn zuvor volle drei Stunden im Wasser hatte schwimmen lassen.
Als er an Bord war, hörte er nicht auf, bei dem Kapitän und den übrigen Offizieren für uns zu flehen, allein dieser blieb bis zum letzten Tage unerbittlich. Als er sich zum Absegeln anschickte und den Befehl erteilt hatte, die Boote aufs Schiff zu holen, kam die ganze Mannschaft vor die Schranken des Halbdecks, auf dem der Kapitän und einige seiner Offiziere auf und ab gingen. Der Bootsmann wurde aufgefordert für sie zu sprechen. Er fiel vor dem Kapitän auf die Knie nieder und bat ihn in den demütigsten Ausdrücken, die vier Mann wieder an Bord zu nehmen und ihnen auf seine Bürgschaft zu verzeihen oder sie lieber in Ketten zu halten und in Lissabon dem Gericht auszuliefern, als sie hier der Barbarei der Wilden oder dem Blutdurste der reißenden Tiere preiszugeben. Lange gab ihm der Kapitän kein Gehör. Endlich ließ er ihn verhaften und drohte ihm für seine Verwendung mit der neunschwänzigen Katze.
Auf diese harte Antwort bat ein Matrose, der mehr Kühnheit besaß als die übrigen, Seine Gnaden mit aller schuldigen Achtung, er möchte wenigstens noch einigen von der Mannschaft erlauben an Land zu gehen, um mit ihren Gefährten zu sterben oder sich mit ihnen womöglich gegen die Eingeborenen zu halten. Mehr erzürnt als eingeschüchtert durch dieses Gesuch kam der Kapitän an die Schranken des Halbdecks und antwortete jedoch mit kluger Mäßigung – denn hätte er in einem rauhen Tone gesprochen, so würden zwei Drittel der Mannschaft, wenn nicht alle, das Schiff verlassen haben – ihre sowohl als seine eigene Sicherheit habe ihn zu dieser Strenge genötigt, er könnte es bei seinen Vorgesetzten nicht verantworten, das ihm übergebene Schiff mit seiner Ladung Männern anzuvertrauen, welche die schwärzesten Pläne gehegt hätten, er wünschte zwar von Herzen, daß er sie irgendwo anders hätte an Land setzen können, wo sie den Wilden weniger preisgegeben wären, da er nicht ihren Untergang beabsichtige, indem er sie sonst ebensogut an Bord hätte hinrichten lassen können wie die beiden andern, und es wäre ihm lieber gewesen, das Verbrechen hätte in einem andern Teile der Welt stattgefunden, wo er sie einem Landesgericht hätte übergeben oder bei einem christlichen Volke hätte zurücklassen können, aber besser sei es, ihr Leben stehe auf dem Spiel, als das seinige samt der Sicherheit des Schiffes, und wenn etwa einer von ihnen, obwohl er sich nicht bewußt sei, dies an ihnen verdient zu haben, deswegen, weil er sich weigere, eine Rotte Verräter an Bord zu behalten, welche sich zu seiner Ermordung verschworen hätten, wenn also einer lieber das Schiff verlassen als seine Pflicht tun wolle, so werde er dies nicht hindern noch sie wegen ihrer Unbotmäßigkeit bestrafen, aber nie, und sollte er allein auf dem Schiffe zurückbleiben, nie werde er in die Aufnahme der Empörer willigen.
Diese an sich sehr vernünftige Rede wurde so gut und mit soviel Mäßigung vorgetragen und schloß so bestimmt, daß der größte Teil der Mannschaft für den Augenblick zufriedengestellt war, aber die geheimen Beratungen, zu denen sie Veranlassung gab, dauerten noch einige Stunden fort, und da auch der Wind gegen Abend nachließ, so befahl der Kapitän, die Anker nicht vor dem folgenden Morgen zu lichten.
In der Nacht noch wandten sich dreiundzwanzig Mann, worunter der Gehilfe des Stückmeisters, der Assistent des Wundarztes und zwei Zimmerleute waren, mit der Bitte an den ersten Offizier, den Kapitän um Erlaubnis zu ersuchen, zu ihren Kameraden ans Land gehen und mit ihren Gefährten sterben zu dürfen, sie könnten in diesem äußersten Falle nicht anders handeln, denn wenn es ein Mittel gäbe, das Leben ihrer Gefährten zu retten, so sei es eine Verstärkung, die sie instand setzte, sich so lange gegen die Wilden zu halten, bis sie früher oder später Gelegenheit fänden zu entkommen und in ihr Vaterland zurückzukehren.
Der Offizier antwortete ihnen, er wage es nicht, über diesen Punkt mit dem Kapitän zu sprechen, und sei sehr ungehalten darüber, daß sie so wenig Achtung vor ihm hätten ihm solches zuzumuten; wenn sie jedoch entschlossen seien ihr Vorhaben auszuführen, so riete er ihnen, am Morgen beizeiten das lange Boot zu nehmen, die Erlaubnis des Kapitäns zu benutzen und einen höflichen Brief an ihn zu hinterlassen, worin sie ihn unter anderm bäten, das Boot, welches sie mitgenommen hätten, wieder abholen zu lassen, da sie es redlich wieder zurückgeben wollten. Schließlich versprach er noch, ihren Anschlag vorderhand geheim zu halten.
Eine Stunde vor Tagesanbruch schifften sich dreiundzwanzig Mann in aller Stille ein. Jeder hatte sich mit einer Flinte und einem Säbel bewaffnet, außerdem nahmen sie noch eine Anzahl Pistolen und einen ziemlichen Vorrat von Pulver und Kugeln, alle ihre Kisten, Kleidungsstücke, Instrumente, Bücher und dergleichen und ungefähr ein halbes Hundert Brote mit.
Der Kapitän erfuhr von ihrer Abfahrt erst, als sie schon die Hälfte des Weges nach der Küste zurückgelegt hatten. Alsbald rief er, da der erste Geschützmeister krank in seiner Koje lag, den Stückmeistersgehilfen, um auf die Flüchtlinge Feuer zu geben, aber zu seinem größten Ärger war der Gerufene selber unter der Zahl der Vermißten, und eben diesem Umstande verdankten sie den großen Vorrat an Waffen und sonstigem Kriegsbedarf. Als der Kapitän sah, wie die Sachen standen, und daß nichts mehr zu tun war, machte er gute Miene zum bösen Spiel, rief die Mannschaft zusammen, sprach freundlich zu ihnen und versicherte sie seiner Zufriedenheit mit ihrer Treue und Brauchbarkeit. Er wolle zu ihrer Aufmunterung, sagte er, den Sold, den die Entwichenen noch zu fordern gehabt hatten, unter die Zurückgebliebenen verteilen, und er könne sich nun Glück wünschen, daß das Schiff von einem aufrührerischen Gesindel befreit sei, das nicht den geringsten Grund zur Unzufriedenheit gehabt hätte.
Diese Worte fanden eine sehr gute Aufnahme und besonders günstig war der Eindruck, den das gegebene Versprechen der Soldverteilung auf die Mannschaft machte. Hierauf erhielt der Kapitän den oben erwähnten Brief aus den Händen seines Kajütenjungen, den die Entwichenen diesem hinterlassen hatten. Er war so ziemlich desselben Inhalts wie ihre Bitte an den Leutnant, der ihnen seine Verwendung verweigert hatte. Nur setzten sie am Schlusse noch hinzu, da sie keine unehrliche Absicht hätten, so hätten sie auch nichts mitgenommen, was sie nicht ihr Eigentum nennen dürften, außer einigen Waffen und der erforderlichen Munition, soviel deren zu ihrer Verteidigung gegen die Wilden und zu der für ihren Unterhalt erforderlichen Jagd unumgänglich notwendig wäre, und da sie noch beträchtliche Rückstände zu fordern hätten, so hofften sie, er würde ihnen den mitgenommenen Kriegsbedarf dagegen überlassen. Was das lange Boot beträfe, auf welchem sie an Land gefahren, so wüßten sie, daß er es nicht entbehren könnte, und wären bereit es zurückzugeben. Wenn er daher Leute danach aussenden wollte, so sollte diesen eine höfliche Behandlung zuteil werden und keinem ein Leid widerfahren, auch wollten sie nicht den geringsten Versuch machen sie zu überreden, bei ihnen zu bleiben. Endlich baten sie den Kapitän noch demütig, er möge ihnen zur Verteidigung und Erhaltung ihres Lebens noch ein Fäßchen Pulver und sonstigen Kriegsbedarf schicken und ihnen Mast und Segel des Bootes überlassen, damit sie, wenn es ihnen möglich sein sollte, selbst ein Boot irgendeiner Art zustande zu bringen, in See gehen könnten, um sich in diejenige Gegend der Welt zu flüchten, in welche sie ihr Schicksal führen würde.
Hierauf kam der Kapitän, der die Zurückgebliebenen durch seine Worte gewonnen hatte und mit der allgemeinen Ruhe völlig zufrieden war, denn wirklich waren es die unzufriedensten Köpfe gewesen, die sich entfernt hatten, wieder auf das Halbdeck und rief die Mannschaft zusammen, um ihnen den Inhalt des Briefes mitzuteilen. Wiewohl sie es nicht verdient hätten, so wolle er sie doch nicht hilfloser machen, als sie selbst freiwillig es getan hätten, deshalb sei er geneigt, ihnen einigen Kriegsbedarf zu schicken. Sie hätten zwar nur um ein Fäßchen Pulver gebeten, er wolle ihnen aber zwei schicken und zudem noch Kugeln oder Blei nebst Kugelformen in verhältnismäßiger Anzahl. Ja, um ihnen zu zeigen, daß er gütiger sei, als sie es verdient hätten, gab er sogar Befehl, ihnen noch ein Fäßchen Arrak und einen großen Sack voll Brot zu ihrem Unterhalt zu senden, bis sie imstande sein würden, sich selbst die nötigen Nahrungsmittel zu verschaffen. Die Mannschaft gab der Freigebigkeit des Kapitäns ihren Beifall zu erkennen, und jeder einzelne legte noch das eine oder das andere für uns bei. Gegen drei Uhr nachmittags landete die Pinasse an unserer Küste und nahm das große Boot wieder zurück. Die Mannschaft der Pinasse, zu welcher der Kapitän nur solche gewählt hatte, von denen er überzeugt war, daß sie nicht zu uns übergehen würden, hatte den gemessenen Befehl bei Todesstrafe, keinen von uns an Bord zu nehmen, und beide Teile waren so gewissenhaft, daß wir sie nicht zum Bleiben und sie uns nicht zum Mitgehen einluden. So war denn unsere Schar ziemlich groß. Wir waren im ganzen unser siebenundzwanzig, sehr gut bewaffnet und vom Mundvorrat abgesehen mit allem hinlänglich versehen. Wir hatten zwei Zimmerleute, einen Geschützmeister, und was soviel wert war wie alles übrige, einen Wundarzt bei uns. Letzterer war nämlich zu Goa bei einem Wundarzt als Gehilfe gewesen und bei uns als überzählig aufgenommen worden. Die Zimmerleute führten ihr ganzes Handwerkszeug und der Arzt seine sämtlichen Instrumente und Arzneimittel bei sich, und wir hatten überhaupt eine ganze Menge Gepäck. Im einzelnen war es indes nicht viel, denn mancher hatte wenig mehr als er auf dem Leibe trug, und zu diesen letzteren gehörte auch ich, aber ich hatte etwas, was keiner von allen besaß: die 22 Goldstücke, die ich mir in Brasilien zugeeignet hatte, und 2 Dollar. Die beiden letzteren und ein Goldstück zeigte ich, mehr nicht, und keiner von meinen Gefährten schöpfte jemals Verdacht, ich könnte mehr auf der Welt mein Eigentum nennen, denn alle wußten, daß ich als armer Knabe aus Mitleid aufgenommen und von meinem grausamen Herrn gleich einem Sklaven, ja noch schlimmer, behandelt worden war.
Daß wir vier über die Ankunft der übrigen erfreut waren, läßt sich wohl denken. Zwar fürchteten wir anfangs, sie kämen, um uns zum Strang abzuholen, aber alsbald wurden wir durch ihre Versicherung beruhigt, daß sie das gleiche Los mit uns teilen wollten, nur mit dem Unterschiede, daß wir uns demselben gezwungen, sie aber sich freiwillig unterworfen hatten.
Die erste Neuigkeit, die sie uns nach der kurzen Erzählung ihrer Flucht mitteilten, war die Aufnahme unseres Gefährten an Bord. Wie er aufs Schiff gekommen war, konnten wir uns nicht vorstellen, denn er hatte sich heimlich von uns entfernt, und wir vermuteten, er müsse in den Wäldern entweder von wilden Tieren zerrissen oder von den Eingeborenen ermordet worden sein. Als wir aber vernahmen, er sei endlich mit großer Schwierigkeit an Bord genommen worden und habe Verzeihung erhalten, wurden wir wieder ruhiger.
Da wir nun durch die angekommene Verstärkung instand gesetzt worden waren uns zu verteidigen, so war unser erstes, uns gegenseitig die Hand darauf zu geben, daß wir uns nie und unter keinen Umständen trennen sondern miteinander leben und sterben wollten, daß jedes erlegte Tier Gemeingut sein sollte, daß bei jeglichem Beginnen Stimmenmehrheit gelten müßte, und in keinem Stücke auf den eigenen Plänen beharrt werden dürfte, wenn sich die Mehrheit dagegen ausspräche. Auch sollte auf beliebige Zeit ein Kapitän gewählt werden, der uns regieren und leiten sollte, der auch, solange er im Amt wäre, bei Todesstrafe unbedingten Gehorsam fordern dürfte. Zu dieser Würde sollte jeder der Reihe nach berechtigt sein, der Kapitän jedoch in keinem Stücke ohne Wissen der übrigen und ohne die Zustimmung der Mehrheit handeln dürfen.
Die Eingeborenen kümmerten sich wenig um uns. Sie fragten nicht und wußten nicht, ob wir bei ihnen bleiben würden oder nicht, und ebensowenig war ihnen bekannt, daß unser Schiff auf immer abgegangen war und uns hier zurückgelassen hatte, denn am andern Morgen, nachdem wir das lange Boot zurückgegeben, war das Schiff südwärts unter Segel gegangen, und nach vier Stunden hatten wir es aus den Augen verloren.
Am folgenden Tage gingen vier von uns, je zwei in verschiedener Richtung, landeinwärts, um die Gegend näher zu untersuchen. Wir fanden bald, daß sie einen sehr angenehmen Aufenthalt versprach.
Das Land hatte Überfluß an Vieh und Früchten, aber wir wußten nicht, ob wir nehmen durften, was wir fanden, und ob wir gleich notgedrungen waren auf Nahrung auszugehen, so scheuten wir uns doch, uns ein ganzes Volk Teufel auf einmal auf den Hals zu laden. Deswegen machten einige den Vorschlag, eine Verständigung mit den Eingeborenen zu versuchen, um zu sehen, wie wir uns gegen sie zu verhalten hätten. Elf Mann wurden mit dieser Sendung beauftragt. Sie versahen sich gut mit Waffen und waren zu jeder Verteidigung gerüstet. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie, daß sie einige Eingeborene gesehen hätten, und daß diese sehr höflich, aber beim Anblick ihrer Flinten gewaltig erschrocken gewesen wären, denn sie hätten offenbar gewußt, was es damit für eine Bewandtnis hätte. Sie hätten den Wilden durch Zeichen zu erkennen gegeben, daß sie Nahrungsmittel zu erhalten wünschten; hierauf hätten sich diese entfernt und Wurzeln, Kräuter und etwas Milch gebracht, aber es läge am Tage, daß sie es nicht wegzuschenken sondern zu verkaufen gesonnen waren, indem sie durch Zeichen fragten, was man ihnen dafür geben wollte.
Die unsrigen kamen in Verlegenheit, denn sie hatten nichts bei sich, was sie austauschen könnten. Indessen zog einer von ihnen ein Messer hervor und zeigte es den Wilden. Sie betrachteten es mit einer Gier, als wollten sie den kleinen Finger darum geben, und feilschten lange genug um den Gegenstand ihrer Bewunderung. Einige boten Wurzeln, andere Milch, endlich einer eine Ziege, für welche denn auch die Ware losgeschlagen wurde. Darauf wies ein anderer von unsern Leuten ein zweites Messer vor, aber die Eingeborenen hatten nichts mehr dagegen auszutauschen, was kostbar genug gewesen wäre. Nun gab einer durch Zeichen zu verstehen, daß er etwas holen wollte. Drei Stunden lang warteten unsere Leute auf seine Rückkehr. Endlich brachte er eine kleine und kurze, aber sehr fette Kuh und gab sie gegen das Messer hin.