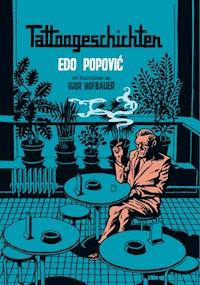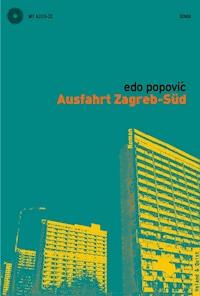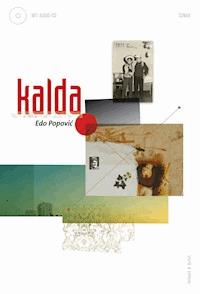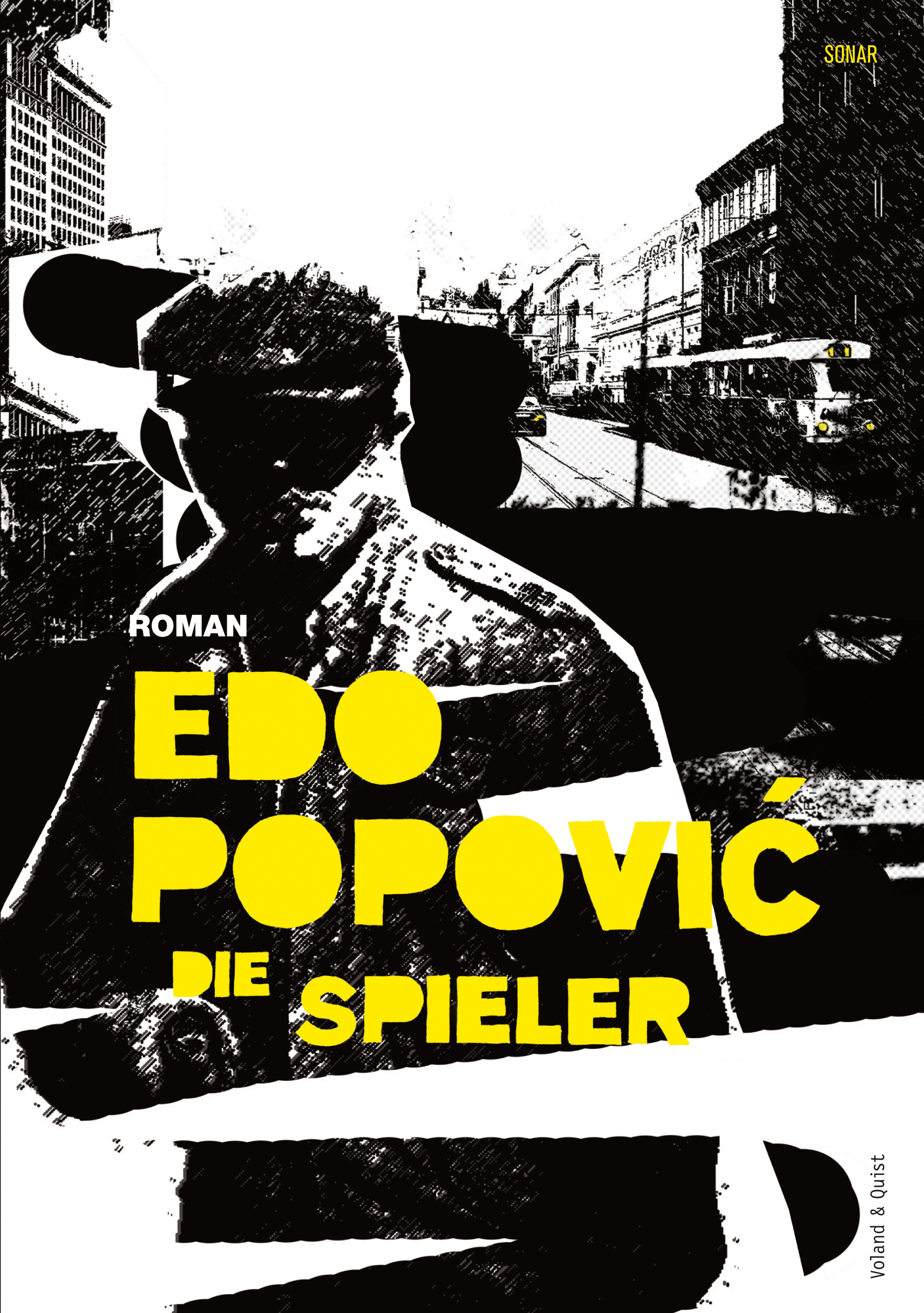Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Edo is back! Zurück im Leben, zurück bei Voland & Quist. Hvala! "Das Leben: es lebe!" erzählt von Popovićs Krebserkrankung, seiner Abkehr vom urbanen Leben in Zagreb und dem Umzug in eine Bauernkate auf dem Lande. Von schmerzvollen Erinnerungen, wie der Trennung von seiner Mutter, die ihn – im Alter von zehn Jahren – zurückließ, um als Gastarbeiterin in Westdeutschland zu arbeiten. Edo Popovićs Erzählen berührt zutiefst und erinnert uns daran, dass das Leben in all seinen Facetten gelebt werden will, bestaunt und gefeiert, erwandert und erlebt. Ein ernstes, aber alles andere als humorloses Buch, drastisch, aber nicht larmoyant, absolut bereichernd!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Sonar 39
Edo Popović, geb. 1957, lebt in Zagreb. Er war Mitbegründer einer der einflussreichsten Underground-Literaturzeitschriften des ehemaligen Jugoslawiens, sein erster Roman »Ponoćni boogie« (»Mitternachtsboogie« 1987) wurde zum Kultbuch seiner Generation. 1991–1995 war Edo Popović einer der bekanntesten Kriegsberichterstatter Kroatiens, anschließend veröffentlichte er mehrere Romane und Erzählbände. Edo Popović gilt als Kroatiens Stimme der gesellschaftlichen Transformation nach der Wende.
Mascha Dabić, geboren in Sarajevo, Studium der Translationswissenschaft (Englisch und Russisch) in Innsbruck, Wien, Edinburgh und St. Petersburg. Übersetzt Literatur aus dem Balkanraum, lehrt Russisch-Dolmetschen und Übersetzen an der Uni Wien. Mit ihrem Debütroman »Reibungsverluste« landete sie auf der Shortlist Debüt des Österreichischen Buchpreises 2017.
Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk, dem das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die Interessengemeinschaft Übersetzerinnen Übersetzer (Literaturhaus Wien) im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Republik Österreich, das Goethe-Institut, die S. Fischer Stiftung, die Slowenische Buchagentur, das Ministerium für Kultur und Medien der Republik Kroatien, das Ministerium für Gesellschaft und Kultur des Fürstentums Liechtenstein, die Kulturstiftung Liechtenstein, das Ministerium für Kultur der Republik Albanien, das Ministerium für Kultur und Information der Republik Serbien, das Ministerium für Kultur Rumäniens, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport von Montenegro, die Leipziger Buchmesse, das Ministerium für Kultur der Republik Nordmazedonien und das Ministerium für Kultur der Republik Bulgarien angehören.
Originaltitel: Kako sam brojio ružičaste roboteerschienen bei OceanMore, Zagreb 2021
© Edo Popović
Deutsche Erstausgabe
© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2024
Lektorat: Leif Greinus
Korrektorat: Barbara Häusler
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Satz: Fred Uhde
Druck und Bindung: BALTO print, Vilnius
ISBN 978-3-86391-375-5
eISBN 978-3-86391-411-0
www.voland-quist.de
Inhalt
ERSTER TEIL: ERWACHEN
ZWEITER TEIL: RÜCKZUG
Pfaue und Zitronenkuchen
Die ganze Erde ist ein Heilmittel
Angst
Wo ist zu Hause?
Was steht in der Zeitung und was in den Sternen
Sjena
Der Regen quillt aus der Erde
Unsichtbare Fischchen und päpstliche Rosenkränze
Der Friede kommt mit der Niederlage
Nahestehende Fremde
Die Kirche des Barabbas
Das Buch der Frauenhasser
Alle Tiere sind mit dem gleichen Anspruch auf Leben geboren
Kintsugi
DRITTER TEIL: ABBRUCH
Das Leben: es lebe!
Kein Überfluss, kein Mangel
Hab keine Angst
Der Kater mit dem Sonnengesicht und der Kater mit dem verfinsterten Mondgesicht
Der Alte Mann
Das Telefon
Ein ganz und gar gewöhnlicher Morgen in einem Dorf am Rande der bekannten Welt
Kodo und Corto
Wildkirschen
Einsamer Hahn im Glaskäfig eines Cafés singt Lieder aus Zagorje
Das zählende Lebewesen
Maga ist Moos
Das Unbekannte
Dobra und Wittgenstein-Zen
Das Geräusch des fallenden Schnees
Snyder bei Feuer im Ofen
Jeffers und Jeffers
Warum singt die Drossel?
Der Meteoritenschweif
Glossar
ERSTER TEIL:
ERWACHEN
Als ich an jenem Morgen die Augen aufschlug, erblickte ich leuchtende Monitore, Kabel, Stäbe, Konsolen, Vorhänge, Röhren. Ich erschauderte. Das war meine erste Gefühlsregung. Ich wusste nicht, wer ich war, was ich war, wo ich war und was das alles zu bedeuten hatte. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuvor schlafen gegangen war und auch nicht, was ich zuvor getan hatte, an gar nichts konnte ich mich erinnern, es gab kein Vorher, keine Vergangenheit. Es gab das Erwachen, und danach bloß Schaudern und Schüttelfrost. Ich schwebte in einer eisigen grauen Suppe und zitterte, aus meinem Inneren stieg Übelkeit empor.
Dann verspürte ich einen fürchterlichen Kopfschmerz. Da war etwas, das unerbittlich gegen meine Schläfen drückte und versuchte, meinen Schädel zu zermalmen. Ich griff mir an den Kopf, meine Handflächen berührten die glatte Oberfläche von etwas, von einem Helm, mutmaßte ich. Ich versuchte, den Helm abzunehmen, ich zog, drehte, zerrte, alles umsonst, der Helm schien mit meinem Kopf verwachsen zu sein. In der Vene meines Unterarms steckte ein dünner Plastikschlauch, der zu einem Säckchen führte, das mit farbloser Flüssigkeit gefüllt war und an einem Metallgestell hing. Ich drehte mich um. Ich befand mich in einem Glaskäfig, an dessen Wand von außen POLIZEI geschrieben stand. Dieses Wort kannte ich. Wieso Polizei, dachte ich, was hatte ich bei der Polizei zu suchen?
Erst da wurde mir bewusst, dass ich in einem Bett mit erhöhtem Kopfende lag und mit einem Laken bedeckt war. Ein Blick unter das Laken offenbarte mir, dass ich nichts anderes am Körper trug außer einer Windel, von der ein brauner Gummischlauch ausging, dessen Ende irgendwo außerhalb des Bettes lag. Das ist verrückt, dachte ich, das kann nicht sein, das muss ein Traum sein, es kann nur ein Traum sein, bald werde ich zu Hause aufwachen, in meinem Bett, und alles wird wieder in bester Ordnung sein.
Aber nichts war in Ordnung. Ich bin noch immer in meinem eigenen Traum gefangen, dachte ich. Eine Zeit lang versuchte ich fieberhaft, eine Möglichkeit zu finden, aus dem Traum zu erwachen, ich zappelte, bog und verkrampfte mich. Als mir schließlich klar wurde, dass ich keineswegs träumte, begann ich zu schreien. Ich muss jemanden herbeirufen, dachte ich, jemand muss mir erklären, was das soll. Falls es überhaupt irgendwen gab, an diesem grauenerregenden Ort. Aber eine Maske dämpfte meine Schreie. Erst da tauchten zwei Personen in weißen Kitteln auf. Hoffnungsvoll fuchtelte ich mit den Armen, schrie, doch sie achteten nicht auf mich und glitten geräuschlos weiter. Ärzte tragen doch weiße Kittel, dachte ich. Dann studierte ich die Aufschrift auf der Glaswand genauer und erkannte, was da wirklich geschrieben stand: ISOLATION.
Ich wusste noch immer nicht, wo ich mich befand und wie und warum ich hier gelandet war, ich war jedoch auf eine bescheuerte Weise felsenfest davon überzeugt, dass es sich um ein Missverständnis handeln musste, dass ich durch einen dummen Fehler hier war, vermutlich war es ein administrativer Fehler gewesen, hundertprozentig war es das, wie wenn die eigene Bankkarte gesperrt würde, weil jemand anderer, dessen Identifikationsnummer sich bloß um eine Ziffer unterschied, Schulden hatte, oder irgendein Bürokrat hatte sich irgendwo vertippt, aber ganz egal, die Situation war unangenehm, dein Konto war gesperrt, und so lag ich also irgendwo, hatte eine Windel um die Hüfte und eine Maske über meiner Schnauze an und hegte eine vage Hoffnung, dass diese Angelegenheit sich bald klären würde, jemand das Missverständnis auflösen würde und ich endlich nach Hause gehen konnte.
Aber wohin nach Hause, dachte ich. Wo ist das, zu Hause?
Da erst blitzte eine Erinnerung auf.
Ich saß im Rettungswagen, ein Techniker schloss mich an eine Sauerstoffflasche an, und ich sah durch die offene Hintertür des Wagens meine Frau Lila, die mit herabhängenden Armen vor unserem Wohnhaus stand, ich versuchte zu lächeln, ihr zu sagen, sie solle sich keine Sorgen machen, alles würde wieder in Ordnung sein. Sie sah nicht so aus, als würde sie mir glauben, sie wirkte verängstigt und schüttelte den Kopf.
Bevor das passierte, war ich tagelang in einem komaartigen, abgestumpften Zustand verharrt. Ich hatte im Bett gelegen und konnte nicht schlafen. Nachts saß ich am Bettrand, die Stirn gegen die Sessellehne gedrückt, und versuchte einzuschlafen, und tagsüber saß ich im Sessel und wartete auf die totale Erschöpfung, sodass ich mich ins Bett legen und einschlafen konnte. Aber sobald ich mich hinlegte, bekam ich keine Luft mehr, musste also wieder aufstehen, und die ganze Sache ging wieder von vorne los. Es war Juni, die Nächte waren dennoch länger als die Tage, das heißt, die Nächte vergingen sehr langsam, während die Tage in Sekundenschnelle ausbrannten. Ich konnte nicht essen, mein Bauch war verkrampft, hart wie ein Knochen, ich nahm merklich ab. Dennoch behauptete ich Lila gegenüber steif und fest, ich bräuchte keinen Arzt, es würde sich bloß um eine flüchtige Schwäche handeln, ich wäre im Moment am Tiefpunkt der Welle, aber schon morgen würde ich mich erheben, schaumgebadet und erstarkt, wie die Wellen unter dem stürmischen Jugo-Wind.
Jedoch wurde ich von Tag zu Tag schwächer. Ich hielt mit Mühe meinen Kopf aufrecht. In manchen Augenblicken wusste ich nicht mehr die Namen der Dinge, die ich gerade betrachtete. Lila erzählte mir später, ich hätte immer wieder gefragt, wo ich sei und welchen Tag wir gerade hätten. Zwischen der Außenwelt und mir entstand allmählich eine Membran, die meine Gefühle betäubte. Ich bewohnte einen Raum voller Sachen, die ich nicht greifen konnte. Wenn ich nach ihnen griff, dehnte sich der Raum zwischen uns aus wie Gummi. Als würde meine Handbewegung eine starke Gegenkraft verursachen, konnte ich bloß wie benommen zusehen, wie die Gegenstände sich entfernten. Außerdem hatte ich nächtliche Halluzinationen. Lila erzählte mir später, ich hätte einmal verlangt, man möge den Zaun entfernen, den einige Menschen um mich herum errichteten. Ein anderes Mal versuchte ich sie davon zu überzeugen, ich wäre ein Kriegsgefangener und man würde mich in einem Geheimgefängnis in Isolationshaft festhalten. Mein Körper zeigte mir zwar deutlich, dass jeder neue Tag nicht etwa eine Option für eine Verbesserung war, sondern ein weiterer schwerer Schlag gegen den Kopf, dass ich am Ende unter den Schlägen zusammenbrechen würde und dass dieser Tag bald kommen würde, und dennoch unternahm ich nichts. Ich saß hilflos da und wartete. Und dann hatte Lila gesagt: Jetzt ist es genug, ich rufe jetzt die Rettung.
Durch das hintere Fenster des Rettungswagens sah ich, wie die Häuserlandschaft, in die ich normalerweise früher als Autolenker hineinfuhr, sich nun zunehmend von mir entfernte. Danach sah ich Hochhäuser im Stadtteil Zapruđe und Wolken über ihnen. Und dann verlor ich das Bewusstsein.
Der Glaskäfig, in dem ich wieder zu Bewusstsein kam, war die Intensivstation. Das erklärte mir die Ärztin, die an besagtem Morgen mit einem Anhang, bestehend aus anderen Ärzten und Studenten, zu mir kam und mich vom Respirator befreite, und während sie mir alles erklärte, zeigte sie mir die Maske, aus der ein verrunzelter Schlauch hinunterhing, wie ein Rüssel.
Dank diesem Ding hier sind Sie noch immer am Leben, sagte sie.
Es war nicht das erste Mal, dass ich dieses Gerät sah, denn meine Mutter hatte es in den letzten Tagen ihres Lebens ebenfalls verwendet. Sie konnte diese Maske nicht ausstehen. Die Erinnerung durchzuckte mich.
Wie lange bin ich schon hier, fragte ich, als ich mich wieder sammeln konnte.
Seit zwei Tagen, antwortete die Ärztin.
Ich war noch immer schwach. Meine Hände zitterten, ich konnte kaum sprechen, und ich war nicht in der Lage, Lila anzurufen oder ihr eine Nachricht zu schicken. Ich konnte das Bett nicht verlassen. Die große Notdurft verrichtete ich in die Windel, für das Urinieren hatte ich einen Katheter. Die Krankenschwestern wechselten meine Windeln, wuschen mir Gesicht und Körper. Sie gaben mir auch zu essen. Ich erhielt eine Infusion, schluckte Tabletten. Schlaf und Wachsein wechselten sich ohne einen bestimmten Rhythmus ab. Einmal wachte ich auf, weil ich eine Bewegung spürte. Es war kein Laut zu hören, da war nur dieses Gefühl, dass etwas passierte. Es war Nacht, ein blassgrünes Licht durchflutete die Station, über dem Bett flackerten Diagramme und Zahlen auf den Bildschirmen, eine Kurve für den Sauerstoffgehalt im Blut, eine für den Puls, eine für den Blutdruck … Ich drehte mich zur Seite. In der Box neben mir standen drei Krankenschwestern neben dem Bett und schauten einer vierten dabei zu, wie sie versuchte, einen Patienten wiederzubeleben. Ich konnte sein Gesicht im Profil sehen, große Nase, dichter Bart und Schnauzer. Die Krankenschwestern standen reglos da und sahen stumm dabei zu, wie die vierte mit ihren Händen das stehengebliebene Herz zum Weitermachen animieren wollte. Ich konnte meinen Blick nicht von dieser Szene abwenden. Am Ende gaben sie auf, verließen die Box und entfernten sich über den Gang. Ich drehte mich wieder auf den Rücken und schlief ein.
Na gut, dachte ich am nächsten Morgen, als mir die nächtliche Szene wieder einfiel, hier wird gestorben. Aber das bedeutet, hier wird auch geboren. Gibt es denn überhaupt einen Ort, an dem nicht sowohl gestorben als auch geboren wird? Ein Ort, wo es nichts gibt, ein Un-Ort. Der Gedanke an eine solche Möglichkeit beunruhigte mich mehr als der Zustand, in dem ich mich gerade befand. Das menschliche Gehirn ist nicht in der Lage, sich das Nichts vorzustellen, die Unendlichkeit des leeren Raums, wie das Nichts fälschlicherweise beschrieben wird, sondern ganz im Gegenteil – die Abwesenheit von Raum, Materie, Gestalt, die Abwesenheit von irgendetwas, also das, was angeblich dem großen Urknall vorausgegangen war. Der Gedanke an dieses unvorstellbare Nichts beunruhigte mich. Ich weiß nicht warum, es ist auch nicht weiter wichtig, wichtig ist nur, dass ich mir falsche Gedanken über etwas Unvorstellbares machte, etwas, das mich zudem beunruhigte und ängstigte. Konnte es denn sein, fragte ich mich, dass dieser Un-Ort womöglich genau das war, woraus ich in diesem Bett, in diesem Käfig erwacht war? War es womöglich der Tod selbst? Ich war schon tot gewesen, aber man hatte mich von den Toten zurückgeholt. Plötzlich verstand ich: Das Schaudern, das ich empfunden hatte, war nicht durch den Ort, an dem ich erwacht war, verursacht worden, sondern durch den Ort, aus dem heraus ich erwacht war. Daher stammte die Angst.
Ich bekam eine Infusion. Eine farblose Flüssigkeit tropfte langsam herunter. Meine Unterarme waren mit blauen Flecken übersät, es sah aus wie eine verschwommene, misslungene Tätowierung. Ich fragte die Krankenschwester, woher das kam. Sie erklärte mir, die Krankenschwestern hätten wiederholt mit der Nadel reinstechen müssen. Als Sie eingeliefert wurden, mussten wir erst eine Vene finden, sagte sie. Bei Ihnen ist das schwer zu finden gewesen, und angesichts dessen, wie Sie bei Ihrer Einlieferung drauf waren, hatten wir keine Zeit für Streicheleinheiten.
Gestern nahmen sie mir die Windel und den Katheter ab, jetzt benutze ich einen Nachttopf für meine Notdurft. Die Toilette liegt noch immer außerhalb meiner Reichweite, aber dafür kann ich schon seit einigen Tagen selbstständig essen. Ich kann auch schon über SMS-Nachrichten mit Lila kommunizieren. Ich mache Fortschritte. Ganz zu schweigen davon, dass ich nach vielen schlaflosen Tagen und Nächten und nach unzähligen Versuchen, im Sitzen einzuschlafen, endlich wieder ausgestreckt schlafen kann, in voller Länge. Was für ein Vergnügen, was für ein Glück.
Allerdings bilde ich mir inzwischen ein, Musik zu hören. Die Musik ertönte aus der Ferne, es war eine sehr leise, feierliche, melancholische Melodie, ich konnte ganz klar eine Harfe und sehr zurückhaltende Blasinstrumente heraushören. Zuerst dachte ich, die Krankenschwestern hätten in ihrer Box das Radio eingeschaltet. Aber da die Musik sich wiederholte, da ich sie Tag und Nacht hörte, und da ich, wie sich herausstellte, der Einzige war, der sie hören konnte, begriff ich irgendwann, dass das Orchester nur in meinem Kopf spielte. Außerdem begann ich abends beim Einschlafen, Adler zu sehen. Die riesigen Vögel versammelten sich über meinem Bett, in einem Raum, der nicht mehr durch die Zimmerdecke und die Wände abgegrenzt war. In solchen Augenblicken hörte die Intensivstation auf zu existieren, es gab keine Glaswände mehr, keine anderen Betten, keine Patienten, keine Krankenschwestern, es gab nur noch das Bett, in dem ich lag, den unendlichen Himmel, und diese riesigen Vögel, die auf unsichtbaren Ästen saßen und mich beobachteten. Ich muss wohl nicht betonen, dass ich den Krankenschwestern und den Ärzten nichts von den Vögeln erzählte.
Abgesehen von den stressigen Situationen, die entstanden, wenn ein neuer Patient eingeliefert wurde, herrschten auf der Intensivstation Tag und Nacht Ruhe und Stille. Ganz im Gegensatz zu der regulären Klinikstation, in die ich später verlegt wurde, sobald die Ärzte zu dem Schluss gekommen waren, dass ich mich ausreichend erholt hatte, selbst essen konnte, keinen Nachttopf mehr benötigte, stark genug war, allein zur Toilette zu gehen.
Ich kam in ein Dreibettzimmer ohne Glaswände, ohne Monitore, Respiratoren und alle anderen Dinge, die einem in Erinnerung rufen, dass das Leben zwar eine massenhafte, jedoch fragile Erscheinung ist. Dafür, dass ich diese Tatsache nicht ganz vergessen konnte, sorgte ein Glaszylinder mit einer Wasserquelle, der über meinem Bett angebracht war. Im Zylinder steckte ein Gummiröhrchen, das Sauerstoff zu meinen Nasenlöchern transportierte. Ich konnte noch immer die Musik hören, und die Adler schwebten weiterhin nachts über meinem Bett. Neuerdings sah ich außerdem in den Blättern der Birke vor dem Fenster das Gesicht eines Jungen, ein blasses, ausdrucksloses Gesicht, das aus der Baumkrone herausschaute, mit Augen, Mund, Nase und allem, was dazugehörte, ein Gesicht, das auch dann nicht verschwand, wenn die Birkenblätter im Wind flatterten. Auch über das Gesicht sprach ich mit niemandem.
Neu war außerdem, dass ich zwei geräuschvolle Zimmernachbarn bekam.
Einer von ihnen war wirklich unerträglich. Abgesehen davon, dass er immer wieder fragte, wo er denn überhaupt war
Sie sind im Krankenhaus, in der Station für Lungenkrankheiten,
antworteten die Krankenschwestern, der andere Zimmernachbar und ich unisono, aber er wunderte sich dennoch,
im Krankenhaus, was soll ich denn im Krankenhaus,
und sobald es Nacht wurde, führte er einen richtigen Zirkus mit seinen Erstickungsanfällen auf.
Hilfe, ich ersticke, ich bekomme keine Luft, rief er lauthals, riss sich die Kanüle aus den Nasenlöchern, sprang aus dem Bett und rannte zum offenen Fenster, wobei er versuchte, die gesamte Luft aus dem Park einzuatmen, mit dem Ergebnis, dass er noch weniger Luft bekam.
Ein klassisches menschliches beschissenes Dilemma, würde ich sagen. Die Unersättlichen und die Gierigen werden am Ende von ihrer Unersättlichkeit und Gier zur Strecke gebracht. Die Sache ist die: Bevor du etwas nimmst, musst du etwas geben, so lautet das Gesetz der Natur. In diesem Fall musst du sogar noch viel mehr geben als das, was du nehmen wirst; das heißt, du musst lange ausatmen und dann kurz einatmen. Nur so erlangst du wieder ein Gleichgewicht, dann ist alles wieder tipptopp, super und schön. Jedoch ist das nicht menschlich, es ist dermaßen nicht menschlich, dass vor lauter Wut das Herz zerspringt, die Fäuste sich verkrampfen und die Tränen fließen. Was ich meine, ist, es ist nicht menschlich, so viel zu geben und so wenig zu nehmen. Meinem unglücklichen Zimmernachbarn hätte es, so wie jedem anderen Menschen auch, genügt, lediglich einen kurzen, ruhigen, weichen, kaum hörbaren Atemzug zu machen, bloß eine Handvoll Luft, ein halber Liter Luft. Aber nein, er wollte ein ganzes Fass, eine Zisterne, einen Tanker, er wollte die gesamte Luft unter der Ozonkappe, und da war er nun, brüllte, zog Grimassen, rief um Hilfe, helft mir doch, du lieber Himmel, und weckte damit die gesamte Station.
Hätte ich eine Knarre gehabt, ich hätte auf ihn geschossen, hätte ich mehr Kraft gehabt, wäre ich aus dem Bett gestiegen und hätte ihn aus dem Fenster geworfen, so aber lag ich bloß da und fluchte wütend, während ich zusah, wie die Krankenschwestern ihn vom Fenster wegholten, wieder ins Bett brachten, seine Kanüle wieder an der Nase befestigten, ihn mit dem Leintuch bedeckten und beschwichtigten, ganz langsam, ruhig, einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund, einatmen, ausatmen, Nase, Mund … Aber es half alles nichts, erst als er mit Beruhigungsmitteln vollgestopft wurde, schlief er ein, dann kehrte auf der Station wieder Ruhe ein, und alles war in bester Ordnung – solange die Beruhigungsmittel wirkten.
Wesentlich leiser, ruhiger und erträglicher war mein anderer Zimmernachbar, ein eher klein gewachsener Siebzigjähriger. Er lag die meiste Zeit nur da. Außer dass er Probleme mit den Lungen hatte, plagten ihn auch Durchfall und Blähungen, und in seinem Bauch und seiner Windel blubberte es unentwegt. Nach jedem Furz war sein leises Jammern zu hören: ajo-jojo-joj, ajo-jojo-joj. Er furzte und jammerte sogar im Schlaf, das Furzen war wohl Teil seiner Identität geworden. Einmal furzte er exakt in dem Moment, als die Krankenschwester seine Windel wechselte. Perfektes Timing. Sie wollte gerade die Windel entfernen, als die dünnflüssige bräunliche Masse herausschoss und teilweise auch auf ihrem Kittel landete. Die Krankenschwester war vollkommen schockiert. An sich sind Krankenschwestern abgebrühte, stabile, gefestigte Personen, die alles Mögliche erlebt und gesehen haben, ihre Nerven sind so fest wie Seile von Flugzeugträgern, und es ist äußerst schwer, sie zu schockieren. Aber das war sogar für eine Krankenschwester zu viel des Guten.
Pfui, du altes Stück Scheiße, schrie sie und machte einen Sprung zur Seite, die Arme auseinander, das Gesicht vor Ekel verzerrt.
Krepieren sollst du, du Drecksack!
Dann lief sie aus dem Zimmer.
Ajo-jojo-joj, sagte der Patient.
Er hatte es bestimmt nicht mit Absicht getan, davon war ich überzeugt. Wie ich schon sagte, das Furzen war ein Teil von ihm geworden, so natürlich wie Atmen, Blinzeln und Herzschlag.
Wie dem auch sei, in unserem Zimmer mangelte es nicht an interessanten Vorkommnissen. Man konnte nicht schlafen, es stank, aber zumindest wurde nicht gestorben. Aus unserem Zimmer kam man in der Regel lebend heraus. So verließ auch ich das Zimmer drei Wochen später – mit eingefallenen Wangen, entzündeten Augen, zitternden Beinen, abgemagerten Oberschenkeln, geschwollenen Unterschenkeln und Füßen voller Lymphe, zerstochenen Unterarmen voller blauer Flecken, mit trockener, aufgerissener Haut, aber, wie gesagt, noch immer am Leben. Was, wie ihr zugeben werdet, durchaus nicht zu verachten ist.