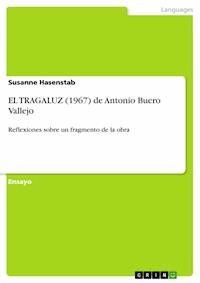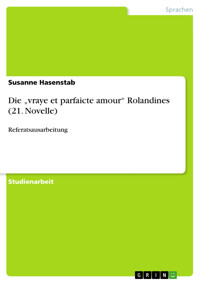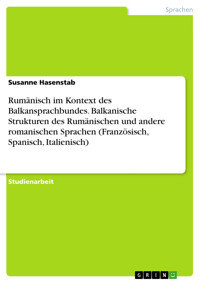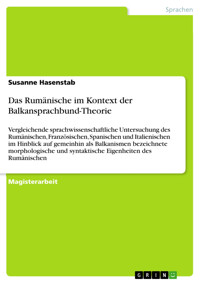9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Seefahrt, die ist lustig – oder vielleicht doch nicht?
Ines' Mutter hat gebucht, und zwar eine Nordseekreuzfahrt mit allem Drum und Dran für sie selbst und ihre Tochter. Die Aussicht auf zwei Wochen auf engstem Raum mit ihrer Mutter erfüllt Ines mit Grauen, sie will die Reise aber nutzen, um sich endlich innerlich von ihrem Freund Günther zu trennen, der zu alt und vor allem zu verheiratet für sie ist. Auf dem Schiff erweist sich Ines' Mutter als geringstes Problem – viel nerviger sind dauerhungrige Mitreisende wie Frau Kempf, die nach dem »Großen Elsässer Käseabend« mit Darmverschluss die Reise vorzeitig abbrechen muss oder ein sehr grantiger österreichischer Greis, der keine Möglichkeit auslässt, seine vernichtende Meinung über den Massentourismus auf hoher See kundzutun. Einziger Lichtblick: Sein attraktiver Sohn Johann, dem Ines auf der Alpenglühn-Oktoberfestparty an Bord näher kommt. Aber was ist mit Günther?
Ebenfalls von Susanne Hasenstab erschienen:
Irgendwo zwischen Liebe und Musterhaus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Ines’ Mutter hat gebucht, und zwar eine Nordseekreuzfahrt mit allem Drum und Dran für sie selbst und ihre Tochter. Die Aussicht auf zwei Wochen auf engstem Raum mit ihrer Mutter erfüllt Ines mit Grauen, sie will die Reise aber nutzen, um sich endlich innerlich von ihrem Freund Günther zu trennen, der zu alt und vor allem zu verheiratet für sie ist. Auf dem Schiff erweist sich Ines’ Mutter als geringstes Problem – viel nerviger sind dauerhungrige Passagiere wie Frau Kempf, die beim Krabben-Dinner fast an einem Salatblatt erstickt und nach dem »Großen Elsässer Käseabend« kurz vor dem Darmverschluss steht. Oder ein grantiger österreichischer Greis, der keine Möglichkeit auslässt, seine vernichtende Meinung über den Massentourismus auf hoher See kundzutun. Einziger Lichtblick: Sein attraktiver Sohn Johann, dem Ines auf der Alpenglüh'n-Oktoberfestparty an Bord näher kommt. Aber was ist mit Günther?
Die Autorin
Susanne Hasenstab, geboren 1984, studierte Romanistik und Skandinavistik in Frankfurt/Main und Lausanne. Sie arbeitet als freie Autorin und Kolumnistin für unterschiedliche Printmedien und beim Radio. Zusammen mit ihrem Bühnenpartner Emil Emaille tritt sie mit kabarettistischen Leseprogrammen auf. In ihrer Freizeit macht sie gern Yoga, reist und belauscht andere Leute, um Inspirationen für ihr Bühnenprogramm zu sammeln.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet undwww.twitter.com/BlanvaletVerlag
Susanne Hasenstab
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: René Stein Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de Umschlagmotive: © Getty Images, Stevegraham; www.buerosued.de JB · Herstellung: sam Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-26030-9V002
Kapitel 1
Im Hinblick auf mein Vorhaben, endlich mit Günther Schluss zu machen, kam mir die drohende Kreuzfahrt gerade recht. Wahrscheinlich hätte ich sonst noch viel ablehnender reagiert, als meine Mutter mich anrief und mir mitteilte, dass sie »gebucht« habe.
Ich war gerade im Büro mit einem Flyer-Entwurf für einen Kehrmaschinen-Hersteller beschäftigt und hatte gleichzeitig im Browser einen Artikel geöffnet, der sich mit dem Thema »So lösen Sie sich endlich aus toxischen Beziehungen« beschäftigte, als mein Handy vibrierte.
Auf dem Display das Foto meiner Mutter. Sie steht fröhlich winkend an der Reling eines Kreuzfahrtschiffes, hinter ihr ist der Markusplatz in Venedig zu sehen. Das Foto habe ich selbst gemacht, vor etwa einem Jahr, als wir dazu beitrugen, die altehrwürdige, von Verfall und Untergang bedrohte Lagunenstadt zu versenken, da wir – gewissen- und ruchlose Kreuzfahrer – unser Monsterschiff durch die engen, schutzlos daliegenden Kanäle quetschten. Nie mehr Kreuzfahrt, hatte ich mir nach dieser Reise geschworen. Zugegebenermaßen weniger aus Mitgefühl mit Venedig oder dessen Einwohnern, sondern eher aus Selbstschutz, denn meine Mutter, wie soll man sagen, ist eine recht fordernde Reisebegleiterin. Das Foto dient mir seitdem als Menetekel, mich an meinen gefassten Vorsatz zu erinnern.
»Ines? Ines!«, ruft sie, kaum dass ich ans Telefon gegangen bin.
»Mama, ich bin im Büro«, murmele ich, »kannst du später …«
»Ines?! Hörst du mich?« Meine Mutter klingt gehetzt, fast schon panisch. Wüsste ich nicht, dass dies ihre normale Telefonstimme ist – ich müsste annehmen, sie befinde sich in einer akuten Notlage.
»Bist du dran? Ich hör dich so schlecht«, ruft sie und schnappt nach Luft. »Ich wollte nur sagen, ich hab gebucht, du musst dir Urlaub nehmen, aber im Juni hattest du sowieso Urlaub, oder?«
Vom Tonfall her hätte sie auch schreien können:Kommen Sie schnell, da ist ein Mann in meinem Haus, er hat ein Messer, oh Gott, er kommt in mein Zimmer!
»Mama, was hast du gebucht?«
»Es waren nur noch zwei Glückskabinen frei, ich musste zuschlagen, sonst wären sie weg gewesen, und als Bonus haben wir sogar ein Krabbenmenü inklusive, hat der vom Reisebüro mir gesagt, das ist in diesem teuren Edelrestaurant, ›Das elfte Gebot‹. Stell dir mal vor, ein exklusives Krabben-Menü, denk dran, dass wir das nicht verfallen lassen, das müssen wir dort gleich einfordern!«
»Was bitte hast du gebucht, Mama?!« Mir schwant nichts Gutes.
»Ines, schreib auf, am 1. Juni geht’s los, von Hamburg ans Nordkap, da wollt ich schon immer mal hin, aber da müssen wir aufpassen, da sind bestimmt Eisbären, die kommen doch immer weiter von der Arktis runter wegen dem Klimawandel! Hast du lange Unterhosen? Da oben kann’s auch im Sommer Minusgrade haben!«
»Mama, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du …«
»Island ist auch dabei«, unterbricht sie mich, »da komm ich doch sonst nie hin, aber ich wollte schon immer mal nach Island!«
»Mama, hast du einfach ’ne Kreuzfahrt für mich mitgebucht, ohne mich zu fragen?!«
»Es war keine Zeit, das Angebot wär sonst weg gewesen, hast du dir das notiert mit dem Termin und dem Krabbenmenü? Du musst dann an die Rezeption gehen und das einfordern, das lassen wir uns nicht entgehen, ist ja teuer genug alles! Island, hoffentlich bricht da kein Vulkan aus, Nordkap, Norwegen und wieder zurück, Balkonkabine, ist zwar teurer als innen, aber egal, was soll’s, ich leb nur einmal, wie lang soll ich denn noch warten, bis ich mir was gönne? Die Frau Weigand ist zwei Monate nach ihrer Pensionierung gestorben!«
Ich atme tief durch und gehe mit dem Handy auf den Balkon, damit nicht das ganze Büro die Liveübertragung meiner ungewollten Urlaubsplanung mitbekommt.
»Mama«, sage ich dann in möglichst strengem Tonfall, »du willst mir jetzt nicht sagen, dass du einfach eine Kreuzfahrt gebucht hast, ohne mich zu fragen, und dass ich da jetzt mit muss!«
»Mit muss, mit muss!«, äfft mich meine Mutter theatralisch nach, »das klingt ja, als würde ich dich ins Straflager zwingen! So kommt’s, wenn man Kinder großzieht, nichts als Undank!«
Es folgt eine chaotische Argumentationskette, die mich von der Sinnhaftigkeit einer neuerlichen Mutter-Tochter-Kreuzfahrt überzeugen soll. Verschwenderisch schleudert sie mir zuerst ihr stärkstes Druckmittel entgegen, und zwar die Androhung ihres baldigen Todes, sie sei immerhin schon neunundsechzig, und da könne es jeden Moment vorbei sein, die Frau Merget vom Eckhaus gegenüber wäre ja auch so gerne noch auf Kreuzfahrten gegangen, habe dieses Ziel aber immer weiter in die Zukunft verschoben, und jetzt –zack! – Pflegefall, und dass ich es bitter bereuen würde, meiner alten Mutter diesen Wunsch – »Es ist kein Wunsch, es sind vollendete Tatsachen!«, protestiere ich kraftlos – ihr diesen letzten einen Wunsch abgeschlagen zu haben.
»Und die ersten zwei Wochen im Juni hast du doch sowieso Urlaub, hast du neulich erzählt, das hab ich mir gemerkt«, trumpft sie weiter auf.
»Aber du kannst mich nicht einfach so verplanen, vielleicht hätte ich ja was anderes vorgehabt«, erwidere ich schwach, innerlich wissend, dass die Kreuzfahrt beschlossene Sache ist.
»Aha, was hättest du denn Spannendes vorgehabt?«
Ich lache hilflos und gebe mich geschlagen. Natürlich hätte ich nichts vorgehabt, beziehungsweise das, was ich vorgehabt hätte, kann ich meiner Mutter keinesfalls erzählen.
»Okay, Mama«, seufze ich, »gehen wir auf Kreuzfahrt.«
Kapitel 2
Ich sitze mit Günther amWurstbänkchen, einer bruchreifen Imbissbude am Flussufer, etwa anderthalb Kilometer außerhalb der Stadt. Wenn wir uns nicht direkt in meiner Wohnung treffen, ist das Wurstbänkchen in den Sommermonaten einer unserer beliebtesten Zufluchtsorte: wacklige Biertischgarnituren, deren Oberflächen noch nie in Kontakt mit einem Wischlappen gekommen sind, auf einer leicht abfallenden Wiese, die die Wurstbänkchen-Gäste im Lauf der Zeit zu einem braungrünen Bodenbelag zusammengetrampelt haben, aus dem noch einzelne, verzweifelte Grashalme ragen. Im Schatten von Trauerweiden und schiefen, mit Bierwerbung bedruckten Plastiksonnenschirmen können wir Händchen halten und so tun, als wären wir ein ganz normales Pärchen, das während eines romantischen Spaziergangs am Fluss zufällig in die groteske Kulisse des Wurstbänkchens gestolpert ist und sich nun aus Kuriositätsgründen – hach, wie authentisch! – hier bei Dosenbier und Currywurst auf den ranzigen Bänken zur Rast niederlässt.
Später, beim Spiele- und Tapas-Abend mit unseren Freunden, können wir dann erzählen, was wir heute Lustiges entdeckt haben, da müssten wir unbedingt mal zusammen hin, das sei irgendwie abgefahren, ein idealerPlaceauch, um ironisch-schrottige Fotos für Insta zu machen.
Aber wir haben keine gemeinsamen Freunde, denen wir vom Wurstbänkchen berichten könnten. Uns steht kein Pärchenabend und kein gemeinsamer Brunch oder Wochenendtrip bevor. Die Existenz des Wurstbänkchens ist für uns bittere Notwendigkeit, da wir uns sonst nirgends blicken lassen dürfen.
Das Wurstbänkchen ist ein kulturelles und soziales Vakuum. Keine Verbindung zu jener Welt, der wir angehören. Man läuft hier nicht Gefahr, entdeckt zu werden. Hier sitzen ausschließlich Senioren, aber nicht die fitten, agilen Senioren, die auf der Apotheken-Umschau oder auf Werbeanzeigen fürBusrundreisen für Best Agerdurch Patagonien oder Namibia abgedruckt sind, sondern das genaue Gegenteil: Worst Ager, die sich jeden Vormittag mit Mühe und Not gichtgeplagt bis zum Wurstbänkchen schleppen. Winzerprosecco, Kümmelschnaps und Weizenbier, bis die Sonne untergeht. Für weitere Reisen fehlt ihnen die Kraft und das Geld. Dass die hochstehenden Kulturfreunde von Günther und Sanna sich ans Wurstbänkchen verirren würden, ist komplett ausgeschlossen.
Günther erzählt mir gerade voller Begeisterung von einer Dokumentation, die er kürzlich gesehen hat. Brutpflege bei Pinguinen, unheimlich interessant sei das. »Der Mann brütet zwei Monate lang das Ei aus, bleibt da in der eisigen Kälte stehen. Die Frau geht weg, isst ganz viel Fisch und kommt dann wieder, um das Kleine und den entkräfteten Mann zu füttern. Erstaunlich, oder?«
Ich bin den Tränen nah. Nicht wegen der rührenden Aufopferungsbereitschaft der Pinguin-Eltern, sondern weil ich heute wirklich mit Günther Schluss machen muss.
»Apropos füttern.« Ich bemühe mich um ein Lächeln. »Soll ich uns was zu essen holen? Currywurst wie immer?«
»Ich mach das schon, Süße.« Günther beugt sich über den Tisch, gibt mir einen Kuss und steht dann auf, um sich an der Bude hinter zwei Senioren anzustellen, die schwarze Unterhemden, Jogginghosen und Filzpantoffeln tragen.
Es ist sowieso klar, dass es unser letztes Treffen vor der Kreuzfahrt ist und wir uns für zwei Wochen nicht sehen werden. Jetzt muss ich Günther nur noch erläutern, dass ich möchte, dass wir uns auch danach nicht mehr sehen, denke ich. Die Kreuzfahrt als Absprung in die Freiheit. Unsere Beziehung basiert auf einer unguten Mischung aus Besessenheit und Ratlosigkeit. Wir wissen nicht, was wir miteinander anfangen sollen, kommen aber auch nicht voneinander los. Das scheinbare Hauptproblem ist, dass Günther verheiratet ist. Dabei kommt mir die verhasste Widersacherin Sanna, deren Existenz uns in die Wurstbänkchen-Heimlichkeit zwingt, bisweilen gerade recht, denn so kann ich mich vor der Frage drücken, ob ich wirklich mit ihm zusammen sein wollte, wenn es denn möglich wäre.
Er ist zu alt und zu verheiratet, rede ich mir zu, wir essen jetzt unsere letzte Currywurst, und dann machst du Schluss, so einfach ist das.
Ein Flusskreuzfahrtschiff gleitet vorbei, an Deck stehen winkende und fotografierende Menschen. Die Wellen schleudern eine in Ufernähe schwimmende Entenfamilie unsanft hin und her, einige der Küken treiben ab. Die Familie geht jedoch routiniert mit der Störung um und sortiert sich rasch wieder zu einem braunfiedrigen Klumpen.
Günther gibt mir von der Bude her ein Zeichen, dass es irgendeine Verzögerung in der Essensausgabe gebe, ich nicke und zucke mit den Schultern. Je später wir unsere Henkersmahlzeit einnehmen, desto länger kann ich unser Ende hinauszögern, denke ich. Die Henkerswurst. Wäre ein schöner Name für eine Mittelalter-Band.
Vier schwergewichtige Senioren, drei Frauen und ein Mann, bringen die Bierbänke neben mir fast zum Durchbrechen, als sie sich schnaufend niederlassen. Mehrere kleine Hunde werden unter dem Tisch angebunden. Zu Prosecco und Underberg eröffnet sich ein deprimierendes Gespräch über Stützstrümpfe, wobei der Mann den Ton angibt, ist wohl so was wie der Hahn im Korb. Er zeigt den Frauen, bei denen nicht klar ist, in welchem Verhältnis sie zu ihm stehen, seine Stützstrümpfe unter der Stoffhose. Sie werden ausgiebig bewundert, weil sie so zart sind. »Trotzdem zerreißen sie nicht, wenn man sie mit den bloßen Händen hochzieht!«, behauptet der Gockel. Er benutze nie einen Handschuh beim Hochziehen der Stützstrümpfe. Die Frauen finden das toll, noch nie hätten sie es geschafft, ohne den Spezialhandschuh ihre Stützstrümpfe anzuziehen. Die Frauen zeigen sich nun auch gegenseitig ihre Strümpfe, die jedoch nicht so fein gearbeitet sind wie die des Mannes. In der Venenklinik hätte man ihr gesagt, sie solle abspecken, erzählt die eine. Große Entrüstung am Tisch. In der Venenklinik werde man nur gedemütigt, ruft der Mann, sie solle ins Strumpfstübchen in der Vita-Klinik gehen, da sei es besser und billiger.
»Abspecken!«, empört sich die Betroffene weiter, »so unverschämt, der soll mir die Strümpfe ausmessen und sich nicht einmischen, wieso soll ich abnehmen, wenn ich was an den Venen hab?«
Ja, wo sei da denn der Zusammenhang?, rufen ihre Freundinnen, unglaublich, man solle die Venenklinik in Zukunft meiden. Deswegen gehe er nur noch ins Strumpfstübchen in der Vita-Klinik, beschließt der Mann die Diskussion, »die messen dich aus und halten ihren Mund.«
Günther kommt mit zwei Dosen Cola Light zurück. Currywurst und Pommes können heute länger dauern, habe es geheißen, es gebe irgendein Problem mit der Fritteuse, die sei überhitzt und müsse erst abkühlen, oder sie sei noch nicht heiß genug, sowas in der Art.
»Naja, solang wir auf die Würste warten, kriegst du schon mal mein Geschenk.« Er wühlt in seinem schwarzen Rucksack.
»Ich hab doch gar nicht Geburtstag.«
»Für die Kreuzfahrt!«
Ich öffne vorsichtig das mit bunten Luftballons bedruckte Papier. Zu Hause habe ich eine ganze Schachtel, die nur mit Günther-Geschenkpapier gefüllt ist. Zugang zu hübschem, teilweise sogar exquisitem, mit Goldfäden durchzogenem oder mit echten Federn beklebtem Papier hat er reichlich, da er Inhaber eines Schreibwarengeschäfts in der Fußgängerzone ist. Mit dem zwischen Burger King und o2-Shop eingequetschten Laden kann er sich nur über Wasser halten, da er das Gebäude von seinem Vater geerbt hat und daher keine Miete zahlen muss. Dieses Geschenkpapier, denke ich, ist das letzte, was zu meiner geliebten Sammlung dazukommt. Oder soll ich es als Anti-Sentimentalitätstraining hier und jetzt entsorgen, im stinkenden blauen Müllsack, der mit Reißzwecken an unseren Nachbartisch getackert ist und den die Wespen umschwirren? Unter dem Papier kommt ein Buch zum Vorschein:Ozean-Tango – Leidenschaft auf hoher See. Das Cover ist in nostalgischen Sepiatönen gehalten und zeigt ein eng umschlungenes Tanzpaar auf dem Deck eines Hochseedampfers. Es muss sehr windig an Deck sein, denn die Frau trägt ein überdimensional langes Seidentuch, das luftig exakt parallel zur Reling flattert, sogar um den Buchrücken herum bis auf die Rückseite.
»Das Cover ist etwas kitschig«, entschuldigt sich Günther, »aber das Buch soll gut sein, der Autor ist Argentinier, kennst du ihn?«
Ich schüttele den Kopf.
»Hab mich extra beraten lassen in der Buchhandlung, was man jemandem schenken kann, der eine Kreuzfahrt macht. Kannst mir ja dann danach erzählen, wie es dir gefallen hat.«
»Danke.« Ich muss schlucken und vermeide es, ihn anzusehen.
Warum ich so traurig sei, will Günther wissen. »Es sind doch nur ein paar Tage. Du hast eine schöne Zeit mit deiner Mutter, lässt dich verwöhnen, kriegst tolles Essen, entdeckst spannende Länder, und dann sehen wir uns ja bald schon wieder und haben noch den ganzen Sommer vor uns.« Er habe neulich einen tollen See entdeckt, eine halbe Stunde von hier, da könne man Tretboote ausleihen und rund um eine kleine, nur von Graureihern bewohnte Insel fahren, das könnten wir dann zusammen machen, sobald ich zurück sei, das sei dann quasi unsere eigene Miniaturkreuzfahrt, und neben dem See gebe es ein portugiesisches Restaurant, die hätten angeblich den besten Stockfisch Deutschlands, nebst zweiundfünfzig verschiedenen Gin-Sorten.
»Klingt super, oder?«
Günther schaut mich so lieb und so begeistert von seinem Vorschlag an, dass mir schlichtweg die Worte fehlen. Kann er nicht mal irgendetwas sagen oder tun, was mir den Einstieg ins Trennungsgespräch (so heißt das auf den Ratgeberseiten) erleichtern würde? Denn es sei wichtig, einen passenden Einstieg ins Trennungsgespräch zu finden, aber ich erinnere mich nicht mehr, wie genau solch ein Einstieg aussehen soll. Ein idealer Einstieg für mich wäre es, wenn Günther sich rülpsend in der Nase bohren, sich Schuppen vom Kopf kratzen, mich mit Cola bespritzen und einen Underberg nach dem nächsten kippen würde, um sich anschließend würgend über den Biertisch zu erbrechen. Dann hätte ich einen schönen Einstieg, könnte sagen: »Schatz, so geht das nicht mehr, es war sehr schön bis hierhin, doch nun möchte ich meine Zukunft ohne dich gestalten, da ich der Meinung bin, dass wir uns in zu unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.«
»Also ich an deiner Stelle würde mich riesig auf die Kreuzfahrt freuen«, fährt Günther fort. »Ich wollte auch schon immer mal so was machen, aber Sanna hatte nie Lust, sie hasst Schiffe, so eine Kreuzfahrt würde sie nervlich nicht verkraften, sie kann ja nicht mal in eine Schiffsschaukel.«
Sanna, seine Frau. Eine finnische Musikerin, die im Staatsorchester die erste Geige spielt oder so etwas in der Art, und die ständig krankgeschrieben ist, da die Posaunen, Trompeten und Jagdhörner hinter ihr so laut blasen, dass sie davon Hörstürze, Tinnitus und manisch-depressive Zustände bekommt, die dann über Wochen und Monate anhalten können. Mehr weiß ich nicht von ihr und will auch nicht mehr wissen.
Sanna sei als Kind mal auf einer Fähre von Helsinki nach Warnemünde in ein Unwetter gekommen, sagt Günther, die Fähre sei fast gesunken, im Prinzip sei sie »nur durch Zufall« nicht gesunken, er habe neulich auch eine interessante Dokumentation darüber gesehen, dass Kreuzfahrtschiffe und Fähren viel unsicherer seien als allgemein bekannt, und dass die Kreuzfahrtmafia alles unternehme, um die unzähligen Beinahe-Havarien zu verschleiern.
»Na, du machst mir ja Mut«, rüge ich ihn, obwohl eine eventuelle Schiffshavarie mir kaum Angst macht. Dann wären wenigstens alle Probleme gelöst, denke ich, der ganze Liebeskummer zusammen mit mir im Nordpolarmeer versenkt. Seebestattung zum Nulltarif, da freuen sich auch die Angehörigen, die sich die Beerdigungskosten sparen und zusätzlich eine Entschädigung vom Kreuzfahrtunternehmen bekommen. Auch für die Umwelt wäre es von Vorteil, wenn unser Schiff unterginge, so ein Unglück sorgt ja zumindest kurzzeitig für etwas Abschreckung. Die Buchungszahlen würden eine Weile in den Keller rauschen, und die verseuchten Weltmeere und von Kreuzfahrern überrollten Küstenstädte könnten aufatmen und sich von Schwermetallen, Feinstaub und Müll regenerieren, eine Art Kreuzfahrtschiff-Detox-Kur.
»Ach, ihr geht schon nicht unter«, behauptet Günther, »und wenn ihr doch in Seenot kommt, rufst du mich an, ich komm sofort und rette dich.«
Das Einzige, was ihn bezüglich meiner Kreuzfahrt etwas betrübt stimme, sei der Zeitpunkt, seufzt er. »Die ersten zwei Juniwochen, das ist genau die Zeit, in der Sanna bei ihrer Familie in Finnland ist, da hätten wir beide so viel Zeit gehabt.«
Könntest du bitte aufhören, ständig deine Gattin zu erwähnen?, denke ich und spüre mit einer gewissen Befriedigung so langsam etwas wie Wut in mir aufsteigen.
»Du meinst, dir wäre es lieber, wenn die Kreuzfahrt im Juli oder August wäre?«, frage ich.
»Naja, ich hätte mich gefreut, mit dir im Juni was zu unternehmen.«
»Aha, und mit welcher Begründung hätte ich die Kreuzfahrt verschieben sollen?« Meine Stimme gewinnt auf unangenehme Art an Schärfe. »Soll ich sagen, Mama, schön und gut, aber lass uns lieber im Juli in See stechen, denn mein verheirateter, doppelt so alter Liebhaber hat im Juni ausnahmsweise Zeit für mich, weil seine Gattin da auf Familienbesuch in Finnland weilt. Ach so, mein Kind, wird meine Mutter sagen, das ist mehr als verständlich, ich werde rasch umbuchen!«
Günther stützt den Kopf in die Hand und vertreibt mit kraftlosem Wedeln eine Wespe von seiner Cola-Dose.
»Ich bin überhaupt nicht doppelt so alt«, sagt er nach längerem Schweigen.
»Als wir uns kennengelernt haben, warst du genau doppelt so alt: Ich sechsundzwanzig und du zweiundfünfzig. Und jetzt bin ich fast dreißig und du fünfundfünfzig.«
Das sei zwar korrekt, aber ich müsse bedenken, dass sich im Laufe der Zeit das Verhältnis immer mehr zu seinen Gunsten verschieben werde, sagt Günther. Er werde nie mehr doppelt so alt sein wie ich. »Überleg mal, wenn du vierzig wirst, bin ich erst sechsundsechzig, dabei müsste ich eigentlich ja schon achtzig sein, wenn ich doppelt so alt wäre.«
Ob er sie verlassen solle, fragt er dann übergangslos.
»Ich mach’s«, sagt er, da ich nicht antworte, »ich mach’s, und dann? Was ist dann? Ich bin doch sowieso zu alt für dich, wie du nicht müde wirst, mir ständig unter die Nase zu reiben. Du würdest mich sowieso nicht wollen.«
Wir sitzen uns zermürbt gegenüber und schweigen. Der heillos verknuddelte Beziehungsknoten, der sich seit unserer ersten Begegnung gebildet hat, ist auf keine Art und Weise mehr zu entwirren. Es ist an der Zeit, das Knäuel entzweizuhacken.
»Günther, vielleicht sollten wir besser Schluss machen.«
Das war natürlich zu vage formuliert, ärgere ich mich gleich, man soll doch klar formulierte Ich-Botschaften aussenden, die den Trennungswunsch deutlich und unmissverständlich transportieren. Aber ich bin wirklich unheimlich schlecht im Schlussmachen.
»Ich bin jetzt sowieso zwei Wochen weg auf dem Schiff«, höre ich mich sagen, »die Zeit können wir ja nutzen, um Abstand zu gewinnen.«
»Willst du Schluss machen oder Abstand gewinnen?« Günther sieht mich ehrlich verstört an.
»Ähm. Beides.«
»Beides? Ach, wie furchtbar.« Günther stöhnt, nimmt meine Hand und legt sie sich an die Wange.
Wir sind beide kurz davor loszuheulen, als sich ein ungepflegter Mann im blauen Trainingsanzug direkt neben Günther an den Tisch setzt. Ob er mal kurz stören dürfe, er sammele Unterschriften zum Erhalt des Wurstbänkchens. Die Imbissbude sei vom Abriss bedroht, Baugenehmigung, Hochwasserschutz, Rathaus, Bürokratie, und sie bräuchten fünfhundert Unterschriften, sonst kämen die Bagger. Er hat wohl ein ernstzunehmendes Kehlkopfproblem, spricht mit pfeifender, heiserer Stimme, schnappt alle drei Worte nach Luft und stellt schließlich einen großen gelben Plastik-Senfeimer auf den Tisch, aus dem er mehrere Zettel holt, die besagten Unterschriftenlisten. Wieder und wieder erläutert er auf umständliche Art den Vorgang, der erfolgen müsse, um das Wurstbänkchen zu retten, man solle unterschreiben, mit einem Stift, einen Stift habe er irgendwo, und es hätten ja schon viele unterschrieben, aber die Bürokratie, fünfhundert Unterschriften, ansonsten die Bagger, und dann sei es ein für alle Mal fort, das schöne Wurstbänkchen.
Auch nachdem wir unterschrieben haben, erklärt er nochmals die Dringlichkeit der Problematik und bedankt sich mehrfach für unsere Unterstützung, bevor er endlich wieder die Unterschriftenlisten in seinen Senfeimer packt und verschwindet.
»Was ist eigentlich mit unseren Currywürsten?«, ist das Erste, was mir einfällt, als er weg ist. Die Unterbrechung macht es mir unmöglich, sofort wieder in die erforderliche Dramatik unseres Trennungsgesprächs zurückzufinden. Günther scheint es ähnlich zu gehen.
Froh über meinen Themenschwenk, stemmt er sich sogleich in die Höhe, um zur Imbissbude zu gehen und sich nach dem Verbleib unserer Bestellung zu erkundigen. Mit der Verkäuferin verstrickt er sich in einen heftigen Disput, den ich nicht verstehen kann, da die gerade lauthals lachende Stützstrumpf-Rentnergruppe im Weg sitzt. Sichtlich empört kommt er zurück, während die Verkäuferin die Klappe, die das Vordach ihrer Bude bildet, herunterlässt und dahinter verschwindet. Offensichtlich ist Feierabend im Wurstbänkchen.
»Komm, wir gehen!«, schnaubt Günther. »Unglaublich, so ein Saftladen, so was hab ich ja noch nie erlebt!«
Die Imbissfrau habe ihm auf unfreundlichste Weise zu verstehen gegeben, sie habe unsere Currywürste ausgerufen, aber es sei keine Reaktion erfolgt. Offenbar haben wir sie nicht gehört, da wir gerade von ihrem seltsamen Kehlkopf-Kompagnon mit dem Senfeimer und den Unterschriftenlisten abgelenkt waren und zusätzlich ja die Stützstrumpfrentner jede Menge Lärm veranstalteten. Da niemand die Würste abgeholt habe, habe sie sie verschenkt.
»Verschenkt?«, staune ich, während wir nebeneinander auf dem Fahrradweg zurück in Richtung Stadt marschieren.
Verschenkt, ja, obwohl er die Würste ja bereits vorab zusammen mit der Cola bezahlt habe, verschenkt an die nah bei der Essensausgabe sitzenden Stützstrumpfrentner, die die Würste sogleich verspeist hätten.
»Und dann sagt sie, wir sollten das nächste Mal halt besser aufpassen, und es sei jetzt Feierabend, und damit ging die Klappe runter. Und wir unterschreiben noch für den Erhalt dieser elenden Bruchbude!«
Man könnte ja zurückgehen und unsere Namen von der Liste streichen lassen, schlage ich vor. »Vielleicht sind es die entscheidenden Unterschriften. Mit uns haben sie fünfhunderteins, und dann nur noch vierhundertneunundneunzig und das Wurstbänkchen wird abgerissen.«
Naja, relativiert Günther. Viel schlimmer als die erlittene Schmach im Wurstbänkchen sei die Tatsache, dass ich Schluss machen wolle. »Oder Abstand gewinnen, wie du es nennst.«
»Es ist besser so, alles andere führt doch zu nichts.«
Wir laufen händchenhaltend unter den riesigen Trauerweiden hindurch. Wenn ein Radfahrer, Jogger oder Hundeausführer entgegen kommt, lösen wir die Hände, bis er an uns vorbei ist, ein eingespielter Automatismus derer, die nicht gemeinsam als Pärchen wahrgenommen werden wollen.
Nach längerem Schweigen beginnt Günther, mir von der Preisgünstigkeit des Parkhauses, wo er heute sein Auto abgestellt habe, zu berichten. Es sei ein neu eröffnetes Parkdeck am Rande des Klostergartens, wo man ein halbes Jahr zum Schnupperpreis von einem Euro vierundzwanzig Stunden lang parken könne.
»Aha«, sage ich. Angesichts der Tatsache, dass wir gerade dabei sind, unsere Beziehung zu beerdigen und uns nach diesem Treffen womöglich nie mehr sehen werden, erscheint mir das billige Parkhaus als ein allzu profanes Gesprächsthema. Aber was erwarte ich denn? Liebesschwüre unter Trauerweiden? Dass er einen Dolch zieht und sich vor Kummer ersticht? Einen Kniefall, flehentliches Bitten und Betteln, ihn nicht zu verlassen? Wahrscheinlich geht er davon aus, dass ich es sowieso nicht ernst meine, denke ich mit leichtem Gruseln. Er weiß, dass ich nicht von ihm loskomme. Fakt ist, dass ich mir von ihm stundenlang Vorträge über die erschwinglichsten Parkhäuser Deutschlands anhören könnte, ohne mich zu langweilen. Solange er dabei meine Hand hält, bin ich glücklich und willenlos.
Durch mein trauriges Vorhaben, meine Zukunft ohne ihn verbringen zu wollen, sei er nun zumindest in der richtigen Stimmung für die Doku-Serie, die er gerade angefangen habe zu schauen, sagt Günther. Da gehe es um eine ehrenamtliche Köchin, die durch Europa reise und Sterbenden in Hospizen ihre Lieblingsgerichte koche. Der Filmemacher sei derselbe, der auch die Samsara-Doku gedreht habe, die Gespräche mit den sterbenden Mönchen in Bhutan.
Was die Themen angeht, mit denen er sich beschäftigt, wundere ich mich über gar nichts mehr. Er ist so umtriebig und wissbegierig, dass es mir manchmal ein schlechtes Gewissen macht. Er nutzt jede freie Minute, um in lehrreichen Dokus Einblicke in andere Lebenswelten zu erhalten und sich Wissen anzueignen. Mithilfe eines achtsamkeitsbasierten Sprachprogramms lernt er gerade alle romanischen Sprachen parallel, ganz allein zu Hause am Computer. Auch die von ihm hoch geschätzten Serien über Kokain-Kartelle und mexikanische Drogenbosse sind nur in zweiter Linie unterhaltsame Abenteuergeschichten, für Günther sind es vornehmlich Lehrstücke über Moral und das immerwährende Böse in der Welt.
Ich frage mich manchmal, weshalb ich ihm so wichtig bin, dass er immerhin seine Ehe aufs Spiel setzt und sie für mich, so behauptet er ja zumindest, sogar beenden würde. Seinen immensen Weiterbildungsdrang finde ich entzückend, aber die Begegnungen mit mir können ihm in dieser Hinsicht doch wirklich nichts Neues bieten. Ich lese gerne Liebesromane, gehe zum Pilates, schaueGirlsund sammle Kochrezepte, die ich dann nie nachkoche. Ansonsten bin ich mit meinem Job bei der Werbeagentur und dem Nachgrübeln über meine aussichtslose Beziehung zu ihm geistig vollkommen ausgelastet. Vielleicht ist es einfach der Sex, der ihn immer wieder meine Nähe suchen lässt, wobei ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass es ihm auch nicht vornehmlich darum geht. Und dass der Sex mir sogar wichtiger ist als ihm. Zumindest gehen dem Liebesakt meistens ausgedehnte Frühstücksverabredungen, Spaziergänge und endlose Berichte über lehrreiche arte-Dokus voraus, die er seit unserer letzten Begegnung gesehen hat und die ich alle nicht kenne. Zum Abschluss gehen wir meistens zu mir in meine kleine Zweizimmerwohnung, dort sitzen wir dann erstmal in der Küche und trinken eine Kanne Tee, Cappuccino, Rotwein, je nach Tageszeit. Mehrfache Klogänge wegen der ganzen Flüssigkeitsaufnahme, bis ich ihn dann schließlich ins Schlafzimmer zerre und seine Nacherzählungen hochinteressanter Wissenschaftssendungen zum abrupten Ende bringe, indem ich beginne mich auszuziehen.
»Gehen wir noch zu dir?«, fragt mich Günther mit Hundeblick, als wir an seinem Auto angekommen sind, »auf ein Glas Wein?«
»Vielleicht besser nicht«, antworte ich zögernd und verdrehe innerlich über mich selbst die Augen. Was ist das wieder für eine bescheuerte Aussage, Frau Rückgrat?Vielleicht besser nicht.
Einen Abschiedskuss will Günther aber, »bevor du dich dann vor mir aufs Kreuzfahrtschiff flüchtest und ich dich nie wiedersehe.«
Ein Abschiedskuss muss erlaubt sein, da stimme ich ihm zu, und steige zu ihm auf den Beifahrersitz. Über Handbremse und Schaltknüppel gekrümmt haben wir in unserer Anfangszeit ganze Nachmittage eng umschlungen verbracht, wir sind geübt im Knutschen in orthopädisch ungünstiger Umgebung.
Allerdings scheint uns der Wageninnenraum dieses Mal mit besonderer Ablehnung zu empfangen, alles ist viel beschwerlicher und unpraktischer als früher. Ich verheddere mich mit der Hand in einem langenUSB-Kabel, das von der Radiokonsole herunterhängt. Im Fußraum liegen Prospekte, eine Wasserwaage undCD-Hüllen, die ich versuche, zur Seite zu schieben, während ich mich zu Günther hinüber lehne, die mir aber immer wieder unter die Füße rutschen.
»Entschuldigung, ich hab nicht aufgeräumt, ich wusste nicht, dass wir im Auto landen«, murmelt er zwischen zwei Küssen und versucht, dasUSB-Kabel herauszuziehen, wobei er versehentlich das Navigationsgerät aktiviert, das auf Finnisch eine strenge Ansage an uns richtet.
»Oh Gott, ich dachte eben, das ist Sanna«, erschreckt sich Günther, »ihre Stimme klingt so ähnlich.«
Bei seinem Versuch, das Navi auszuschalten, geht erst das Radio an, dann öffnet sich plötzlich hinter uns die Schiebetür des Autos.
»Verdammt, das ist neulich schon mal passiert, die Elektronik spinnt.« Günther löst sich von mir, steigt aus und zieht die Schiebetür wieder zu. »Wenn man länger im Auto sitzt und nicht losfährt, geht die Tür von selbst auf, weil das Auto denkt, man will raus und könnte sich selbst nicht mehr befreien.«
Günther steigt wieder ein und lässt sich seufzend auf den Fahrersitz fallen.
»Wie unromantisch«, sagt er, »tut mir leid.«
Ich gebe ihm einen Kuss und kraule ihm den Hinterkopf. »Komm. Wir gehen lieber zu mir in die Wohnung.«
Kapitel 3
Hamburg – Tag 1
»Ich hab’s gewusst, weit und breit kein Gutschein fürs Krabbenmenü, das ist wieder typisch! Um alles muss man kämpfen!« Meine Mutter läuft empört auf und ab, während ich die Koffer aus dem Gang in unsere Kabine wuchte.
»Wir müssen sofort zur Rezeption und den Gutschein einfordern, die wollen uns den vorenthalten, die denken, wir merken das nicht! Na, denen sag ich Bescheid!«
»Lass uns doch erst mal auspacken«, stöhne ich und hieve unsere Koffer nacheinander aufs Doppelbett. »Du darfst diesmal keine Souvenirs kaufen, Mama, hast du gehört? Dein Koffer ist jetzt schon tonnenschwer!«
»Ach komm, die Fahrt hat noch gar nicht angefangen, da soll ich mich schon wieder beschränken«, empört sie sich. »Was kauf ich denn schon, ein paar Trolle vielleicht und irgendwas Kleines für die Enkel, wobei, die danken’s mir ja doch nicht, ach schau mal, hier liegt was, ist das der Krabbengutschein?«
Meine Mutter holt einen kleinen Pappaufsteller aus dem Plastikeinbauregal neben ihrer Seite des Bettes. »Lies mir mal vor, was da steht, ich kann nicht so gut lesen ohne Brille!«
Sie hält mir das Pappschild etwa zwei Millisekunden lang direkt vor die Nase und zieht es dann wieder weg, da sie sich wohl kurzfristig entschlossen hat, die Entzifferung der Aufschrift trotz fehlender Sehhilfe selbst vorzunehmen.
»Ich freue mich, Ihre Kabine pflegen zu dürfen«, liest sie vor, »herzlich willkommen an Bord, Ihr Kabinensteward Vishnu Sun … Was steht da? Vishnu Sundanarariam.«
Ja, ja, Kabine pflegen, das sei ja alles schön und gut, schimpft sie und wirft den Pappaufsteller zurück ins Regal, die wollten sich doch nur vorab schon ihr Trinkgeld sichern, die Vishnus, aber weit und breit sei kein Krabbengutschein zu finden, und der Mann im Reisebüro habe gesagt, der Gutschein liege bei Anreise auf der Kabine bereit, so werde man für dumm verkauft, und in der Kabine seien übrigens wieder viel zu wenige Haken und Ablageflächen, wie beim letzten Mal in Venedig. Und da sehe man mal, dass die Kreuzfahrtgesellschaft die ganzen Feedback-Bögen überhaupt nicht zur Kenntnis nähme und auswerte, denn sie habe die fehlenden Haken und Ablageflächen in der Vergangenheit schon mehrfach bemängelt.
»Resonanz: Null! So ist das auf der Welt, es wird gespart an allen Ecken und Enden!«, resümiert sie, schiebt einen Prospektaufsteller voller Werbematerial (Wellnessträume auf hoher See – Verwöhnung pur in unserem Ocean Spa) in die hinterste Regalecke und beginnt, ihr Medikamenten-Arsenal aufzubauen. Ich setze mich gähnend aufs Bett, lehne mich an die Kabinenwand und lege die Füße auf meinem Koffer ab, während sie eine Großpackung Heilerde, eine Vorratstube Voltaren, diverse Vitamintabletten-Dosen, eine Flasche mit grüner Flüssigkeit – wahrscheinlich ein desinfizierendes Rachenspray –, drei Packungen Isländisch-Moos-Pastillen (wie passend zum Reiseziel, denke ich) und einen straff mit Haushaltsgummis umwickelten, backsteingroßen Klumpen aus diversen angebrochenen Tablettenblistern ordentlich im Regal drapiert, als richte sie eine Museumsvitrine mit wertvollen Ausstellungsstücken ein.
»Viel zu wenig Platz und Stauraum«, redet sie dabei weiter, »die denken nicht daran, dass man hier die nächsten zwei Wochen verbringen muss, die wollen einen doch nur auf die öffentlichen Decks locken, wo man konsumieren muss, deshalb machen die die Kabinen so ungemütlich, wir gehen jetzt gleich zur Rezeption, der Gutschein, denk dran, Ines, hast du gehört?«
»Mhm.« Ines hat gehört.
Ich schließe die Augen und übe mich in der Kunst des achtsamen Weghörens. Eine Meditationstechnik, die ich auf den vergangenen Kreuzfahrten aus der schieren Not heraus selbst entwickelt habe. In den nächsten Tagen werde ich sie perfektionieren müssen, will ich diese Reise ohne Nervenzusammenbruch überstehen. Achtsames Weghören bedeutet, in der Haltung des reinen Gewahrseins den erratischen Redefluss meiner Mutter emotional unbeteiligt an mir vorüberziehen zu lassen, aber stets aufmerksam genug zu sein, um auf eventuelle, aus dem logischen Nichts an mich gerichtete Fragen antworten zu können.
»Und der Schrank ist ja allein mit diesen zwei riesigen Schwimmwesten schon voll, guck mal, wie riesig die sind! Müssen die unbedingt in der Kabine sein? Vielleicht kann man die an der Rezeption abgeben! Dass die das für einen verwahren.«
»Die brauchen wir doch, wenn das Schiff untergeht, Mama. Da muss es schnell gehen, da können doch nicht alle zweitausend Passagiere erst an die Rezeption und sich da ihre Schwimmweste aushändigen lassen.«
»Wenn das Schiff untergeht, nützen dir auch die Schwimmwesten nichts«, behauptet meine Mutter, »wir fahren ins Nordpolarmeer, da bist du in einer Minute erfroren, also sind die Westen völlig sinnlos, die nehmen nur Platz weg. Wann ist denn jetzt diese blöde Seenotrettungsübung?«
»Um vier«, seufze ich.
»Und da müssen wir hin? Wir haben doch schon Kreuzfahrten gemacht, warum müssen wir da nochmal mitmachen, das ist doch reine Schikane.«
»Das ist verpflichtend für alle, ist halt so.«
»Ich kann mir sowieso nicht merken, wo diese Rettungsstation ist«, bemängelt Mama weiterhin den Sinn der zwangsweise verordneten Seenotrettungsübung, »ich kann ja nicht mal die Schwimmweste anziehen!«
In der Tat versucht sie gerade, sich die ausladende, orangefarbene Rettungsweste überzuwerfen und festzuschnallen. Hilflos zerrt sie an diversen Schnüren und Klettverschlüssen.
»Siehst du? Und wenn das Schiff dann untergeht, und ich bin in Panik, dann kann ich das erst recht nicht, da musst du dann bei mir bleiben und mir helfen. Ich hab die Weste komplett falsch rum an, oder?«
»Ja.«
»Aber wie … Ah, jetzt hab ich’s! So rum, aha, aha, und dann den Gurt da unten durch! Womit man sich alles beschäftigen muss im Urlaub!« Sie lässt einen Verschluss einrasten und zurrt den Brustgurt fest.
»Mama, du brauchst die Weste noch nicht anziehen, bis zu der Übung dauert es noch über eine Stunde.«
»Ich lass die jetzt an. Wenn ich die jetzt auszieh, weiß ich dann ja wieder nicht, wie ich die anzieh!« Sie behält sie tatsächlich an und packt weiter ihren Koffer aus. Natürlich stößt sie jetzt überall an und kommt mit ihrer sperrigen Oberkörper-Ummantelung kaum zur Badezimmertür hinein und hinaus. Auch dass die Badezimmertür so eng sei, führt sie auf die perfide Strategie der Kreuzfahrtgesellschaft zurück, den Passagieren den Aufenthalt in der Kabine zu verleiden.
»Und die Duschtür ist noch viel enger als die Badtür«, tönt es aus dem Bad, »du kommst gar nicht in die Dusche, wenn du die Schwimmweste anhast!«
Ich wundere mich, auf welche abseitigen Ideen sie mitten in ihrem Redeschwall immer wieder kommt. Wieso sollte man mit Schwimmweste duschen wollen? Während das Schiff irgendwo zwischen Island und dem Nordkap sinkt, könnte ein Kreuzfahrer vielleicht den Wunsch verspüren, nochmal schnell zum Aufwärmen eine heiße Dusche zu nehmen, überlege ich, bevor er dann vom Balkon ins zwei Grad kalte Wasser hüpft.
Ich muss an Günther denken, der keine Saunas mag, obwohl er mit einer Finnin verheiratet ist. Die Saunaverweigerung wird ihm wohl des Öfteren von Sanna zum Vorwurf gemacht, führte bislang aber noch nicht zum Beziehungs-Aus. Sobald das Schiff ablegt, werde ich nicht mehr an Günther denken, nehme ich mir vor. Dann beginnt eine neue Zeitrechnung, ja geradezu ein Abenteuer, ein neuer Lebensabschnitt. Es kann ja wohl nicht sein, dass ich komplett lahmgelegt werde durch diese desaströse Beziehungskiste ohne Zukunft. Aus, Schluss, vorbei. Wenn das Schiff ablegt, ist das Kapitel Günther beendet.
Die Zeit bis zur Seenotrettungsübung verbringe ich damit, aus dem bodentiefen Balkonfenster auf das graue Containerterminal vom Hamburger Hafen zu starren und Günther zu vermissen. Das darf ich ja, das Schiff liegt ja noch im Hafen.
Die Seenotrettungsübung ist wirklich eine lästige Angelegenheit, da muss ich meiner Mutter recht geben. Der Vorgang läuft dergestalt ab, dass man sich auf einen gellenden Alarmton hin die Schwimmweste überzieht und sich zu seiner persönlichen »Sammelstation« begibt, in unserem Fall Deck 5. An der Sammelstation versammelt man sich dann, mehr muss man an Aktivität nicht aufbringen. Bis sich alle Passagiere an ihrer jeweiligen Station versammelt haben, vergeht jedoch eine Zeitspanne, die endlos und zermürbend erscheint, wenn man dicht an dicht und mit reichlich Körperkontakt von allen Seiten in einer orangefarbenen Plastikschwimmwesten-Menge steht. Noch dazu ist es ein ungewöhnlich warmer Sommertag, die Hamburger Hafenluft auf Deck 5 durchzieht eine zarte Brise von Öl, Diesel und Kreuzfahrerschweiß. Über ein Megafon werden Kabinennummern von Gästen ausgerufen, die noch fehlen. Vier verwirrte Senioren, die sich zuvor wohl an einer falschen Sammelstation eingefunden hatten, werden von einem Steward herbeieskortiert und der wartenden Menge einverleibt, die sich nun noch dichter zusammendrängt, da vorn an der Reling ein Fluchtweg frei bleiben muss. Meine Mutter wurde durch unachtsames Verhalten im Sammelvorgang von mir abgedrängt und steht jetzt zwei Reihen hinter mir. Ich lege den Kopf in den Nacken und versuche, nach oben zu atmen, um an frischere Luft zu kommen. Eine endlose Lautsprecherdurchsage beginnt, die uns darauf hinweist, was man alles an Bord keinesfalls tun darf, da es zum sofortigen Untergang des Schiffes führen würde. Feuer machen darf man nicht, und rauchen darf man nicht, wenn das Schiff gerade betankt wird, da jeder Funkenflug eine Katastrophe auslösen könne; außerdem: Der Crew darf man nicht widersprechen, in den Maschinenraum darf man nicht gehen, und auf keinen Fall darf man etwas über Bord werfen, egal was, es gibt nichts, was ungefährlich genug wäre, um bedenkenlos über Bord geworfen zu werden. Im Prinzip ist das auch ein Selbstmordverbot, denke ich. Vor meinem inneren Auge sehe ich einen depressiven, suizidal veranlagten Kreuzfahrer an der Reling stehen, bereit, seinem Leben ein Ende in den Fluten des Ozeans zu setzen. Doch dann denkt er zurück an die Seenotrettungsübung, in der nachdrücklich das Verbot ausgesprochen wurde, etwas von Bord zu werfen, und sei es der eigene Körper. Schuldbewusst nimmt er von seinem düsteren Plan Abstand und geht zur Happy Hour.
Der Rentner, dessen linker Oberarm an meinen rechten gepresst wird, erzählt gerade von der »Provence letzten Monat«, da sei es auch so warm gewesen wie heute, und da hätten sie eine ganztägige Wanderung mit Eseln gemacht, und er wisse nun, dass man mit Eseln sehr laut und streng sprechen müsse, sonst könne man sich nicht gegen sie behaupten. Der »Führer« sei ein Witzbold gewesen, er habe immer gesagt, man müsse mit dem Esel so verfahren, »als würden Sie mit Ihrer Frau sprechen, die macht sonst ja auch, was sie will!« Seine Reisebegleiter lachen ob dieser gelungenen Anekdote.
Links neben mir bricht ein Senior zusammen, er wird nach vorn durchgereicht und an der Reling auf einen Klappstuhl gesetzt. Die endlose Lautsprecherdurchsage mit den Warnhinweisen wird noch einmal wiederholt, diesmal auf Englisch. Ein genervtes Stöhnen geht durch die Menge. Eine Oma in vorderster Front zeigt einer Mitarbeiterin an, dass sie auch kurz davor ist umzukippen, ein weiterer Klappstuhl wird organisiert. Als der Kapitän dann endlich die Übung für beendet erklärt, verfallen alle Schwimmwesten in hektische Betriebsamkeit und drängen ins Schiffsinnere zurück. Anstatt zu warten, dass die Menge mich auf sie zutreibt, kämpft meine Mutter sich völlig sinnlos und mit verzerrtem Gesicht gegen den Strom der Senioren zu mir durch und packt meinen Unterarm, als sei er nach einer gefährlichen Flussdurchquerung der rettende Ast in Ufernähe. Wenn sie schon am ersten Tag so ihre Energie verpulvert, wird sie den Rest der Reise erschöpft im Bett liegen und Tierfilme schauen, denke ich.
»Komm mit, wir gehen jetzt gleich zur Rezeption«, ruft sie mir zu, »die ist doch auch auf Deck 5, da müssen wir nicht erst nochmal in die Kabine zurück, wir gehen da jetzt gleich hin und beschweren uns!«
Die Idee, die Seenotrettungsübung mit einem Beschwerdebesuch an der Rezeption zu verbinden, haben außer uns anscheinend noch andere Kreuzfahrer. Etwa fünfzig Passagiere mit Schwimmwesten tummeln sich bereits im Rezeptionsbereich und stauen sich bis ins Treppenhaus zurück. Aus den Aufzugtüren quellen unablässig weitere, allesamt beschwerdewillige Menschen.
Meine Mutter reißt sich mitten im Getümmel die Schwimmweste vom Leib und drückt sie mir in die Hand. Eine kluge Aktion, denn nun ist sie um einiges wendiger und dünner als die restlichen, unförmig verdickten Passagiere. So kann sie sich geschickt in entstehende Lücken zwängen und hat sich in Windeseile in eine günstige Warteposition vorgekämpft.
Ich bringe unsere Schwimmwesten in unsere Kabine auf Deck 8 und kehre dann zurück an die Rezeption, um meiner Mutter bei der geplanten Krabbenbeschwerde beizustehen. Die wartenden Kreuzfahrer haben inzwischen zwei recht ordentliche Schlangen gebildet, wir stehen in der linken Schlange ganz vorn und haben nur noch ein Kreuzfahrer-Pärchen vor uns.
»Ich weiß nicht, was die alles zu besprechen haben«, flüstert meine Mutter mir unwillig zu, »ich hätte mich lieber am anderen Schalter anstellen sollten in der rechten Schlange geht’s viel schneller!«
In der rechten Schlange, ein schöner Buchtitel, denke ich, so könnte man einen Lyrikband nennen, den Erfahrungsbericht eines Nazi-Aussteigers, oder die letzten Gedanken einer Futtermaus im Terrarium eines Pythonpärchens.