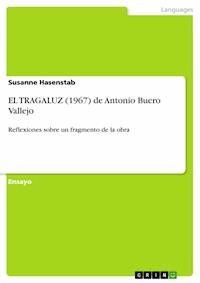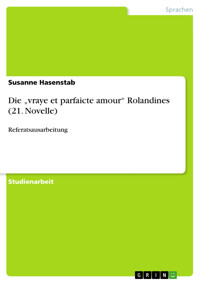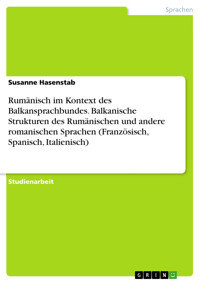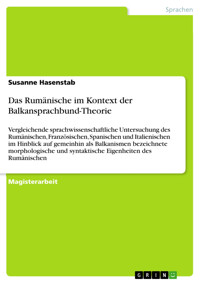13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Reihenmittelhäusern, obskuren Literatur-Soireen und diesem Gefühl namens Liebe ...
Katja ist Anfang dreißig und arbeitet beim »Sonntags-Blitz«, der Gratis-Zeitung ihres Heimatorts, bei der sie nach dem Praktikum irgendwie hängen geblieben ist. Während ihr Freund Jonas das Projekt Eigenheim vorantreibt, überkommt Katja beim Brunch mit werdenden Müttern und Pärchenausflügen zur »langen Nacht der Musterhäuser« zunehmend ein Gefühl der Beklemmung. Sie flüchtet sich in einen schrägen Zirkel kleinstädtischer Möchtegernliteraten und -künstler und begegnet auf einer der alkoholgeschwängerten Abendveranstaltungen dem Krimiautor Robert Klotzky, dem mit »Die Geschändeten von Heusenstamm« ein Überraschungserfolg gelang – und der auch bei Katja einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Katja ist Anfang dreißig und arbeitet beim »Sonntags-Blitz«, der Gratis-Zeitung ihres Heimatorts, bei der sie nach dem Praktikum irgendwie hängen geblieben ist. Während ihr Freund Jonas das Projekt Eigenheim vorantreibt, überkommt Katja beim Brunch mit werdenden Müttern und Pärchenausflügen zur »langen Nacht der Musterhäuser« zunehmend ein Gefühl der Beklemmung. Sie flüchtet sich in einen schrägen Zirkel kleinstädtischer Möchtegernliteraten und -künstler und begegnet auf einer der alkoholgeschwängerten Abendveranstaltungen dem Krimiautor Robert Klotzky, dem mit »Die Geschändeten von Heusenstamm« ein Überraschungserfolg gelang – und in den Katja sich verliebt …
Autorin
Susanne Hasenstab, geboren 1984, studierte Romanistik und Skandinavistik in Frankfurt/Main und Lausanne. Sie arbeitet als freie Autorin und Kolumnistin für unterschiedliche Printmedien und beim Radio. Zusammen mit ihrem Bühnenpartner Emil Emaille tritt sie mit kabarettistischen Leseprogrammen auf. In ihrer Freizeit macht sie gern Yoga, reist und belauscht andere Leute, um Inspirationen für ihr Bühnenprogramm zu sammeln. »Irgendwo zwischen Liebe und Musterhaus« ist ihr erster Roman bei Limes.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Susanne Hasenstab
Irgendwo zwischen Liebe und Musterhaus
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
AF · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-23125-5V002www.limes-verlag.de
Kapitel 1
WIRHÄTTENANdiesem Freitag einfach wie immer zum Fettgriechen gehen sollen. Einfach wie immer zum Fettgriechen, und alles wäre beim Alten geblieben. Aber ausgerechnet an jenem Tag hatte Herr Böhmann Lust auf Veränderung.
Zunächst ist alles wie immer. Pünktlich um dreizehn Uhr tritt er an meinen Schreibtisch, legt seine Hand mit dem unheimlichen, vom Nagelpilz zerstörten Zeigefingernagel neben meiner Tastatur ab, dann seufzt er tief, halb ermattet, halb erleichtert, dass jetzt in Kürze die Mittagspause eine Schneise der Hoffnung in seinen trüben Tag schlagen wird.
»Also ich wär so weit«, sagt er.
»Ja, gehn wir«, erwidere ich, den Blick aber auf dem Bildschirm, weil immer noch was zu aktualisieren ist oder irgendwelche Fenster zu schließen sind.
»Gehn wir?«, fragt Herr Böhmann, immer dieser kleine Beckett-Dialog zwischen uns, bis wir endlich aufbrechen.
»Ja, ich bin fertig«, sage ich, stehe aber nicht auf.
»Keine Hektik.« Herrn Böhmanns Hand verharrt während des Mittagspausen-Einstiegsgesprächs stets neben meiner Tastatur, als mahnendes Zeichen des Aufbruchs oder was weiß ich, jedenfalls beeile ich mich wirklich, abmarschbereit zu werden, weil ich nicht ständig den gruseligen zersplitterten Fingernagel aus dem Augenwinkel ansehen mag.
»Bist du so weit?«
»Ja, gehn wir.«
»Keine Hektik.«
»Nee, ich bin fertig. Gehn wir.«
Dann fragt Herr Böhmann, und das ist die folgenschwere Abweichung in unserem verkrusteten Ritual, ob man heute nicht ausnahmsweise den Nudeltag beim Da Giovanni wahrnehmen könne statt wie gewohnt das Freitagsmenü beim Fettgriechen.
»Okay, können wir machen.« In diesem Moment ist mein Schicksal quasi besiegelt, aber zum Glück weiß ich davon noch nichts. Ich aktualisiere noch mal die E-Mails, nichts Neues. Während ich meine Handtasche einräume, erläutert Herr Böhmann seine Motive. Nach dem letzten Besuch beim Fettgriechen am vergangenen Freitag habe er das ganze Wochenende über Sodbrennen gehabt, auch große Mengen Bullrich-Salz und Heilerde hätten ihm keine Linderung verschafft, und er sei sich nicht sicher, ob die Dionysos-Platte, die er damals gegessen hatte, in der Zwischenzeit überhaupt schon seinen Körper verlassen habe.
»Kein Problem, gehn wir zum Da Giovanni«, sage ich schnell, bevor er seine Verdauungsproblematik noch detaillierter ausführt.
Um 13.12 Uhr verlassen wir die Redaktion und machen uns auf den Weg zum Nudeltag. Der Fettgrieche, der eigentlich Poseidon heißt, ist berüchtigt für seine riesigen, verklumpten Fleischberge, die einem den Magen über Stunden wie Flüssigbeton ausfüllen, dafür kostet der Mittagstisch aber auch nur 4,50 Euro, weniger als im Thai Express. Egal, ich kann nachvollziehen, dass man ein Unbehagen gegen ein Restaurant entwickeln kann, dessen Gerichte einem über Tage hinweg störrisch im Darm verharren.
Wir gehen schweigend die Bahnhofstraße entlang in Richtung Marktplatz, wo sich der Da Giovanni befindet. Als ein herbstlicher Nieselsprühregen einsetzt, wühlt Herr Böhmann umständlich einen rot-grün karierten Knirps aus seiner Herrenhandtasche, befindet den Niederschlag dann wohl aber doch als zu schwach, um sich dagegen mit einem Schirm zu rüsten, und zieht stattdessen eine knisternde Kapuze aus einem Wulst am Nacken seiner wetterfesten blauen Übergangsjacke und stülpt sie sich über die Glatze.
Herr Böhmann wird von Besuchern in der Redaktion manchmal für behindert gehalten, dabei ist er einfach nur sehr freundlich, leise und unbeholfen. Eine Kollegin erzählte mir, Herr Böhmann habe vor zehn Jahren einen Unfall beim Bungee Jumping gehabt. Er sei in Neuseeland von einem Hochhaus gesprungen und blöd mit dem Kopf irgendwo aufgekommen, und seitdem sei er »so«. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass Herr Böhmann jemals im Höhenrausch und voller Adrenalin von einem Hochhaus gesprungen sein soll, wenn ich ihn so anschaue, wie er jetzt neben mir her trabt in seinen schwarzen Gesundheitsschuhen. Irgendwann werde ich ihn fragen, ob die Story stimmt. Jedenfalls mag ich ihn gerne. Herr Böhmann läuft oft schräg hinter mir wie ein freundliches Begleitfahrzeug. Auch er scheint nicht ungern mit mir seine Mittagspause zu verbringen – sonst stünde er wohl nicht Tag für Tag an meinem Schreibtisch, um mich abzuholen – zeigt jedoch keinerlei Interesse an meiner Person. Gegenseitiges Desinteresse ist wahrscheinlich eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Beziehung, überlege ich mir. Wenn man sich einfach gegenseitig in Ruhe lässt, kommen kein Streit und kein Zwist auf, und man kann in Frieden zusammen alt werden.
Wir überqueren den Marktplatz, Herr Böhmann mit wehem Blick und etwas gekrümmt, vielleicht wegen des Herbstwinds, der uns entgegenbläst, vielleicht weil er in seinen Eingeweiden eine acht Tage alte, halb verweste Dionysos-Platte mit sich herumträgt, ich stelle keine Fragen. Vor dem schmucklosen Marktplatzbrunnen liegen sechs Heuballen, daneben ein Schubkarren voller Kürbisse, Überbleibsel von irgendeiner Erntedankfeierlichkeit. Weder Herr Böhmann noch ich kommentieren das seltsame Ensemble. Weitgehender Kommunikationsverzicht ist die tragende Säule unserer jetzt schon seit anderthalb Jahren bestehenden Mittagspausenpartnerschaft.
Wir bestellen beide Spaghetti mit Meeresfrüchten, dann holt jeder sein Smartphone heraus. Ich habe eine WhatsApp von Jonas. Ob ich an den Termin denke heute um fünf. Wir haben eine Hausbesichtigung in einem Neubaugebiet. Ein »sympathisches Reihenendhaus in bester Lage«. Ich weiß nicht, was die Nachricht soll. Als hätte ich je einen Besichtigungstermin verpasst. Wahrscheinlich merkt er, dass sich bei mir eine gewisse Gereiztheit in Bezug auf sein Häuslichkeitsprojekt eingestellt hat. Ich tippe »Ja«, woraufhin Jonas »Super, freu mich« schreibt und ein rosa Herz schickt. Obwohl alles gesagt ist, schreibt er noch mal »Also, dann bis um fünf«, als wäre mir wirklich zuzutrauen, dass ich die Uhrzeit vergesse, schließlich schickt er noch ein rotes Herz und einen Daumen-nach-oben-Smiley, was für eine dämliche Kombination. Ich schicke ihm ein von einem Pfeil durchschossenes blaues Herz und einen Knutsch-Smiley, dass endlich Ruhe ist.
Ruhe ist natürlich nicht, stattdessen schickt er drei selige Smileys mit Heiligenscheinen, was zeigen soll, wie glücklich ihn das durchschossene blaue Herz und der Knutsch-Smiley machen. Ich stecke das Handy wieder in die Handtasche und spüre eine plötzliche Niedergeschlagenheit.
Herr Böhmann zeigt mir ein verwackeltes Katzenvideo, das ihm seine Frau geschickt hat. Eine Katze steht vor einer Spiegelwand und kämpft gegen sich selbst. Da wir die einzigen Gäste bei Giovanni sind, kann er den Ton anlassen, und man hört Leute lachen und »Oh my gaaad!« rufen, während die Katze gegen die Spiegel knallt. Giovanni steht derweil vor dem Fenster und raucht. Eigentlich heißt er Jens und kommt aus Mannheim. Seine Frau ist die Köchin, sie heißt Oana und kommt aus Rumänien. Das Altöl, in dem sie die Meeresfrüchte brät, kommt aus dem Schwarzen Meer, so vermuten Herr Böhmann und ich zumindest. Egal, was man im Da Giovanni bestellt, es schmeckt fischig und schwer, weswegen wir meistens die Meeresfrüchtenudeln nehmen, denn wenn die fischig und schwer schmecken, ist das natürlicher, als wenn man eine Salamipizza oder Hackfleischlasagne mit Fischgeschmack isst.
Alle paar Monate fährt die Rumänin zu ihrer Familie in die Hafenstadt Constanza, wo sie wahrscheinlich die für den Restaurantbetrieb benötigten Altölbestände auffüllt. Während Oana weg ist, kocht Jens, aber vermutlich wärmt er nur von Oana vorgekochte Gerichte auf, denn die langen Absenzen der Köchin haben sich noch nie in einer kulinarischen Veränderung bemerkbar gemacht.
Mein Handy vibriert in der Handtasche. Jonas schon wieder. Er schreibt, das Möbelhaus Soundso bei Wiesbaden veranstalte heute die »Lange Nacht der Musterhäuser«, von zwanzig Uhr bis drei Uhr morgens. Inga und Borke hätten ihn gerade gefragt, ob wir Lust hätten, da hinzugehen.
Ich habe nicht die geringste Lust, auf die Lange Nacht der Musterhäuser zu gehen. Es ist höchste Zeit, aktiv zu werden, das ahne ich, irgendetwas muss geschehen, sonst wird sich die Schlinge namens Eigenheimerwerb immer enger um meinen Hals ziehen. Ich überlege, wie viel Geld ich auf dem Konto habe und wie lange ich damit überleben könnte, wenn ich alles abheben und verschwinden würde. Es gibt doch so billige Länder, Thailand oder so, da kann man mit zwei Euro am Tag angeblich königlich leben, aber ich will überhaupt nicht nach Thailand, das ist viel zu weit weg, und die Leute sind so klein. Ich will aber auch nicht mit einem befreundeten Pärchen auf die Lange Nacht der Musterhäuser.
»Weiß nicht, mal gucken«, schreibe ich Jonas.
Dieser schickt umgehend ein verdutzt dreinschauendes Smiley. »Wieso, wir ham doch sonst nix vor, oder? Inga und Borke würden uns auch abholen und wieder heimfahren.«
Na dann ist ja alles bestens. Wir können uns bei der Langen Nacht der Musterhäuser ja gleich zusammen mit Inga und Borke ein schlüsselfertiges Musterhaus aussuchen und in einem familienfreundlichen Gebiet errichten lassen. Da drin wohnen wir dann, zwei befreundete Pärchen, bald Ehepaare, und ein Kinderzimmer nach dem anderen wird gefüllt. Mich überfällt Mutlosigkeit. Ich kann Jonas nicht begreiflich machen, was ich an Unternehmungen wie der ominösen Musterhausnacht so schlimm finde, weil ich es ja nicht einmal selbst verstehe.
Giovanni tischt die Meeresfrüchtenudeln auf.
»Bin grad beim Essen, können ja kurzfristig entscheiden«, schreibe ich. Kurzfristig entscheiden, das klingt doch gut, es klingt nach Spontaneität und Schwung, nicht nach missmutiger Verweigerungshaltung.
Die Oktopusse und Krabben haben die Konsistenz lange gelagerter Gummibärchen, man kann sie kaum kauen, sie werden aber auch nicht kleiner, wenn man sie lutscht. Wir haben gerade den zweiten Bissen im Mund, da geht wie im Bauerntheater die Tür auf, und herein kommt Heinrich Waldemar Ertel, gefolgt von seinem unsympathischen, nervösen Hund – irgendein langbeiniges, dünnes Mischlingsvieh mit rotbraunem Zottelfell.
»Katja, was für ein Zufall! Wie schön, dich mal wieder zu sehen!«, ruft Heinrich lauthals durch das zum Glück leere Lokal – auch die Anwesenheit anderer Gäste hätte ihn nicht dazu veranlasst, seine Lautstärke zu drosseln. Mit dramatisch ausgebreiteten Armen tritt er an unseren Tisch, wedelt mit den Armen, was seinen zuckenden Hund noch nervöser macht, und ich stehe auf, noch mit vollem Mund, um Heinrich die Begrüßungsumarmung zu gewähren.
Er presst mich so fest an sich, dass es mir den Ölnudel- und Meeresfrüchtebrei in der Speiseröhre ein Stück nach oben drückt. »Katja«, sagt er noch einmal, »was für eine Fügung, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen!« Er streichelt mir über den Rücken, während zu unseren Füßen der hagere Zottelhund im Quadrat springt und mit seinem langen Schwanz gegen Stuhl- und Tischbeine schlägt. Ganz so erregt wie sein Hund ist Heinrich zwar nicht, trotzdem entwinde ich mich möglichst schnell seiner Umklammerung und lasse mich wieder in der schützenden, geschlechtslosen Aura von Herrn Böhmann nieder.
Heinrich trägt eine dunkelblaue Baskenmütze, seinen Körper umhüllt ein beiges Textiliensammelsurium, das man vielleicht als eine Art Herren-Freizeitanzug beschreiben könnte, viel luftig geschnittenes Leinen und Hirschholzknöpfe sind dabei. Ich habe ähnliche Kleidungsstücke kürzlich in einem Film gesehen, der in den zwanziger Jahren auf einem Hochseedampfer spielte, wo Herren in solchen flatternden Freizeitanzügen übers Deck flanierten, oft mit Spazierstock, ein Detail, das in Heinrichs Gesamtkomposition fehlt.
Es sind ein paar Wochen vergangen, seit er mich zum letzten Mal zufällig in der Stadt abgefangen und sich an mir festgelabert hat, und seitdem ist ihm ein Bart gewachsen, wie er ekliger kaum sein kann, denn eigentlich ist es nur ein grauer, buschiger Ring rund um den Mund herum.
Heinrich Waldemar Ertel war früher Leiter des Wasserwirtschaftsamts. Seit seiner Frühpensionierung betätigt er sich als Schriftsteller und versucht zwanghaft, in unserer Provinzstadt eine Art Künstlerszene zu erschaffen, was mangels hier ansässiger Künstler an sich schon ein interessantes Kunstprojekt ist. Ihm schwebt eine Art Rhein-Main-Bohème vor, in die er auch mich mit Gewalt eingliedern will.
Heinrich legt den Mantel ab, die Baskenmütze behält er seltsamerweise auf, lässt sich auf den Stuhl an der Stirnseite fallen, winkt Giovanni heran und bestellt einen Wermut. So was hätten sie nicht, sagt der Wirt knapp. Heinrich behauptet, neulich bei seiner Studienreise nach Bologna regelmäßig als Aperitif einen Wermut getrunken zu haben, und das hier sei doch schließlich auch ein italienisches Lokal, aber Giovanni weiß nicht einmal, was ein Wermut ist.
Dann fällt Heinrich ein, dass er den Wermut gar nicht in Bologna, sondern in Barcelona getrunken hat, Giovanni verdreht die Augen, Heinrich bestellt stattdessen einen Ramazotti.
»Katja, was gibt’s Neues in deinem Leben? Schreibst du, bist du produktiv? Mach dich auf was gefasst, ich hab gleich noch einen Anschlag auf dich vor! Aber iss erst mal in Ruhe fertig!«
Herr Böhmann wird von ihm komplett ignoriert. Während Heinrich mit einer Hand versucht, den sich ständig aufbäumenden Hund dauerhaft unter die Tischplatte zu drängen, fummelt er mit der anderen ein Kärtchen aus der Brusttasche und legt es neben meinen Teller. »Schau mal, meine neuen Visitenkarten, hab ich gerade abgeholt, du bist die Erste, die eine bekommt!«
Auf dem unangenehm uringelben Kärtchen steht: »Heinrich Waldemar Ertel – Schriftsteller und Mensch«.
Heinrich ist übrigens frühpensioniert wegen eines Überfalls, den er gar nicht miterlebt hat. Der Ex-Wasserwirtschaftsamtsleiter stand vor etwa acht Jahren im DM – Markt hinten beim Hundefutter, als vorne an der Kasse ein Junkie die Kassiererin mit einer unechten Waffe bedrohte. Weil die Waffe so unecht aussah, schickte die Kassiererin den Räuber weg und rief die Polizei, die ihn zwei Straßen weiter festnahm. Als Heinrich mit seinem Hundefuttersack zur Kasse kam und von dem Vorfall unterrichtet wurde, erlitt er einen Zusammenbruch, von dem er sich laut eigener Aussage bis heute nicht erholt hat. Der Zusammenbruch, so behauptet er, sei entstanden aufgrund einer Bedrohung, die gerade deshalb so bedrohlich gewesen sei, weil er zum Zeitpunkt ihrer Existenz nichts davon geahnt habe. Wäre er direkt mit der Bedrohungssituation konfrontiert gewesen, hätte er diese im Nachhinein besser verarbeiten können, so aber mündete seine psychische Zerrüttung letztlich in einem Antrag auf Frühpensionierung, dem stattgegeben wurde. Jetzt ist er nicht mehr Wasserwirtschaftsamtsleiter, sondern »Schriftsteller und Mensch« und hat endlos Zeit für sogenannte Studienfahrten nach Bologna, Barcelona und anscheinend auch nach Marokko, denn gerade erzählt er von einer einwöchigen Wüstenwanderung durch die Sahara. Ihm sei von den Tuareg ein persönliches Kamel zugewiesen worden, und er habe nach fünf Tagen dann auch eine Bindung zu dem Kamel aufbauen können, nachdem es ihn zunächst abgelehnt habe.
Mit letzter Kraft esse ich unter Heinrichs ungeduldigen Blicken auf und bedecke die knorpelartigen Tintenfischreste mit der Papierserviette, die sich sofort mit braunem Öl vollsaugt. »So, jetzt aber zur Sache«, sagt Heinrich, bestellt einen zweiten Ramazotti, dann wendet er sich mir zu, legt mir die Hand auf die Schulter und sieht mir tief in die Augen, als wolle er mir einen Heiratsantrag machen. »Das ist wie gesagt eine glückliche Fügung, dass ich dich hier treffe, denn heute Abend findet die große Premiere statt, und ich möchte, dass du dabei bist.«
»Was für eine Premiere?«
»Hast du meine Rundmail nicht gelesen?« Heinrich schickt ständig Rundmails mit kulturellen Ausgehtipps und Einladungen zu Vernissagen, Finissagen und Poetenstammtischen, ich lösche alles sofort.
»Ich weiß nicht, du schickst immer so viel Zeug rum, ehrlich gesagt les ich das nicht alles.«
»Richtig so«, freut er sich und hebt den Ramazotti lobpreisend in die Höhe, »der wahre Künstler darf sich nicht zu vielen Außenreizen aussetzen, er muss sich der Überflutung widersetzen, löblich, dass du nicht alles liest, was dir so ins Postfach schneit!«
Viel wichtiger sei der Kontakt von Mensch zu Mensch, weshalb er mir hier und jetzt verkünde, dass heute Abend zum ersten Mal sein seit Monaten geplantes Soiree-Konzept »Heinrich, still und leise« über die Bühne gehen werde.
»Heinrich, still und leise?«
»Ein genialer Titel, oder? Es findet bei mir zu Hause statt, ich kreiere eine Art Verschmelzung von Soiree, Come-Together, Kunst und Geselligkeit, jeden ersten Freitag im Monat. Es gibt Kurzlesungen, Musik, Performance ist auch dabei, sozusagen die Auferstehung des literarischen Salons, aber auch mit crazy Elementen!«
Aha. Es reicht ihm nicht mehr, einfach nur Schriftsteller und Mensch zu sein, jetzt sieht er sich anscheinend auch noch als Gertrude Stein vom Untermain. Der Titel sei ihm in der letzten Nacht der marokkanischen Wüstenwanderung eingefallen, »Heinrich, still und leise«, denn er sei zwar offen für Kunstdarbietungen aller Couleur, jedoch dürfe aufgrund seiner kunstfeindlichen Nachbarn eine gewisse Lautstärke nicht überschritten werden. »Und stell dir vor, wenn sich das rumspricht, dass ich Künstlern eine Plattform biete, da rennen mir doch die ganzen Rockbands die Bude ein, also Musik ja, aber nur akustisch, heute Abend spielen die Blackmailed Tombstones of Vienna, kennst du die?«
Ich schüttele den Kopf.
»Die machen so begleitende Impressionen, lassen sich von den Gästen und der Stimmung im Raum inspirieren, so bisschen tempelmusikmäßig. Und im Wintergarten gibt’s immer eine Vernissage, da ist Platz für circa zehn Bilder und auch die ein oder andere Skulptur, jeden Monat will ich da einen anderen Künstler vorstellen, unter dem Motto ›Räumchen, wechsel dich!‹, auch hervorragend gewählt, der Titel, oder? Um acht Uhr geht’s los, du kannst aber auch früher kommen, dann mix ich dir einen persönlichen Begrüßungscocktail.«
Auch der ignorierte Herr Böhmann hat mittlerweile aufgegessen und schaut auf die Uhr. Leider drängt er nicht zum Aufbruch, sondern bestellt sich bei Giovanni noch ein Tiramisu und einen doppelten Fernet Branca, wohl in der Hoffnung, den abscheulichen Hauptgang dadurch retten oder zumindest neutralisieren zu können.
»Ja, danke für die Einladung, aber ich hab heute keine Zeit.«
»Katja, das kannst du mir nicht antun, was hast du denn Wichtiges vor, dass du dir so eine Premiere entgehen lässt?«
»Ich muss noch arbeiten und hab danach eine Hausbesichtigung mit Jonas.«
»Dein Freund?«
»Ja.«
»Ihr wollt euch ein Haus kaufen?«
»Vielleicht, wir schauen erst mal nur.« Warum lasse ich mich so in die Enge treiben, es geht ihn überhaupt nichts an, weswegen ich seiner bescheuerten Soiree nicht beiwohnen werde.
Heinrich holt ein feuchtes Erfrischungstuch aus der Hosentasche, eines, wie man es nach Hähnchenverzehr bekommt, und wischt sich damit ausgiebig unter seinem Herrenfreizeitdress die Achseln aus, riecht dann kurz am Erfrischungstuch, stopft es zurück in die aufgerissene Packung und die Packung zurück in die Hosentasche.
»Und wenn ich dir sage, dass sich sogar ein Großschriftsteller angekündigt hat für heute Abend, könnte dich das umstimmen? Ob du es glaubst oder nicht, zur Premiere von ›Heinrich, still und leise‹ hat sich Robert Klotzky angekündigt!« Er sieht mich triumphierend an. Ich kenne keinen Robert Klotzky.
Dafür kommt plötzlich Leben in Herrn Böhmann. »›Die Geschändeten von Heusenstamm‹!«, ruft er aus und erhebt das Glas.
»Genau«, schreit Heinrich und haut mit der Hand auf die Tischplatte, so dass sein Hund jaulend auffährt, sich unter dem Tisch im Kreis dreht und wieder mit dem Schwanz zu schlagen beginnt. »Der Mann kennt sich aus!« Heinrich deutet auf Herrn Böhmann, den er nun erstmals wahrnimmt, dann schiebt er auch ihm eine seiner Schriftsteller-und-Mensch-Visitenkarten zu. »Entschuldigung, ich war so auf Katja fixiert, ich habe mich gar nicht vorgestellt, Sie sind wohl ein Arbeitskollege? Heinrich, sehr erfreut.«
»Böhmann«, sagt Herr Böhmann, und sie geben sich die Hand.
»Jedenfalls hat sich für heute Abend Robert Klotzky angekündigt!«
»›Die Geschändeten von Heusenstamm‹«, wiederholt Herr Böhmann, unablässig nickend, »ein sehr gutes Buch, grausam, aber gut«.
»Tut mir leid, ich kenn den nicht«, sage ich.
»Sie kennt Robert Klotzky nicht.« Heinrich sieht Herrn Böhmann voller Bedauern an, er will sich mit ihm gegen mich verbünden, aber Herr Böhmann bearbeitet nun wieder unbeteiligt sein klumpiges Tiramisu.
»›Die Geschändeten von Heusenstamm‹, noch nie gehört? Das war der erste Regionalkrimi, der deutschlandweit Beachtung gefunden hat, Spiegelbestsellerliste und so.«
»Grausames Buch«, sinniert Herr Böhmann vor sich hin, »sehr grausam. Aber gut!«
»Katja, stell dir doch mal vor, du liest heute Abend was vor von deinen Gedichten, der Robert Klotzky hört das, es gefällt ihm, er empfiehlt dich weiter, das ist ein einflussreicher Mann, und zack, so schnell geht’s, dann hast du nächstes Jahr den Büchner-Preis!«
Das wird ja immer besser, ich bin anscheinend nicht als Besucherin zu dieser ominösen Soiree geladen, sondern als Akteurin. Ich soll mich in Heinrich Waldemar Ertels Wohnzimmer setzen und Gedichte vorlesen, am Ende noch zur improvisierten, tempelmusikmäßigen Begleitung der Blackmailed Tombstones of Vienna, in der Hoffnung, von einem mir unbekannten angeblichen Großschriftsteller entdeckt zu werden. Ich finde, Heinrich hätte lieber in Marokko bleiben und die Bindung zu seinem Kamel vertiefen sollen, anstatt sich so einen Schwachsinn auszudenken.
Dass ein anscheinend deutschlandweit aktiver Autor seiner Soiree beizuwohnen gedenkt, beflügelt ihn auf ungute Weise. Es ist eine Untermauerung seiner Trugwelt, in die er mich jetzt umso zwanghafter integrieren will, wieder und wieder sagt er, ich müsse kommen heute Abend.
»Überleg’s dir, Katja«, fällt mir Herr Böhmann mit ungewohnt eindringlicher Stimme nun in den Rücken, »das könnte eine Chance sein, sonst sitzt du bis in alle Ewigkeit im Sonntags-Blitz, so wie ich.«
»Das ist mir aber jetzt zu kurzfristig, ich hab wie gesagt halt leider schon was anderes vor. Vielleicht beim nächsten Mal.«
Heinrichs Blicke gewinnen eine immer unangenehmere Intensität. »Manche Chancen bieten sich nur einmal im Leben, und man muss sie ergreifen, bevor sie vorbeigeschwommen sind. Du weißt, dass ich mich sehr für dich einsetze, für dich als Künstlerin – und als Mensch. Aber ich kann es dir auch nicht alle Tage bieten, dass ich so einen dicken Fisch an der Angel habe. Ich kann dir diesen dicken Fisch nur heute Abend exklusiv in der Bratpfanne servieren, mit Zitrone und Rosmarin garniert, und es ist an dir, ob du zum Essen vorbeikommst oder nicht. Eigentlich eine gute Formulierung, oder? Dieser Vergleich mit dem dicken Fisch? Muss ich mir gleich notieren.« Und tatsächlich holt er sein Handy hervor und beginnt, genau die gleichen Sätze noch einmal als Sprachmemo hineinzusprechen.
Ich glaube ihm sogar, dass er irgendeinen Halbpromi engagiert hat, um seiner Soiree Glamour zu verleihen, er ist sehr findig, was so schreckliche Tätigkeiten wie Networking angeht. Während er überdeutlich seine Fischvergleiche ins Smartphone spricht, bin ich hypnotisiert von seinen Lippen, die sich wie ein Fischmaul auf und zu bewegen, wodurch sich sein struppiger Mund-Umrundungs-Bartring abwechselnd vergrößert und verkleinert.
Auf seine Mundpartie starrend, muss ich mir eingestehen, dass ich Heinrich Waldemar Ertel eins meiner peinlichsten Geheimnisse verdanke. Nämlich einen unsäglichen Kuss. Und ehrlich gesagt nicht nur einen, sondern mehrere. Zumindest hatte er damals, vor etwa zwei Jahren, den hässlichen Bart noch nicht, was aber keine Entschuldigung sein kann. Wenn Jonas davon wüsste, würde er keineswegs mit mir den Kauf eines Eigenheims planen. Im Prinzip, überlege ich, wäre, ihm von meiner nächtlichen Hinterhof-Knutscherei mit Heinrich Waldemar Ertel zu berichten, die einzige Möglichkeit, ihm die Schnapsidee mit dem Sesshaftwerden und Heiraten und Hauskaufen auszutreiben. Wie alt ist Heinrich überhaupt, mindestens fünfundfünfzig, die Frühpensionierung war vor zehn Jahren, hat er erzählt, mit siebenundvierzig, also ist er jetzt siebenundfünfzig, herrje.
Zu dem Vorfall kam es, weil ich ab und zu Gedichte schreibe. Eigentlich nur so für mich, ohne Ambitionen auf Veröffentlichung, wobei ich dann doch einmal den Fehler machte, eines bei einem Nachwuchswettbewerb einzureichen, den der mir damals noch nicht bekannte Heinrich als Vorsitzender der mittlerweile wieder aufgelösten Dichtervereinigung Reim-Erlös ausgeschrieben hatte. Mein Gedicht belegte den ersten Platz, wobei die Jury aus Heinrich und sonst niemandem bestand und es außer mir nur vier weitere Einsendungen gab. Der Preis bestand in einer Lesung in der Buchhandlung Schmökerbär, zusammen mit der Zweit- und Drittplatzierten des Nachwuchswettbewerbs, einer Mittvierzigerin namens Hermine, die »spirituelle Aphorismen« schrieb, und einer Mundartdichterin, die, auf einen Rollator und auf einen Urenkel gestützt, den Buchladen betrat. Wir rezitierten abwechselnd unsere Gedichte, vor insgesamt neun Zuhörern, alles in allem ein heilsamer, desillusionierender Ausflug in die Welt des Literaturbetriebs, der von meiner Seite aus keiner Wiederholung bedurfte, wobei Heinrich und auch der rotbackige Buchhändler überaus zufrieden mit der Veranstaltung waren. Es sei nicht normal, dass bei einer Lesung so viel mehr Zuhörer als Literaten anwesend seien, erfuhr ich, und beim Soundso, der Buchhändler nannte einen Namen, den ich nicht kannte, seien neulich nur vier Leute gekommen, und der habe immerhin schon beim Bachmannpreis gelesen.
Danach viel, viel Sekt im Hinterhof der Buchhandlung. Und ich war ziemlich enttäuscht, dass weder Jonas noch meine Eltern noch sonst wer, den ich kannte, zu meiner ersten und einzigen Lesung gekommen waren. Die sieben Zuhörer – außer Heinrich und dem Buchhändler – stellten sich als Angehörige der Zweit- und Drittplatzierten heraus, euphorisiert und lachend standen sie bei ihren frisch gekürten Lyrikpreisträgerinnen, und ich stand blöd, angetrunken und einsam mit meinem Sektglas daneben, was wiederum Heinrich auffiel und was er geschickt als Einstiegsluke für ein »intensives Gespräch« nutzte, dessen Inhalt ich zum Glück vergessen habe, es bestand, glaube ich, nur aus Huldigungen meiner Kunst und meiner Person und mündete gegen Mitternacht in eine Abfolge sektklebriger Küsse und eine Klammer-Umarmung, aus der ich mich nicht so entschieden herauswand, wie ich es wahrscheinlich gemusst hätte. Aber in dem Moment tat er mir auch leid, weil er alles so akribisch organisiert und solch einen nutzlosen, von niemandem gewürdigten Enthusiasmus an den Tag gelegt hatte. Wie dem auch sei: Seit diesem unseligen Ereignis beißt sich Heinrich regelmäßig, aber zum Glück nur verbal an mir fest, wenn wir uns zufällig in der Stadt über den Weg laufen, was nicht selten passiert, da er ja den ganzen Tag nichts anderes macht, als mit seinem ruhelosen Tier herumzulaufen, »Eindrücke zu sammeln« und sich als literarischer Flaneur zu fühlen.
Gerade steckt Heinrich das Smartphone wieder weg, hebt den Kopf und kratzt sich ausgiebig am Kinn, wie um seinen vom Bart umrankten Mund noch besser zu präsentieren, damit ich auch ja nicht vergesse, wie nah wir uns waren, die aufstrebende Literatin und ihr reifer Mentor, im Rausch der Sinne vereint, wie das eben so ist im freigeistigen Milieu der Rhein-Main-Bohème.
Was ein Elend. Ich bin einunddreißig Jahre alt, sitze im Da Giovanni und stoße toxischen Tintenfischbrei auf. Neben mir ein windiger Kulturschaffender, mit dem ich damals wenigstens nicht im Bett gelandet bin, aber vielleicht auch nur deswegen nicht, weil in der gegebenen Situation kein Bett erreichbar war, außer wir hätten den freundlichen Buchhändler gefragt, ob wir die Leseliege im Schmökerbär benutzen dürften. In drei Stunden muss ich mit Jonas ein Reihenendhaus besichtigen, er scheint wirklich ernsthaft in Erwägung zu ziehen, so etwas zu kaufen und mit mir bis zu unserem Tod dort zu wohnen. Ich bin gerade wahnsinnig dankbar für die Anwesenheit Herrn Böhmanns, der als glatzköpfiger Ruhepol mir gegenüber den letzten Bissen Tiramisu sorgfältig auf der Gabel platziert, ihn sich in den Mund steckt und schluckt.
»Also, meine Liebe«, sagt Heinrich mit Milde in der Stimme, »ich hab es dir angeboten, aber wenn du keine Zeit hast … Wo habt ihr die Hausbesichtigung?«
»Im Libellenweg.«
»Ah, draußen im Neubaugebiet. Im Tal der glücklichen Familien.«
»Heißt das so?«
»Ja, sagt man so, weil da nur glückliche junge Familien wohnen.«
»Man nennt es auch die Känguru-Siedlung«, wirft Herr Böhmann ein, »große Sprünge, nix im Beutel.«
»Das ist gut, das muss ich mir merken«, ruft Heinrich begeistert, holt sein Handy und spricht »Känguru-Siedlung, große Sprünge, nix im Beutel, weil die sich ja alle beim Hauskauf so überschulden« in die Diktiergerät-App. »Überschuldet ins Familiengrab, das wäre auch ein schöner Titel für einen Roman, oder, Katja? Vielleicht kann ich dich dann bald als Expertin befragen!«
»Es ist ganz unverbindlich«, sage ich genervt, »wir schauen uns das einfach mal an.«
»In der Straße hat doch der eine Tatort-Schauspieler gewohnt«, sagt Heinrich, »ist schon ein paar Jahre her, der da dann seine Geliebte erwürgt hat.«
»Der hat da gewohnt, ja«, weiß Herr Böhmann, »aber die Geliebte hat er nicht in dem Haus erwürgt, wo er gewohnt hat. Die hat bei ihm geklingelt und wollte ihn zwingen, sie seiner Frau vorzustellen, deshalb ist er mit ihr ins Industriegebiet gefahren und hat sie am Mainufer erwürgt.«
Es erstaunt mich sehr, dass Herr Böhmann über solche Dinge so genau Bescheid weiß.
Heinrich klopft jovial auf die Tischplatte und steht auf. Sein Hund schießt voller Aufbruchsfreude unterm Tisch hervor und stranguliert sich dabei fast, da sich im Zuge seiner Selbstumkreisungen die Hundeleine mehrfach um ein Stuhlbein geschlungen hat und ihm nur einen äußert kleinen Radius lässt.
»Also Katja, überleg’s dir. Falls ihr nach der Besichtigung nicht gleich zum Notar geht und anfangt, Umzugskisten zu packen, kannst du ja vielleicht doch noch vorbeikommen.« Heinrich entwirrt die Hundeleine und raunt zum Abschied, es sei ihm »sehr, sehr wichtig«, dass die Veranstaltung »besucht« aussehe, eben wegen des bedeutenden Gasts. »Er kommt immerhin extra aus Frankfurt!«
»So weit ist Frankfurt doch gar nicht«, sage ich, »da fährt er ne halbe Stunde.«
»Nie und nimmer ist man in einer halben Stunde in Frankfurt, schon gar nicht, wenn Stau ist«, protestiert Heinrich, um die Weitgereistheit des ominösen Herrn Klotzky zu betonen.
Heinrich und Hund verlassen mit großem Getöse die Gaststube, Herr Böhmann winkt nach der Rechnung, und ich bin plötzlich wahnsinnig müde.
Kapitel 2
DASNAVIBERECHNETmeine Ankunftszeit im Libellenweg 14c auf exakt siebzehn Uhr. Ich fahre raus aus der Stadt ins Neubaugebiet, das sich entlang eines weiten, sanft abfallenden Hangs erstreckt und im unteren Bereich an der Autobahn, im oberen am Waldrand endet. Um eine Bebauung des »Tals der glücklichen Familien« zu ermöglichen, wurde die A3 zuvor in diesem Bereich mit hohen Schallschutzwänden versehen.
Ich fahre den Rotkehlchenweg entlang, von dem der Marienkäferweg, der Schmetterlingsweg, der Eichhörnchenweg und der Blaumeisenweg abzweigen. Anscheinend hat man hier alle Straßen nach putzigen Wald- und Gartentieren benannt.
Eine Nacktschneckenstraße, Rattengasse oder einen Wespenweg gibt es nicht. An der Kreuzung Rotkehlchenweg/Libellenweg ragt hinter einer Hecke ein hoher Mast in die Höhe, an dem eine riesige schwarze Piratenflagge hängt. Es ist aber keine Wagenburg, sondern der Kindergarten Klabauterschiff, wie ein buntes Schild am Eingang verkündet.
Keine zwanzig Meter vom Klabauterschiff entfernt habe ich mein Ziel erreicht. Im Radio verebben gerade die letzten Klänge eines Whitney-Houston-Songs, in dessen Fade Out der Moderator platzt: »Hunderte Tonnen Müll liegen am Rand von Hessens Autobahnen! Wer soll das alles entfernen? Wir sprechen jetzt mit …«
Ich stelle den Motor ab. Jonas ist schon da, er steht an der Waschbetonbegrenzung einer Vorgartenrabatte und winkt mir zu. Ich steige aus, er kommt mir entgegen und gibt mir einen Kuss. »Na, hast du’s gut gefunden? Ist ganz schön hier, oder? Als ich unter der Autobahn durchgefahren bin, dachte ich: Oje, das liegt ja direkt an der A3, aber hier sind wir fast ganz oben am Waldrand, und ich steh ja schon fünf Minuten, und man hört fast gar nichts, krass, hätte ich nicht gedacht, dass die das so gut abschirmen, die Lärmschutzwände, echt klasse.«
»Welches Haus ist es denn?«, frage ich, denn wir stehen jetzt vor drei wuchtigen, leicht versetzt aneinandergeklebten Hausklötzen mit identischen Vorgärten.
»Hier, das rechte. Reihenendhaus, das ist gut, besser als das in der Mitte, da hat man eine Seite frei und ist nicht so eingequetscht. Nach hinten raus ist ein Garten, den siehst du von hier nicht. Die Maklerin hat mich übrigens grad angerufen, die steht im Stau, wir müssen noch kurz warten.«
Wir stehen also da und warten. Die Autobahn hört man tatsächlich kaum, was aber auch daran liegt, dass im Klabauterschiff noch mächtig Betrieb herrscht. Hinter der Hecke hervor dringen anhaltende, schrille Schreie, durchsetzt mit dumpfen Schlägen. Wie kann man nur so laut und abscheulich spielen? War ich auch so? Es klingt nicht nach fröhlichem Reigentanz oder Turmbau mit Holzklötzchen, eher so, als würde jemand mit einer Machete durch den Garten laufen und die Kinder niedermetzeln.
Da Jonas die akustische Höllenkulisse nicht kommentiert, halte ich auch meinen Mund, anscheinend sind in Todesangst schreiende Kinder ein hinzunehmender Störfaktor in einem derart gebärfreudigen Neubaugebiet. Während wir vor dem Haus stehen, sind schon sechs Frauen mit Kinderwägen, jeweils paarweise und ins Gespräch vertieft, aber dennoch freundlich grüßend, an uns vorbeigegangen.
»Der Gehsteig ist so breit, dass zwei Kinderwägen nebeneinander draufpassen, das haben die Planer bestimmt extra so gemacht«, sagt Jonas völlig wertfrei.
Jonas hat ein schlimmes Oberteil an. Da er schon um sechs Uhr aufsteht und zur Arbeit fährt, wenn ich noch schlafe, kann ich seine Kleiderwahl an Werktagen nicht beeinflussen. Als er seine erste Stelle als IT-Berater in einer großen Werbeagentur antrat, kaufte seine Mutter ihm knallbunte T-Shirts mit blöden Witz-Aufdrucken. Wahrscheinlich dachte sie, in der Kreativbranche sei es üblich, mit platzenden Melonen, Sprechblasen-Pokémons oder einem säbelschwingenden Zeichentrick-Fakir auf der Brust im Meeting zu sitzen. Als er nach Frankfurt in seinen Bankenturm wechselte, wo er heute noch arbeitet, schaffte er es zumindest, ihr zu sagen, sie brauche ihm jetzt keine T-Shirts mehr zu kaufen, denn in seinem neuen Job als Computerfachmann im Bankensektor müsse er seriös aussehen. Stattdessen bekommt er seitdem bügelfreie kurzärmlige Karohemden geschenkt sowie andere Textilien, die seine Mutter als seriös empfindet.
Das Oberteil, das er heute anhat, ist ein besonders schillerndes Exemplar: Ein Marken-Polohemd mit langen Ärmeln, gefertigt aus schwerem, segeltuchartigem Stoff, mit extrem breiten schwarzen und dunkelgelben Querstreifen. Er sieht darin aus wie eine Hornisse. Oder wie ein Geisteskranker, der sich einbildet, eine Hornisse zu sein und der sich im Klinik-Kreativworkshop selbst ein schönes Hornissenkostüm geschneidert hat, das ihm die Psychiater zu tragen erlauben, da ein Verbot eine Trotzreaktion und eine noch intensivere Hornissenidentifikation des Patienten nach sich ziehen könnte.
»Wie war’s auf der Arbeit«, frage ich, »heute war doch die Präsentation, oder?«
»Ja, war ganz gut. Die Ungarn wollen das Access-Office-Tool übernehmen, aber erst mal nur die Version 3.8, als Testballon quasi, aber immerhin. Die Kollegen sind mit denen noch nach Sachsenhausen in irgendeine Äppelwoi-Kneipe. Ich war ganz froh, dass wir jetzt die Besichtigung haben, da hatte ich ne gute Ausrede, ich hab keinen Bock auf das Gelaber. Die Ungarn saufen immer, bis sie unterm Tisch liegen, und dann muss man die zum Hotel bringen. Und wie war’s in der Redaktion?«
»Och, ganz okay, alles ruhig.«
»Freitag, wart ihr beim Fettgriechen?«
»Nee, beim Altöl-Italiener. Dem Böhmann war noch schlecht von letztem Freitag. Er meint, die Dionysos-Platte steckt ihm immer noch im Dickdarm.«
»Ist ja ekelhaft.«
»Bist du auch am Blaumeisenweg vorbeigefahren?«, frage ich. »Fällt mir grad ein, vorhin in der Redaktion kam ne Polizeimeldung rein, dass Anfang der Woche jemand ein volles Aquarium an den Altglascontainern im Blaumeisenweg abgestellt hat. Und in dem Aquarium war ein Antennenwels.«
»Ein Antennenwels? Hab ich ja noch nie gehört.«
»Der ist jetzt im Tierheim.«
»Aha. Und solche Lappalien stehen dann in der Zeitung. Na ja, wenn sonst nix passiert, ist es ja gut.«
»Mir tut der Fisch leid«, sage ich.
»Du bist ja süß.« Jonas streichelt mir über die Haare.
»Überleg dir doch mal, du bist ein Antennenwels, schwimmst so in deinem Aquarium, und auf einmal hat der Besitzer keinen Bock mehr auf dich, packt das Aquarium in den Kofferraum und fährt zum Glascontainer. Und da stellt er dann fest, dass es nicht ins Loch passt, oder keine Ahnung, was er sich gedacht hat, und stellt das Aquarium samt Fisch einfach da ab. Und der schwimmt dann da die ganze Nacht einsam und allein vor sich hin. Na ja, besser als tot und vertrocknet im Altglascontainer.«
»Oh Mann, auf der A3 ist irgendein Unfall, die steckt immer noch im Stau«, sagt Jonas mit Blick auf sein Handy. Das Schicksal des Antennenwelses scheint ihn nicht zu interessieren.
Mir fällt ein ovales, hellblau schimmerndes Schild neben der Eingangstür des Reihenendhauses auf, das wir besichtigen wollen. »Casa Steigerwald« steht darauf. Auch neben der Tür des mittleren Reihenhauses hängt ein Schild, und ich gehe rüber, um zu lesen, wer neben der Casa Steigerwald wohnt.
»Wo willst du denn hin?«
»Gucken, wer unsere potenziellen Nachbarn sind.«
Das Schild der Nachbarn ist sehr farbenfroh und geschwätziger als das nüchtern-elitäre Casa-Steigerwald-Emblem: »Hier leben, lieben, lachen, weinen, streiten und versöhnen sich Tizian, Tabea, Timothy, Dorothee und Markus Rögel.«
Die Tür geht auf, und aus dem Reihenmittelhaus tritt eine Frau in meinem Alter, rote Backen, rosa Kopftuch über kurzen braunen Löckchen, eine Schüssel mit Bio-Abfällen in der Hand, auf der Hüfte ein haarloses Kleinkind.
»Hallo, nicht erschrecken«, ruft sie, »ich hab euch vom Küchenfenster aus gesehen, ihr seid bestimmt wegen der Casa Steigerwald hier?«
»Ja, wir hatten einen Termin um fünf, die Maklerin steht aber im Stau«, sage ich.
»Ich bin die Dorothee, ich stell mich einfach schon mal vor, vielleicht sind wir ja bald Nachbarn. Guck mal, Timothy, das sind vielleicht unsere neuen Nachbarn. Ich muss grad mal kurz den Biomüll auskippen.«
Während wir auch unsere Namen sagen, erscheint im Türrahmen ein zerzaustes Mädchen. Es ruckelt autistisch auf einem hölzernen Lauflernrad vor und zurück und sieht uns durchdringend und böse an, ganz im Kontrast zur Herzlichkeit seiner Mutter.
»Das ist ja doof, dass die euch so lang warten lässt. Wisst ihr was? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch so lange unser Haus anschauen, innen ist es ja im Prinzip völlig identisch mit eurem, die sind alle baugleich!«
Während ich im Vorgarten der Familie Rögel einen unsicheren Blick mit Jonas austausche, hat Dorothee eine Bekannte erblickt, die gerade mit einem gelben Plastiktablett auf den Unterarmen den Gehsteig entlanggeht. Beim Näherkommen sehe ich, dass es sich bei der halben Kugel, die auf dem Tablett ruht, um einen Käse-Igel handelt. Mit straffer Wickelung befestigt, transportiert die Käse-Igel-Frau ein schlafendes Kleinkind auf dem Rücken, zudem führt sie noch einen hellblonden Labrador an einer Leine mit sich. Multitasking im Tal der glücklichen Familien.
»Huhu«, ruft Dorothee, »schau mal, Carmen, ich hab zwei Interessenten für die Casa Steigerwald kennengelernt, das sind Jonas und Katrin, die sehen nett aus, oder?«
Sie rafft Timothy etwas nach oben und lacht uns entschuldigend an: »Wir haben hier nen sehr offenen Umgang, sorry, aber ihr seht echt beide so sympathisch aus, ich sag das jetzt einfach mal, ich seh so was immer schnell, ihr würdet gut hier herpassen! Das ist die Carmen, die wohnt auch im Libellenweg in der Achtzehn. Carmen, was hast du da? Das sieht total lecker aus, ein Käse-Igel! Verrückt!«
»Ja«, sagt Carmen, »ich bring den Igel grad rüber zu Cornelius auf den Kindergeburtstag. Tizian ist auch da, oder?«
»Ja, aber ich dachte, die sind alle zu diesem Indoor-Spielplatz am Real-Markt gefahren.«
»Die sind schon wieder zurück«, sagt Carmen, »Ingrid hat mich angerufen, Ronja hat sich wohl die Oberlippe aufgeschlagen an so einem Kletterpilz.«
»Oje!« Dorothee hält sich die Hand vor den Mund. »Hat sie ihr hoffentlich gleich Belladonna gegeben?«
»Ja, klar.«
»Na dann ist ja gut. Tabea, guck mal, die Carmen ist da, mit der Alicia und dem Freddy. Die Alicia schläft auf dem Rücken von der Mama, aber der Freddy ist wach.« Freddy ist anscheinend der Hund. Tabea ruckelt auf dem Lauflernrad weiter vor und zurück, ohne eine Miene zu verziehen.
»Die Tabea spricht grad nicht«, sagt ihre Mutter zu uns und der Käse-Igel-Frau, »sie wollte auch nicht mit zu Cornelius, na ja, ich hab gesagt, dann geht der Tizian halt allein zum Cornelius.«
»Mal gucken, wie der Käse-Igel ankommt«, meint Carmen mit einem skeptischen Blick auf ihr mit Trauben gespicktes kulinarisches Werk, »ich glaub, das kennen die Kinder gar nicht, ich kenn das auch nur von ganz früher von meiner Oma.«
»Ist schon ziemlich retro, ja, aber echt cool.«
»Ich hab das in so nem Nostalgie-Kochbuch entdeckt und gedacht, wow, das muss ich mal ausprobieren!«
Nach uns und dem Käse-Igel bekommt nun auch der Hund Aufmerksamkeit. Dorothee beugt sich zu ihm hinunter und spricht ihn direkt an: »Na, Freddy? Gehst du jetzt auch auf den Kindergeburtstag? Gehst du jetzt auch zum Cornelius auf den Kindergeburtstag?«
Da Freddy nicht antwortet, übernimmt Carmen das für ihn, das Tier aber gleichwohl in die Kommunikation integrierend: »Nein, der Freddy geht nicht auf den Kindergeburtstag, der Freddy und ich liefern nur den Igel ab, und dann laufen wir noch ne Runde, bevor das Herrchen zurückkommt, gell, Freddy? Seit der Ernährungsumstellung hat er ne ziemlich sensible Verdauung, ich muss ständig mit ihm raus.«
»Na ja, das pegelt sich schon ein, mach dir keine Gedanken!«
»Ja, Freddy, wir gehen jetzt schön auf die Hundewiese, gell? Schön auf die Hundewiese gehen wir jetzt. Und den Kastrations-Chip hat er irgendwie auch noch nicht so richtig verkraftet, manchmal hab ich ja schon ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm das angetan hab, aber es ging halt nicht mehr anders, du weißt ja, wie er war. Ja, Freddy, da bist du jetzt ein bisschen verwirrt, gell? Er merkt, dass was mit ihm nicht stimmt, aber er kann schließlich nicht wissen, dass er kastriert ist.«
Im Tal der glücklichen Familien scheinen sich verborgene Tierdramen abzuspielen, erst der ausgesetzte Antennenwels, und jetzt der Hund, der nicht weiß, dass er kastriert ist, aber ahnt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Jonas schaut auf die Uhr, ihm scheint das Thema etwas unangenehm zu sein.
Dorothee blickt sehr mitfühlend auf Freddy und dessen Besitzerin und spricht mit ganz milder Stimme. »Hast du auch das Problem, dass die anderen Hunde ihn jetzt als Neutrum ansehen?«
»Na ja«, sagt Carmen, »die anderen haben ihn ja auch vorher schon kaum beachtet, von daher merk ich keinen großen Unterschied. Heute hat er mit der Schnauze unser frisches Hochbeet umgewühlt, so was hat er noch nie gemacht, vielleicht sind das auch Auswirkungen vom Kastrations-Chip.«
»Ach, das pegelt sich schon ein.«
»Hast du ganz frech in unserm Hochbeet gewühlt, Freddy? Was das Herrchen mühsam angelegt hat am Wochenende! Mit dir erleben wir was, Freddy, gell? Mit dir erleben wir immer was. Ja, du bist schon ganz unruhig, wir gehen jetzt auf die Hundewiese. Auf die Hundewiese gehen wir. Also, Dorothee und ihr beiden, ich sag mal tschüss, der Käse-Igel wird doch ein bisschen schwer auf die Dauer.«
Als sie weg ist, beginnt Dorothee übergangslos mit einer Führung durch ihr Reihenmittelhaus. Da die Maklerin immer noch nicht da ist, folgen wir ihr ins Innere des mit der Casa Steigerwald baugleichen Eigenheims.
»Die Küche hat ein großes Fenster zum Vorgarten raus, das ist total praktisch, da sehe ich immer, wenn mein Mann heimkommt, wenn ich grad am Herd steh. Und hier das Wohnzimmer, das ist so unser Wohlfühlraum, ihr müsst euch nur das ganze Durcheinander wegdenken, im Prinzip hat man hier viel Platz, und die Fliesen habt ihr bei euch drüben auch, das ist italienisches Terrakotta in so nem warmen Rosé-Orange-Ton.«
Dass sie Material und Farbe des Fußbodens erläutert, ist nett von ihr, denn aufgrund des wegzudenkenden Durcheinanders sieht man den Untergrund, auf dem wir stehen, fast gar nicht. Das Zimmer sieht aus, als hätte ein riesiger Schaufelbagger hier gerade einen Container voller Kuscheltiere, Buntstifte, Pappbilderbücher, Dreiräder, Tretroller, Kinderschuhe, Playmobilverpackungen, Plastik-Krabbeltunnel sowie eine Armada hässlicher Weltraum-Alien-Spielfiguren mit beweglichen Gliedmaßen ausgeschüttet.
»Passt auf, dass ihr nirgendwo drauftretet, das wäre nett, sonst kriegt die Tabea wieder einen Schreikrampf. Boah, Timothy, du wirst auch immer schwerer!« Dorothee legt ihr Kind während der beschwerlichen Wohnzimmerdurchquerung in einem Laufstall ab, dessen Gitterstäbe aus dem Spielzeugmeer aufragen. Jonas wird um ein Haar von einer grünen Ikea-Kuschelschlange zu Fall gebracht, die sich um seinen Knöchel geschlungen hat, ich halte ihn am Arm fest, und gemeinsam stolpern wir hinter Dorothee her auf den Balkon, dessen Boden von Heu bedeckt ist, das aus einem großen leeren Tiergehege herausweht. »Das ist unser Meerschweinchenstall, den haben wir übergangsweise auf den Balkon verlagert, weil drinnen kein Platz mehr war«, sagt Dorothee, »und die Meerschweinchen haben auch immer das ganze Stroh rausgeworfen, das war dann in den Sofaritzen und in der Stereoanlage und im Fernseher, aber jetzt sind die eh alle drei gestorben, ihr braucht nicht zufällig einen Meerschweinchenstall?«
Ich schüttele den Kopf, Jonas zum Glück auch.
»Hätte ja sein können, na ja, ich denk, wir tun vielleicht einfach die Schildkröten rein, ich muss noch mal googeln, ob das geht oder ob die ein spezielles Schildkrötenterrarium brauchen.«
»Schildkröten habt ihr auch?«, frage ich, die Artenvielfalt im Tal der glücklichen Familien bestaunend.
»Ja, die sind grad unten im Garten im Freigehege. Eine ist vom Marder weggeschleppt worden letzte Woche, jetzt sind es nur noch zwei. Aber die kommen im Winter sowieso in den Kühlschrank, von daher tu ich den Meerschweinchenstall vielleicht ins eBay, der nimmt ja nur Platz weg. Wenn ihr euch den Stall wegdenkt, hat man hier einen richtig schönen großen Balkon.«
»Die Schildkröten kommen in den Kühlschrank?«, vergewissert sich Jonas.
»Ja, die überwintern im Gemüsefach, die fahren ihre Körpertemperatur runter, und im Frühling taut man sie dann wieder auf. Das heißt, man taut sie nicht auf, man holt sie einfach wieder raus, auftauen müsste man sie ja nur, wenn sie im Gefrierfach wären, aber da darf man sie nicht reintun, das ist zu kalt, da sterben die. Gemüsefach soll ideal sein, unser Gefrierfach ist eh voll, da sind ja die drei toten Meerschweinchen drin. Entschuldigung, ich grusel euch hier bestimmt total, so von wegen: Uaahh, voll die irre Mörderfamilie, aber mein Vater ist Tierpräparator, so hobbymäßig, der will die Meerschweinchen ausstopfen und dann den Kindern schenken zum Geburtstag oder zur Kommunion oder so.«
Wir blicken vom Balkon nach unten in den Garten, auf das von einem Netz überspannte Schildkrötengehege. Auf beiden Längsseiten schließen sich die Gärten der Casa Steigerwald und des linken Nachbarhauses an, nicht etwa durch einen Zaun oder eine Hecke getrennt, sondern nur optisch durch ein paar Zierrabatten und kaum kniehohe Miniaturbüsche.
Die Zäune hätten die drei Parteien vor ein paar Jahren nach gemeinschaftlicher Absprache entfernt, erläutert Dorothee. So könnten die Kinder besser »hin und her flitzen«.
»Ah, interessant«, sagt Jonas, »echt cool!«
Man habe gemeinsame Gartenanteile geschaffen, die zusammen bepflanzt und bewirtschaftet werden. »Wir grillen im Sommer auch total oft zusammen und teilen uns die Gartengeräte. Wenn ich hier auf dem Balkon stehe und rausschaue, verspür ich immer so ne große Dankbarkeit, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt.«
»Doch, total, echt schön hier«, bestätigt Jonas.
Ich nicke, denn auch ich verspüre eine große Dankbarkeit, allerdings dafür, hier nicht wohnen zu müssen.
»Kommt, wir gehen nach unten, dann könnt ihr den Garten sehen.«
Wir gehen zurück durchs Wohnzimmer – von Timothy dringt kein Lebenszeichen aus dem verschütteten Laufstall, was seine Mutter aber nicht zu beunruhigen scheint – und steigen eine Treppe in den Keller hinunter. Unten stolpert Dorothee über einen umgestürzten hölzernen Kaufmannsladen. »Ach verdammt, wir müssen mal aufräumen. Hier lang geht’s nach draußen.« Da der Reihenhauskomplex am Hang liegt, betreten wir vom Keller aus ebenerdig den Garten.
»Tabea, was machst du denn hier? Bist du heimlich vor uns runtergeflitzt?«
Mitten auf der Rasenfläche, uns zugewandt, sitzt das unheimliche Mädchen auf seinem Lauflernrad und ruckelt schwungvoll und mit grimmig entschlossenem Blick vor und zurück, als würde es darauf warten, dass jeden Moment unter ihm ein Raketenantrieb zündet und das Gefährt in vollem Karacho durch die Glasfront der Terrassentür katapultiert.
»Da drüben wäre dann euer Garten, und hier auf der anderen Seite wohnen die Helfmanns, also die Annegret und der Thomas, die sind gerade im Urlaub, die haben ihr Wohnzimmer im Keller, das ist auch ne ganz praktische Lösung, weil wir hier Südseite sind, da kommt immer genug Sonne auch da unten rein.« Wir lugen seitlich bei den Helfmanns durch die bodentiefen Fenster ins Keller-Wohnzimmer. Man sieht Kinderschuh-Berge, umgestürzte Tretroller, Kuscheltiere, Dreiräder, Playmobil-Burgen, einen aufgeblasenen Plastikdelfin, einen Katzenkratzbaum und zwei volle Wäscheständer.
»Der Kindergarten ist hier gerade um die Ecke, habt ihr den gesehen beim Herfahren? Das Klabauterschiff? Neulich waren so blöde Leute hier«, raunt Dorothee, »so ein missmutiges Rentnerpärchen, die haben die Casa Steigerwald besichtigt, ich war grad im Garten und hör, wie die sich über den Kindergarten beschweren, das wär eine unerträgliche Geräuschkulisse, stellt euch mal vor! Weil man halt manchmal ein bisschen Kinderlachen und so hört, unmöglich, oder?«
»Ja, schlimm«, sage ich, »schlimm«, auch im Moment sind Folterschreie aus dem Klabauterschiff zu hören.
»Ich dachte nur, oh mein Gott, hoffentlich kaufen die zwei Idioten die Casa Steigerwald nicht! Bei so Leuten ist doch Ärger vorprogrammiert, auch wenn der Tizian Schlagzeug übt oder wenn er mal mit Cornelius im Garten kämpft mit seinem Laser-Schwert. Da stehen die doch sofort auf der Matte von wegen Ruhestörung. Ihr habt noch keine Kinder, oder?« Wir verneinen, beziehungsweise wir bestätigen, ja, noch keine Kinder.
»Und einen Hund? Falls ihr einen Hund habt, wär das hier ideal, die Helfmanns haben Kaninchen und einen Kater, aber der ist total friedlich, der versteht sich auch mit Hunden. Habt ihr einen?« Wir verneinen wieder, fast schon schuldbewusst.
Wir haben weder Hund noch Kind. Noch nicht! Hier jedoch herrschen so ideale Brutbedingungen, denke ich, dass ich wahrscheinlich schon eine Stunde nach dem Einzug in die Casa Steigerwald schwanger wäre.
Sie führt uns zu einem hölzernen Verhau auf dem Grundstück der Helfmanns: »Das ist unsere kleine Gemeinschafts- und Grillhütte, da sind die Gartengeräte und das Grillzubehör drin. Mein Mann und Thomas haben die zusammen gebaut.«
»Ah, super«, sagt Jonas, »sehr schön.« Und ich fürchte, er meint das ehrlich.
Sie ruckelt an der verklemmten Holzlattentür, die sich jedoch nicht öffnen lässt. »Im Sommer grillen wir eigentlich jede Woche zusammen. Wieso geht das jetzt nicht auf hier? Wir haben so ne lustige Tradition, dass immer einer von den drei Männern der Grillmeister ist. Der darf dann das Fleisch aussuchen und kriegt die große Grillzange überreicht und hat dann auch den ganzen Abend über unsere spezielle Grillmeisterschürze an, die ist echt sehr, sehr speziell, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten!« Sie zwinkert Jonas neckisch zu, als sähe sie ihn schon vor sich, den neuen jungen Nachbarn mit der großen Grillzange in der Hand, nackt unter der »speziellen Grillmeisterschürze«.
Anscheinend tut in den Augen anderer Frauen das schreckliche Hornissenhemd seiner Attraktivität keinen Abbruch, wenn er noch in der Lage ist, eine Chippendales-Grillmeisterfantasie auszulösen. Überflüssigerweise bietet er ihr jetzt auch noch seine Hilfe beim Öffnen der verkeilten Holzlattentür an, gemeinsam zerren und stöhnen sie.
»Jonas, wir müssen mal oben gucken, ob die Maklerin inzwischen da ist. Nicht dass die wieder losfährt, wenn sie uns nicht findet.«
Niemand beachtet mich. Jonas bläst sich schnaubend eine blonde Haarsträhne von den Augen weg und wischt sich übers Gesicht. Beneidenswerterweise sieht er immer leicht gebräunt aus, als käme er gerade von einem Surf-Urlaub, dabei sitzt er den ganzen Tag in seinem klimatisierten Großraumbüro. Wahrscheinlich nimmt er die schweißtreibende Aufgabe des Holzschuppen-Aufbrechens dankbar als Ausgleich zu seinem bewegungsarmen Arbeitsleben an. Neulich hat ihn eine Frau im Supermarkt angesprochen und gefragt, ob er Norweger sei, sie komme aus Trondheim und erkenne Landsleute in der Regel sehr zielsicher.
Ich bin seit acht Jahren mit einem Computerfachmann aus Fulda zusammen, der von Norwegerinnen für einen Norweger gehalten wird und eine Grillmeisterkarriere im Libellenweg offensichtlich für eine Option hält.
Mit einem Krachen öffnet sich plötzlich die Tür, Jonas und Dorothee stolpern synchron nach hinten, und uns schiebt sich eine Lawine aus Eimern, langstieligen Gartengeräten, Dreirädern, Holzkisten, leeren Tupperdosen, Taucherbrillen, Plastikblumentöpfen, unnatürlich verdrehten Klappstühlen, Nistkästen und Boccia-Kugeln entgegen. »Oje, hier müssen wir auch mal wieder aufräumen, ignoriert das einfach.«
Der Unrat wird durchzogen und zusammengehalten von meterlangen Brombeer-Ranken, die anscheinend zielstrebig durch die Wände des wackeligen Verschlags eingedrungen sind.
»Wir müssen jetzt wirklich mal raus auf die Straße und gucken, ob die Maklerin inzwischen da ist«, werfe ich nachdrücklich ein, bevor uns Dorothee noch mehr ungewollte Einblicke in unordentliche Familien-Wohnwelten verschafft. Sie scheint mit aller Gewalt der benachbarten Casa Steigerwald zu gebärfähigen, integrationswilligen, kinderfreundlichen Käufern verhelfen zu wollen, und bemüht sich, den Eindruck zu vermitteln, hier herrsche ein total easy entspanntes, von Solidarität, Improvisationskunst und Lebensfreude durchdrungenes Miteinander, und mich nervt, dass Jonas ihr permanent durch zustimmende Mimik, Gestik und Lautäußerungen wie »Ah, super!«, »Interessant!«, »Sehr cool!« den Eindruck vermittelt, ihre Botschaft komme bestens bei uns an.
Dorothee macht gar nicht erst den Versuch, die jetzt vom Schuppeninhalt blockierte Tür wieder zu schließen, sondern geht mit uns zurück in ihr Haus, entlässt uns jedoch nicht, ohne noch einen weiteren Trumpf des Gebäudes vorzuführen.
»Ja, wir gehen gleich hoch, aber schaut erst mal kurz, das will ich euch noch zeigen, der Keller ist nämlich total raffiniert! Guckt, wenn man hier eine Wand einzieht …« – sie läuft vor uns durch einen leeren Raum und beschreibt mit den Armen in der Luft einen imaginären Wandverlauf – »… wenn man hier eine Wand einzieht und da vorne einen Durchbruch macht, dann hat man im Prinzip fast so was wie ne kleine Einliegerwohnung. Das ist superpraktisch, wenn mal einer zum Pflegefall wird, denn es ist ja alles ebenerdig und barrierefrei!«
»Das ist echt raffiniert!«, begrüßt Jonas eifrig die praktische Wohnlösung für Pflegefälle.
»Ja, oder?«, freut sich Dorothee über sein Interesse, »das find ich gut, dass ihr da so aufgeschlossen seid, die meisten Leute verdrängen so was ja, aber es kann jeden treffen. Die Helfmanns nebenan haben ihren dementen Vati hier untergebracht, die haben auch den baugleichen Keller. Schaut, hier ist so eine Art Waschküche, die nutzen wir momentan leider gar nicht.« Sie knipst ein grelles Deckenlicht an, das einen leeren, komplett weiß gekachelten Raum erhellt. Oben eine Deckenbrause, seitlich an der Wand Duscharmaturen, unten ein Abfluss, es sieht aus wie eine Gaskammer. »Hier können die Helfmanns ihren Vati einfach immer nackt in seinem Rollstuhl reinschieben und eben mal schnell abbrausen, das ist echt praktisch!«
»Superpraktisch!«, bestätigt Jonas, »sehr interessant!«
»Total genial, echt«, sagt Dorothee, und gemeinsam blicken sie weiterhin bewundernd in den Waschraum, der so praktisch ist, dass es geradezu bedauerlich ist, keinen Pflegefall in der Familie zu haben, den man hier mal eben schnell abbrausen kann.
»Na ja, aber es ist ja nicht gesagt, dass mal einer zum Pflegefall wird«, dämpft Dorothee schließlich die Euphorie. »Ihr könnt auch einen Hobbykeller hier einrichten.«
Um die Hausführung zu beenden, behaupte ich schließlich, ich hätte oben ein Auto vorfahren gehört. Überstürzt eilen wir die Treppe hinauf zur Haustür, und kurioserweise bewahrheitet sich meine Lüge, denn draußen steigt gerade eine sehr dünne Frau aus einem roten Firmen-Smart mit dem Aufdruck »Lehmbach & Ritter – Immobilien«. Sie scheint unter großem Zeitdruck zu stehen, denn fast ohne Begrüßung eilt sie auf die Eingangstür der Casa Steigerwald zu, erwähnt beim Hantieren mit dem Schlüsselbund Feierabendverkehr, Stau, Vollsperrung, Stress, Umleitung und nun ebenfalls von Verspätung bedrohte Anschlusstermine, dann schlägt sie die Tür hinter uns zu, und wir stehen im Wohnzimmer.
Die Maklerin ist eher auf jung gebotoxt als jung, sie hat ein glattes, perfekt geschminktes und wie mit Photoshop nachbearbeitetes Gesicht, mit strammem, blondem Pferdeschwanz, ihre Fingernägel sind im selben Beige gehalten wie ihr Hosenanzug und ihre Zehn-Zentimeter-Lackstilettos, auf denen sie jetzt über die Terrakottafliesen trippelt.
Trotz ihrer Stöckelschuhe ist sie kaum eins sechzig groß, und die Last des umfangreichen Aktenordners, den sie in der linken Armbeuge trägt und der wohl wissenswerte Informationen zur Casa-Steigerwald-Immobilie enthält, bringt sie in leichte Schräglage.