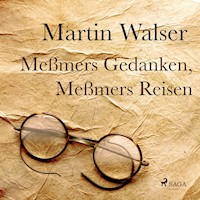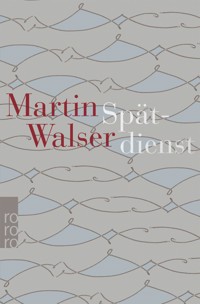9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Martin Walser ist Schriftsteller. Jakob Augstein ist Journalist. Und sie sind Vater und Sohn. In diesem Buch sprechen sie über das Leben von Martin Walser, über dessen Jugend in Wasserburg am Bodensee, über den Vater, der Hölderlin gelesen hat, und die Mutter, die das Gasthaus geführt hat. Sie sprechen über den Krieg, über das Schreiben, über Geld und das Spielcasino in Bad Wiessee, über Uwe Johnson und Willy Brandt. Sex sei kein Sujet, sagt Walser, und so sprechen sie stattdessen über das Lieben. Und dann über das Beten. Jakob Augstein fragt Walser nach der umstrittenen Rede in der Paulskirche und der öffentlichen Fehde mit Marcel Reich-Ranicki. Und natürlich spielen Auschwitz und die deutsche Vergangenheit eine Rolle, ohne die das Leben und die Romane von Walser nicht zu denken sind. Und sie sprechen auch über sich. «Das Leben wortwörtlich» ist ein gemeinsamer Blick auf eine deutsche Lebensgeschichte, bewegend und voller überraschender Einsichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Ähnliche
Martin Walser • Jakob Augstein
Das Leben wortwörtlich
Ein Gespräch
Über dieses Buch
Martin Walser ist Schriftsteller. Jakob Augstein ist Journalist. Und sie sind Vater und Sohn. In diesem Buch sprechen sie über das Leben von Martin Walser, über dessen Jugend in Wasserburg am Bodensee, über den Vater, der Hölderlin gelesen hat, und die Mutter, die das Gasthaus geführt hat. Sie sprechen über den Krieg, über das Schreiben, über Geld und das Spielcasino in Bad Wiessee, über Uwe Johnson und Willy Brandt. Sex sei kein Sujet, sagt Walser, und so sprechen sie stattdessen über das Lieben. Und dann über das Beten.
Jakob Augstein fragt Walser nach der umstrittenen Rede in der Paulskirche und der öffentlichen Fehde mit Marcel Reich-Ranicki. Und natürlich spielen Auschwitz und die deutsche Vergangenheit eine Rolle, ohne die das Leben und die Romane von Walser nicht zu denken sind. Und sie sprechen auch über sich.
«Das Leben wortwörtlich» ist ein gemeinsamer Blick auf eine deutsche Lebensgeschichte, bewegend und voller überraschender Einsichten.
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Jakob Augstein, geboren 1967 in Hamburg, studierte Politikwissenschaften, Germanistik und Theaterwissenschaften in Berlin und Paris. Er arbeitete für die «Süddeutsche Zeitung», unter anderem als Chef der Berlin-Seite, und für «Die Zeit». 2008 übernahm er die Wochenzeitung «der Freitag», deren Verleger und Chefredakteur er heute ist. Er ist Kolumnist bei «Spiegel Online».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2017
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Fotos der Autoren: Isolde Ohlbaum ((Walser)); Gudrun Senger ((Augstein))
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00049-0
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
«Ich ersticke an den Schönheiten der Welt. Wenn mich die steigende Wiese nichts anginge, wenn mir egal wäre, wer an mir vorbei fährt, wenn ich nicht alles an mich reißen möchte, was es gibt, wär alles gut. So aber …»
Martin Walser, Tagebucheintrag 24.3.1976
1.Im Roman ist die Lüge wunderbar
Über dieses Buch
Lieber Martin, wir machen ein Buch zusammen. Ein Abenteuer. Was für ein Buch wird es denn werden?
Jedes Buch ist ein Abenteuer. Dieses hier stelle ich mir wie ein Gespräch vor, das wir in einem kleinen Saal miteinander führen. Da sitzen vielleicht hundert Leute und hören uns zu. In so einem Saal, das erlebe ich ja andauernd bei meinen Lesungen, da bin ich jeweils imstande, so zu reagieren, dass die Leute das Gefühl haben, sie erfahren etwas, was sie sonst nicht erfahren. Sie können lachen, sie werden unterhalten. Darauf kommt es an. Dann bin ich lebendig. Wir ertasten, worüber wir sprechen können. Aber, Jakob, wir werden uns natürlich immer an der Grenze zur Indiskretion bewegen.
Ist das ein Problem?
Es wird Stellen der Verletzlichkeit geben, die jeder Rezensent benutzen kann, wie er will. Wenn wir unser Gespräch ganz offen führen, werden wir auch ganz offen sein, ganz ungeschützt. Ich habe das erlebt, als der letzte Band der Tagebücher erschien. Jeder Depp kann sich auf uns stürzen. Niemand muss sachlich bleiben. Je nachdem, ob uns einer mag oder nicht, wird er so oder so mit uns verfahren. Das trifft natürlich mehr mich als dich.
Du bist nach all den Jahren noch so verletzlich?
Was hat das mit den Jahren zu tun? Glaubst du, es wird mit den Jahren erträglicher, verletzt zu werden? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich war in meinem ganzen Leben gegen nichts so empfindlich wie gegen Machtausübung. Kritik ist Machtausübung, und Macht bedeutet Verletzung. Ein anderer sagt dir: Du darfst nicht sein, wie du bist.
Glaubst du denn, dass die Journalisten und die Kritik darauf warten, dir zu schaden?
Ich habe eine Notiz in meinen Tagebüchern, die lautet: «Ich leide an Verfolgungswahn, und das ist das Einzige, was mich von meinen Verfolgern unterscheidet.»
Was meinst du, warum werden die Leute dieses Buch lesen wollen?
Wollen? Das ist eine märchenhafte Formulierung. Ich glaube nicht, dass sie es lesen wollen. Sagen wir lieber, das Buch wird erscheinen, und es wird Leute geben, die sich dafür interessieren. Wir sind da ganz und gar abhängig von den Gerüchten und Tatsächlichkeiten des sogenannten Literaturbetriebs.
Was wird die Leute an diesem Buch interessieren?
Also, wenn ich jetzt darauf antwortete, wäre meine Antwort eine reine Höflichkeitsphrase, als hielte ich deine Frage für sinnvoll.
Du hältst sie für unsinnig.
Wenn ich einen Roman schreibe, dann denke ich nicht daran, ob die Leute ihn lesen und warum. Also, wenn ich einen Roman schreibe, habe ich eine Ahnung, und ich versuche, schreibend dieser Ahnung nachzukommen. Dann erfahre ich, das ist immer überraschend, ob positiv oder negativ, wie viele Einstellungen und Erlebnisarten und Stimmungen es geben kann für die Aufnahme eines Buches. Beim Schreiben aber denke ich darüber nicht nach. Es gibt vielleicht einen unter tausend Augenblicken, in dem ich sagen kann: Ich habe bei einem Satz daran gedacht, wie der wohl gelesen werden wird. Und dann bin ich gleich wieder darüber hinweg. Ich sage dir mal ein Beispiel. Im «Springenden Brunnen» lautet der erste Satz: «Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird.» Als ich diesen Satz hingeschrieben habe, das weiß ich noch genau, da habe ich mir so halbpolemisch gedacht: «Ach, wenn Frau Sowieso aus Markdorf diesen Satz lesen wird, dann schlägt sie das Buch zu.» Aber wenn ich sehe, wie sich das Buch verkauft hat, muss ich feststellen: Ich habe Frau Sowieso aus Markdorf unrecht getan.
Wo wir gerade bei ersten Sätzen sind: Wie fängt man einen Roman an?
Du weißt, der Roman wird «Ehen in Philippsburg» heißen oder «Halbzeit». Und dann beginnst du zu schreiben. Und wenn es nicht der richtige Ton ist, dann merkst du das sehr schnell. «Ehen in Philippsburg» habe ich zweimal völlig neu angefangen, dann erst stimmte der Ton. Beim zweiten Roman war es noch deutlicher. Ich kam aus Amerika zurück, 1958 war das, im September, und ich war ganz erfüllt vom Schreibenwollen. Ich habe sofort begonnen und drei Wochen lang geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich wollte mich durch das Weiterschreiben davon überzeugen, den Ton bereits gefunden zu haben. Dabei wusste ich: Das ist es noch nicht. Trotzdem, immer weiter geschrieben und geschrieben. Drei Wochen lang. Und dann habe ich alles weggeworfen. Und habe neu angefangen – und der Ton war da. Ich muss übrigens zugeben, der erste Satz im «Springenden Brunnen» …
… «Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird» …
… das war ursprünglich nicht der Anfangssatz. Der stand vielleicht auf der dritten Seite. Das habe ich dann zum Anfang gemacht.
In manchen ersten Sätzen steckt die gesamte Geschichte. Zum Beispiel im «Fliehenden Pferd»: «Der Zufall führte zwei Ehepaare im Urlaub zusammen.»
Der erste Satz von «Einhorn» heißt: «Ich liege, ja, ich liege.» Und schon läuft das. Wenn der Ton richtig ist, muss ich nachher erstaunlich wenig korrigieren.
Bei dir heißt es im «Dreizehnten Kapitel»: «Jeder Roman ist ein Sachbuch. Ein Sachbuch der Seele.» Es spielt darum vielleicht keine Rolle, was es ist, was wir hier verfassen, ein Roman, ein Sachbuch. Vielleicht ist es eine Autobiographie? Du hast nie eine geschrieben.
Und ich würde nie eine Autobiographie schreiben. Das zwingt zu einer mir unangenehmen Art von Lüge. Die Lüge im Roman ist wunderbar. Sie ist eine Variation der Wahrheit. Aber die Lüge in den Memoiren, die möchte ich nicht. Also ziehe ich es vor, einen Roman zu schreiben. Jeder Roman ist eine Autobiographie, ein Selbstporträt des Autors zum Zeitpunkt des Schreibens. Anders als aus meinen Erfahrungen heraus kann ich gar nicht schreiben. Ich bin als Autor wirklichkeitsgesättigt. Was es aus meinem Leben zu erzählen gibt, das habe ich natürlich alles schon einmal gesagt. Aber die Vergangenheit verwandelt sich immerzu. Die eigene Kindheit zum Beispiel spielt zu verschiedenen Zeiten immer wieder eine neue Rolle.
Mal angenommen, du würdest dich dafür interessieren, was die Leute lesen wollen, was wäre es dann?
Wir müssen natürlich auf einzelne Personen zu sprechen kommen.
Werden wir tratschen, auf hohem Niveau? Das ist gut. Die Leute lieben Tratsch.
Du sagst das mit einer beunruhigenden Freude. Aus dir spricht die Medienlust. Aber gut, nimm einmal den Schirrmacher, meine ganze Geschichte mit Schirrmacher und wie sie geendet ist, zeugt von meiner Naivität. Aber für die kann ich nichts. Da war einer der Tagebuch-Bände erschienen, und im Literarischen Colloquium in Berlin fand die erste Lesung statt. Der Verlag hat mich gefragt, wen ich gerne dabeihätte. Da habe ich gesagt: Ladet doch den Schirrmacher ein. In der FAZ war ja damals – das war nun allerdings lange vor seiner Zeit – die schlimme Kritik von Reich-Ranicki erschienen, und es sollte an dem Abend um das Tagebuch gehen, in dem Reich-Ranicki dauernd vorkommt. Seine Vernichtungskritik, die übertitelt war «Jenseits der Literatur», mit der er mich aus der Literatur vertreiben wollte, mir die Literatur verbieten wollte. Aber gut, ich dachte, wir laden den Schirrmacher ein, weil ich fest angenommen habe, dass er nun nach so vielen Jahren eine andere Haltung zu der Frage haben würde, ob diese Kritik eine akzeptable Art und Weise war, in einer Zeitung über ein Buch zu schreiben. Und dann sagt er, wie sehr er es bedauere, dass heute keine solchen Kritiken mehr erscheinen. Das war für mich eine Riesenenttäuschung.
Gut, Frank Schirrmacher. Wer sonst?
Unseld natürlich. Ich war immer auf seiner Seite. Auch damals, als die Lektoren um eine Verfassung gerungen haben, die ihnen Mitsprache und was weiß ich nicht noch für Rechte einräumen sollte. Das war Mode zu jener Zeit. Da habe ich ihn unterstützt und gesagt: Ihr wollt eine Verfassung, aber dann ist jemand anderes der Chef, oder ihr alle seid es, und dann bin ich von dem Neuen abhängig – oder von euch. Ich tausche eine Abhängigkeit, die ich kenne, nicht gegen eine, die ich noch nicht kenne. Das war mehr als ein Freundschaftsdienst.
Dann sollten wir also über Freundschaft reden. Ob es so etwas gibt. Und was das eigentlich ist. Wer wird sonst noch auftauchen?
Uwe Johnson natürlich. Der hat am Ende ja in Sheerness gewohnt und war, wie man so sagt, alkoholabhängig. Er hatte dann, glaube ich, eine Flasche Wein, die ging nur schwer auf, und wegen der Anstrengung ist ihm ein Aneurysma geplatzt. Der Uwe, das war jemand, mit dem konnte man leicht Krach bekommen. Ich bin vielleicht noch am besten mit ihm ausgekommen. Dann Max Frisch. Das war eine so vorsichtige Freundschaft, der konnte nichts passieren.
Peter Hamm?
Solange er mich brauchen konnte, war er ein Freund. Als er mich nicht mehr brauchte, wurde er feindselig.
Reich-Ranicki?
Kritiker sollten weder Freund noch Feind sein.
Günter Grass?
Problemreich.
Als er starb, schrieb ich:
Jetzt
Jetzt. Es ist vorbei.
Jetzt. Es war einmal.
Jetzt. Günter. Günter. Günter.
Jetzt. Ich habe immer gedacht
Jetzt. Du streitbarster Freund
Jetzt. Wir blieben zusammen.
Jetzt. Auf einmal
Jetzt. Nichts mehr.
Jetzt. Deutschland, trauere.
Rudolf Augstein?
Rudolf? Für mich eine vorbildliche Existenz. Und mir hochwillkommen, weil er, wie ich, gegen die deutsche Teilung war. Einer der wenigen Intellektuellen, die nicht opportunistisch waren. Unsere Beziehung war immer politisch bedingt. Ich war eben froh, dass es ihn gab.
Mir fällt auf, dass es bisher lauter Männer sind. Es ist keine Frau dabei. Wir müssen doch auch über Frauen reden, oder?
Nur zu gern. Also! Der entscheidende Unterschied: Frauen sind mir nicht als Machtausübende begegnet. Und jede Begegnung war mehr als nur sachlich. Wenn zum Beispiel Felicitas von Lovenberg eine Kritik schrieb, dann war das, bei aller kritischen Klarheit, nie feindselig. Genauso bei Iris Radisch. Sie lassen den, den sie kritisieren, am Leben. Sonst aber, du schreibst ein Buch «Jenseits der Liebe», Reich-Ranicki überschreibt seine Kritik: «Jenseits der Literatur». Da bist du hinausgeworfen. Iris Radisch überschreibt eine Kritik »Amoklauf der Liebe». Das ist eine reine Genauigkeitsleistung ohne Stimmungsmache! Natürlich gibt es auch Kritikerinnen, die imitieren die Scharfrichterei. Aber wenn du mit Thea Dorn über dein Buch diskutierst, darfst du staunen, was ihr alles einfällt. Sie erlöst dich sozusagen aus deiner existenziellen Monotonie. Oder Ingeborg Bachmann, wo auch immer man sie traf, sie war eine Steigerung des Daseins. Als ich in Texas von ihrem furchtbaren Tod erfuhr, notierte ich ins Tagebuch:
1.11.1973
Ingeborg Bachmann
Wink der Idiotin mit dem Bleimund
und Fleischfelsenkinn, ausdrucksvoll
objektiv: hier ist eine gestorben
die unseren Feinsinn teilte und
weiter ging. Wer war denn nicht ihr Freund.
Also gut. Also gut. Also gut.
Persönlich sag ich, sagt jeder, jetzt
werden die Tage noch schneller
vergehn. Aber bitte. Aber bitte.
In meinem ältesten Anzug geh ich
glaub ich zu ihrer Beerdigung
und schau: meine Anzüge alle
sind neu und würden objektiv
ausdrücken, wo ich noch überall
hingehen will nach der Beerdigung.
Rasier dich oder rasier dich nicht
du wirst dein Gesicht in die Zeitung pressen
die dir Veronika reicht.
30.11.1973
Blutend aus erdachten Wunden,
Eis lutschend in der Parksonne,
die Seele voll vom Comicstripmodell.
Könnten wir nicht weiterfahren ins
Bachmannland, wo keine Zimmer bestellt sind?
Was blüht uns denn hier noch als
dann und wann ein besiegtes Kind.
Und Frauen, die weder Kritikerinnen sind noch Kolleginnen? Liebe, ist das ein Thema?
Das ist schwierig.
Sicher ist das schwierig. Aber wir sollten über die Liebe reden, und wie soll das gehen, wenn wir nicht über Frauen reden?
Für Liebe als Hauptwort bin ich nicht zuständig, das ist ein anderes Fach. Ich bin nur für das Verbum. Und da allerdings gibt es kein Darüberreden. Karl Barth, der große Theologe, hat geschrieben, alle Theologie muss erzählerisch sein. Und so ist es auch mit der Liebe. Man kann nicht darüber sprechen, sondern muss erzählerisch sein. Wenn wir das könnten, dürften, wollten, dazu erzählerisch sein, dann könnten wir es.
Was hindert uns?
Scham, Vorsicht, Diskretion.
Und es wird eine Rolle spielen, dass wir unser Gespräch als Vater und Sohn führen.
Das dürfte das schwierigste Thema sein. Ich habe mich zum Beispiel in Interviews immer gewehrt, Fragen, die damit zu tun hatten, zu beantworten. Ich habe deine Gerichtsberichte gelesen, ich habe deine Artikel in der «Süddeutschen» und in der «Zeit» gelesen, habe im Fernsehen zugeschaut, wie du über Politik diskutiert hast, aber es wäre mir immer sonderbar vorgekommen, dich öffentlich zu loben. Ich lobe auch nicht öffentlich, was meine Töchter schreiben, auch wenn ich oft einfach hingerissen bin von ihren Sätzen und Gedanken, und da du auch eine sozusagen öffentliche Person geworden bist, verfalle ich, wenn ich nach dir gefragt werde, in verlegenes Schweigen. Ich kann über dich öffentlich nur sagen, was ich auch über meine Töchter öffentlich sagen kann, dass es nämlich das größtmögliche Glück für einen Schriftsteller ist, wenn seine Kinder ganz von selbst auch schreiben. Ich habe kein bisschen erzieherisch manipuliert, dass die Töchter Schriftstellerinnen werden sollten. Dass sie es geworden sind und wie sie ganz und gar anders schreiben als ihr Vater, aber so, dass der vor intimer Überraschung oft ganz fassungslos staunt, das ist das reine Glück in meinem Leben. Bei dir ist es ja noch deutlicher, dass ich nicht mitgewirkt haben kann daran, dass du ein Autor geworden bist, weil wir wegen der bürgerlich unvermeidbaren Umstände deiner und meiner Existenz immer in einiger Distanz lebten. Aber dass eigene Kinder von selbst das tun, was ein Vater tut, das darf diesen Vater manchmal auf den Gedanken bringen, dass er doch das sein könnte, was er am liebsten ist.
2.Es gibt keine Grenze der Nachsicht mit sich selbst
Über eine Kindheit in Wasserburg
Wenn ich Erinnerung sage …
… dann unterbreche ich dich und sage, dass ich über etwas Begriffliches gar nicht essayistisch daherreden kann. Ich kann nur konkret sagen: «Dann bin ich über die Straße gegangen und wurde zum Glück nicht überfahren.» Wenn ich mich daran erinnere.
Man braucht nicht so viele Erinnerungen, um das Gefühl zu haben, dass man eine Kindheit hatte, oder?
Wie meinst du das?
Es gibt einen Film, da weiß eine Figur selbst gar nicht, dass sie synthetisch ist, ein künstlicher Mensch. Ihre Schöpfer haben ihr Erinnerungen gegeben, nicht viele, gerade genug, dass sie meint, sie habe eine eigene Kindheit gehabt. So geht es uns allen. Oder zweifelst du deine Kindheit an?
Nein, natürlich nicht. Die Kindheit ist im Leben ein so ausführliches und deutliches Kapitel, dass sie immer eine Rolle spielen wird. Immer eine andere, wie gesagt. Aber sie wird andauernd gebraucht. Ich habe gesagt, dass ich nie eine Autobiographie schreiben wollte. Aber für den «Springenden Brunnen» habe ich doch zwanzig, fünfundzwanzig Jahre lang in meinen Tagebüchern Notizen gesammelt. Immer unter dem Stichwort: «Eintritt meiner Mutter in die Partei».
Du hast deine Kindheitserinnerungen mit dem Eintritt deiner Mutter in die NSDAP verknüpft?
Nur für den Roman «Ein springender Brunnen». Der spielt von 1932 bis 1945. Meine eigene Kindheit ist und bleibt mein Universum. Zum Beispiel finden die meisten meiner Träume im Milieu der Kindheit statt. Darüber staune ich dann, wenn ich in der Gegenwart aufwache.
Ich schreibe mir das auf und frage dich später vielleicht noch einmal danach. Deine Mutter, was ist deine erste Erinnerung an sie?
Kein Mensch weiß doch die erste Erinnerung an seine Mutter. Ich frage dich: Könntest du die erste Erinnerung an deine Mutter sagen?
Ich glaube, wenn man mir diese Frage stellte, würde ich sie unwillkürlich beantworten und irgendeine Erinnerung zur ersten Erinnerung machen.
Genau. Allerdings kann ich sagen, dass sich in mir alles dagegen sträubt, irgendetwas zur ersten Erinnerung zu erklären.
In deinem Tagebuch schreibst du einmal von der «mühsam beherrschten Stimme meiner Mutter, die allen gerecht zu werden versuchte». Wie muss man sich das vorstellen? Wäre sie andernfalls in Zorn ausgebrochen, oder in Tränen?
Das musst du dir so vorstellen, dass sie glaubte, es sich nicht leisten zu können, die Beherrschung zu verlieren. Egal, ob es dann Zorn oder Traurigkeit gewesen wäre.
War sie denn eine warmherzige Frau?
Was ist das für ein Wort? Ich weiß, oder ich glaube zu wissen, dass meine Mutter niemals einen Satz gesagt hätte, den man tröstend hätte nennen können. Das war fremd im Wortschatz meiner Mutter und auch für uns damalige Kinder. Sie hat nie gratuliert, wenn etwas gelungen ist. Sie hat nie kritisiert, wenn etwas misslungen ist. Ich erinnere mich nicht daran, dass meine Mutter mich jemals in den Arm genommen oder liebkost hätte. Ich erinnere mich nur an heftige Parteinahmen der Mutter mit Nachbarn, die sich über ihre Kinder beklagt haben. Da war sie immer auf der Seite der Nachbarn.
Ich kann mir keine Kindheit vorstellen, in der eine Mutter weder Lob noch Tadel ausspricht.
Doch, wenn die Angst allgegenwärtig ist. Die Mutter hat Angst um alles. Wenn sich ein Nachbar beschwert, der mächtig ist, und solche gab es ja, es waren eigentlich immer alle mächtiger als man selbst, dann hat die Mutter Angst um das Kind, um das Geschäft, um alles. Aus dieser Angst heraus handelt sie, sie unterwirft sich, und sie unterwirft damit auch das Kind, obwohl sie wissen kann, dass das Kind das nicht immer so versteht. Ich habe da sehr konkrete Szenen im Kopf. Wir wohnten ja vis-à-vis vom Bahnhof, es gab einen Nachbarn, der hatte Verwandte im Bayerischen, die kamen immer in den Ferien von München an den Bodensee, um hier ihre Ferien zu verbringen. In dieser Zeit war der Sohn, mir gleichaltrig, sozusagen mein Freund. Ich weiß: Wenn wir zusammen herumgerannt sind, dann hat mir nichts gefehlt, und ihm kann es auch nicht an vielem gefehlt haben. Aber einmal hat er Äpfel von einem bestimmten Baum heruntergerissen. Der gehörte einem mächtigen Bauern. Wie viele hatte er in seinen Taschen? Ich weiß es nicht. Wir wurden auf jeden Fall erwischt. Ich war dabei – als hätte ich einen einzigen Apfel angefasst! Das hatte ich nicht. Diese Äpfel interessierten mich nicht, nur dieser Münchener Ferienbub. Aber dieser mächtige Bauer ist natürlich zu meiner Mutter gegangen und hat mich des Apfeldiebstahls, wenn ich das sehr hochdeutsch formuliere, angeklagt. Meine Mutter war tatsächlich tief erschrocken. Und obwohl ein solcher Apfeldiebstahl meinerseits weder stattgefunden hat noch sie selbst sich das hätte vorstellen können, hat sie einfach, weil dieser Bauer im Dorf mächtig war, vor dessen Augen ihr Kind bestraft.
Wie denn?
Nicht durch Schlagen. Obwohl meine Mutter ihre Kinder auch geschlagen hat. Mit dem Kochlöffel hintendrauf. Aus Angst, natürlich, um ihre Kinder zu behüten. Aber nicht dieses Mal. In meiner Erinnerung hat sie dieses Mal dem Bauer einfach recht gegeben. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber jetzt wage ich einen Satz, der lässt sich kaum ahnen und noch weniger aussprechen: Ich glaube, dass sie sich in dieser Szene sicher war, dass ich in meinem Gefühl ihre krasse Parteinahme für den mächtigen Dorfmenschen im Tiefsten kein bisschen ernst nehmen würde, dass sie also sich darauf verließ, dass ich wusste, dass sie nicht wirklich böse war gegen mich. Das sage ich jetzt. Damals habe ich vielleicht gelitten oder geweint, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gab es mit dieser Mutter eine Einigkeit, die unantastbar war durch welche Machteinreden auch immer.
Hast du dich als Vater später auch so verhalten? Deine vier Töchter sind mit dir aufgewachsen, da kann es zu solchen Gelegenheiten gekommen sein.
Ich fürchte, ja. Ich erinnere mich an eine Szene, da habe ich die Partei eines Lehrers ergriffen, gegen ein Kind. Über dieses Kind sollte verhandelt werden. Diese Tochter sollte sich ändern, hieß es. Und ich habe da, sogar in ihrer Gegenwart, die Partei des Lehrers ergriffen. Das ist tatsächlich eine der fürchterlichsten Szenen in meinem Seelenvorrat. Und wenn ich mich sündhaft schämen muss für irgendetwas, dann für diese Szene. Dieser Lehrer war ein Vollidiot. Und ich habe seine Partei ergriffen!
Aber warum?
Es ging um irgendwelche blödsinnigen Verordnungen. Sie sollte weniger Musik hören, was weiß ich. Das hat er so auf das Leben dieser Tochter hin gesagt, und ich habe das offenbar für befolgenswert gehalten. Ich konnte nicht widersprechen.
Ja, aber warum? Wegen der Autorität?
Ich weiß gar nicht, was das ist, Autorität. Ich sehe dann nur, dass einer Macht hat über mein Kind. Da versuche ich, mich opportunistisch anzupassen, damit er seine Macht über mein Kind nicht zu sehr ausübt. Ich glaube dann, ich könne mein Kind schützen durch Opportunismus.
Schützt man nur sein Kind mit Opportunismus oder auch sich selber?
Da bin ich nicht anders als alle Menschen. Wenn du merkst, in welcher Situation auch immer, dass jemand über dich Macht hat, dann ist vom Recht nicht mehr die Rede. Dann geht es nur um die Macht.
Was bedeutete es denn, wenn einer mehr oder weniger mächtig war im Dorf?
Ein Dorf hat eine viel kompliziertere Hierarchie als jede andere Menschenorganisation. Es gab nicht zwei Nachbarn, die gleich mächtig waren. Jeder war ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr – und der war der Höchste, Wichtigste. Entlang dieser Stufung ging es um Glück oder Unglück für die Familie, das Geschäft. Je mehr Macht einer hatte, desto mehr konnte er uns schaden. Wir hatten eine Wirtschaft, wir hatten einen Kohlenhandel. Das ganze Dorf war auch eine Kundschaft.
Waren diese Angst und der mögliche Schaden ausgedacht oder real?
Von Ausdenken kann gar keine Rede sein. Da ging es um einen unmittelbar aus der Dorfmentalität heraus entstehenden und sofort empfundenen Schaden. Weil eben jeder im Dorf ein Kunde werden oder, wenn er einer war, ein Kunde bleiben sollte!
Erinnerst du dich, dass jemand derart in Acht und Bann gefallen ist?
Ich habe miterlebt, wie es ist, wenn das Geschäft misslingt, wenn einer nicht mehr zahlungsfähig ist. Wenn der Bankrott kommt, verstehst du? Ich habe schon sehr früh daran mitgewirkt, genau das zu verhindern, den Bankrott. Es gab einen Laden, Glatthaar hießen die, die verkauften alles, Hemden, Handtücher, Messer, mitten im Dorf. Eine gute Lage. Emil, der Sohn, Ferdinanda, die eine Tochter, Maria, die andere, und Herr und Frau Glatthaar – die gingen also bankrott, und es wurde alles versteigert. Ich war dabei, wir alle streiften durch den Laden und machten Beute. Herr Glatthaar war auch danach noch ein Gast bei uns, ein ganz stiller Gast. Er hat jahrelang kein Wort mehr geredet. Er hat nur noch geraucht. Diese langen Dinger, die Virginias hießen. Er war bankrott. Es war nicht so, dass man ihn das hätte spüren lassen und dass er darum nicht mehr am Stammtisch sitzen durfte. Er war einfach für sich und vereinzelt durch die geschäftliche Niederlage. Das erlebt zu haben, das war ein Grauen. Darum durften wir nicht bankrottgehen. Tatsächlich müssen wir einmal zahlungsunfähig gewesen sein. Der Gerichtsvollzieher – das Wort sagt schon alles – kam und klebte Marken an einen Eisschrank und an das Klavier. Diese Marken sagten: gepfändet. Würden wir nicht rechtzeitig zahlen, konnte das Verpfändete abtransportiert werden. Die Angst der Mutter hatte viele Gründe. Bevor sie sich ins Bett legte, hat sie immer geschaut, ob jemand darunter war. Das kam vielleicht aus ihrer Kindheit in dem kleinen Hof in Kümmertsweiler.
Und du hast vom Flur durch den Türspalt gesehen, wie sie sich auf den Boden gekniet hat, in ihrem Nachthemd, und unter das Bett gesehen hat?
So würde man sich das jetzt vorstellen und damit ein Bild erzeugen, das sich in meinem Kopf heute nicht mehr findet. Vielleicht hat es so ausgesehen, vielleicht nicht. Ich weiß nur, dass sie das aus Kümmertsweiler so gewohnt war.
Wieso, waren da immer Leute unter den Betten?
Du kannst dir halt nicht vorstellen, wie früher gelebt werden musste. Meine Mutter war auf jeden Fall angstbesetzt. Als sie später ins Krankenhaus kam, war sie sicher, dass sie jetzt sterben würde. Da habe ich gemerkt, welche Angst sie vor dem Tod hatte. Sie meinte, die oberste Weltleitung sei ihr nicht freundlich gesonnen, weil sie doch aus Geschäftsgründen am Sonntag oft nicht in die Kirche gegangen ist. Damit hat sie gehadert. Sie hat das an ihre Kinder delegiert. Wir sind also statt ihrer in die Kirche. Nachher gehen die Wasserburger zu den Gräbern auf dem Friedhof, der rund um die Kirche liegt. Manchmal haben mein zwei Jahre älterer Bruder und ich es aus irgendwelchen infantilen Dringlichkeiten versäumt, ans Grab des Vaters zu gehen. Das wurde der Mutter von Beobachtern, Nachbarn natürlich, gemeldet. Da hat meine Mutter fast laut geweint. Jetzt wisse sie, wie es ihr ergehen werde, wenn sie tot ist, wir werden nicht an ihr Grab kommen. Das war für sie furchtbar. Ein Grab, an dem niemand stand, um für den Gestorbenen zu beten, also halblaut zu sagen: Herr, gib ihm die ewige Ruhe, lass ihn ruhen in Frieden, amen. Dann war das Weihwasser zu spenden. Wenn das also an einem Grab nicht stattfand, so hieß das, der Gestorbene müsse im Fegefeuer leiden. Es hat auf mich jedenfalls einen großen Eindruck gemacht, dass sie einerseits so vollkommen ungebrochen, geradezu mittelalterlich, gläubig war, andererseits aber solche Angst vor dem Sterben hatte.
Autorität und die Angst vor der Autorität spielen eine große Rolle in deinem Leben, oder?
Ich würde niemals Autorität sagen. Immer nur Macht. Wenn einer Macht über dich hat, dann bist du abhängig. Das war immer mein Verhältnis nach oben.
Wie geht man damit um?
Nun, ich habe mir 25 Jahre lang die Abhängigkeit von Reich-Ranicki gefallen lassen, und dann habe ich «Tod eines Kritikers geschrieben». Nach 25 Jahren! Bis dahin war immer klar: Ich bin abhängig von ihm. Aber ich hatte nie den Mut, gegen ihn oder andere, die über mich Macht hatten, zu veröffentlichen. Nur in meinen Tagebüchern habe ich gegen diese Leute Vierzeiler geschrieben. Natürlich wäre der ideale Zustand, dass niemand Macht über einen hat. Aber davon bin ich himmelweit entfernt. Angestellte, die haben meistens nur einen Chef, siehst du, aber ich habe nicht einen Chef, sondern hundert. Jeder Depp und jeder Nichtdepp kann über mich schreiben, was er will. Beim Abhängigen kann alles gleich zur Katastrophe werden. Das endet nie.
Als deine Mutter starb, im April 1967, hast du sehr viel darüber in deinem Tagebuch geschrieben. Da steht der Satz: «Sonst war nie jemand so wichtig.»
Ja, so kommt es mir immer noch vor.
Sie hieß Augusta, die Erhabene. Das ist ein großer Name für ein Mädchen aus Kümmertsweiler.
Ach Jakob! Der Vater meiner Mutter, also mein Großvater, hat Thaddäus geheißen. Er hatte drei Brüder, die hießen Anselm, Kaspar und David. So viel zu Namen aus Kümmertsweiler!
Du hast geschrieben: «Ich stehe nur vor ihr, vor ihrem Sarg, vor ihrem Grab, unersättlich. Was hat sie alles mitgenommen. Vierzig Jahre. Wasserburg und Kümmertsweiler und Geiselharz. Wir waren fünf, jetzt sind wir noch zwei und beide überspült von neuen Familien.»
Das Daseinsgefühl nach dem Tod der Mutter.
In den Monaten vor ihrem Tod hast du beinahe ein ärztliches Bulletin geführt.
Das war mein unmittelbares Bedürfnis. Das Tagebuch schreibt man ja nicht für später, sondern für den Augenblick. Hast du nie Tagebuch geführt?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich mir nie etwas merken wollte.
Du wolltest dir nie etwas merken? Aber das Tagebuch schreibt man nicht, weil man sich etwas merken will, sondern weil es einem jetzt wichtig ist, etwas aufzuschreiben. Das Tagebuch ist das Unmittelbarste, Absichtsloseste, was es gibt. Wenn du es schreibst, kommt es nur darauf an, dass du beim Schreiben das Gefühl hast, dass es so ist, wie du es jetzt schreibst. Das ist es jetzt. Dadurch, dass du es jetzt vor dir auf dem Papier hast, begreifst du es. Es ist, als würde man in den Spiegel schauen. Da siehst du dich auch noch einmal. Das kann so oder so auf dich wirken. So ist das Tagebuch, ein Spiegelbild deiner selbst.
Und warum will man das wissen?
Warum schaust du in den Spiegel?
Ich schaue gar nicht so oft in den Spiegel.
Jetzt hör aber auf.
Nein, ich meine das ganz ernst.
Nun, dann kann sich das geändert haben. Es muss Zeiten gegeben haben, da hast du sehr oft in den Spiegel geschaut. Da wurdest du nicht müde, in den Spiegel zu schauen.
Wann war das denn?
Als du 15, 16, 17, 18, 19, 20 warst.
Da kannten wir uns gar nicht.
Ich dich nicht. Aber du dich. Es muss eine Zeit gegeben haben, in der du daran interessiert warst, in den Spiegel zu schauen. Anders ist das nicht vorstellbar.
Du meinst, es ist für dich nicht anders vorstellbar.
Ich kann mir nur zwei Motive vorstellen, dass jemand absichtsvoll von sich wegblickt. Wenn man so wahnsinnige Bilderwartungen von sich selber hat, dass man sich noch nicht einmal selbst genügen kann; wenn einer geradezu bersten muss vor lauter Sichselbstgenügen. Das andere, das man trivial nennen kann, das kenne ich auch nur vom Hörensagen, das wäre die Depression. Bei uns im Dorf hieß das Schwermut.
Ich kann mir vorstellen, dass man sich selber für nicht so interessant hält, dass man sich mehr für andere Menschen interessiert als für sich selbst.
Daran glaube ich nicht. Man muss sich nicht interessant sein, um sich doch gerne im Spiegel anzuschauen. Schlicht, man sieht sich gern. Ein Satz von mir, den ich neulich wieder gelesen habe, heißt: «Es gibt keine Nachsicht mit sich selbst.»
Tatsächlich, ich bin mit mir nicht nachsichtig.
Nein, um Gottes willen, das war falsch zitiert, ich habe notiert, es gibt keine Grenze der Nachsicht mit sich selbst! Entschuldigung!
Das ist das Gegenteil.
Ja, verzeih, ich war dement.
Nein, das ist nicht dement, das ist wahrscheinlich der Freud’sche Versprecher. Denn so ist es doch: Man ist mit sich selber unnachsichtig. Man kann sich nicht verzeihen. Das ist das ganze Elend.
Hat sich das irgendwann auf deine gegenwärtigen Handlungen ausgewirkt?
Kaum je.
Kaum? Also kannst du es dir leisten, dich zu verurteilen, in aller Ruhe?
Das klingt so, als handele es sich um einen frivolen Spaß. So kommt es mir nicht vor. Man ist sein eigener Ankläger.
Ja, und sein eigener Verteidiger. Aber wenn man das jetzt summiert, dann könnte man sagen, dass du zu dir ein prima Verhältnis hast. Denn wenn bei dir die Anklage lauter ist als die Verteidigung, kannst du doch sehr zufrieden sein. Dann bist du ein sehr anständiger Mensch.
Ist das so?
Natürlich. Wenn ich mich häufiger und heftiger anklage, als ich mich verteidigen kann, dann kann ich mir das doch zugutehalten.
Ich halte es eher mit dem Satz, den du einmal geschrieben hast: «Andauernd bemerken wir, wozu wir imstande sind, und erschrecken viel zu wenig.»
Also, ich verstehe das in jenen Fällen, wo einem die Fähigkeit gefehlt hat, auf sich zu verzichten. Wo man sich in einer Art durchgesetzt hat, die man nicht goutieren kann. Aber bitte, da geht es immer um einzelne Personen. Es geht nicht um die Welt, um die Partei, um die Gesellschaft, um Europa. Es geht immer um Herrn oder Frau Sowieso, denen gegenüber man sich, dafür gibt es dieses Lieblingswort, schuldig gemacht hat. Aber indem man das aushält, beweist man, dass es keine Grenze der Nachsicht mit sich selbst gibt. Man hält sich aus.
Es gibt Menschen, die sich nicht mehr aushalten.
Und die sich umbringen?
Das wäre der dramatische Schritt. Man kann auch vorher schon die Verbindung zu sich selber kappen. Der Mensch, der sich fallenlässt, der sich von sich selber abkehrt, der nicht mehr in den Spiegel guckt, der muss sich gar nicht umbringen, um sich selber loszuwerden.
Das kommt mir jetzt vor wie eine Fiktion. Nichts gegen den Selbstmord. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Leuten das Aufhören schwerzumachen. Es muss einem nur schlecht genug gehen, dann ist der Selbstmord eine Befreiung. Aber schlecht im Sinne von körperlichen Schmerzen, nicht, weil man seiner selbst überdrüssig ist.
Aber Martin, du kennst doch wahrscheinlich Dutzende Menschen, denen es so ergangen ist. Die Gescheiterten.
Also, ich weiß nicht, woher du dieses Wort hast. Ich denke gerade, dass ich es beinahe nur aus der Seefahrt kenne. Es ist ein unkonkretes, abstraktes, nur dramatisch tuendes Wort, mit dem ich keinen wirklichen Vorgang in mir verbinden kann. Ich sage das auch, weil man immer wieder in der Zeitung lesen kann, dass ich über Figuren schreibe, die das Scheitern kennen. Dass es da sozusagen einen Generalbass bei mir gebe, dass ich ein Experte des Scheiterns sei. Ein wirkliches misslingendes Leben wird mit diesem Wort nur blumig zugedeckt. Ich bin kein Experte des Scheiterns und würde auch nie eine scheiternde Figur eine scheiternde Figur nennen. Nur weil ihr etwas im Leben misslingt. Vielleicht kommen wir, wenn wir über den Literaturbetrieb reden, auch zu der Frage, warum man mich für einen Experten des Scheiterns hält.
Ja. Und du hast eben das Wort «schuldig» gebraucht, ich bin sicher, dass wir auch noch über das Gewissen reden werden. Aber wir sind abgekommen. Du hast gesagt, deine Mutter habe dich nie berührt. Aber mir fällt auf, dass du das andauernd machst.
Ich? Bitte nimm das zurück.
Wieso? Das ist nicht schlimm. Und das ist kein Geheimnis. Man kann das auch lesen über dich, das fällt jedem auf.
Wenn ich mit jemandem spreche, kann es sein, dass eine Hand den Sprechpartner schnell berührt. Damit will ich dann unterstützen, was ich gerade sage. Aber das ist natürlich eine vollkommen andere Körpersprache. Verglichen mit der möglichen oder erwünschten familiären Körpersprache, könnte man die im gesellschaftlichen Verkehr sogar eine Fremdsprache nennen.
War dein Vater so? Hat er Berührungen verteilt?
Das nicht, er war einfach lieb.
Wie alt warst du, als er starb.
Ich war zehn. Er hatte Zucker und starb mit 48 oder 49, ich weiß es gerade nicht. Er war ja Soldat im Ersten Weltkrieg, sehr jung noch, und war als Gefangener nördlich von Paris. Das muss sehr schlimm gewesen sein. Die Deutschen hatten furchtbar gehaust jenseits der Grenze, und wer in Gefangenschaft geriet, an dem wurde dann in diesen sogenannten Vergeltungslagern sozusagen auch Vergeltung geübt. Auf jeden Fall hatte mein Vater von da an eine Zuckerkrankheit und musste sich dreimal am Tag Insulin spritzen. Es hat dann aber nicht geholfen. Er ist zu Hause gestorben. Im Zimmer 11 unserer Wirtschaft. Ich wurde nachts geholt. Ob er da schon tot war oder nicht, das weiß ich nicht mehr.
Hast du irgendeine Erinnerung an ihn?
O ja. Er ist mir deutlich in Erinnerung, am Klavier, singend, da saß er so aufrecht, dass er einen Kopf größer war als ich, wenn ich neben ihm stand.
Taucht er in deiner Erinnerung als schöner Mann auf? Hat er sich so bewegt?
Es gibt eine Zeichnung von ihm, die ist mit «Josef Zapf» signiert. Das war, glaube ich, ein Tischlerbursche aus Wasserburg. Der hat meinen Vater im Jahr 1910 gezeichnet, in Kohle. Da war er zwanzig Jahre alt. Als ich dieses Bild aus Wasserburg geholt habe, das war erst 1980, da habe ich in meinem Tagebuch geschrieben: «Wie schön dieser Zwanzigjährige dasteht, und 28 Jahre später war es ganz aus. Von da an hatte er noch vier bis fünf gute Jahre. Der Rest war Krieg, Dreck, Gefangenschaft, Krankheit, Not.» Das muss ich immer denken, wenn ich das Bild ansehe, es hängt in Nußdorf, über dem Klavier. Er sieht darauf sehr elegant aus. Sein Schnurrbart weist rechts und links ein bisschen nach oben, der wilhelminelt noch sehr, dieser Bart. Auf dem Kopf trägt er einen runden schwarzen Hut, beinahe eine Melone, das Hemd wird oben von einem hohen, steifen Kragen gehalten. Dazu der schwarze Rock, ein bisschen fest im Stoff, die Weste. Er trug immer solche Jacken, also Anzugsjacken. Aber die Hose extra und die Jacke extra, und immer zweireihig. Und die Jacke verhüllte nicht ganz, aber annähernd seine Oberschenkel, beinahe bis zum Knie.
Wie ein altmodischer Hauslehrerrock?
Nein, nein! Seine langen zweireihigen Jacken – die waren einfach toll. Ich denke immer, so wie er angezogen war, hat er überhaupt nicht zu uns gepasst. In diese Wirtschaft. Ohne dass ich das jetzt in einzelnen Szenen erscheinen lassen könnte, kann ich sagen, dass ich niemals einen milderen Menschen kennengelernt habe als meinen Vater.
Also hat er dich nicht mit dem Kochlöffel geschlagen?
Mein Vater? O nein! Er hat mir überhaupt nur ein einziges Mal eine Ohrfeige gegeben, und das war damals dann so gut wie keinmal, das musst du bitte bedenken. Es gab bei uns in der Wirtschaft einen breiten Gang. Geradezu ging es zur Küche, und nach links hin war ein ganz langes Buffet, das hatte ein Unterteil und ein Oberteil, alles aus Glas. Einmal standen dort noch die Gläser vom vergangenen Wochenende, ungespült. Und ich hatte einen Gummiring, den man an einer Schnur herumschleudern konnte. Patsch!, entglitt mir der Ring und sauste in die Gläser, und es waren, was weiß ich, neun, elf, fünfzehn hinüber. Da hat er mir eine gewischt. Nur dieses eine Mal hat er mich strafend gerügt. Er war sonst das ganze Gegenteil.
Erzähl mir von ihm.
Er hatte immer Angst, dass er das Geschäft nicht bewältigen kann. Er wollte verkaufen, um etwas Kleineres zu übernehmen. Das könnte man, dachte er, eher betreiben. Die Wahrheit ist, dass er geschäftlich nicht zurechnungsfähig war. Meine Mutter war immer das Gegenteil. Sie hat stets gesagt, man muss Schulden haben, solange das Geld immer weniger wert wird, muss man Schulden haben, daran verdient man. Aber mein Vater fürchtete das Risiko. Also ist er eines Tages losgefahren mit seinem Fahrrad und hat mich mitgenommen. Er hatte eins und ich auch. Wir sind nach Neukirch gefahren. Das ist zwischen Tettnang und Wangen. Da fährt man ein schönes Stück. Es wurde dunkel, es fing an zu regnen. Und er hatte ein Licht, ich weiß noch, wie die Regentropfen darauf zischten, es war also ein Licht, das gebrannt haben muss. Eine kleine Flamme. Und ich hatte auch ein solches Licht und bin hinter ihm hergefahren, durch den Regen, nach Neukirch, um eine Wirtschaft und Bäckerei anzuschauen. Die Wirtschaft war, das weiß ich heute noch, verglichen mit unserem Wasserburger Haus ein jämmerliches Quartier. In einem Winkel der Straßenecke lag sie und hatte einen kleinen Bäckerladen. Ich hätte ihm damals nicht sagen können: Um Gottes willen, lass uns umkehren. Von heute aus weiß ich, es wäre entsetzlich gewesen, wenn es gelungen wäre, unsere Wirtschaft zu verkaufen, um in Neukirch unterzuschlüpfen. Aber es war nun mal seine defätistische Mentalität, allem Geschäftlichen den Rücken zu kehren.
Hatte er denn schlechte Erfahrungen gemacht?
Na ja, er hatte aus dem Ersten Weltkrieg einen Freund, der ein Heilmittelgeschäft in Oberstaufen hatte. Und für den hat er eine Bürgschaft über 15000 Mark übernommen, obwohl er selber in Wasserburg noch Schulden hatte. Aber mit den Heilmitteln, das wurde nichts. Wenn der uns besucht hat, dann hat er seine Tees mitgebracht, die mussten wir alle trinken. Er hat sie ganz stolz ausgepackt und vor uns ausgebreitet. Aber sonst hatte niemand Interesse daran. Der Vater fuhr manchmal dahin, nach Oberstaufen, um den zu besuchen. Und wenn er zurückkam mit dem letzten Zug, dann habe ich am Bahnhof auf ihn gewartet. Und ich habe das Gefühl, dass nur ich immer da auf ihn gewartet habe und nie der Bruder, der doch zwei Jahre älter war. Er hat viel besser Klavier gespielt als ich, mein Bruder, er war im Klavierspielen dem Vater viel näher als ich, aber er hat nie auf den Vater gewartet. Das habe immer ich getan. Ich habe ihm dann seine Tasche abgenommen, die er mir über die Sperre am Bahnsteig reichte. Es war die schönste Tasche, die es in Wasserburg gab. Er hatte sie aus Lausanne. Es war eine Tasche, wie sie nicht einmal der Arzt bei uns besaß. Helles Leder, weich, bauchig. Von heute aus gesehen: das Bild einer Epoche.
Warst du stolz auf deinen Vater?
Ich war ungeheuer stolz. Ich fand alles an ihm wunderbar. Als ich mit ihm in die Kirche gegangen bin, da war ich noch sehr klein, sechs, sieben, acht, da musste ich noch nicht vorne bei den anderen Kindern sein, da konnte ich noch hinten bei den Erwachsenen, bei den Eltern bleiben, obwohl man das nicht soll. Und da habe ich gesehen, dass er ein Gebetbuch hatte in Steno. Verstehst du? Er konnte wegen seiner wirtschaftlichen Ausbildung Stenographie lesen und hatte ein Gebetbuch in dieser Schrift, die außer ihm niemand in Wasserburg lesen konnte.
Warum hatte er das?
Das war einfach sein Rang. Er hatte in Lausanne Kaufmannschaft gelernt und konnte stenographieren. Niemand sonst konnte damals stenographieren – außer mir, ich habe es sehr schnell gelernt.
Warum war er denn dann ein schlechter Geschäftsmann?
Warum? Weil er lieber Bücher las, Klavier spielte, Klavierauszüge von Wagneropern, und vor allen Risiken Angst hatte.
Und warum ist er Geschäftsmann geworden?
Daran war sein Vater schuld, der Josef Walser.
Wer war denn Josef Walser?