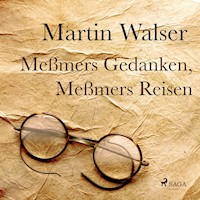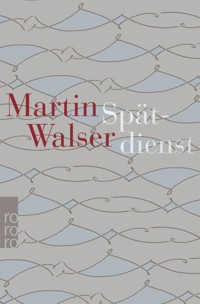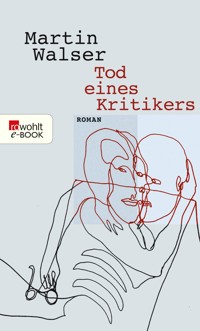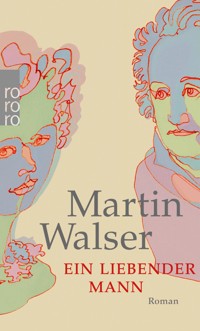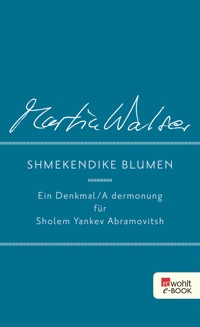Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die hier versammelten Buchbesprechungen Martin Walsers können als eine kleine, sehr persönliche Literaturgeschichte verstanden werden.
Das E-Book Winterblume wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Uwe Johnson, Arno Schmidt, Max Frisch, Thomas Hürlimann, Arnold Stadler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Über Hans Rothfels' Buch »Die deutsche Opposition gegen Hitler«
Wo doch die Henkel das Beste sind
Über »Lieblose Legenden« von Wolfgang Hildesheimer
Italienische Erzähler
Über neue Bücher von Ingeborg Guadagna, Giuseppe Berto, Carlo Còccioli und Dino Buzatti
Über Heinrich Bölls Roman »Und sagte kein einziges Wort«
Arno Schmidts Sprache
In Sachen Beckett
Brief an Siegfried Unseld
Wenn die Kimmung leer bleibt
Zu »Nichts in Sicht« von Jens Rehn
Über Ray Bradburys Roman »Fahrenheit 451«
Über »Reise ans Ende der Nacht« von Louis-Ferdinand Céline
Über »Erbarmen mit den Frauen« von Henry de Montherlant
Prophet mit Marx- und Engelszungen
Zum Erscheinen des Hauptwerks von Ernst Bloch in Westdeutschland
Was Schriftsteller tun können
Zu »Das dritte Buch über Achim« von Uwe Johnson
Vorwort zu »Die Nacht zu begraben, Elischa« von Elie Wiesel
Nachwort zu Wolfgang Werners Buch »Vom Waisenhaus ins Zuchthaus«
Daumenlutscher, Vorbildschnitzer
Über Kurt Batts »Die Exekution des Erzählers – Westdeutsche Romane zwischen 1968 und 1972«
Ernsthafter Feind
Ein stilles Bild von brutaler Zurückhaltung – Walter Kappachers Roman »Morgen«
Unentbehrlich
Über Ernst Bloch
In schlichter Leserfreude
Über Uwe Timms Roman »Morenga«
Literatur contra Leid
Vorwort zu Winfried Leuprechts »Der Versuch, aufrecht zu stehen«
Die Literatur der gewöhnlichen Verletzungen
Lieber Herr ...
Über Walter Boehlich
Der Mensch erscheint im Kriminalroman
Über Max Frischs Erzählung »Blaubart«
Mit angehaltenem Atem
Nachwort zum Briefwechsel zwischen Emil und Frieda Faller
Um das richtige Leben
Zu Katharina Adlers Buch »Lebenslandschaft Allgäu«
Gisela gibt's doppeltönig
Nachwort zum Geschichtenband »Zur Freude geboren« von Gisela Linder
Eine Daseinssteigerung
Über Thomas Hürlimann
Geist und Sinnlichkeit
Gert Neumanns deutsch-deutsches Gespräch
Über das Verbergen der Verzweiflung
Zu Arnold Stadlers Romanen
Der Untergeber, der Hinreißer
Unser aller Maudit: Über den Erzähler Erich Wolfgang Skwara
Anteilnahme, wissenschaftlich
Vorwort zu Manfred Fuhrmanns Buch »Aus der Bahn geworfen«
Winterblume
Cicero – eine Begeisterung
Über Manfred Fuhrmann und Cicero
Neue Wörter im Einflugloch
Über Egon Gramers »Gezeichnet: Franz Klett«
Martin Zingg
Vom Gewicht der Bücher
Nachweise
Über Hans Rothfels’ Buch »Die deutsche Opposition gegen Hitler«
Morgen jährt sich zum siebenten Male der Tag des Attentats auf Hitler. Mehr als sonst wird sich an diesem Tag so mancher die Frage stellen: Waren die Verschwörer des 20. Juli 1944 wirklich nur meuternde Edelleute, unzufriedene, ehrgeizige Generäle, reaktionäre Zivilisten oder gar Verbrecher, Abschaum der Gesellschaft? Wollten sie sich nur aus der unvermeidlichen Niederlage heraushalten und Vorteile für ihren Stand herausschlagen?
Diese Frage stellt und beantwortet Hans Rothfels in seinem Buch »Die Deutsche Opposition gegen Hitler«. Hans Rothfels war Professor für neuere Geschichte in Königsburg, musste wegen seiner jüdischen Herkunft Deutschland verlassen und lehrte im Exil an der Universität Chicago. In Amerika erschien sein Buch schon 1948. Jetzt erst, nachdem Rothfels inzwischen den Lehrstuhl für neuere Geschichte an der Universität Tübingen übernommen hat, jetzt erst ist das Buch in einer Übersetzung des Verfassers auch in Deutschland, und zwar im Scherpe-Verlag, Krefeld, erschienen. Professor Rothfels, der als deutscher Offizier schwer verwundet aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war, blieb auch von Amerika aus den Vorgängen in Deutschland aus »äußerer Ferne«, aber mit »innerer Nähe« verbunden. Er spricht nicht als Parteigänger, sondern als Historiker, der jene Vorgänge aus den propagandistischen Übermalungen lösen und die plakathaften Legenden durch gründliche wissenschaftliche Arbeit zerstören will und zwar, wie er sagt, »um der geschichtlichen Gerechtigkeit willen«. Das Ergebnis ist überraschend genug und zeigt der Weltöffentlichkeit, dass es sich bei der Opposition gegen Hitler nicht um Ehrgeizlinge, Reaktionäre oder rückständige Adelscliquen gehandelt hat. Nicht erst in der Panikstimmung der Kriegsjahre, sondern schon 1933 begann die Arbeit dieser »Front der Anständigkeit«. Rothfels kommt es darauf an, die konstruktiven politischen Programme dieser Oppositionsgruppen einmal nebeneinander und vergleichend darzustellen; er misst das Unternehmen nicht am Erfolg, sondern an den moralischen Grundsätzen, die für den Kampf der Opposition bestimmend waren.
Es ist durchaus möglich, dass die Zukunft noch weitere Einblicke in heute unzugängliche Dokumente bringen wird, es ist möglich, dass dadurch dieses oder jenes Ereignis noch heller beleuchtet wird; was aber Rothfels als grundsätzliche historische Erkenntnis in seinem Buch festgelegt hat, den Geist der Opposition, die Gründe ihres Scheiterns und vor allem den auch heute noch gültigen Wert ihres Gedankengutes, das bedarf keiner Revision mehr, das kann nach diesem Werk keinem Zweifel mehr unterliegen. Man darf Professor Rothfels dafür ganz offen danken. Er hat mit diesem Buch mehr für Deutschland getan, als eine Legion gut demokratischer Gesinnungsadressen an das Ausland zu tun vermöchten. Er hat die Kontinuität der Menschlichkeit von 1933-45 in Deutschland bewiesen.
(1951)
Wo doch die Henkel das Beste sind
Über »Lieblose Legenden« von Wolfgang Hildesheimer
1. SPRECHER Wie soll eine Kritik beschaffen sein? Sie soll helfen können. Sie muss also sagen, was falsch ist. (Sehr betont:) Sie muss aber auch sagen, wie das Falsche vermieden werden kann: Sie muss also eine Vorstellung vom Richtigen haben.
2. SPRECHER (dieser Abschnitt ziemlich rasch): Ein junger Schriftsteller lässt sich einladen, tanzt, trinkt, plaudert und tut einen Abend lang so wie die anderen. Die anderen gehen dann heim und schlafen. Der junge Schriftsteller geht auch heim, schläft aber nicht: er schreibt. Er setzt sich hin und macht die ganze Abendgesellschaft fertig, d.h. er verhilft auf dem Papier allen Gesichtszügen dieser Gesellschaft zum vollkommenen Ausdruck. Das meint das Wort: Er macht die Gesellschaft fertig.
1. SPRECHER Das Buch, das entsteht, heißt Lieblose Legenden. Der Schriftsteller heißt: Wolfgang Hildesheimer. Deutsche Verlagsanstalt übrigens.
2. SPRECHER Die Methode, mit der Hildesheimer die Gesellschaft, die Zeit und den Menschen kritisiert, ist unvollkommen.
1. SPRECHER Methode, d.h. in der Kunst und Literatur: Still Stile sind, weil sie Methoden sind, nachprüfbar!
1. STIMME (nicht ganz wirklich): Eines Tages kam ich von einem Spaziergang nach Hause und sah meinen Pudel Cassius auf dem Schreibtisch sitzen. Er las in einigen Gedichten, die ich in der letzten Zeit geschrieben hatte. Als ich an ihn herantrat, sah er mich scharf an. Mist, sagte er. Ich war, wie man sich vorstellen kann, überrascht, und zwar nicht nur über die Tatsache, dass mein Pudel offensichtlich lesen und sprechen konnte, sondern auch über das – wie mir schien – zu harte Urteil.
2. SPRECHER (wirklich): Merken wir uns:
1. SPRECHER Der Besitzer dieses Pudels ist überrascht, weil sein Hund lesen kann.
2. SPRECHER Weiter:
1. STIMME (nicht ganz wirklich): Ich habe mich aus Überzeugung in eine Nachtigall verwandelt. Da weder die Beweggründe noch der Entschluss zu einer derartigen Tat in den Bereich des Alltäglichen gehören, glaube ich, dass die Geschichte dieser Metamorphose erzählenswert ist.
2. SPRECHER Merken wir uns:
1. SPRECHER Die Verwandlung ist nur erzählenswert, weil sie nicht alltäglich ist, weil sie überraschend ist, wie das Sprechenkönnen des Pudels.
1. STIMME Ich demonstrierte meinen Freunden die neu entdeckten Eigenschaften meines Hundes, indem ich ihn in ein Gespräch über Lyrik verwickelte. Ein Wunder, riefen sie staunend.
2. SPRECHER Merken wir uns:
1. SPRECHER Dass ein Pudel sprechen kann, ist ein Wunder!
2. SPRECHER Eine Wohnung, die nur noch an einer Stahlstütze in der Höhe schwebt, wird dieses einzigen Haltes beraubt.
1. STIMME Er kletterte hinunter, legte mit ruhiger Zuversicht die Hände an den letzten Träger und knickte ihn wie eine Blume. Er hatte keine Zeit mehr, sich seines fatalen Irrtums bewusst zu werden. Das Dach sackte zusammen ...
2. SPRECHER und schlägt ihn tot. Merken wir uns:
1. SPRECHER Die Meinung, dass die Wohnung ohne Träger in der Luft bleiben könne, ist ein »fataler Irrtum«, der mit dem Tode gebüßt wird.
2. SPRECHER Merken wir uns:
1. SPRECHER Der sprechende Pudel: Überraschung und Wunder. Die Wohnung ohne Träger: fataler Irrtum.
2. SPRECHER Bitte, eine kleine Geschichte, einen Witz gegen Wolfgang Hildesheimer.
2. STIMME Ein Gast bestellt eine Tasse Kaffee, der Ober bringt sie, der Gast zerschlägt die Tasse, isst die Scherben und legt den Henkel neben sich auf den Tisch. So macht er es mit fünf Tassen Kaffee. Da wird der Ober nervös und rennt zum Geschäftsführer. Will Rat holen und Erklärungen! Fünf Tassen habe der Gast zerschlagen, alle fünf aufgegessen, nur die Henkel habe er neben sich auf den Tisch gelegt! So was, sagt der Geschäftsführer, wo doch die Henkel das Beste sind.
2. SPRECHER Der Theoretiker erklärt:
THEORETIKER (dünn, scharf, souverän, nicht ganz wirklich): Wer heute eine Feder in die Hand nimmt, nimmt Zweitausend jahre in die Hand. Wem das zu schwer ist, der soll’s bleiben lassen. Wer heute eine Feder in die Hand nimmt, der muss wissen, dass jeder Stil exklusiv ist. Der Ober in der Witzgeschichte will sich wundern über den Gast, der die Tassen isst, er will vom Geschäftsführer eine Erklärung haben. Was aber tut der Geschäftsführer in diesem Witz: Er sagt nicht, wie Wolfgang Hildesheimer, das ist ein Wunder, das ist Überraschung, das ist ein fataler Irrtum! Er sagt:
1. STIMME So was, wo doch die Henkel das Beste sind.
THEORETIKER So führt der brave Geschäftsführer die Sucht nach Erklärung und Begründung noch tiefer in den reinen unbegründeten Ausdruck. Wolfgang Hildesheimer aber erzählt geistreiche, ironische, spöttische Geschichtchen, er erfindet wunderbare Ansätze, aber am Ende fällt er immer wieder ins Erklären, ins Begründen. Ihm ist seine erfundene Ausdruckswelt selbst nicht geheuer. Er traut seinen Erfindungen nicht und verrät sie immer wieder an die Wirklichkeit. Und Wolfgang Hildesheimer ist unter allen jungen Autoren wohl der, der dem Stil, den unsere Zeit verlangt, noch am nächsten ist. Eine seiner Lieblosen Legenden ist vollkommen: Da hat ein kleiner Privatmann eine Lokomotive gekauft. Er lehnt es aber ab, auch noch einen Kran zu kaufen: Die Geschichte schließt:
1. STIMME (unwirklich): Was soll ich mit einem Kran?
THEORETIKER Wer heute eine Feder in die Hand nimmt, nimmt zweitausend Jahre in die Hand. Jeder Stil ist exklusiv. Ein Schriftsteller muss wissen, was sein Stil erlaubt und was er ausschließt. Wenn er das noch nicht weiß, dann ist sein Stil noch kein Stil, sondern eine Annäherung.
STIMMEN Zeichen der Zeit.
THEORETIKER Verwirrung der Begriffe: keine geprüfte Methode: keine reinen Stile. Die Kritiker loben Wolfgang Hildesheimer, weil er geistreich ist und erfinderisch. Wer aber hilft ihm, seinen Stil zu reinigen? Wer hindert ihn, seine echten Erfindungen weiterhin an eine stoffsüchtige, erklärungswütige Wirklichkeit zu verraten?
1. STIMME So was, wo doch die Henkel das Beste sind!
(1952)
Italienische Erzähler
Über neue Bücher von Ingeborg Guadagna, Giuseppe Berto, Carlo Còccioli und Dino Buzatti
Ganz kluge Literatur-Ökonomen haben sich seit 1945 immer wieder darüber beklagt, dass die deutsche Literatur »überfremdet« werde, dass zu viel ausländische Literatur ins Deutsche übersetzt werde. Auch in der deutschen Filmwirtschaft hörte man diese Klage. Nun weiß man ja, was uns blühen würde, wenn wir nur auf deutsche Filme angewiesen wären! In der Literatur ist es nicht ganz so schlimm, da haben wir noch Reserven aus der Zeit vor 1933; aber um ein wirklich zeitgenössisches Bewusstsein zu erlangen, müssen wir auch in der Literatur häufig, sehr häufig in die Ferne greifen, weil in der Nähe eben tatsächlich sehr wenig Gutes liegt.
Wir wollen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, heute mit vier italienischen Büchern bekannt machen. Ingeborg Guadagna, Giuseppe Berto, Carlo Còccioli und Dino Buzatti sind die Verfasser dieser Bücher.
Beginnen wir mit Ingeborg Guadagna, die uns in wenigen Jahren nun schon den vierten Roman vorlegt, wieder im Artemis-Verlag, Zürich und Stuttgart. »Die Fahrt zur Insel« heißt der neue Roman dieser jungen Erzählerin, die, wenn ich recht unterrichtet bin, aus Schwaben stammt und durch Heirat Italienerin geworden ist. Sie schreibt ihre Bücher in deutscher Sprache. Und doch verdankt sie ihre Romane Italien. »Die Fahrt zur Insel« unternimmt ein frischgebackener römischer Dottore, und zwar zur Insel Elba. Un aufgeweckt, blass, appetitlos, und sehr gebildet, betritt er die Insel. Mit einem Schäfer kann er sich nicht unterhalten, und barfuß kann er auch nicht gehen, weil seine immer behüteten Fußsohlen zu zart sind.
Erst, als er dann Leda, die arme Tochter armer Inselbauern kennenlernt, scheint ihm eine neue Haut zu wachsen. Der blöde Jüngling, der tumbe Tor, der Parzival ist es, der Unerweckte, der hier durch die schwerblütige Leda ins Leben hineingerissen wird, um verwundet zu werden bis ins Mark. Natalino flieht von der Insel, kehrt nach Rom zurück und weiß nicht, warum ihn Leda mit einem rothaarigen Handlungsgehilfen betrogen hat.
Er wird Journalist bei einer Fascistenzeitung, heiratet die Tochter seines Chefs, hat Erfolge in seinem Beruf, wird Soldat, Offizier – kehrt am Ende des Krieges nach Rom zurück, macht endlich sein Staatsexamen, um als Lehrer neu und brav anzufangen. Aber Natalino hat die »Fahrt zur Insel« weder vergessen noch verwunden. Die Erzählerin sagt, dass ihm »das tägliche Leben ohne Wichtigkeit weiterrann«.
Nun fügt es sich, das heißt, Ingeborg Guadagna fügt es so, dass Natalino mit seiner ungeliebten Frau noch einmal auf die Insel kommt, und hier sieht er Leda wieder. Sie erkennt ihn nicht mehr. Aus dem schlanken schwarzäugigen Mädchen ist eine biedere wohlbeleibte Geschäftsfrau geworden.
So bringt Guadagna alles ins rechte Geleise, vermeidet happy end, vermeidet aber auch Tragik: Natalino erhält alle Erklärungen über die Vergangenheit, die nötig sind, um den Jugendtraum von der Insel zu überwinden: Er wird ein braver Bürger mit edlen Neigungen.
Die vielfältige Handlung rollt nicht ganz von selbst durch die 500 Seiten. Ingeborg Guadagna muss manchmal etwas hart lenken und drehen, dass es zum neutral-befriedigenden Ende kommt. Diese Hilfskonstruktionen zeigen, dass das erzählerische Lenken vieler Schicksale gelernt sein will. Ingeborg Guadagna wird das lernen, daran ist kein Zweifel. Sie ist eine wirkliche Erzählerin. Ihre Sprache zeigt es. Aus ihrer süddeutschen Herkunft schießen ihr unverbrauchte kräftige Bildungen zu, die sie in ihre gelenkreiche und farbengesättigte Prosa einfließen lässt.
Nun zu Giuseppe Berto, zu seinem Roman »Mein Freund der Brigant«, erschienen im Claassen Verlag, Hamburg, ins Deutsche übertragen von Charlotte Birnbaum. Der Schauplatz ist Sizilien: die Not der Bauern, denen der Brigant Michele Rende helfen will. Er wiegelt sie auf, führt sie auf die unbebauten Ländereien der Großgrundbesitzer, die Landnahme misslingt, Michele wird zum gesetzlosen Briganten, der es auf sich nimmt, die Not der Armen zu rächen. Nino, der Sohn eines rechtschaffenen Bauern, erzählt diese Geschichte.
Er selbst verfällt dem kühnen, hochmutigen Michele; auch seine Schwester Emilia verfällt dem großen rücksichtslosen Mann: Und als Michele geächtet und gejagt durch die Berge irrt, da folgt ihm Emilia. Die rechtschaffene Bauernfamilie, die ihren wenigen Besitz treu pflegt und sich ehrlich am Leben hält, zerbricht. Das Gemüt der Mutter wird zerstört, der harte Stolz des Vaters wird unmenschlich verhärtet. Aber Nino, der Erzähler, erkennt allmählich, dass es ein falsches Gesetz ist, das Michele zum Briganten gemacht hat, zum Mörder und Brandstifter. Und als Ninos Schwester erschossen wird, da ist zwar dem Gesetz Genüge getan, da sind auch Micheles Morde gesühnt, aber die Not der Armen und die verständnislose Härte der in der Großstadt lebenden Großgrundbesitzer sind gleich geblieben. Also ist alles wie zuvor? Nein: Der sechzehnjährige Nino ist aufgewacht, er liest die Bücher, die ihm Michele hinterließ, er beweist auf einem steinigen Stück Land, dass dieses Land nicht der Unfruchtbarkeit überlassen bleiben muss, er weiß vom Recht der Armen auf das unbebaute Land.
Guiseppe Berto schließt seinen Roman mit dem Tod des Briganten, aber die Folgerungen, die sich für den Leser ergeben, sind unabweisbar. Giuseppe Berto muss keine Mahnungen aussprechen, keine Warnungen erteilen, er schildert das spärliche und mühsame Dasein dieser sizilianischen Bergbauern: flimmernde Hitze über steinigen Ackern, Schweiß und Staub, Werkzeug und Brot und Wein und einfache Andacht. Als die deutschen und dann die alliierten Truppen durchs Dorf ziehen, sagt der Erzähler Nino: »Irgendwer hatte uns immer regiert; es machte uns nicht viel aus, ob diese eine andere Sprache sprachen, wenn sie nur gerecht waren und uns nicht die Speise wegholten oder die Frauen nahmen.«
In dieser uralten Geduld ertragen sie auch die Herren, die Großgrundbesitzer, von denen sie Michele befreien wollte.
Es ist ein einfaches Buch ohne vielfältige Handlung und weitläufige Schicksale: Es ist so einfach und karg und gleichzeitig so schön wie die Landschaft und die Menschen, durch die es entstand.
Kunst und Natur haben einträchtig zusammengewirkt, um dieses Werk hervorzubringen. Es ist ja bekannt, welch großer Kunst es bedarf, um das Natürliche künstlerisches Ereignis werden zu lassen.
Die deutschen Blut- und Bodenromane beweisen es von Mal zu Mal aufs Neue. Welcher unserer deutschen Erzähler weiß noch so um die ursprünglichen Gesetze des Erzählers wie Giuseppe Berto. Er erzählt durch den jungen Nino, und er verletzt die Perspektive dieser Figur nicht ein einziges Mal. Was erzählt wird, wird durch Nino erzählt. Und dieser Rahmen wird nicht zum Mittel erniedrigt, wird nicht zur Beschränkung. Nino hört und sieht, was gesprochen wird, was geschieht. Und gerade dieses Nacherzählen dessen, was man im Dorf sagt und meint, die vielfache Brechung der Ereignisse, die dann noch einmal durch Ninos Augen gesehen werden, gerade daraus schlägt Giuseppe Berto phantastisches Kapital.
Man sollte dieses Buch unseren jungen Erzählern dringend empfehlen, das würde manche klug gespreizte Diskussion überflüssig machen.
Nun zu Carlo Còccioli. »Das Spiel« heißt dieser Roman, den Fritz Jaffé für die Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart übersetzte. Bei Giuseppe Berto war alles Natur, auch die jahrhundertealte Erinnerung der Bauern ist dort nicht Geschichte, sondern unveränderliche Natur; bei Carlo Còccioli ist alles Geschichte.
Der junge Schriftsteller Fabio kommt in die uralte Universitätsstadt Hesperia. Zwei Frauen sind um ihn, Lucia und Lisabetta. Das sind die drei Hauptrollen des Spiels. Der Sinn des Spiels ist es, dass jeder Spieler sich über seine Rolle klar wird. Lucia ist durch ihre Großmutter mit dem vorchristlichen Bewusstsein ihres uralten Volkes bekannt geworden. Von ihr erfährt sie: »Unser Gott war blind, ohne Augen, ein Sinnbild des großen Spiels, das das Schicksal mit uns treibt.«
Fabio lernt durch sie und durch den Umgang mit den uralten Mauern Hesperias, dass man das Spiel, das das Schicksal mit uns treibt, erkennen muss: Die vergessenen Regeln, die Normen, die jeder Bewegung zugrunde liegen, müssen wieder bewusst gemacht werden.
Das heißt, man muss Einsicht in das eigene Marionettendasein gewinnen. Man kann zwar nichts ändern, aber man darf nicht blind an den Drähten hängen.
Wir können hier natürlich nur ein paar grobe Andeutungen über dieses vielfach versponnene Schicksalsspiel geben. Ein gedankenreiches Buch, mit dem man als Leser gerne streitet, das man aber auch gerne liest, weil das wirklich-unwirkliche Traumgehege, in dem Fabio und die beiden Frauen irren und suchen, nicht in intellektueller Esoterik verdorrt. Còccioli ist zwar in Gefahr, manchmal nur die Mechanik der Ideen vorzuführen, aber er erliegt dieser Gefahr immer nur für wenige Augenblicke, dann entschädigt er dafür wieder mit einer so ungemein eindrucksvollen Schilderung einer Lindenallee, eines alten Mauerwerks, einer nächtlichen Straße, dass man nicht anders kann, als ihm überall hin zu folgen. Eine Vorstadt, eine Sehnsucht, ein Lufthauch oder ein flüchtiger Traum: Das ist für ihn alles in gleichem Maß erzählbar, gegenständlich erlebbar.
Còccioli hat die sprachliche Kraft – und Fritz Jaffé hat sie ins Deutsche herübergebracht – , die Kraft, die Überlagerung dieser Sphären und den unerbittlichen klärenden Lauf des Spiels Gestalt werden zu lassen.
Fritz Jaffé hat auch das vierte Buch, das wir kennenlernen wollen, übersetzt: die Erzählung »Panik in der Scala« von Dino Buzzati, erschienen in der Reihe der Stern-Ausgaben der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart. Endlich, möchte man sagen, endlich wieder eine größere Erzählung von Buzzati. Gleichzeitig aber bedauert man, dass es nur bei einer Erzählung geblieben ist. Fritz Jaffé hat auch Buzzatis Prosa in ihren eigentümlichen Qualitäten ins Deutsche gebracht. Diese Erzählung ist dazu angetan, für Buzzati einen größeren Leserkreis in Deutschland zu gewinnen. Es ist eine der leichtesten, der zugänglichsten Erzählungen dieses Dichters. Die noble Gesellschaft in der Mailänder Scala wird von der allgemeinen Angst befallen, dass während der Vorstellung eine Revolution der Morzisten in der Stadt ausgebrochen sei.
Niemand will die Scala verlassen. Kleine Belanglosigkeiten werden in der panischen Stimmung zu schrecklichen Zeichen kommenden Unglücks! Die seidenen Roben der vornehmen Premierengesellschaft liegen auf dem Boden des Foyers, elegante Herren rauchen mit zitternden Händen noch eine Zigarette. Man sitzt und liegt eine ganze Nacht im Foyer herum und steigert sich gegenseitig weiter in die Panik hinein. »Das letzte gespenstische Biwak einer todgeweihten Welt«, sagt Buzzati mit sarkastischem Lächeln. »Von den Dingen weicht der Glanz.« Zyniker verspritzen ihre letzten Bonmots, mondäne Damen werden hysterisch, und ehrwürdige Kunstgreise zittern wie ganz kleine Kinder. Dann dämmert der Morgen, die Blumenfrau kommt, und der Straßenkehrer draußen auf dem Platz fegt die Furcht hinweg.
Während sonst die Erzählungen Buzzatis oft eine Verweisung ins Ontologische in sich tragen, ist die »Panik in der Scala« nur auf das Ontische, und zwar auf das Gesellschaftliche bezogen. Aber das wirkt sich nicht nachteilig aus auf die Meisterschaft der Erzählkunst dieses Dichters. Und wir könnten froh sein, wenn wir in Deutschland heute einen Dichter hätten, der mit solcher Sicherheit und mit so überlegener Charakterisierungskunst der Gesellschaft einen satirischen Spiegel vorhalten könnte. Auch Buzzati hat von Kafka gelernt. Mehr als jeder andere europäische Autor hat er verstanden, dem großen Vorbild das ihm Gemäße zu entnehmen und zum Eigentum zu machen.
Buzzati ist auch der Einzige geblieben, der bis jetzt tatsächlich bewiesen hat, dass Kafka nicht ein historischer Einzelfall war, sondern dass er den Stil und die Thematik unseres Jahrhunderts vorgezeichnet hat – so vorgezeichnet, dass keiner an ihm vorbeigehen kann, wenn er unser Dasein zum Ausdruck bringen will. Buzzati ist kein Epigone geblieben, er ist durch das Vorbild er selbst geworden.
(1953)
Über Heinrich Bölls Roman »Und sagte kein einziges Wort«
Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Postkarten nicht vertrauenswürdig sind; ja, man könnte in vielen Fällen ohne weiteres beweisen, dass sie lügen. Die Postkartenphotographen konzentrieren sich in den Städten zum Beispiel auf jene von Wiederaufbau-Glätte strahlenden Fassaden, die der gesinnungstüchtige Verkehrsverein zur Vervielfältigung empfiehlt. Wo sich eine gähnende Ruine in glänzenden Travertin verwandelt, wachsen auch die Stative solcher Photographen aus der Erde. Und anschließend wird das Bild noch mit Hochglanz versehen.
Heinrich Bölls Roman »Und sagte kein einziges Wort« – bei Kiepenheuer und Witsch, Köln, erschienen – ist in jeder Zeile und in der Fülle seines Sinns ein Buch gegen die Postkartenindustrie; ein Buch gegen die hochglanzpolierten Fassaden, die von Geschäftsleuten als das Bild einer Stadt verkauft werden. Es ist ein Buch gegen jeden Verkehrsverein, der seine Stadt als bequemes und wohlrestauriertes Milieu für tagungsbeflissene Zeitgenossen empfiehlt. Ein Buch, das man also ohne weitere Diskussion in die längst verstaubte Schublade »Trümmerliteratur« abschieben kann?! Nein. Von Trümmern ist hier kaum die Rede. Allerdings auch nicht von Wiederaufbau. Hier ist von Menschen die Rede, die es noch nicht geschafft haben, die es vielleicht niemals schaffen werden: Sie haben den Baukostenzuschuss nicht, der ihnen ein menschliches Wohnen ermöglichen könnte! Sie gehören keinem Interessenverband an, der sie ins sorglosere Dasein steuern könnte. Diese Familie Bogner ist zur Armut verurteilt, und er und sie wissen, dass Armut eine Strafe ist. Zuerst allerdings müssen sie spüren, dass Armut auch eine Schuld ist, ein moralisches Übel, das die Strafe ganz von selbst nach sich zieht. Die Richter sind Angehörige jener bürgerlichtüchtigen Umwelt, die es geschafft hat: Frau Franke ist Repräsentantin dieser wohlanständigen Tüchtigkeit. Sie ist katholische Christin, eine der »führenden« Frauen der Diözese, einmal im Monat wird sie vom Bischof empfangen! Sie lädt die verwahrloste Familie Bogner in barmherziger Regung an Feiertagen in ihre glänzende Wohnung, um die Bogners wie heidnische Dienstboten vorwurfsvoll und herablassend mit kleinen Geschenken zu demütigen. Einer der wichtigsten Stränge dieses ganz und gar zeitgenössischen Buches ist diese, der katholischen Umwelt gewidmete Handlung. Frau Franke, die gutsituierte 150%ige Katholikin, der volkstümlichtuende Bischof, der sich als Danteforscher in leer stehenden Häusern seinem kultivierten Hobby hingibt, während Bogners Ehe an barer Raumnot zugrunde zu gehen droht (wobei dieses leerstehende Haus übrigens einem General gehört), die geistige Dürftigkeit und religiöse Geschäftigkeit des Verwaltungsklerus einer Bischofsstadt, das sind