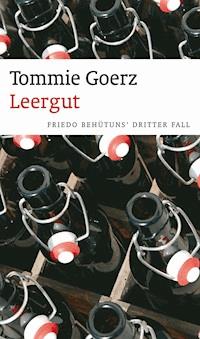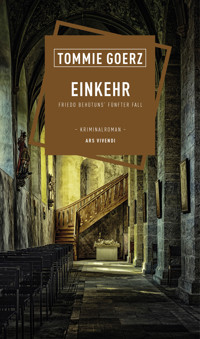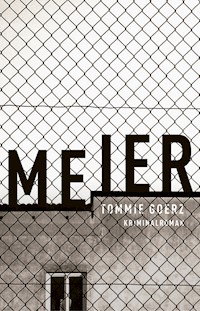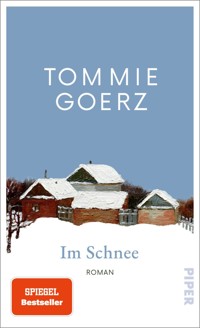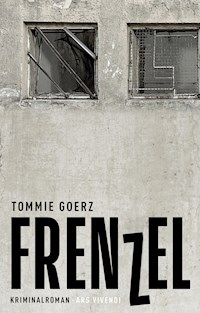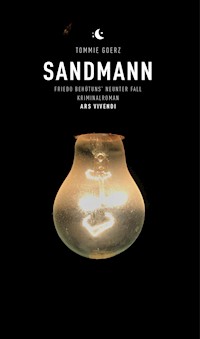Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tommie Goerz ist vor allem als Schöpfer des beliebten Kommissars Friedo Behütuns bekannt geworden. Aber auch mit seinen regionalen Sachbüchern sowie seinem Roman Meier, der auf der Krimi-Bestenliste stand, hat sich Goerz eine große Leserschaft erschrieben. Mit diesem Band bietet sich die Gelegenheit, den Autor als Meister der kurzen Form zu entdecken, der atmosphärisch und mit viel Gespür für lokale Feinheiten das Abgründige im Alltäglichen aufdeckt. Für Goerz-Fans besonders erfreulich: zwei neue, eigens für dieses Buch geschriebene Kurzkrimis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tommie Goerz
Das letzte Bier
Kriminalgeschichten
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage März 2021)
© 2021 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © Walther Appelt
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0240-1
Inhalt
Die Kärwasau ist tot
Ahmoll bringinern nu umm
Das Schweigen
Weidmanns Ruh
Das letzte Bier
Die Nacht
Einmal nur noch fliegen
Die Weihnachtsgans
Mein Opa
Umkleide 36
Der Selbstmord
Spalter Hopfenspargel
Der Autor
Die Kärwasau ist tot
»Der Dokter, der Dokter, schnell, ist der Dokter nu doh?« Urplötzlich herrschte große Aufregung im Grauen Wolf. Und so, wie die hektischen Rufe aus dem Eingangsbereich des Wirtshauses klangen, musste etwas Schreckliches passiert sein. Die Tür zur Gaststube wurde aufgerissen. Es war früher Vormittag, ich saß gerade beim Frühstück. Was man mir serviert hatte, hätte eine vierköpfige Familie einen Tag lang mühelos ernährt, aber es war der Dienstag nach der Kärwa, und wer die letzten viereinhalb Tage hier im fränkischen Oberspring erlebt und mitgemacht hatte, der brauchte jetzt etwas Deftiges. »Herr Dokter, Herr Dokter, schnell, kummer S’, schnell!« Der Meindl und der Regenfuß waren hereingestürzt, hatten sich umgesehen, mich entdeckt und waren an meinen Tisch gestürmt. Sie waren sichtlich aufgeregt. Nicht gut für deren alte Herzen. Dass die beiden überhaupt schon wieder auf den Beinen waren und halbwegs geradeaus sehen konnten, grenzte an ein kleines Wunder, so beieinander, wie sie gestern Nacht gewesen waren – und dass sie die Kärwatage überhaupt überlebt hatten, schon an ein größeres. Doch die Menschen in diesem Landstrich sind zäh und hart im Nehmen. Ich hatte in den vergangenen Tagen etliche dieser Eingeborenen kennengelernt. Und auch etliche von deren rustikalen Bräuchen.
Ich bin, das sollte ich vielleicht vorausschicken, Arzt. Ich habe ein Leben lang in der Gegend von Hersbruck eine Praxis für Allgemeinmedizin betrieben und bin seit zwei Jahren im Ruhestand. Seit ich endlich wieder Zeit habe, wandere ich viel durchs fränkische Land, meist Mehrtagestouren, bei denen ich in Gasthöfen entlang des Weges übernachte. So war ich ahnungslos am letzten Donnerstag in Oberspring gelandet, hatte mir ein Zimmer genommen – ein Wunder, dass überhaupt eines frei gewesen war, wie ich hernach feststellte – und mich zum Abendessen in die Wirtsstube begeben, die sich, eigentlich ungewöhnlich für einen Donnerstag, ziemlich schnell bis auf den letzten Platz füllte. Aber ich wusste schon, warum, denn auf der Wiese neben dem Gasthof hatte unter dem sattgrünen Mailaub der alten Bäume eine kleine Schiffschaukel gestanden, daneben eine Losbude, ein Schießstand mit Plastikblumen und eine Bude für Süßigkeiten, dahinter zwei, drei Wohnwägen der Schausteller. Eine Handvoll Kinder lungerte erwartungsvoll um die Stände herum, die aber hatten ihren Verkauf noch nicht gestartet. Die Beleuchtungen brannten schon und verströmten im frühen Abendlicht das Gefühl heimeliger Vorfreude. Vor dem Gasthof waren Biergarnituren aufgestellt, doch hatte dort niemand Platz genommen, denn es hatte zuvor geregnet und ein weiterer Gewitterschauer kündigte sich mit dunklen Wolken an, außerdem wurde noch nicht bedient. Seitlich brummte ein in die Jahre gekommener Kühlcontainer einer lokalen Brauerei vor sich hin, eine Mückensäule tanzte im Licht einer Laterne auf und nieder.
Ich muss gestehen, ich hatte mich gefreut, als ich das alles so unverhofft erblickt hatte: Sofort war mein Jagdtrieb befeuert. Denn ich sammle alte »Kärwasliedli«, Lieder oder Gstanzln, die manchmal von den Alten zur Kärwa noch gesungen werden, schon seit Jahrzehnten intonierte, oft aber auch aus dem Stegreif gedichtete – ein Brauch, der immer mehr in Vergessenheit geriet, und mit ihm die kurzen, oft derben Verse. Die Jungen singen nicht mehr so viel. Voraussetzungen für diese »Versli« waren nicht zwingend, aber fast immer genügend Alkohol und ausgelassene, gute Stimmung.
Ich war also zum Abendessen hinuntergegangen und hatte mich an einen der Tische gesetzt. Im Lauf des Abends – während dem ich noch bis Dienstag, also heute, meine Zimmerbuchung verlängert hatte, denn er war für mein Hobby sehr vielversprechend gelaufen – lernte ich die Männer am Tisch schnell kennen. Die Franken sind nicht so mumbflerd und Fremden gegenüber verstockt, wie man ihnen oft nachsagt. Die Männer waren meine Generation und älter, und alle kamen aus dem kleinen, kaum mehr als zweihundert Seelen zählenden Ort. Und da ich mir Namen gut merken kann, kann ich sie hier auch vorstellen. Es waren, bis auf die Landwirte, alles »Ehemalige«: der Lehrer Regenfuß, der Maurer Meindl, Gemeindeschreiber Egersdörfer, der Anstreicher Lenz, der alte, dicke Zeilmann, einst Brauer in der alten, längst aufgelassenen Brauerei gegenüber, sowie die Bauern Eh, Malter, Weisel, Schmitt und Schmid. Wir saßen also zu elft am Tisch, es war entsprechend eng. Und laut. Und keiner trank. Warum? Man wartete auf den Herrn Pfarrer. Das erste Fass stand auf dem Tresen und sollte angestochen werden, das Zapfzeug lag bereit. Der Pfarrer, so der Brauch, hatte das erste Fass anzustechen. Fünfzig Liter Freibier, traditionell vom Wirt spendiert, vom Pfarrer gesegnet für eine gelungene Kärwa. Kein Wunder, dass bislang keiner ein Getränk bestellt hatte. Da endlich ging die Tür auf, Hochwürden betrat den Raum, und ein Gejohle ging los, vom Feinsten. Der Pfarrer setzte sich erst gar nicht. Er stellte sich vor den Tresen, nahm umgehend das Zapfzeug und breitete damit die Arme aus, als spräche er einen Segen. Wartete, bis die Gemeinde verstummte. Und ließ ein Gstanzl los:
»Die Kärwa is kumma,
die Kärwa is do.
Die Aldn, die brumma,
die Junger sen froh.«
Ein ohrenbetäubendes »Djiiijuhuu!«, vielfach Schlusspunkt dieser Gstanzl, ließ den Gastraum erbeben. Und während sich der Geistliche dem Fass zuwandte, um den Zapfhahn anzusetzen, frotzelte der dicke Zeilmann zwei Plätze neben mir sangeslustig:
»Der Pfarrer stichd es Fässlo oh,
die Madli lässder sei,
er wollerd scho, doch dearfer ned,
nedmoll in der Sakristei.«
Die Gemeinde schmetterte ihr obligates »Djiiijuhuu!«. Da aber nahm der Pfarrer demonstrativ den Zapfhahn wieder vom Fass, drehte sich seinen Schäfchen zu, blickte dem Zeilmann ins Gesicht und konterte, ohne mit der Wimper zu zucken:
»Beim dicken Zeilmann quietscht es Bett
wenn er mid seiner Aldn ...,
doch die is hässlich, bugglerd, fett,
die Warzn kanner bhaldn.«
Brüllendes Gelächter im Raum, manche hauten auf den Tisch, und alles sah erwartungsvoll den Zeilmann an. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, und hatte längst mein Büchlein gezückt, um mir die Verse zu notieren, da erhob sich der wohlbeleibte Angesungene und retourkutschte eiskalt:
»Der Pfarrer hod so scheena Aung
dass die Madli grunzn,
doch der trinkt doh sei drei Moß Bier
dann gehder ham auf Brunzn.«
Eins zu eins. Der Pfarrer grinste und nickte anerkennend, drehte sich zum Fass, setzte an und holte aus. Ein Schlag, zwei, Bier spritzte seitlich weg, der dritte Schlag setzte den Hahn richtig fest, der vierte war nur noch zur Sicherheit. Derweil legte Zeilmann noch einen nach, und ich machte mir ob seiner Leibesfülle und seines hochroten Kopfes ernsthaft Gedanken um seine Gesundheit. Der Bluthochdruck war ihm förmlich anzusehen. Ich schätzte ihn auf hundertsiebzig. Mindestens. Aber er presste mit ungeahnter Leichtigkeit umgehend ein Kontra aus seinem dicken Leib:
»Der Pfarrer stichd es Fässla oh
dasses nur so spritzt,
der wollt scho anders spritzn ah,
doch drauf der Teifl sitzt.«
Hochwürden ließ das erste Bier ins Glas, Schaum pur, der Wirt übernahm, der Gottesmann hielt das schaumgefüllte Seidla hoch, skandierte aus dem Stegreif
»Freund Zeilmann is gar durschdi heut,
doch grichder bloß an Schaum,
weil in der Kirchn sichdmern nie,
der tut ans Weardshaus glaum.«
und reichte ihm unter fröhlichem Gejohle der Gemeinde das mit weißem Schaum gefüllte Glas. Anschließend sang er mit ausgebreiteten Armen den Segen für die Kärwa:
»Wenn aufs Johr die Kärwa is,
na soll die lusti sei,
sunst scheiß i in die Kärwa nei,
soll lieber kahni sei.«
Auch der Herr Pfarrer hatte ein hochrotes Gesicht, allerdings war der Grund hierfür eine sichtlich ausgeprägte Couperose. Vielleicht gingen die vielen kleinen Äderchen ja auf den Messwein zurück? Konnte aber auch Bluthochdruck sein oder einfach eine Bindegewebsschwäche. Ich konzentrierte mich wieder aufs Mitschreiben, kam kaum mehr nach. Aus der Küche wurden die ersten Teller mit Bratwürsten, Kraut und Brot balanciert, die Wirtin und ihre Töchter servierten. Dabei sang die Wirtin den Ersten, dem sie einen Teller hinstellte, direkt an:
»Wo is denn es Gerchla?
Es Gerchla, des is net daham.
Des is aaf der Kärwa,
frisst die ganzn Brodwörschd zam.«
Der Angesungene, er hieß ganz offenbar Georg, also Gerch, konterte den braven Vers gleich rustikal:
»Früh um halber vierer
weggd der Weard die Wearddi auf
zubbfdera weng oh ihrer,
bumms, do hoggder drauf.«
Die Wirtin ließ sich nicht lumpen und antwortete, als sie auf ihrem Rückweg an ihm vorbeikam:
»Ach ja, es Gerchla glah,
des sauft sei Bier allah
doch noch der erschdn Moß
ner werder groß.«
Was soll ich sagen. Das Bier floss in Strömen, das Freibierfass war ruck, zuck leer, der Zapfhahn wurde aufgedreht, die Stimmung ebenso, es wurde immer lauter und die Gstanzln immer derber. Sang einer
»Im Summer, do is Kärwa,
im Winter Weihnachd und Neijohr,
die Katzn rammln zeitenweis,
die Madli is ganz Johr«,
griff ein anderer das Stichwort »Kärwa« auf und donnerte:
»Und wenn mei Fra ihr Kärwa hat,
dann hob ich meine a,
bei mir left’s dann di Gurgl ro,
bei meiner Fraa die Baa.«
Der Saal tobte, es wurde immer schlüpfriger. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass sich, bis auf zwei oder drei, keine Frauen in der Gesellschaft der dreißig, fünfunddreißig Männer befanden. Es dürften so ziemlich alle Männer sein, die der Ort aufweisen konnte, schätzte ich. Ob sie, weil sie unter sich waren, so zotig wurden? Jedenfalls fielen die Hemmungen im Lauf des Abends immer mehr, und mit ihnen das Niveau.
»Nüber, rüber, rauf und ro,
säht der Bauer Linsen.
Wenn die Madli bemberd ham,
dann genners ham und grinsen.«
Die Obergrenze der Derbheit war noch längst nicht erreicht, das Thema der nachfolgenden halben Stunde aber fest umrissen: Es ging ab da nur um die Weiblichkeit und ums Essenzielle. Und wiewohl ich nicht nur einmal heftig lachen musste, ich gestehe es, hatte ich doch stark den Eindruck, dass die hier anwesenden Mannsbilder allesamt bei ihren Ehefrauen zu kurz kamen, sich nicht trauten, von anderem träumten oder was auch immer. Manchmal fühlte ich mich auch derb an meine Jahrzehnte andauernde berufliche Tätigkeit erinnert, während der ich auch das eine oder andere, manchmal durchaus ganz und gar nicht Erfreu- oder Erbauliche, erlebt hatte:
»Ich hob amol a Madla ghabt,
des wor vo Kastlreith,
der hobi untern Ruck nogschaut,
no hätti mi ball gschbeid.«
So verbrachte ich den Eröffnungsabend der Kärwa von Oberspring sehr unterhaltsam am Tisch der Alten und sollte schon am nächsten Morgen zum Frühstück drei von ihnen wiedersehen: den Anstreicher Lenz, den dicken Zeilmann sowie den Landwirt Eh. Sie saßen beim Frühschoppen, die anderen waren mit der Dorfjugend in den Wald hinausgezogen, um den Kärwabaum zu holen. Als der Wirt dem Zeilmann das erste Seidla brachte, stellte der es vor sich hin, hielt es mit ausgestreckten Armen zwischen den Händen und strich genüsslich mit den Daumen über die Kondenswassertropfen, die sich am Glas gebildet hatten.
»Ja, des is schon was Schönes«, sagte er wie zu sich selbst.
»Ein Bier so früh am Morgen?«, konnte ich mir nicht verkneifen.
»Nein«, schüttelte er den Kopf, »obwohl – das auch. Aber ich mein, dass ma jetzt so tolle Kühlschränk hat, wo des Bier immer so schö frisch ist und kalt.«
Ich muss ihn wohl etwas begriffsstutzig angesehen haben, denn er schob gleich die Erklärung nach: »Wissen S’, früher wurd ja noch geeist. Da hammers Eis ausm Weiher gholt druntn und drühm«, und dazu deutete er hinüber zur ehemaligen Brauerei, »in den Keller bracht, fürn Sommer. Da semmer aufs Eis, einer hat gesächd, mit der Hand nu, und der war mit an Seil gesichert. Und manchmal hammern auch reinfallen lassen.« Er lachte. »Issermoll fast ahner dabei gschdorm, ersoffm. Den hammer grodnu rechtzeitig rausgrichd. War so.«
Der Eh nickte, während mein Blick fasziniert auf dessen offensichtlicher Aszites ruhte. So extrem hatte ich das schon lange nicht mehr gesehen. Es war ein massives Dreieck, das es ihm unter den Rippen und über seinem Gürtel herauspresste. Der Zustand seiner Leber konnte nicht sonderlich gut sein, aber er hatte noch keinen Anflug von Gelb im Gesicht, zumindest konnte ich im leichten Zwielicht, das hier herrschte, nichts diesbezügliches Erkennen. Derweil hatte der Eh die Ausführungen vom Zeilmann ergänzt: »Des Eis aus dem Keller hat sich en ganzn Sommer ghalten. Und wenn mir gschlacht ham, aber die Metzger ah, dann ham mir des Eis kafft und hams für di Wurscht gnummer und fürn Leberkäs, do braugst ja eins. Des deaferst heut nemmer, Weiereis für die Wurscht. Wie lang bleim S’ n einglich doh?«, wandte er sich unvermittelt an mich.
»Bis Dienstag hab ich jetzt gebucht«, sagte ich, »bis die Kärwa rum ist.«
»Dann könner S’ ja mit uns ah di Sau eigrohm.«
»Sau eingraben?« Ich wusste nicht, was er meinte.
Da grinste er nur verschmitzt. »Des wern S’ dann scho sehn.« Und das sollte ich auch.
Inzwischen war es draußen lauter geworden, die Männer mit dem Baum kamen aus dem Wald zurück. Es war ein bestimmt zwanzig Meter langer, gerade gewachsener und bis auf die Spitze entasteter Nadelbaum. Das ganze Dorf schien auf den Beinen zu sein.
Die restlichen Kärwatage sind schnell erzählt. Der Baum wurde unter großem Hallo aufgestellt, die Musikkapelle spielte, die Kärwasburschen bewachten in der ersten Nacht den Baum, damit er von den Burschen der Nachbargemeinde nicht abgeschält würde – was eine Schmach fürs ganze Dorf gewesen wäre. Der Bauer Malter, aus dessen Wald der Baum stammte, erzählte mir, genau das sei vor Jahren einmal passiert, da hätten es die Kärwasburschen mit dem Trinken übertrieben und seien in der Nacht eingeschlafen. Schon sei der Baum bis auf Mannshöhe abgeschält gewesen. Er aber sei dann noch »gleich in der Früh, bevor’s alle gsehng ham«, hinaus in den Wald gefahren, habe einen anderen Baum entrindet und die Rinde am Kärwasbaum angebracht. »Alle Welt hätt doch es ganze Joahr über uns glacht, wenn do so a naggerder Baum mittn im Dorf gschdandn wär.« Seitdem sei nachts zur Baumwache immer wenigstens ein Erwachsener da, der über die Kärwasburschen wache. Damit die nicht gar zu viel tränken und noch halbwegs zurechnungsfähig blieben. Trotzdem sahen die Kärwasburschen am nächsten Tag reichlich verorgelt aus, und nach nur sehr wenig Schlaf zogen sie mit drei Musikanten durchs Dorf und tanzten ihre Madli raus.
Der Sonntag ließ sich dann schon etwas gemütlicher an, alle schienen inzwischen reichlich mitgenommen, man aß gut nach einem gemütlichen Frühschoppen, überwiegend Braten und Klöße, und saß danach bei Musik und Tanz unter den großen Bäumen zur einen oder anderen Maß Bier. Erst im Lauf des späteren Nachmittags zog die Stimmung, dem Alkohol und der Musik geschuldet, wieder an.
So endete der Sonntag. Während all der Tage war mir immer wieder der Mann an der Schiffschaukel aufgefallen. »Schiffschaukelbremser« wurde er von den Einheimischen etwas abfällig gerufen. Er war ein noch relativ junger Mann, zahnlückig und etwas heruntergekommen, der sichtbar lustlos seinem Geschäft nachging, immer etwas zu viel getrunken zu haben schien und selbst zu den Kindern nicht freundlich war. Einmal bremste er eine der Schiffschaukeln mit seinem Holzkeil derart ruckartig ab, dass das Kind darinnen, es war die Petra, die Enkelin vom Zeilmann, den Halt verlor, nach vorn geschleudert wurde und sich zwei Schneidezähne ausschlug. Gott sei Dank waren es nur die Milchzähne, wie ich, der als Arzt sofort hinzugezogen wurde, feststellte. Trotzdem gab es beinahe eine Schlägerei, denn der Zeilmann war sofort zur Stelle und hatte den Schausteller schon am Kragen. Dann aber griffen ein paar der anderen ein und trennten die beiden, die Lage beruhigte sich wieder. Der Zeilmann aber warf ab da immer wieder wild funkelnde Blicke hinüber zur Schiffschaukel.
Am Montagabend dann, nach einem letzten »s’is Feierahmd«, wurden draußen im Hof die Lichter gelöscht und man ging teilweise heim, teilweise in die Wirtsstube zum »Sau eigrohm«, einem Brauch, wie ich ihn bisher noch nie gesehen hatte. Die Männer im Wirtshaus suchten den aus, von dem man meinte, er habe während der letzten Tage am meisten getrunken. Der musste die »Kärwasau« machen. Die Wahl fiel unter dem Gejohle der Mannsbilder auf den Kerl von der Schiffschaukel, der allein im Eck saß. Er konnte kaum mehr geradeaus schauen, schwankte mit dem Oberkörper und drohte jeden Moment vornüberzukippen. Er war – ich konnte mir diesen Blick nicht verkneifen, er gehörte über Jahrzehnte zu meinem Berufsalltag – in seinem Alkoholismus schon sehr weit fortgeschritten, spindeldürr und längst in der Phase des Austrocknens, der mit Alkohol natürlich nicht entgegenzuwirken war. Aber sein Durst schien hemmungslos. Man servierte ihm noch einen Schnaps, er leerte sein halb volles Bierglas, dann begleitete man ihn hinaus, und er nahm in einer Schubkarre Platz, die schon bereitstand. Dem Schausteller schien das alles zu gefallen, er machte das Spiel offensichtlich freudig mit, vielleicht fühlte er sich auch nur endlich einmal akzeptiert. Der Weisel malte ihm das Gesicht weiß an, der Meindl warf ihm eine schwarze Decke über, und dann zog man mit der Schubkarre zum zweiten Wirtshaus von Oberspring, das eigentlich schon seit Jahren geschlossen war und nur zu diesem Zweck wieder öffnete. Der dicke Zeilmann hatte einen weiten Mantel angezogen, einen Eimer Wasser mit einer Klobürste dabei und mimte den Pfarrer der Beerdigung, indem er immer wieder Wasser verspritzte. So erreichte der Trupp den Blauen Hund, wie das Wirtshaus hieß. Hier gab es noch mal Schnaps und Bier, auch für den Schaukelbremser, und man sang echte Sauflieder. Ich schrieb schon wieder und sammelte.
»O du edler Gerstensaft,
wie stärkst du meine Glieder,
gestern hast mi in Grohm neigschmissn,
heut probierst’s scho wieder.«
Irgendwann schließlich, es ging schon auf halb zwei zu, stand die Wirtin mit ihren – wahrscheinlich aufgrund einer Herzinsuffizienz – dick angeschwollenen Beinen im Raum, stemmte die Arme in die Seite und wetterte: »Schluss jetzt, die Sau is eigrohm. Ham geht’s!« Und, oh Wunder, die Männer machten sich fast ohne Widerspruch auf den Weg nach Hause. Der Zeilmann und der Malter mussten den Schaukelbremser inzwischen beinahe tragen, weil dieser kaum mehr gehen konnte. Der Zeilmann hatte noch eine Flasche Himbeer mitgenommen, setzte sie dem Bremser hin und wieder an den Mund und schien seinen Spaß daran zu haben. Oder war es versteckte Bosheit und Rache für die Zähne seiner Enkelin? Wir waren wohl auf halbem Weg zurück, da tönte der Bauer Eh noch einen letzten Vers in die Nacht:
»Wenn die Bauern dreschen,
dann hockt die Bäueri unterm Tisch
und dut ihr Bumbl messen,
wie tief und brad si is.«
Da ging drüben ein Fenster auf, und eine Frau schalt hinaus: »Hans, schau edds, dass d’ endli hamkummst, sonst kannst was erlehm, Himmlherrgottkreuzdunnerwetter. Was solln denn die Leut denkn!« Da wurde der Hans Eh schlagartig still und schlich sich nach Hause. Der Zeilmann und der Malter brachten den Bremser noch in seinen Wohnwagen – und kamen ohne die Flasche Himbeer wieder heraus.
»Ihr habt doch jetzt dem die Flasche nicht noch reingestellt?«, fragte ich ungläubig, aber der Zeilmann lachte bloß. »No wenner nachts an Doschd grichd?«
Dann endlich war Nachtruhe.
Und jetzt standen der Meindl und der Regenfuß aufgelöst an meinem Frühstückstisch. »Herr Dokter, Herr Dokter, schnell, kummer S’ schnell, der Bremser, der Bremser, Himmlherrgott scheiße, ich glab, der is hie.«
Ich ließ alles stehen und liegen und eilte mit den beiden hinaus. Vor dem Wohnwagen hatte sich schon eine kleine Menschenmenge angesammelt.
Der Schiffschaukelbremser war tot. Er lag inmitten von Erbrochenem, vielleicht war er daran erstickt. Sehr wahrscheinlich sogar, wie mir ein Blick in seinen Rachenraum zeigte. Also Aspiration. Außerdem zeigte er Anzeichen von Zyanose, der typischen Blaufärbung der Haut durch Sauerstoffmangel. Und das Risiko einer Aspiration ist erhöht, wenn das Bewusstsein durch Rauschzustände gestört ist. Anzeichen für Fremdeinwirkung waren keine zu erkennen, der Körper war längst erstarrt, also mindestens zwei Stunden tot. Der Vollständigkeit halber untersuchte ich die Hände, den Hals, den Kopf. Nichts, keinerlei Hinweise auf einen Kampf, eine Strangulation oder ähnliches. Das Innere des Wohnwagens war ziemlich verwahrlost. Ein Saustall. Hinweise auf Drogenmissbrauch? In Griffweite: Die Flasche Himbeergeist lag geöffnet und fast leer am Boden. Ich hatte genug gesehen, eigentlich hatte ich meinen Befund schon. Aber hatte der Bremser in seinem Zustand tatsächlich gestern Nacht noch getrunken? Warum nur hatte es der Zeilmann nicht lassen können, ihm noch die Flasche zu hinterlassen? Oder ... – ein heimlicher Verdacht keimte in mir auf: Hatte er sie ihm gestern Abend im Wohnwagen womöglich doch noch einmal an den Hals gesetzt, aus genüsslicher Rache für die Zähne seiner kleinen Petra? Damit die Kärwasau am nächsten Tag mit einem Schädel erwachte, die sie so schnell nicht mehr vergessen würde? Könnte durchaus sein ... aber das ließ sich nicht mehr feststellen, ich fragte auch nicht nach. Die Antwort wäre ohnehin »Nein« gewesen und das Klima hinterher vergiftet. Der Mann war, das stand fest, so oder so an den Folgen seines übermäßigen Alkoholkonsums gestorben. Also stellte ich qua ärztlicher Verpflichtung den Tod fest, auch die vermutliche Todesursache, und der hinzugezogene zuständige Arzt pflichtete mir später nach Inaugenscheinnahme bei. Die zwei Polizisten, die gerufen worden waren, schüttelten nur den Kopf. »Desmol habders ja mol richtich eigrohm, euer Kärwasau«, sagte der eine nur kopfschüttelnd. »Dass ihr ah immer sovill saufm müsst.«
Danach saßen wir, ein paar der Männer und ich, noch eine Zeit lang im Grauen Wolf, schweigend und betreten. Und während draußen der Schiffschaukelbremser von den Bestattern abgeholt wurde, sang der Meindl leise:
»Doh holnsnern edds, doh fährder edds,
randvoll worer, der Simpl,
todgsuffm hadder si am End,
edds isser voll im Himml.«
Kein »Djiiijuhuuu!« folgte auf das Gstanzl, das er gerade gedichtet hatte, auch kein sehr leises. Die Männer tranken schweigend, und irgendwann sang auch der alte Gemeindeschreiber Egersdörfer noch eins.
»Der Dood, der Dood, der kummd einfach,
der sochd si dir ned oh,
sonsd könnsdnern ja dervohlaafm,
und er stennerd bleed doh.«
Ob der Zeilmann seit dieser Nacht gut schlafen kann? Ich weiß es nicht. Die Kärwasau auf jeden Fall wird seither in Oberspring nicht mehr »eigrohm«, der schöne Brauch ist tot.
Die Kärwalieder stammen teilweise aus eigener Sammlung, teilweise von www.kaerwalieder.de
Ahmoll bringinern nu umm
»Ich bring ihn noch um. Eines Tages bring ich ihn noch um!«
Man muss sich das gesprochene Wort in dieser Geschichte in breitem, ja breitestem, so gemütlich klingendem – aber nur so klingendem! – Fränkisch vorstellen. Wie dickflüssiges Starkbier, etwa ein undurchsichtiger dunkler Urbock. Nur so entspricht es dem Tempo und der Wirklichkeit. Also ungefähr so:
»Ihch bringnern umm. Ahmoll bringinern nu umm!«
Nur noch langsamer.
Aber so kann man nicht schreiben – beziehungsweise: Klar, als Autor könnte ich natürlich so schreiben, aber kein Mensch könnte oder wollte das dann lesen, denn er bräuchte dafür zu lange und es passte nicht in sein Zeitbudget. Oder es strengte ihn zu sehr an, er müsste sich zu sehr konzentrieren – und dann legte er die Geschichte weg. Auch wenn er es vielleicht bereuen würde, aber das weiß er ja zu Anfang nicht. Deswegen geht es jetzt hier schön gesittet auf Hochdeutsch weiter und zu, aber damit leider auch viel zu schnell. Auf Fränkisch ginge in der Geschichte alles seeehhr viiiel langsamer. Laangsaaamer.
Sei’s drum.
Mörtel genoss schon seit hundert Jahren bei der Mari in der Wirtsstube hinten im Eck im schönen Halbdunkel seinen Ruhestand vor sich hin, dienstags bis sonntags, weil montags war Ruhetag, da wurde geschlachtet und die Herrschaft hatte für Gäste keine Zeit, sie musste wursten und Fleisch klein schneiden für Schnitzel für die Woche und so. An allen anderen Tagen aber saß Mörtel dort und genoss mit einer an ein Naturgesetz mahnenden Regelmäßig- und Verlässlichkeit von früh um zehn bis abends um fünf, manchmal auch sechs Uhr nahezu bewegungslos seine sechs, sieben Seidla; das ist jetzt kein Dialekt, sondern die heißen so und wären mit »Seidel« nicht richtig übersetzt. Denn »Seidla«, das sind die alten, dünnwandigen, hohen und henkellosen Einhalbliter-Biergläser, und ein Seidla ist immer das Glas mit Bier, während ein Seidel nur eine Maßeinheit und damit nichts wert ist. Und am Abend ging er wieder schräg über die Straße hinüber in das alte, etwas heruntergekommene Haus in sein Zimmer, um dort erst die Wand und später die Zimmerdecke mit ihren schwarzen Spinnfäden anzusehen, bis die Erinnerungen gingen und der Schlaf kam. Und die Erinnerungen kamen immer öfter, und das war nicht gut. Es waren keine guten Erinnerungen. Der Mörtel saß also so vor sich hin und schwieg, und in seinen Kopf, da konnte man nicht hineinsehen. Kein Mensch außer dem Mörtel wusste, was sich da tat.
Im Grunde war dies das Leben, das er selbst gewählt hatte. Und auch wenn er zutiefst überzeugt war, dass man keine Wahl hat, war er, unlogisch genug, trotzdem davon überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben. Denn mit sechs, sieben Seidla am Tag wurde die Welt doch halbwegs schön und erträglich …
… solange diese kleine wichtigtuerische, nervige Stinkwanze mit ihrer grün gefärbten Haartolle nicht hier hereinkam und sich auch noch an seinen Tisch setzte …
In diesem Moment aber ging die Tür auf, knarzte, und? Die kleine wichtigtuerische, nervige Stinkwanze mit ihrer grün gefärbten Haartolle kam herein. Also wieder so ein versauter Tag – was umso schlimmer war, als sich die Anzahl seiner Tage nach hinten raus ohnehin immer weiter verringerte. Wahrscheinlich gestaltete sich die für ihn noch zu erwartende Restzahl auch schon recht übersichtlich, aber das konnte keiner wissen. Und das gehörte auch mit zum Spiel: dass man erstens nicht wusste, wie lange das noch so gehen würde, und dass man zweitens nicht wusste, was dann danach kam und wer. Also wen man dann vielleicht alles wiedersehen oder wiedertreffen würde. Das machte ihm schon manchmal Angst. So trank er hier unten auf der Erde, wo er sich halbwegs auskannte, seine Seidla, wusste bei keinem, ob es nun schon das letzte war, und auch nicht, ob er sich derer noch in größerer Zahl würde erfreuen können. Beim alten Wischer war das genauso gewesen damals. Jetzt aber kam erst einmal diese Grünlocke mit den hochstehenden Haaren herein und wollte ihm bestimmt wieder etwas vom Leben erzählen. Ihm! Der hatte noch nichts erlebt, als dass man ihm den Arsch abgewischt und das Essen hingestellt hatte, der wohnte doch noch bei seiner Mutter, der arbeitete ja nicht einmal etwas. Kein Wunder, bei diesem Aussehen. So wollte den doch keiner haben. Aber tönte hier groß herum vom Leben, wollte ihm etwas erzählen, der Grünschnabel. Seit Wochen schon kam dieses nervige Stück Spätpubertät hier herein, setzte sich zu ihm – an seinen Tisch! –, fragte nicht einmal, sondern tat das, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, schüttete sich innerhalb kürzester Zeit zwei, drei Bier in das Loch unter der Nase, war dann besoffen und dachte, klugscheißen zu müssen. Auf großen Mann zu machen. Und machte dazu auch noch immer an diesem kleinen Ding herum, mit dem die heute alle telefonierten, Musik hörten, fotografierten und was weiß Gott noch alles. Mörtel verstand das ja alles nicht, aber er brauchte es auch nicht zu verstehen, er hatte es beinahe fünfundsiebzig Jahre lang nicht gebraucht und würde es bis an sein Lebensende auch nicht mehr benötigen. Internet – er wusste gar nicht, was das war. Aber Erinnerungen – das wusste er, was das war. Und auch, dass die, obwohl sie schon längst vergessen gewesen waren und gut aufgeräumt schienen, so plötzlich wieder hervorkamen und einen quälten. Tagsüber ging das ja meistens, da hatte er das Bier und die Stube und die Mari. Aber nachts kamen die Erinnerungen wie die bösen Geister. Dann konnte er die nur ertragen, denn fliehen konnte er ja vor ihnen nicht. Sie würden ihn doch immer wieder einholen.
Zwei Tage war der jetzt nicht mehr da gewesen, und der alte Mörtel hatte schon gehofft, es werde wieder so wie früher und er könne in Ruhe vor sich hin sitzen und seine Seidla trinken, schön eins nach dem anderen, und hoffen, dass abends die Bilder nicht kamen, da ging die Türe auf und herein kam? Genau: die grün gefärbte Haartolle mit der Dummheit im Gesicht.