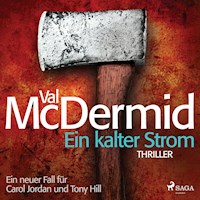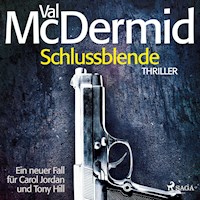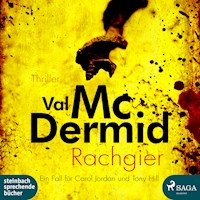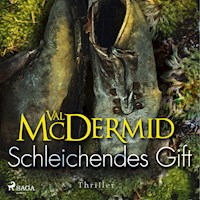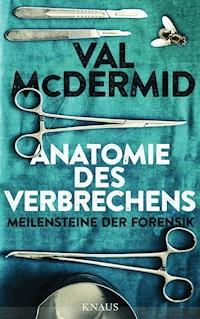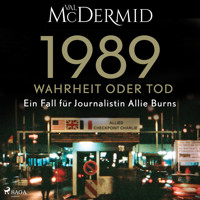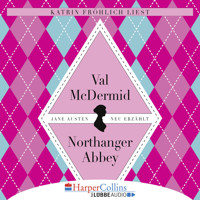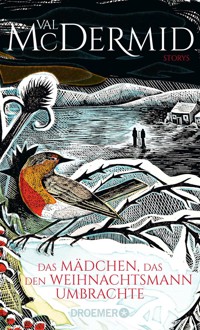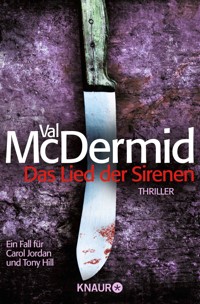
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carol Jordan und Tony Hill
- Sprache: Deutsch
"Das Lied der Sirenen" von Bestseller-Autorin Val McDermid ist ein eiskalter Thriller, der tiefen Einblick in die seelischen Abgründe eines Serienkillers gewährt – raffiniert geplottet, psychologisch ausgefeilt und gnadenlos gut. Der erste Teil der erfolgreichen Thriller-Serie um das Ermittlerduo Carol Jordan und Tony Hill beginnt mit dem Fund von vier männlichen Leichen in Yorkshire. Diese Entdeckung ist selbst für das hartgesottene Team der Mord-Kommission ein Schock: Offenbar wurden die Opfer vor ihrer Ermordung mit mittelalterlichen Folter-Instrumenten gequält und verstümmelt. Obwohl alles nach der Tat eines Serienkillers aussieht, besteht der Superintendent darauf, dass die Morde getrennt voneinander untersucht werden. Detective Chief Inspector Carol Jordan und der um Unterstützung gebetene Psychologe und Profiler Tony Hill arbeiten dennoch an einem Täterprofil des möglichen Serienkillers. Sie stellen fest, dass die Morde immer einem bestimmten Muster folgen. Und sie decken auf, dass die Opfer des Serienkillers gar nicht, wie vorerst angenommen, homosexuell waren. Die Zeit wird immer knapper, denn schon taucht eine weitere Leiche auf: Wieder verstümmelt und wieder gefoltert, doch dieses Mal ist es einer von ihnen, ein Polizist. Wird es Carol und Tony gelingen, den grausamen Serienkiller zu stoppen? Mit einer Sache haben beide nicht gerechnet: selbst das nächste Opfer zu werden. Das neue Ermittlerduo hebt sich erfrischend von den Standardtypen des überfütterten Thrillergenre ab. Lovelybooks.de Ein herausragender Psychothriller. Cosmopolitan Die aufgebaute Spannung ist ungeheuerlich. Krimi-Couch.de Die Thriller-Serie von Val McDermid, der Crime-Queen des Thriller-Genres, ist in folgender Reihenfolge erschienen: Bd. 1: Das Lied der Sirenen Bd. 2: Schlussblende Bd. 3: Ein kalter Strom Bd. 4: Tödliche Worte Bd. 5: Schleichendes Gift Bd. 6: Vatermord Bd. 7: Vergeltung Bd. 8: Eiszeit Bd. 9: Schwarzes Netz Bd. 10: Rachgier Bd. 11: Der Knochengarten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Val McDermid
Das Lied der Sirenen
Thriller
Aus dem Englischen von Manes H. Grünwald
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vier Männer werden tot aufgefunden. Offenbar wurden sie vor ihrer Ermordung grausam gefoltert und verstümmelt. Der Psychologe Tony Hill wird von der Polizei um Hilfe bei der Lösung des Falles gebeten. Und sieht sich plötzlich einer Situation gegenüber, mit der er nicht gerechnet hat: Er könnte das nächste Opfer sein!
»Fesselnd und schockierend!«Minette Walters
»Ein herausragender Psychothriller.«Cosmopolitan
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Vorbemerkung
Disketten-Backup
1. Kapitel
Disketten-Backup
2. Kapitel
Disketten-Backup
3. Kapitel
Disketten-Backup
4. Kapitel
Disketten-Backup
5. Kapitel
Disketten-Backup
6. Kapitel
Disketten-Backup
7. Kapitel
Disketten-Backup
8. Kapitel
Disketten-Backup
9. Kapitel
Disketten-Backup
10. Kapitel
Disketten-Backup
11. Kapitel
Disketten-Backup
12. Kapitel
Disketten-Backup
13. Kapitel
Disketten-Backup
14. Kapitel
Disketten-Backup
15. Kapitel
Disketten-Backup
16. Kapitel
Disketten-Backup
17. Kapitel
Disketten-Backup
18. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Tookie Flystock, meinen geliebten Serien-Insektenkiller
Ich habe die Meerjungfrauen singen hören.
Sie sangen einander vor.
Ich glaube nicht, daß sie je einmal für michsingen werden.
T. S. Eliot, J. Alfred Prufrocks Liebesgesang
Die Seele der Folter ist männlich.
Anmerkung auf der Eintrittskarte für das Museum für Kriminologie und Folter in San Gimignano, Italien
Alle den Kapiteln vorangestellten Epigraphe sind dem Buch Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet von Thomas De Quincey (erschienen 1827) entnommen.
3 ½-Zoll-Diskette, Backup.007; Love001.doc
Man erinnert sich stets an das erste Mal. Sagt man das nicht vom Sex? Wieviel eher aber trifft es auf Mord zu. Ich werde keinen einzigen köstlichen Augenblick dieses neuen, exotischen Dramas vergessen. Obwohl ich inzwischen vor dem Hintergrund langer Erfahrung und später Einsicht sagen muß, daß es eine doch recht amateurhafte Vorstellung war – es vermag mich immer noch erschauern zu lassen, auch wenn es mir nicht mehr das Gefühl der Befriedigung verschafft.
Obgleich es mir vor der aufgezwungenen Entscheidung zum Handeln nicht bewußt war, ich hatte den Weg zum Mord weit im voraus geebnet. Stellen Sie sich einen Augusttag in der Toskana vor. Ein komfortabler Reisebus mit Klimaanlage brachte uns im Eiltempo von Stadt zu Stadt, eine Reisegruppe von Kulturbeflissenen aus dem Norden Englands, die begierig darauf waren, jeden Augenblick der Zweiwochentour mit erinnerungswürdigen Besichtigungen auszufüllen, die man Castle Howard und Chatsworth entgegenstellen konnte.
Ich hatte Florenz genossen, seine Kirchen und Museen voller sich auf seltsame Weise widersprechender Gemälde von Martyrien und Madonnen. Ich war in die schwindelerregende Höhe von Brunelleschis Kuppel gestiegen, welche den monumentalen Dom überragt, beginnend bei der Wendeltreppe, die von der Galerie zum kleinen Kuppeldach hinaufführt und deren abgetretene Steinstufen zwischen der Decke des Doms und dem Dach selbst eingezwängt sind. Ich hatte das Gefühl, in meinem Computer zu stecken, nur eine Rolle in einem Fantasy-Stück zu spielen, während ich mich durch das Labyrinth zum Tageslicht hocharbeitete. Es fehlte bloß noch, daß unterwegs irgendwelche Ungeheuer auftauchten und zum Erreichen des Ziels erschlagen werden mußten. Und dann, beim Eintauchen ins helle Tageslicht, die Verwunderung, daß hier oben, am Ende dieses klaustrophobischen Aufstiegs, ein Postkarten- und Souvernirverkäufer stand, ein kleiner, dunkler, lächelnder Mann, gebeugt vom jahrelangen Hochschleppen seiner Ware. Wenn es tatsächlich nur ein Spiel gewesen wäre, hätte ich bestimmt irgendeinen Zauber bei ihm kaufen können. Wie es aber nun einmal in der Realität um die Dinge bestellt war, kaufte ich mehr Postkarten bei ihm, als ich Leute kannte, denen ich sie hätte schicken können.
Nach Florenz kam San Gimignano. Die Stadt ragte hoch aus der grünen toskanischen Ebene auf, und ihre zerfallenden Türme reckten sich in den Himmel wie Krallenfinger aus einem Grab. Der Fremdenführer plapperte etwas von einem »mittelalterlichen Manhattan« – ein weiterer krasser Vergleich zu all den anderen, mit denen er uns seit Calais gefüttert hatte.
Als wir der Stadt näher kamen, steigerte sich meine Aufregung. Überall in Florenz war ich auf Werbeplakate für die einzige Touristenattraktion gestoßen, die ich wirklich zu sehen wünschte. Die in prächtigem tiefem Rot und Gold gehaltenen Plakate glänzten mir verheißungsvoll von den Laternenpfählen entgegen, und sie forderten mich mit Nachdruck auf, das Museo Criminologico di San Gimignano zu besuchen. Ich zog meinen Reiseführer zu Rate und fand bestätigt, was ich vermutet hatte – ein Museum für Kriminologie und Folter. Natürlich befand es sich nicht auf unserem kulturellen Reiseplan.
Ich brauchte nicht nach meinem Ziel suchen; wir waren kaum ein paar Meter durch das massive Steintor in der mittelalterlichen Stadtmauer gegangen, als mir auch schon ein Faltblatt über das Museum, komplett mit Stadtplan, aufgedrängt wurde. Ich kostete meine Vorfreude aus, wanderte einige Zeit durch die Gassen und bewunderte die Baudenkmäler bis hin zu den Türmen, die dem Stadtbild eine gewisse Disharmonie verliehen. Jede mächtige Familie hier hatte ihren eigenen befestigten Turm gehabt, und sie hatte ihn mit allen Mitteln, von flüssigem Blei bis zu Kanonen, gegen die Nachbarn verteidigt. In seiner Blütezeit hat San Gimignano angeblich einige hundert Türme gehabt. Verglichen mit den Zuständen im mittelalterlichen San Gimignano geht es heutzutage in Hafenvierteln am Samstag nach Arbeitsschluß zu wie in einem Kindergarten, und die rauflustigen Seeleute sind nichts als chaotische Dilettanten.
Als ich dem Drang, endlich ins Museum zu kommen, nicht mehr widerstehen konnte, überquerte ich die Piazza im Stadtzentrum, warf eine zweifarbige 200-Lire-Münze in das Becken des Springbrunnens, um mir Glück in der Zukunft zu sichern, und ging dann ein kurzes Stück in eine Seitenstraße, wo die mir inzwischen bekannten rot-goldenen Plakate in großer Zahl die alten Hauswände zierten. Aufregung summte in meinem Inneren wie ein blutgieriger Moskito, als ich das kühle Foyer des Museums betrat und mir, äußerlich gelassen, die Eintrittskarte und den auf Hochglanzpapier gedruckten, reich illustrierten Museumsführer kaufte.
Wie soll ich dieses Erlebnis schildern? Die physische Realität war überwältigend, weitaus beeindruckender, als ich durch Fotos oder Videos oder Bücher darauf vorbereitet war. Das erste Ausstellungsstück war eine Streckbank, und das Hinweisschild beschrieb ihre Funktion auf italienisch und englisch in liebenswertem Detail. Schultern ruckten aus ihren Gelenkpfannen, Hüft- und Kniegelenke zerplatzten zum Geräusch zerfetzender Sehnen und Bänder, Wirbelsäulen dehnten sich aus ihrer Verankerung, bis die einzelnen Wirbel wie Perlen von einer defekten Schnur auseinanderrissen. »Die Opfer«, verkündete das Hinweisschild lakonisch, »waren nach der Behandlung auf der Streckbank meist zwischen fünfzehn und dreiundzwanzig Zentimeter länger als vorher.« Wie außergewöhnlich phantasievoll diese Inquisitoren doch waren. Es genügte ihnen nicht, ihre Ketzer peinlich zu befragen, solange sie noch lebten und qualvoll litten, nein, sie mußten auch noch in den verstümmelten Leichen nach weiteren Antworten suchen.
Die Ausstellung war ein Denkmal für die Genialität des Menschen. Man mußte diese Geister bewundern, die den menschlichen Körper so gründlich studiert hatten, daß sie sich solch auserlesene und feinstens abgestimmte Leidensprozesse ausdenken konnten. Trotz ihrer noch verhältnismäßig gering entwickelten Technologie waren diese mittelalterlichen Gehirne in der Lage, derart raffinierte Folterungssysteme zu ersinnen, daß sie heute noch angewendet werden. Es scheint, daß die einzige Verbesserung, die unsere moderne postindustrielle Gesellschaft hervorgebracht hat, in der zusätzlichen Anwendung der Elektrizität besteht.
Ich ging durch die Räume, genoß jedes einzelne Ausstellungsstück, von den dicken Eisenstacheln der Eisernen Jungfrau bis zum subtileren und äußerst eleganten Mechanismus der Lochbirnen, diesen schmalen, aus Einzelsegmenten zusammengesetzten eiförmigen Gebilden, die in die Vagina oder den Anus eingeführt werden. Wenn dann eine Sperrklinke gelöst und das Gerät gedreht wurde, glitten die einzelnen Segmente auseinander und spreizten sich nach außen, bis die Birne eine Metamorphose durchgemacht und sich in eine exotische Blume verwandelt hatte, deren Blütenblätter an den Rändern rasiermesserscharfe Metallzähne aufwiesen. Dann zog man das Gerät heraus. Manchmal überlebten die Opfer, was wahrscheinlich das grausamere Schicksal war.
Ich bemerkte das Unbehagen und das Entsetzen auf den Gesichtern und in den Stimmen einiger anderer Besucher, aber ich erkannte es sofort als Heuchelei. Insgeheim genossen sie jede Minute hier, aber die bürgerliche Ehrbarkeit verbot ihnen jegliches Eingeständnis ihrer inneren Erregung. Nur die Kinder waren ehrlich in ihrer begeisterten Faszination. Ich hätte liebend gern gewettet, daß ich keinesfalls die einzige Person in diesen kühlen pastellfarbenen Räumen war, die das Aufwallen sexueller Erregung zwischen den Beinen verspürte, während wir die Ausstellungsstücke gierig in uns aufnahmen. Ich habe mich oft gefragt, wie viele Sexakte während des Urlaubs durch die heimliche Erinnerung an das Foltermuseum gewürzt wurden.
Draußen im sonnendurchfluteten Innenhof kauerte ein Skelett in einem Käfig, die Knochen so sauber, als wären sie von Geiern abgenagt worden. In den Tagen, als die Türme noch herrisch San Gimignano überragten, waren Käfige mit solchem Inhalt an die Außenseite der Stadtmauer gehängt worden als Botschaft an die Einwohner wie an Fremde gleichermaßen, daß dies eine Stadt war, in der das Gesetz harte Strafen für diejenigen vorsah, die es nicht beachteten. Ich spürte eine seltsame Verwandtschaft mit diesen Bürgern. Auch ich respektiere die Notwendigkeit der Bestrafung nach einem Treuebruch.
In der Nähe des Skeletts lehnte ein großes, eisenbeschlagenes Speichenrad an der Mauer. Es wäre eher in einem landwirtschaftlichen Museum am richtigen Platz gewesen. Aber das Schild an der Wand dahinter wies auf eine phantasievollere Verwendung hin. Verbrecher wurden auf das Rad gebunden. Als erstes wurden sie gegeißelt, und zwar mit Peitschen, versehen mit Dornen, die ihnen das Fleisch von den Knochen rissen und für die geifernde Menge ihre inneren Organe und Eingeweide bloßlegten. Dann wurden ihnen auf dem Rad mit Eisenstangen die Knochen gebrochen. Ich dachte unwillkürlich an die Tarot-Karte Das Schicksalsrad.
Als mir später klar wurde, daß ich zum Morden gezwungen sein würde, stieg die Erinnerung an das Foltermuseum wie eine Muse vor meinem geistigen Auge auf. Ich bin immer geschickt mit meinen Händen gewesen.
Nach dem ersten Mal hoffte ein Teil meines Bewußtseins, daß ich nicht gezwungen würde, es noch einmal zu tun. Aber ich wußte auch, wenn es wieder sein mußte, dann würde ich es besser machen. Wir lernen ja aus unseren Fehlern, aus den Unzulänglichkeiten unserer Handlungen. Und gottlob führt zunehmende Praxis letztendlich zur Perfektion.
1
Gentlemen, mir ist die Ehre zuteil worden, von unserem Komitee mit der anspruchsvollen Aufgabe betraut worden zu sein, den Williams-Vortrag über das Thema »Der Mord als eine der schönen Künste« zu halten – eine Aufgabe, die abzuhandeln vor drei oder vier Jahrhunderten ein leichtes gewesen wäre, als diese Kunst noch wenig verstanden zu werden pflegte und nur vereinzelte vorbildhafte Fälle zutage getreten waren. Aber in unserer Zeit, in der von genialen Könnern exzellente Meisterwerke ausgeführt sind, muß es für alle Welt augenscheinlich sein, daß, entsprechend der Kritik, mit der sie vom Volke belegt worden werden, die Polizei danach zu trachten gezwungen ist, ihre Methoden dieser Meisterschaft anzupassen.
Tony Hill legte die Hände hinter den Kopf und starrte an die Decke. Ein feines Netz von Rissen zog sich durch die kunstvolle Gipsrose, die sich um die Lampenbuchse rankte, aber er hatte keinen Blick dafür. Das dünne Licht der Morgendämmerung, vermischt mit dem Orange der Straßenlampen, drang durch einen dreieckigen Spalt am oberen Rand der Vorhänge, aber auch das interessierte ihn nicht. Unterbewußt registrierte er das Anspringen der Zentralheizung, die sich daranmachte, der feuchten Winterkälte die Schärfe zu nehmen, welche durch die Ritzen in der Tür und den Fensterrahmen hereinsickerte. Seine Nase war kalt, die Augen verklebt. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er zum letztenmal eine ganze Nacht durchgeschlafen hatte. Seine Sorgen über das, was am heutigen Tag auf ihn zukam, waren zum Teil schuld daran, daß seine Träume immer wieder unterbrochen worden waren, aber da war mehr als das. Viel mehr.
Als ob es heute nicht schon genug gäbe, über das er sich Sorgen machen müßte. Er wußte, was man von ihm erwartete, aber es auch fertigzubringen, das war eine ganze andere Sache. Es gab Menschen, die standen diese Dinge mit nicht mehr als einem leichten Flattern im Magen durch, doch nicht so Tony. Er würde alle seine Kräfte mobilisieren müssen, um die Fassade aufrechterhalten zu können, die erforderlich war, den Tag zu überstehen. Unter dem Eindruck der Umstände, die ihn derzeit in ihrem Bann hielten, hatte er ein ganz neues Verständnis dafür, wie viel für Schauspieler, die immer wieder im selben Stück auftreten, dazu gehört, das Publikum durch konzentriertes, schwungvolles Spiel zu fesseln. Heute abend würde er zu nichts mehr zu gebrauchen sein als zu einem weiteren vergeblichen Versuch, einmal acht Stunden durchzuschlafen.
Er veränderte seine Lage im Bett, zog eine Hand unter dem Kopf hervor und fuhr durch sein kurzes dunkles Haar. Dann strich er sich über die Bartstoppeln auf seinem Kinn und seufzte. Er wußte, was er heute am liebsten tun würde, war sich aber darüber im klaren, daß es beruflicher Selbstmord war, wenn er es tatsächlich machte. Sein Wissen, daß in Bradfield ein Serienmörder sein Unwesen trieb, war nicht von Bedeutung. Er konnte es sich nicht leisten, der erste zu sein, der das aussprach. Sein leerer Magen rebellierte, und er zuckte zusammen. Mit einem Seufzer schob er die Steppdecke zurück und stieg aus dem Bett.
Tony schleppte sich zum Bad und machte das Licht an. Während er pinkelte, schaltete er mit der freien Hand das Radio auf der Ablage ein. Der Ansager des Straßenverkehrsberichts der Station Bradfield Sound verkündete die üblichen Staus mit einer Fröhlichkeit, die keinem Autofahrer ohne eine gehörige Dosis Aufputschmittel zu entlocken gewesen wäre. Tony war froh, daß er sich heute morgen nicht in den Verkehr stürzen mußte, und wandte sich dem Waschbecken zu.
Er starrte im Spiegel in seine tiefliegenden blauen Augen, die noch verschlafen dreinblickten. Wer auch immer gesagt hat, die Augen seien der Spiegel der Seele, er hat echten Scheiß geredet, dachte er zynisch. Nun ja, vielleicht stimmte es doch, und er hatte nur keinen intakten Spiegel im Haus. Er machte den obersten Knopf seiner Schlafanzugjacke auf, öffnete die Tür des Spiegelschranks und wollte den Rasierschaum herausnehmen. Das Zittern seiner Hände ließ ihn abrupt innehalten. Wütend schlug er die Tür wieder zu, die mit einem lauten Knall ins Schloß fiel, und griff nach seinem elektrischen Rasierapparat. Er haßte diese Trockenrasur, die ihm nie das frische, saubere Gefühl der Naßrasur vermittelte. Doch es war immer noch besser, sich ein wenig schmuddlig zu fühlen, als zur Illustration für einen mißlungenen Selbstmordversuch durch tausend Schnitte zu dienen.
Ein weiterer Nachteil der elektrischen Rasur war die Tatsache, daß er sich nicht auf die Tätigkeit zu konzentrieren brauchte, und das gab seinem Geist die Möglichkeit, über den bevorstehenden Tag nachzudenken. Manchmal war es verführerisch, sich vorzustellen, alle anderen Menschen seien wie er selbst, würden morgens aufstehen und sich eine bestimmte Rolle für den Tag aussuchen. Aber er hatte im Lauf der jahrelangen Erforschung des Geistes anderer Menschen erkannt, daß das nicht so war. Für die meisten Leute war das, was sie wählen konnten, eng begrenzt. Einige von ihnen wären zweifellos dankbar für die Möglichkeiten, die das Wissen, das fachliche Können und die ihm auferlegten Zwänge Tony verschafft hatten. Er war keiner von ihnen.
Als er den Rasierapparat ausschaltete, erklangen im Radio die hektischen Musikfetzen, die jeder Nachrichtensendung bei Bradfield Sound vorausgingen. Mit dem Gefühl einer bösen Vorahnung wandte er das Gesicht dem Radio zu, wachsam und angespannt wie ein Mittelstreckenläufer in Erwartung des Startschusses. Am Ende der fünfminütigen Sendung seufzte er erleichtert auf und zog den Duschvorhang zur Seite. Er hatte eine Nachricht erwartet, die er auf keinen Fall hätte ignorieren können. Aber es war bei den drei Leichen geblieben.
Am anderen Ende der Stadt beugte sich John Brandon, Assistant Chief Constable (Kriminalabteilung) der Stadtpolizei von Bradfield über das Waschbecken in seinem Badezimmer und starrte griesgrämig in den Spiegel. Nicht einmal der Rasierschaum, der sein Gesicht wie der Bart eines Weihnachtsmanns umrahmte, konnte ihm ein gütig-wohlwollendes Aussehen verleihen. Wenn er sich nicht für den Polizeidienst entschlossen hätte, wäre er ein idealer Kandidat für den Beruf des Bestattungsunternehmers gewesen. Er war einsachtundachtzig groß, schlank an der Grenze zur Magerkeit, hatte tiefliegende dunkle Augen und – vorzeitig – stahlgraues Haar. Selbst wenn er lächelte, wich ein Ausdruck der Melancholie nicht von seinem langen Gesicht. Heute sehe ich aus wie ein Bluthund mit einer Kopfgrippe, dachte er. Es gab allerdings gute Gründe für sein Elend. Er war im Begriff, eine Vorgehensweise einzuschlagen, die bei seinem Chief Constable so populär sein würde wie ein christlicher Priester in einer Satanskult-Loge.
Brandon seufzte tief und bespritzte dabei den Spiegel mit Schaumflocken. Derek Armthwaite, sein Chief, hatte die brennenden blauen Augen eines Visionärs, aber was sie vor sich sahen, hatte nichts mit revolutionären Entwicklungen zu tun. Er war ein Mann, der das Alte Testament als angemesseneres Handbuch für Polizeibeamte betrachtete als das Polizeigesetz samt der Ermittlungsverordnung. Er hielt die meisten modernen Polizeimethoden nicht nur für untauglich, sondern sogar für ketzerisch. Nach Derek Armthwaites oft geäußerter Ansicht würde die Rückkehr zur Rute und zur neunschwänzigen Katze weitaus eher dazu beitragen können, die Kriminalitätsrate zu senken, als jede noch so große Zahl von Sozialarbeitern, Soziologen und Psychologen. Wenn er wüßte, was Brandon für diesen Morgen geplant hatte, würde er ihn umgehend zur Verkehrspolizei versetzen, was als modernes Äquivalent zum alttestamentarischen Verschlingen Jonas’ durch den Wal zu betrachten war.
Ehe es jedoch dazu kommen konnte, daß Brandons Depression seinen Vorsatz überlagerte, wurde er durch ein Klopfen an der Badezimmertür aus seinen Gedanken gerissen. »Dad?« rief seine ältere Tochter. »Brauchst du noch lange?«
Brandon schnappte sich hastig sein Rasiermesser, tunkte es ins Waschbecken und zog es über eine seiner Wangen, ehe er antwortete. »Noch fünf Minuten, Karen«, rief er. »Tut mir leid.« In einem Haus mit drei Teenagern und einem Badezimmer konnte man es sich nur selten leisten, grübelnd die Zeit zu vertrödeln.
Carol Jordan stellte die noch halbvolle Kaffeetasse auf den Rand des Waschbeckens und wollte in die Dusche steigen, stolperte aber über die schwarze Katze, die um ihre Knöchel strich. »Nur ein paar Minuten, Nelson«, murmelte sie als Antwort auf sein fragendes Miauen, als sie es dann doch geschafft hatte und die Gleittür der Dusche zuschob. »Und weck bloß Michael nicht auf.«
Carol hatte sich vorgestellt, daß die Beförderung zum Detective Inspector und die damit verbundene Entlassung aus dem Turnus des Schichtdienstes ihr zu den regelmäßigen acht Stunden Schlaf verhelfen würden, die seit dem Eintritt in den Polizeidienst ihre große Sehnsucht gewesen waren. Aber sie hatte das Pech gehabt, daß ihre Beförderung mit dem, was ihr Team inoffiziell die »Schwulenmorde« nannte, zusammenfiel. Wie oft Superintendent Tom Cross den Medien gegenüber und in den Büroräumen des Morddezernats auch prahlte, es gäbe keine forensisch nachweisbaren Verbindungen zwischen den Morden und keinerlei Anlaß zu der Vermutung, ein Serienkiller treibe sein Unwesen in Bradfield, die Teams der Mordkommission waren da anderer Meinung.
Als das warme Wasser über Carol strömte und ihr blondes Haar eine mausgraue Farbe annahm, dachte sie – und nicht zum erstenmal –, daß Cross’ Haltung, ebenso wie die des Chief Constable, eher seinen Vorurteilen entsprang, als daß sie für die Allgemeinheit dienlich war. Je länger er leugnete, daß da ein Serienmörder umging, der Männer tötete, die hinter einer ehrbaren Fassade ein heimliches Homosexuellenleben verbargen, um so mehr schwule Männer würden sterben. Wenn man sie nicht mehr von der Straße bekommen konnte, indem man sie einsperrte, dann sollte doch ein Mörder sie aus dem Verkehr ziehen. Es spielte im Grunde keine Rolle, ob ihm das durch Mord gelang oder dadurch, daß er sie von ihrem Tun abbrachte, indem er ihnen Angst einjagte.
Das war eine Taktik, welche alle Arbeit, die Carol und ihre Kollegen in die Untersuchung steckten, ad absurdum führte, ganz zu schweigen von den Hunderttausenden von Pfund, die diese Untersuchungen den Steuerzahler kosteten, vor allem, weil Cross darauf bestand, daß jeder Mord als ein völlig von den anderen getrennter Fall zu behandeln war. Jedesmal, wenn eines der drei Teams auf Details stieß, die die Fälle miteinander in Verbindung zu bringen schienen, wies Cross sie mit fünf Punkten, die seiner Meinung nach dagegen sprachen, zurück. Es spielte keine Rolle, daß die Gemeinsamkeiten jedesmal andere waren und Cross’ Gegenargumente stets aus denselben ermüdenden fünf Punkten bestanden. Cross war der Boß. Und sein Stellvertreter, der Deputy Chief Inspector, hatte den Entschluß gefaßt, dem Streit zu entgehen, indem er sich mit seinen für solche Fälle reservierten »Rückenbeschwerden« in Krankenurlaub abgemeldet hatte.
Carol schüttelte unter dem warmen Wasserstrahl die letzte Schläfrigkeit ab. Der von ihr eingeschlagene Kurs bei der Untersuchung würde am Felsen von Popeye Cross’ bigotter Voreingenommenheit nicht stranden. Selbst wenn einige der jüngeren Polizeibeamten dazu neigten, sich – als Ausrede für ihren mangelnden eigenen Einsatz bei den Untersuchungen – der einseitigen Ansicht des Bosses anzuschließen, sie, Carol Jordan, würde sich stets zu hundert Prozent engagieren, und zwar in die richtige Richtung. Sie hatte sich nun fast neun Jahre im Dienst die Hacken abgelaufen, zunächst mit dem Ziel, einen verantwortlichen Dienstgrad zu erreichen, und dann, um den erkämpften Sitz im Schnellzug der Beförderungen auch zu rechtfertigen. Sie hatte nicht die Absicht, ihre Karriere auf einen Prellbock auflaufen zu lassen, nur weil sie den Fehler begangen hatte, sich einer Abteilung von Neandertalern anzuschließen.
Carol hatte ihren Entschluß gefaßt, und sie stieg mit gestrafften Schultern und einem trotzigen Blick in den grünen Augen aus der Dusche. »Komm, Nelson«, sagte sie, schlüpfte in ihren Morgenmantel und nahm das Muskelbündel im schwarzen Fell auf den Arm. »Komm, Junge, jetzt kriegst du dein Frühstück aus schönem rotem Fleisch.«
Tony drehte sich um und schaute noch einmal für letzte fünf Sekunden auf das Folienbild auf der Leinwand hinter sich. Da die Mehrheit der Zuhörer das Desinteresse an seinem Vortrag dadurch zum Ausdruck gebracht hatte, daß man sich demonstrativ keine Notizen gemacht hatte, wollte er wenigstens dem Unterbewußtsein der Leute die bestmögliche Gelegenheit geben, das Flußdiagramm des Prozesses über die Erstellung eines Verbrecherprofils aufzunehmen.
Er wandte sich wieder den Zuhörern zu. »Ich brauche Ihnen nicht vorzutragen, was Sie längst wissen. Psychologen, die Verbrecherprofile erstellen, schnappen keine Kriminellen. Das machen unsere Bobbys.« Er schaute lächelnd in die Gesichter der hochrangigen Polizeibeamten und Beamten des Innenministeriums, wollte sie dazu bringen, seine Bescheidenheit anzuerkennen. Einige taten es, lächelten zurück, die meisten aber sahen ihn weiterhin mit steinerner Miene an.
Tony wußte, was er auch anstellte, er konnte die Masse der leitenden Polizeibeamten nicht davon überzeugen, daß er kein theoretisierender Universitätsprofessor war, der sich anmaßte, ihnen zu sagen, wie sie ihren Job zu machen hatten. Er unterdrückte einen Seufzer, warf einen Blick auf sein Konzept und fuhr fort, während er versuchte, soviel Augenkontakt wie nur möglich herzustellen und die lässige Körpersprache der erfolgreichen, witzigen Redner zu imitieren, auf die er bei einer Studie über das Clubleben in Nordengland gestoßen war. »Aber manchmal sehen wir Psychologen, die wir Verbrecherprofile erstellen, die Dinge anders«, sagte er. »Und diese neue Perspektive kann alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Tote haben durchaus noch etwas zu berichten, und was sie Profilerstellern erzählen, ist nicht das gleiche wie das, was sie Polizeibeamten sagen.
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Drei Meter neben einer Straße wird im Gebüsch eine Leiche gefunden. Ein Polizist hält diese Tatsache natürlich fest. Er wird den Boden in der ganzen Umgebung nach Spuren absuchen. Gibt es Fußspuren? Hat der Mörder irgend etwas zurückgelassen? Sind Stoffasern an Ästen hängengeblieben? Aber für mich ist diese einzige Tatsache nur der Ausgangspunkt für Überlegungen, die, in Verbindung mit allen anderen Informationen, welche mir verfügbar sind, sehr wohl zu nützlichen Schlüssen über die Person des Mörders führen können. Ich werde mich fragen: Wurde die Leiche absichtlich hier abgelegt, oder war der Mörder nur zu kaputt, sie an einen entfernteren Ort zu schleppen? Kam es ihm darauf an, die Leiche zu verstecken, oder war er vornehmlich darauf aus, sie loszuwerden? Wollte er, daß die Leiche gefunden wird? Wie lange sollte seiner Absicht nach die Leiche unentdeckt bleiben? Hatte dieser Ort eine besondere Bedeutung für ihn?« Tony hob die Schultern und streckte die Hände in einer fragenden Geste aus. Die Zuhörer beobachteten ihn weiterhin unbewegt. Mein Gott, wie viele Tricks mußte er noch aus dem Hut ziehen, ehe eine Reaktion erfolgte? Das leichte Prickeln der Schweißtropfen in seinem Nacken wurde zu einem Rinnsal, das zwischen seiner Haut und dem Hemdkragen herunterlief. Es verursachte ein unangenehmes Gefühl, das ihn daran erinnerte, wer wirklich hinter der Maske steckte, die er für diesen öffentlichen Auftritt aufgesetzt hatte.
Tony räusperte sich, streifte ab, was er fühlte, wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem zu, was er sagen wollte und fuhr fort: »Ein Verbrecherprofil ist nichts anderes als ein weiteres Werkzeug, das den Untersuchungsbeamten der Polizei helfen kann, sich auf den Kern der Ermittlungen zu konzentrieren. Unser Job ist es, dem Bizarren einen Sinn zu geben. Wir können Ihnen nicht den Namen, die Adresse oder die Telefonnummer eines Verbrechers nennen. Aber was wir tun können, ist, Ihnen aufzuzeigen, um welche Art von Persönlichkeit es sich handeln muß, die da ein Verbrechen mit besonderen Charakteristika begangen hat. Manchmal vermögen wir auch Hinweise darauf zu geben, in welcher Gegend der Verbrecher höchstwahrscheinlich lebt und welcher Arbeit er vermutlich nachgeht.
Ich weiß, einige von Ihnen haben die Notwendigkeit angezweifelt, eine Nationale Einsatzgruppe zur Erstellung von Verbrecherprofilen ins Leben zu rufen. Sie stehen damit nicht allein da. Auch in den liberalen, auf extreme Nutzung der freiheitlichen Rechte in unserem Land bedachten Kreisen lehnt man sich dagegen auf.« Na endlich, dachte Tony mit einiger Erleichterung, als er Lächeln und Nicken in der Zuhörerschaft wahrnahm. Er hatte vierzig Minuten gebraucht, bis es soweit war, aber nun war es ihm schließlich doch gelungen, sie aus ihrer stoischen Teilnahmslosigkeit herauszuholen. Das hieß noch nicht, daß er sich jetzt entspannen konnte, aber es milderte doch sein Unbehagen. »Es ist«, fuhr er fort, »bei uns schließlich nicht wie bei den Amerikanern. Bei uns lauern nicht hinter jeder Ecke irgendwelche Serienmörder. In unserer Gesellschaft werden mehr als neunzig Prozent aller Morde von Familienangehörigen oder Bekannten der Mordopfer begangen.« Jetzt hörten sie ihm wirklich aufmerksam zu. Wie auf Kommando in der Exerzierhalle wurden gekreuzte Arme entfaltet und übereinandergeschlagene Beine gelockert.
»Aber das Erstellen von psychologischen Profilen kann nicht nur zu Festnahme von Jack the Ripper beitragen, sondern auf einem weiten Feld des Verbrechens eingesetzt werden. Wir hatten bereits bemerkenswerte Erfolge bei Maßnahmen zur Verhinderung von Flugzeugentführungen sowie bei der Überführung von Drogenkurieren, anonymen obszönen Anrufern und Briefschreibern, Erpressern, Vergewaltigern und Brandstiftern. Und ebenso wichtig ist, daß wir das System der Profilerstellung sehr effektiv eingesetzt haben, Polizeibeamte in Verhörmethoden zu unterweisen, mit denen sie bei Ermittlungen in Fällen von Schwerverbrechen aus Verdächtigen mehr herausholen können. Natürlich heißt das nicht, daß es Ihren Beamten an der entsprechenden Sachkenntnis bei Verhören mangelt. Es ist einfach nur so, daß unser klinisch-analytischer Hintergrund differenziertere Zugangsmöglichkeiten eröffnet, die oft bessere Ergebnisse bringen als die herkömmlichen Befragungstechniken.«
Tony holte tief Luft und beugte sich nach vorn, die Hände um den Rand des Pults klammernd. Sein Finale hatte vor dem Badezimmerspiegel sehr gut geklungen. Er betete, daß er damit den Nerv der Leute traf und ihnen nicht etwa auf die Hühneraugen trat.
»Mein Team und ich arbeiten jetzt seit einem Jahr an der auf zwei Jahre konzipierten Realisierbarkeitsstudie des Projekts ›Nationale Einsatzgruppe zur Erstellung von Verbrecherprofilen‹. Ich habe dem Innenministerium vor kurzem einen Zwischenbericht vorgelegt, und man hat mir gestern bestätigt, daß die feste Absicht besteht, diese Einsatzgruppe aufzustellen, sobald mein Schlußbericht vorliegt. Ladies und Gentlemen, diese Revolution in der Verbrechensbekämpfung wird tatsächlich stattfinden. Sie haben jetzt noch ein Jahr Zeit, daran mitzuarbeiten, daß das Projekt in einer Form realisiert wird, mit der Sie einverstanden sein können. Mein Team und ich sind offen für konstruktive Vorschläge. Wir stehen ja alle auf derselben Seite. Wir wollen wissen, was Sie über die Sache denken, denn wir möchten natürlich erreichen, daß sie auch funktioniert. Wir wollen genauso wie Sie, daß gewaltbereite Serienverbrecher hinter Gitter kommen. Ich bin davon überzeugt, daß Sie dabei unsere Hilfe brauchen können. Und ich weiß, daß wir Ihre Hilfe benötigen.«
Tony trat einen Schritt zurück und genoß den Applaus – nicht etwa, weil dieser besonders enthusiastisch aufbrauste, sondern weil damit das Ende der fünfundvierzig Minuten gekommen war, vor denen er sich seit Wochen gefürchtet hatte. Es hatte stets weit außerhalb der Grenzen seines Wohlbefindens gelegen, öffentliche Rede zu halten, und zwar so sehr, daß er nach dem Erringen der Doktorwürde einer akademischen Karriere den Rücken zugekehrt hatte, weil er sich dem Zwang zu permanenten Vorlesungen vor Studenten nicht gewachsen fühlte. Der Gedanke, seine Tage mit dem Herumstochern in den geheimsten Winkeln verwirrter, kranker Verbrechergehirne zu verbringen, erschien ihm weitaus weniger beunruhigend.
Als der kurze Applaus verklang, sprang Tonys Ansprechpartner beim Innenministerium von seinem Stuhl in der ersten Reihe auf. Während Tony bei den Vertretern der Polizei unter seinen Zuhörern nur einen wachsamen Argwohn wachrief, wirkte George Rasmussens allgemeines Verhalten und sein Erscheinungsbild aufreizender auf die Leute als ein Mückenstich. Sein eifriges Lächeln entblößte zu viele Zähne und verlieh ihm eine verwirrende Ähnlichkeit mit George Formby, was im Gegensatz stand zu seinem hohen Beamtenposten, dem eleganten Schnitt seines grauen Nadelstreifenanzugs und dem nachhaltigen Schmettern seines Public-School-Akzents, der so übertrieben klang, daß Tony überzeugt war, Rasmussen sei in Wirklichkeit an irgendeiner kleinen Schule gewesen. Tony hörte ihm nur mit halbem Ohr zu, während er sein Manuskript zusammenklaubte und seine Folien wieder in den Ordner heftete. Dankbar für großartige Einblicke bla, bla, bla … Kaffee und diese absolut köstlichen Kekse bla, bla, bla … Einräumen der Möglichkeit zu informellen Fragen bla, bla, bla … Erinnere Sie daran, alle Vorlagen an Dr.Hill zu geben, und zwar bis zum bla, bla, bla …
Das Geräusch davonschlurfender Schritte überlagerte den Rest von Rasmussens Gequassel. Wenn es die Wahl zwischen den Dankesworten eines Ministerialbeamten und einer Tasse Kaffee gab, war die Entscheidung nicht schwer zu treffen, nicht einmal für die anderen Beamten des Innenministeriums. Tony atmete tief durch. Jetzt war die Zeit gekommen, den Dozenten hinter sich zu lassen und zum charmanten, informierten Kollegen zu werden, der stets eifrig zum Zuhören und zur Anpassung bereit war und seinen neuen Kontaktpersonen das Gefühl geben mußte, daß er wirklich auf ihrer Seite stand.
John Brandon erhob sich und trat einen Schritt zurück, um den anderen Leuten in seiner Reihe das Verlassen ihrer Sitze zu ermöglichen. Tony Hills Vortrag war nicht so informativ gewesen, wie er gehofft hatte. Die Ausführungen hatten ihm zwar eine Menge über das Erstellen von psychologischen Verbrecherprofilen gesagt, aber fast nichts über den Mann Tony Hill, außer vielleicht, daß er selbstsicher, jedoch nicht arrogant zu sein schien. Die letzte Dreiviertelstunde war nicht dazu geeignet gewesen, ihn darin zu bestärken, daß das, was er vorhatte, die richtige Handlungsweise war. Aber er sah keine Alternative. Dicht an der Wand entlang bewegte Brandon sich gegen den Strom, bis er auf Höhe von Rasmussen angekommen war. Die Abstimmung mit den Füßen hatte den Ministerialbeamten veranlaßt, seine Rede abrupt abzubrechen und sein Lächeln abzuschalten. Als Rasmussen sich bückte, um seine Papiere an sich zu nehmen, die er auf dem Stuhl abgelegt hatte, schlüpfte Brandon an ihm vorbei und ging auf Tony zu, der gerade die Verschlüsse seiner abgeschabten Gladstone-Tasche zudrückte.
Brandon räusperte sich, dann sagte er: »Dr.Hill?« Tony schaute mit höflichem Interesse zu ihm hoch. Brandon schob alle Bedenken zur Seite und fuhr fort: »Wir haben uns noch nicht kennengelernt, aber Sie beackern dasselbe Feld wie ich. Ich bin John Brandon …«
»Der Assistant Chief Constable der Kripo Bradfield?« unterbrach Tony und lächelte ihn an. Er hatte genug von John Brandon gehört, um zu wissen, daß er ein Mann war, den er auf seiner Seite haben wollte. »Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr.Brandon.«
»John, sagen Sie John«, bat Brandon hastiger, als er beabsichtigt hatte. Er stellte mit einiger Überraschung fest, daß er nervös war. Da war etwas an Tony Hills ruhiger Selbstsicherheit, das ihn verwirrte. »Haben Sie noch Zeit für ein kurzes Gespräch?«
Ehe Tony antworten konnte, drängte sich Rasmussen zwischen sie. »Entschuldigen Sie«, unterbrach er ohne den geringsten Anflug von Bescheidenheit, und er hatte wieder sein breites Lächeln aufgesetzt. »Tony, darf ich Sie bitten, mit in die Cafeteria zu kommen. Ich bin sicher, unsere Freunde von der Polizei werden sehr interessiert daran sein, mit Ihnen noch ein wenig in gelockerter Atmosphäre plaudern zu können. Begleiten Sie uns doch, Mr.Brandon.«
Brandon spürte, daß sich seine Nackenhaare sträubten. Die Situation war bereits schwierig genug, und nun würde er auch noch darum kämpfen müssen, das mit Hill geplante vertrauliche Gespräch in einem Raum voller kaffeetrinkender Polizisten und neugieriger Mandarine aus dem Innenministerium überhaupt führen zu können. »Ich hätte gern vorher noch allein mit Dr.Hill gesprochen.«
Tony sah Rasmussen an und bemerkte, daß sich die parallelen Falten zwischen seinen Augenbrauen leicht vertieften. Normalerweise hätte es ihn gejuckt, Rasmussen zu ärgern, indem er auf dem Gespräch mit Brandon bestanden hätte. Es machte ihm stets Spaß, Wichtigtuern eins auszuwischen und ihre Überheblichkeit als Hilflosigkeit bloßzustellen. Aber heute hing zu viel vom Erfolg seines Zusammenseins mit anderen Polizeibeamten ab, und so entschloß er sich, auf diesen Spaß zu verzichten. Er wandte sich demonstrativ von Rasmussen ab und sagte zu Brandon:
»John, fahren Sie nach dem Mittagessen nach Bradfield zurück?« Brandon nickte.
»Würden Sie mich dann mitnehmen? Ich bin mit dem Zug gekommen, aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich auf dem Rückweg gern auf den Kampf mit den Unzulänglichkeiten der Britischen Eisenbahn verzichten. Sie können mich ja am Stadtrand absetzen, wenn Sie nicht dabei gesehen werden wollen, wie Sie sich mit einem dieser supermodernen Spinner fraternisieren.« Brandon lächelte, und sein langes Gesicht verzog sich in tausend Fältchen. »Ich glaube nicht, daß das erforderlich sein wird. Ich setze Sie ebenso gern vor der Polizeizentrale ab.« Er trat zurück und sah zu, wie Rasmussen, weiterhin unter großem Getue, Tony zum Ausgang dirigierte. Die leichte Verwirrung, die der Psychologe bei ihm hervorgerufen hatte, konnte er nicht abschütteln. Vielleicht lag es einfach nur daran, daß er es so gewohnt war, alles in seiner Welt fest unter Kontrolle zu haben, daß eine Bitte um Hilfe zu einer fremden Erfahrung für ihn geworden war, die ihn sich automatisch verwirrt fühlen ließ. Es gab keine andere einleuchtende Erklärung. Er zuckte mit den Schultern und folgte den anderen in die Cafeteria.
Tony legte den Gurt an und genoß die Bequemlichkeit des nicht als Polizeifahrzeug gekennzeichneten Range Rovers. Er sagte nichts, während Brandon vom Parkplatz der Polizeizentrale von Manchester und dann in Richtung Autobahn fuhr, denn es erforderte äußerste Konzentration, aus dieser nicht vertrauten Stadt wieder herauszufinden. Als Brandon sich dann in den schnell dahinfließenden Fahrzeugstrom des Autobahnzubringers eingeordnet hatte, brach Tony das Schweigen. »Wenn es hilfreich ist – ich glaube, ich weiß, worüber Sie mit mir reden wollen.«
Brandons Hände schlossen sich fester um das Lenkrad. »Ich dachte, Sie wären Psychologe und nicht Hellseher«, scherzte er, was ihn selbst überraschte. Humor gehörte nicht zu seinen Stärken. Er konnte sich nicht damit abfinden, wie nervös es ihn machte, um Hilfe bitten zu müssen.
»Einige Ihrer Kollegen würden mich mehr beachten, wenn ich Hellseher wäre«, erwiderte Tony sarkastisch. »Also, wollen Sie mich raten und das Risiko eingehen lassen, daß ich mich unsterblich blamiere?«
Brandon warf Tony einen schnellen Blick zu. Der Psychologe wirkte entspannt, hatte die Handflächen auf die Oberschenkel gelegt und die ausgestreckten Beine unten gekreuzt. Er machte den Eindruck, als würde er sich in Jeans und Pullover wohler fühlen als in dem Anzug, den er gerade trug, und dem selbst Brandon ansah, daß er längst aus der Mode war. Er konnte sich diese Einschätzung erlauben, weil er sich nur daran zu erinnern brauchte, wie seine Töchter seine formelle Zivilkleidung regelmäßig mit vernichtenden Kommentaren bedachten. »Ich glaube, in Bradfield ist ein Serienmörder am Werk«, sagte er abrupt.
Tony stieß einen leisen, zufriedenen Seufzer aus. »Ich fing schon an mich zu fragen, ob Sie das nicht auch langsam bemerken würden«, entgegnete er ironisch.
»Das ist aber keinesfalls eine einhellige Auffassung«, fügte Brandon hinzu. Er meinte Tony warnen zu müssen, noch ehe er ihn um Hilfe bat.
»Das ergibt sich schon allein aus den Berichten in den Medien«, sagte Tony. »Wenn es ein Trost für Sie ist – ich bin nach allem, was ich darüber gehört und gelesen habe, absolut sicher, daß Ihre Beurteilung zutrifft.«
»Oh, das deckt sich aber nicht ganz mit dem Eindruck, den ich aus Ihrer Stellungnahme in der Sentinel Times nach dem letzten Mord gewonnen habe.«
»Es gehört unabdingbar zu meinem Job, mit der Polizei zu kooperieren, nicht ihre Arbeit zu unterminieren. Ich nehme an, Sie hatten ganz bestimmte taktische Gründe, mit Ihrer Serienmörder-Theorie nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meinerseits habe den Verantwortlichen gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß meine Beurteilung nichts weiter als eine sachlich begründete Vermutung ist, die sich auf die allgemein zugänglichen Informationen stützt«, fügte Tony hinzu, wobei sein gleichbleibend freundlicher Ton im Widerspruch zu der Tatsache stand, daß er plötzlich seine Finger in den Stoff seiner Hosenbeine krallte und damit längliche Falten erzeugte.
»Touché! Sind Sie denn nun daran interessiert, uns zu unterstützen?«
Tony spürte eine warme Welle der Befriedigung in sich aufsteigen. Das war es, was er nun seit Wochen herbeigesehnt hatte …
»Ein paar Meilen weiter ist eine Raststätte. Hätten Sie nicht Lust auf eine Tasse Tee?«
Detective Inspector Carol Jordan starrte auf das zerfetzte Fleischbündel, das einmal ein Mann gewesen war, und sie zwang ihre Augen ganz bewußt dazu, sich nicht darauf zu konzentrieren. Sie wünschte, sie hätte das vertrocknete Käsesandwich aus der Kantine nicht gegessen. Es wurde irgendwie akzeptiert, daß junge männliche Polizisten sich übergaben, wenn sie mit Opfern von Gewaltverbrechen konfrontiert wurden. Man brachte ihnen sogar Mitgefühl entgegen. Aber trotz der Tatsache, daß man bei Frauen im allgemeinen von sensiblen Magenreaktionen ausging, verlor eine Polizeibeamtin, wenn sie sich am Tatort eines Verbrechens übergeben mußte, jeglichen Respekt, den sie sich je erworben hatte, und wurde zu einem Objekt der Verachtung, zur Zielscheibe von derben Witzen. Wo bleibt da die Logik, dachte Carol bitter und biß die Zähne zusammen. Sie steckte die Hände tief in die Taschen ihres Trenchcoats und ballte die Fäuste.
Carol spürte eine Hand auf ihrem Arm, gleich oberhalb des Ellbogens. Dankbar für die Möglichkeit, ihren Blick abwenden zu können, schaute sie ihren Sergeant an, der hoch neben ihr aufragte. Don Merrick war gut zwanzig Zentimeter größer als seine Chefin, und er hatte sich eine seltsam gebeugte Haltung angewöhnt, wenn er mit ihr sprach. Anfangs hatte sie das amüsant genug gefunden, um damit unter Freunden bei gemeinsamen Drinks oder den Abendessen, zu denen sie kaum einmal die Zeit fand, Witze zu machen. Jetzt nahm sie es gar nicht mehr wahr. »Absperrung um den Tatort steht, Ma’am«, sagte er in seinem weichen Geordie-Akzent. »Der Pathologe ist auf dem Weg hierher. Was halten Sie von der Sache? Haben wir es mit Nummer vier zu tun?«
»Lassen Sie das ja nicht den Super hören, Don«, erwiderte sie, und sie meinte es nur halb im Scherz. »Ich würde Ihre Frage jedoch bejahen.« Carol schaute sich um. Sie waren im Stadtteil Temple Fields, im Hinterhof eines Pubs, der seine Kundschaft vornehmlich in der Homosexuellenszene hatte und im Obergeschoß dreimal in der Woche eine Bar für Lesbierinnen betrieb. Im Gegensatz zu den Machos unter den Kollegen, die sie bei den Beförderungen überholt hatte, hatte Carol nie einen Grund gehabt, dieses Lokal zu betreten. »Was ist mit dem Tor zum Hinterhof?«
»Stemmeisen«, antwortete Merrick lakonisch. »Das Tor ist nicht an das Alarmsystem angeschlossen.«
Carol schaute sich die großen Müllcontainer und die aufgestapelten Lattenkisten mit Abfall an. »Offensichtlich kein Grund, das zu tun«, meinte sie. »Was hat der Besitzer zu sagen?«
»Whalley redet gerade mit ihm, Ma’am. Der Mann hat gestern abend um halb zwölf das Lokal geschlossen. Sie haben hinter den Tresen Tonnen auf Rädern für den anfallenden Müll, und wenn sie dichtgemacht haben, rollen sie diese Tonnen da drüben hin.«
Merrick zeigte auf die Hintertür des Pubs, wo drei blaue Plastiktonnen standen, alle etwa in der Größe von Supermarkt-Einkaufswagen. »Sie sortieren den Müll dann erst am nächsten Nachmittag aus und werfen ihn in die Container.«
»Und bei dieser Arbeit haben sie das da gefunden?« fragte Carol und zeigte mit dem Daumen über ihre Schulter.
»Ja, lag einfach da. Den Elementen ausgesetzt, könnte man sagen.«
Carol nickte. Ein Schauder befiel sie, und er war nicht auf den scharfen Nordostwind zurückzuführen. Sie ging auf die Hintertür des Pubs zu. »Okay. Überlassen wir das erst mal der Spurensicherung. Wir sind hier nur im Weg.« Merrick folgte ihr in die schmale Gasse hinter dem Pub. Sie war gerade breit genug, daß sich ein kleiner Personenwagen hindurchquetschen konnte. Carol schaute erst in die eine, dann in die andere Richtung; sie war an beiden Enden mit Trassierband abgesperrt und zusätzlich von je zwei uniformierten Constables bewacht. »Er kennt sein Revier«, murmelte sie. Sie bewegte sich rückwärts durch die Gasse, dabei die Tür des Pubs ständig im Auge behaltend. Merrick folge ihr und wartete auf weitere Anweisungen.
Am Ende der Gasse blieb Carol stehen, drehte sich um und sah sich die Straße an, in die die Gasse mündete. Gegenüber lag ein hohes Gebäude, ein ehemaliges Lagerhaus, das man in Werkstätten für Kunsthandwerker umgebaut hatte. Bei Nacht lag es verlassen da, aber jetzt, mitten am Nachmittag, hingen fast in jedem Fenster Leute, die neugierig aus der Wärme ihrer Räume auf das Drama da unten starrten. »Zum entscheidenden Zeitpunkt hat wohl keiner aus dem Fenster geschaut«, stellte sie fest.
»Und selbst wenn jemand es getan hätte, er hätte das Geschehen kaum beachtet«, sagte Merrick zynisch. »Wenn die Lokale abends schließen, ist in dieser Gegend hier schwer was los. Unter jedem Torbogen, in jeder Gasse, in der Hälfte aller abgestellten Autos sind Schwulenpärchen zugange und ficken sich in die Ärsche. Kein Wunder, daß der Chief Temple Fields als Sodom und Gomorrah bezeichnet.«
»Wissen Sie, in dem Zusammenhang habe ich mir oft eine Frage gestellt: Es ist ziemlich klar, was die Leute in Sodom getrieben haben, aber können Sie mir sagen, was die Sünde der Leute in Gomorrha war?«
Merrick sah verwirrt aus. Das steigerte seine Ähnlichkeit mit einem traurig dreinblickenden Labrador in beunruhigendem Maße. »Jetzt kann ich Ihnen nicht folgen, Ma’am«, sagte er.
»Macht nichts. Es wundert mich, daß Mr.Armthwaite nicht dafür gesorgt hat, daß die Sitte diese Leute wegen anstößigen Verhaltens eingebuchtet hat.«
»Er hat es vor ein paar Jahren mal versucht«, erwiderte Merrick.
»Der Polizeiausschuß hat ihm dafür jedoch die Eier gegrillt. Er hat sich dagegen aufgelehnt, aber man hat ihm mit dem Innenministerium gedroht. Und nach der Holmwood-Three-Sache war ihm klar, daß er sich bei den Politikern schon tief in die Nesseln gesetzt hatte, und so hat er dann ganz schnell den Schwanz eingezogen. Aber das wird ihn nicht davon abhalten, bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder in die Scheiße zu treten.«
»Na, da wollen wir hoffen, daß unser freundlicher Nachbarschaftskiller uns diesmal ein paar Spuren mehr hinterlassen hat, sonst wird unser geliebter Chef sich auf ein neues falsches Ziel stürzen, um den Tritt in die Scheiße ja nicht zu verpassen.« Carol straffte die Schultern. »Okay, Don, wir starten sofort mit der Befragung von Tür zu Tür, und heute abend klappern wir die Straßen ab und reden mit den Leuten vom einschlägigen Gewerbe …«
Ehe Carol ihre Anweisungen abschließen konnte, wurde sie von einer Stimme hinter der Absperrung unterbrochen. »Inspector Jordan? Penny Burgess von der Sentinel Times … Inspector? Was haben Sie herausgefunden?«
Carol schloß für einen Moment die Augen. Sich mit den widerspenstigen Betbrüdern unter ihren Kollegen auseinanderzusetzen, war eine Sache, sich mit den Medien auseinanderzusetzen, war eine andere und unendlich viel schwieriger. Sie wünschte, sie wäre im Hinterhof bei der gräßlichen Leiche geblieben, atmete dann jedoch tief durch und ging auf die Absperrung zu.
»Jetzt noch mal, damit ich das auch richtig kapiere – Sie wollen, daß ich für die Dauer der Ermittlungen in diesen Mordfällen zu Ihnen an Bord komme, aber Sie wollen nicht, daß ich das irgend jemandem sage?« Der Ausdruck der Belustigung in Tonys Augen verbarg seinen Ärger über das widerstrebende Zögern der leitenden Polizeibeamten, den Wert der Arbeit, die er für sie leisten konnte, vorbehaltlos zu akzeptieren.
Brandon seufzte. Tony machte es ihm nicht einfach, aber warum sollte er auch? »Ich möchte jeden Hinweis in den Medien vermeiden, daß Sie uns bei der Sache unterstützen. Ich hätte nur dann eine Chance, Sie formell in die Ermittlungen einzuschalten, wenn ich den Chief Constable davon überzeugen könnte, daß Sie weder ihm selbst noch seinen Cops den Glorienschein des Erfolgs nehmen würden.«
»Und daß die Öffentlichkeit nicht erfahren würde, daß Derek Armthwaite, die Hand Gottes, Hokuspokus-Typen wie mich um Hilfe gebeten hat«, sagte Tony, und die Schärfe in seiner Stimme verriet mehr, als er beabsichtigt hatte.
Brandon verzog den Mund zu einem zynischen Lächeln. Es war interessant, zu sehen, daß man die glatte Oberfläche des Psychologen ankratzen konnte. »Sie sagen es, Tony. Technisch gesehen ist es eine operative Sache, und er darf regulär nicht in meine Befugnisse eingreifen, es sei denn, ich verstoße gegen die strategische Planung der Polizeiführung oder des Innenministeriums. Und es ist offizielle Strategie der Stadtpolizei von Bradfield, die Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen, wenn das angemessen erscheint.«
Tony lachte verächtlich. »Und Sie gehen davon aus, daß er mich als ›angemessen‹ akzeptiert?«
»Ich gehe davon aus, daß er es nicht auf eine weitere Konfrontation mit dem Innenministerium oder dem Polizeiausschuß ankommen lassen will. In achtzehn Monaten ist seine Pensionierung, und er ist ganz wild darauf, in den Ritterstand erhoben zu werden.« Brandon konnte selbst nicht glauben, daß er das alles sagte. Er machte solche illoyalen Äußerungen nicht einmal seiner Frau gegenüber, ganz zu schweigen von Leuten, die ihm praktisch fremd waren. Was war an diesem Tony Hill, das ihn dazu brachte, sich ihm gegenüber so schnell zu öffnen? An diesem Psychologie-Zeug schien tatsächlich etwas dran zu sein. Brandon tröstete sich damit, daß er dabei war, dieses Etwas in den Dienst der Justiz einzuspannen. »Was sagen Sie dazu?« fragte er.
»Wann soll ich anfangen?«
3 ½-Zoll-Diskette, Backup. 007; Love002.doc
Schon beim ersten Mal hatte ich den Ablauf sorgfältiger geplant als ein Theaterregisseur die Inszenierung eines neuen Stücks. Im Geist stellte ich mir das bevorstehende Erlebnis vor, bis es, wenn ich die Augen schloß, zu einem hellen und glänzenden Traum wurde. Ich überprüfte wieder und wieder die Choreographie jedes einzelnen Schritts, vergewisserte mich, daß ich kein wichtiges Detail übersehen hatte, welches meine Freiheit gefährden konnte. Wenn ich heute daran zurückdenke, erinnere ich mich, daß der mentale Film, den ich abspulte, mir fast so viel Spaß machte wie die Ausführung des Akts selbst.
Als erstes galt es, einen Ort zu finden, an den ich mein Opfer gefahrlos bringen, an dem ich unser ganz privates Beisammensein genießen konnte. Meine Wohnung schloß ich von vornherein aus. Sie hat eine schlechte Geräuschdämmung: ich kann die lautstarken Streitereien meiner Nachbarn, das Bellen ihres hysterischen Schäferhunds und das aufreizende Dröhnen der Bässe ihrer Stereoanlage hören. Ich hatte nicht die Absicht, sie an meiner Apotheose teilnehmen zu lassen. Außerdem gibt es in den Reihenhäusern meiner Straße zu viele Durch-den-Vorhang-Gucker. Ich wollte keine Zeugen bei Adams Ankunft oder seinem Verschwinden haben.
Ich überlegte auch, eine alleinstehende Garage zu mieten, verwarf dann den Gedanken jedoch aus denselben Gründen. Darüber hinaus kam mir das irgendwie zu schäbig vor, zu sehr als Klischee aus der Welt des Fernsehens und des Films. Ich wollte einen Ort haben, der meinem Vorhaben angemessen war. Dann fiel mir Tante Doris, eine Tante meiner Mutter, ein. Doris und ihr Mann Harry waren Schaffarmer im Hochmoor über Bradfield. Vor etwa vier Jahren starb Harry. Doris versuchte noch eine Weile, die Farm weiterzuführen, aber als ihr Sohn Ken sie im vergangenen Jahr zu einem ausgedehnten Urlaub im Kreis seiner Familie in Neuseeland eingeladen hatte, verkaufte sie die Schafe und packte ihre Sachen. Ken hatte mir zu Weihnachten geschrieben und berichtet, seine Mutter habe einen leichten Herzanfall erlitten und würde wohl in absehbarer Zeit nicht nach England zurückkehren.
Eines Abends nutzte ich eine Flaute in meiner Arbeit und rief Ken an. Er klang zunächst überrascht, von mir zu hören, und murmelte dann: »Ich nehme an, du benutzt dein dienstliches Telefon.«
»Ich hatte schon seit langem vor, dich mal anzurufen«, sagte ich. »Ich wollte mich erkundigen, wie es Tante Doris geht.« Es ist sehr viel einfacher, via Satellit fürsorglich zu klingen als im direkten Gespräch. Ich bemühte mich, die jeweils angemessenen Laute von mir zu geben, als Ken sich lang und breit über den Gesundheitszustand seiner Mutter und das Ergehen seiner Frau, seiner drei Kinder und seiner Schafe äußerte.
Nach zehn Minuten meinte ich, daß es nun genug sei. »Da ist noch eine andere Sache, Ken. Ich mache mir Gedanken über euer Haus«, log ich. »Es liegt so einsam da oben, jemand sollte ein Auge darauf haben.«
»Da hast du recht«, sagte er. »Ihr Anwalt soll das machen, aber ich nehme nicht an, daß er sich bisher darum gekümmert hat.«
»Möchtest du, daß ich hin und wieder hochfahre und nachsehe, ob alles in Ordnung ist?«
»Würdest du das tun? Es wäre natürlich eine große Erleichterung für mich, das brauche ich dir ja wohl nicht zu sagen. Ganz unter uns, ich glaube nicht, daß Mum jemals wieder gesund genug wird, um in ihr Haus zurückzukehren, aber mir gefällt der Gedanke nicht, daß der Stammsitz unserer Familie verkommt«, sagte Ken eifrig.
Dir gefällt eher der Gedanke nicht, daß dein Erbe verkommt, dachte ich. Ich kannte Ken. Zehn Tage später hatte ich die Schlüssel zum Haus in Händen. An meinem nächsten freien Tag fuhr ich hin, um mich von der Richtigkeit meiner Erinnerungen zu überzeugen. Der Feldweg, der zur Start Hill Farm führt, war weit mehr von Gras überwachsen als bei meinem letzten Besuch, und mein geländegängiger Jeep mußte sich anstrengen, die drei Meilen lange Steigung von der einspurigen Straße im Tal bis zur Farm zu bewältigen. Zehn Meter vor dem düsteren kleinen Cottage hielt ich an, stellte den Motor ab und blieb etwa fünf Minuten horchend im Wagen sitzen. Der beißende Wind vom Hochmoor raschelte in den verwilderten Hecken, hin und wieder sang ein Vogel. Aber es waren keinerlei Geräusche zu hören, die von Menschen stammten, nicht einmal ein ferner Verkehrslärm von irgendwelchen Straßen.
Ich stieg aus dem Jeep und schaute mich um. Das eine Ende des Schafstalls war zusammengestürzt, ein einziger Haufen aus zerbrochenen Steinen, aber es freute mich, daß es keine Anzeichen für gelegentliche menschliche Besuche gab – keine Überreste von Picknicks, keine verrottenden Bierdosen, keine zerknüllten Zeitungen, keine Zigarettenstummel, keine gebrauchten Kondome. Ich ging zum Cottage, schloß die Tür auf und trat ein.
Es hatte nur zwei Zimmer im Erdgeschoß und zwei im Obergeschoß. Im Inneren unterschied es sich erheblich von dem gemütlichen Farmhaus, das ich in Erinnerung hatte. Alles, was die persönliche Note ausgemacht hatte – die Fotos, der schmückende Krimskrams, die ziselierten Pferdeplaketten aus Messing, die Antiquitäten –, war verschwunden, in Kisten verpackt und einer Spedition zur Lagerung übergeben worden, eine für die Bewohner von Yorkshire sehr typische Vorsichtsmaßnahme. In gewisser Weise erleichterte mich das; es gab hier nichts zu sehen, was Erinnerungen heraufbeschwören konnte, die sich störend auf mein Vorhaben auswirken würden. Dieses Haus war eine leere Schreibtafel, auf der alle Demütigungen, Peinlichkeiten und Qualen ausgewischt waren. Die Person, die ich einmal gewesen war, gab es nicht mehr.
Ich ging durch die Küche zur Vorratskammer. Die Regale waren leer. Gott weiß, was Doris mit den Dutzenden von Marmelade- und Gurkengläsern sowie den Flaschen mit hausgemachtem Wein angestellt hatte. Vielleicht hatte sie das alles als Vorsichtsmaßnahme gegen fremdartige Nahrung mit nach Neuseeland genommen. Ich stand in der Tür, starrte auf den Boden des Vorratsraums und spürte, wie ein albernes Grinsen mein Gesicht verzog. Meine Erinnerung hatte mich nicht getrogen. Da war die in den Boden eingelassene Falltür. Ich ging in die Hocke und zog an dem rostigen Eisenring. Mit quietschenden Angeln schwang die Tür auf. Als ich die aus dem Keller aufsteigende Luft roch, war ich zunehmend überzeugt, daß die Götter auf meiner Seite waren. Ich hatte befürchtet, sie würde feucht, schal und stinkend sein. Statt dessen war sie kühl und frisch, roch leicht süßlich.
Ich zündete meine Camping-Gaslaterne an und stieg vorsichtig die Steinstufen hinunter. Das Licht der Laterne erhellte einen großen, etwa sechs Meter breiten und neun Meter langen Raum. Der Boden war mit Steinplatten ausgelegt, und entlang einer der Wände befand sich eine breite Steinbank.
Ich hielt die Lampe höher und sah jetzt die soliden Deckenbalken. Als einziges im Raum war der Verputz der Decke zwischen den Balken in desolatem Zustand. Ich konnte das jedoch leicht mit Mörtel wieder in Ordnung bringen und würde damit auch erreichen, daß kein Licht durch das Lattengerüst nach oben drang. Im rechten Winkel zur Steinbank ragte ein Wasserhahn aus der Wand, und im Boden war ein Abfluß eingelassen. Ich erinnerte mich, daß die Farm ihr Wasser aus einer eigenen Quelle bezog. Der Wasserhahn war festgerostet, aber es gelang mir schließlich, ihn aufzudrehen, und nach kurzer Zeit strömte klares, sauberes Wasser heraus. Neben der Treppe stand eine abgenutzte hölzerne Werkbank, komplett mit Schraubstöcken und Zwingen, und darüber hing Harrys Werkzeug in ordentlichen Reihen an der Wand. Ich setzte mich auf die Steinbank und beglückwünschte mich. Es bedurfte nur weniger Stunden Arbeit, um diesen Keller in einen Kerker zu verwandeln, der weitaus besser seinem Zweck dienen würde als alles, was einschlägige Videospiel-Programmierer je auf den Markt gebracht hatten. Jedenfalls brauchte ich mir keine Gedanken für eine Schwachstelle zu machen, die meinen Abenteurern die Flucht ermöglichen würde.
Ich fuhr täglich in meiner Freizeit zur Farm, und am Ende der Woche hatte ich die Arbeiten abgeschlossen. Es war nichts Kompliziertes zu tun gewesen. Ich hatte das Vorhängeschloß und die Riegel an der Falltür repariert, die Decke des Kellerraums verputzt und die Wände mit mehreren Schichten weißer Farbe getünscht. Ich wollte den Raum so hell wie möglich haben, um eine gute Qualität der geplanten Videoaufnahmen sicherzustellen. Ich hatte sogar eine Leitung vom zentralen Schaltkasten in den Keller gelegt, um mit Elektrizität versorgt zu sein.
Ich dachte lange und angestrengt nach, bevor ich endgültig beschloß, wie ich Adam bestrafen würde. Ich entschied mich zu dem, was die Franzosen »chevalet«, die Spanier »escalero«, die Deutschen »Streckbank«, die Italiener »veglia« und die poetischen Engländer »Die Tochter des Duke of Exeter« nennen. Diese Folterbank hatte ihren euphemistischen Namen nach dem einfallsreichen John Holland, Duke of Exeter und Earl of Huntingdon, bekommen. Nach einer erfolgreichen Karriere als Soldat war der Duke zum Constable des Tower of London ernannt worden, und um 1420 hatte er dieses großartige Instrument zur Überredung starrköpfiger Sünder in England eingeführt.
Die erste Version bestand aus einem offenen rechteckigen Rahmen auf Holzbeinen. Der Gefangene wurde unter das Gestell gelegt, und um seine Handgelenke und Fesseln wurde Seile geschlungen. An jeder der Ecken führten die Seile zu Winden, die von Wärtern durch Drehen der Kurbeln bedient wurden. Dieses wenig elegante und arbeitsaufwendige Gerät wurde mit den Jahren verfeinert und schließlich zu einer Konstruktion umgestaltet, die aus einer Art Tischplatte auf einer horizontalen Leiter bestand, in die in der Mitte eine mit Eisenstacheln versehene Rolle eingebaut war, so daß, wenn der Körper des Gefangenen sich streckte, sein Rücken von den Stacheln zerfetzt wurde. Man hatte auch ein Flaschenzugsystem entwickelt, das alle vier Seile erfaßte und somit ermöglichte, daß die Maschine von nur einer Person bedient werden konnte.
Glücklicherweise haben diejenigen, die sich im Lauf der Jahrhunderte für die Bestrafung der Sünder einsetzten, sorgfältige Beschreibungen und Zeichnungen ihrer Apparaturen hinterlassen. Darüber hinaus hatte ich ja auch den Museumsführer als Vorlage, und mit Hilfe eines Handbuchs für Heimwerker baute ich mir meine eigene Streckbank. Für den Mechanismus schlachtete ich eine alte Wäschemangel aus, die ich in einem Antiquitätenladen gekauft hatte. Bei einer Versteigerung erstand ich einen Eßtisch aus Mahagoni. Ich schaffte ihn geradewegs zur Farm und nahm ihn in der Küche auseinander, wobei ich das handwerkliche Können bewunderte, mit dem dieses harte Holz verarbeitet worden war. Es dauerte ein paar Tage, dann war meine »Tochter des Duke of Exeter« fertig. Jetzt blieb nur noch, sie einmal auszuprobieren.
2
Überlassen wir dann den geneigten Leser der reinen Ekstase des Horrors, wenn er in der atemlosen Stille der Erwartung, des Vorausahnens und, wahrhaftig, des Wartens darauf, daß die unbekannte Hand wieder einmal zuschlägt, gefangen ist und dennoch nicht glauben will, daß jemals eine solch wilde Verwegenheit aufgebracht werden könnte, diesen Versuch zu wagen, während alle Augen darauf gerichtet sind … und sich dann dennoch ein zweiter Fall der gleichen mysteriösen Art ereignet und ein Mord nach demselben vernichtenden Plan in ebenderselben Nachbarschaft begangen wird.
Brandon hatte gerade den Motor gestartet, als das Autotelefon in der Halterung am Armaturenbrett läutete. Er nahm ab und meldete sich: »Brandon!« Tony hörte eine Computerstimme sagen: »Es liegen Nachrichten für Sie vor. Rufen Sie bitte Eins-Zwei-Eins an. Es liegen Nachrichten für Sie vor. Rufen Sie …«
Brandon drückte auf einige Tasten. Diesmal konnte Tony nicht verstehen, was der Angerufene sagte. Nach einigen Sekunden wählte Brandon eine andere Nummer. »Meine Sekretärin«, erklärte er. »Tut mir leid … Hallo, Martina? John hier. Sie lassen mich suchen?«
Während ihm geantwortet wurde, kniff Brandon wie im Schmerz die Augen zu. »Wo?« fragte er dann.
»Okay, verstanden. Ich werde in einer halben Stunde dort sein. Wer hat die Leitung? … Gut, danke, Martina.« Brandon öffnete die Augen und beendete das Gespräch. Er drückte den Hörer wieder in die Halterung und wandte sich Tony zu. »Sie wollten wissen, wann Sie anfangen sollen? Wie wäre es mit sofort?«
»Die nächste Leiche?« fragte Tony.
»Die nächste Leiche«, bestätigte Brandon grimmig, setzte sich gerade, legte den ersten Gang ein und fuhr los. »Wie reagieren Sie auf Tatort-Szenen?«
Tony zuckte mit den Schultern. »Ich werde vermutlich mein Mittagessen wieder ausspucken, aber es ist ein Bonus für mich, wenn ich die Leichen in noch halbwegs ursprünglichem Zustand sehe.«
»Bei dem Zustand, in dem sie dieser kranke Bastard zurückläßt, kann man nicht von ›ursprünglich‹ sprechen«, knurrte Brandon. Er fädelte sich zügig in die Überholspur ein. Der Tacho zeigte fünfundneunzig Stundenmeilen, doch dann ging Brandon ein wenig vom Gas.
»Ist er wieder auf Temple Fields zurückgekommen?« fragte Tony.
Brandon warf ihm einen erstaunten Blick zu. Tony schaute geradeaus und runzelte die Stirn. »Woher wissen Sie das?« fragte Brandon.
Da war eine Gegenfrage, auf deren Beantwortung Tony nicht vorbereitet war. »Nennen Sie es Intuition«, wich er aus. »Ich nehme an, beim letztenmal hatte er Angst, Temple Fields könnte ein wenig zu heiß für ihn geworden zu sein. Indem er die dritte Leiche in Carlton Park finden ließ, rückte er Temple Fields aus dem Mittelpunkt des Interesses, hielt die Polizei davon ab, sich nur auf einen Ort zu konzentrieren, und versprach sich wohl auch davon, die Wachsamkeit der Leute ein wenig einzuschläfern. Aber er mag Temple Fields, sei es, weil er sich dort gut auskennt oder weil es seine Phantasie anregt. Vielleicht aber bedeutete es ihm auch aus irgendeinem Grund etwas«, überlegte Tony laut.
»Kommen Sie jedesmal mit einem halben Dutzend verschiedener Hypothesen, wenn jemand Sie mit einer Tatsache konfrontiert?« fragte Brandon und ließ seine Lichthupe aufblitzen, damit der BMW vor ihm von der Überholspur fuhr. »Mach den Weg frei, du Bastard, oder ich hetzte dir die Verkehrspolizei auf den Hals«, schimpfte er.
»Ja, das versuche ich«, antwortete Tony. »So gehe ich bei meiner Arbeit immer vor. Nach und nach führen dann neue Erkenntnisse dazu, daß ich einige meiner ursprünglichen Annahmen ausmerzen kann. Und so beginnt sich schließlich ein Raster zu formen.« Daraufhin schwieg er und malte sich bereits aus, was er am Tatort vorfinden würde. Sein Magen flatterte, seine Muskeln waren angespannt wie bei einem Musiker vor einem Konzert. Im Normalfall bekam er stets nur die sterilen, von anderen vorgetragenen Schilderungen der Tatorte zu hören und die Bilder zu sehen. Wie gut der Polizeifotograf und die anderen Polizeibeamten ihre Arbeit am Tatort auch gemacht hatten, es waren immer die Versionen anderer Leute, die er für seine Folgerungen übersetzen mußte. Diesmal würde er so nahe bei einem Mörder sein wie nie zuvor. Für einen Mann, der sein Leben hinter dem Schild akademischer Verhaltensweisen verbrachte, war es eine Offenbarung, direkt an der Fassade eines Mörders kratzen zu können.
Carol sagte inzwischen schon zum elftenmal: »Kein Kommentar.« Penny Burgess kniff den Mund zusammen und schaute sich verzweifelt um, ob sie vielleicht jemand anderen von der Polizei erwischen konnte, bei dem ihre Fragen nicht wie an einer Steinmauer abprallten. Popeye Cross mochte zwar ein chauvinistisches Schwein sein, aber er salzte seine belehrenden Kommentare doch meistens mit ein paar verwertbaren Aussprüchen. Sie wollte es jedoch nicht wahrhaben, daß sie bei Carol kein Glück hatte. Also nahm sie einen neuen Anlauf.
»Wo ist die schwesterliche Verbundenheit geblieben, Carol?« beschwerte sie sich. »Kommen Sie, lassen Sie mich nicht hängen. Es muß doch außer ›Kein Kommentar‹ irgendwas geben, das Sie mir sagen können.«