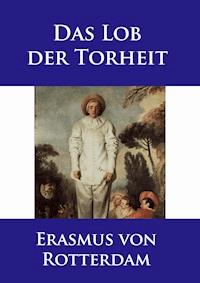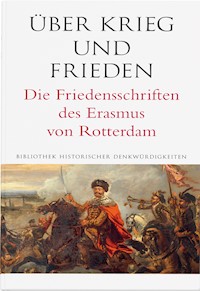Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Buchreihe Taschenbuch Literatur Klassiker
- Sprache: Deutsch
Das bekanntestes Werk des Erasmus von Rotterdam ist die Satire Lob der Torheit (Laus stultitiae) aus dem Jahr 1509. Tief verwurzelten Irrtümern tritt er mit Spott und Ernst in seiner "ironischen Lehrrede" entgegen und setzt sich ein für vernünftige Anschauungen. Das Lob der Torheit ist eines der meistgelesenen Bücher der Weltliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Lob der Torheit
Eine Stilübung des Erasmus von Rotterdam
Die Torheit tritt auf und spricht:
Mögen die Menschen in aller Welt von mir sagen, was sie wollen – weiß ich doch, wie übel von der Torheit auch die ärgsten Toren reden –, es bleibt dabei: mir, ja mir allein und meiner Kraft haben es Götter und Menschen zu danken, wenn sie heiter und frohgemut sind. Das beweist ihr selber schon zur Genüge; denn sowie ich vor eure große Gemeinde trat, ging augenblicklich über jedes Gesicht ein ganz ungewöhnlicher, überraschender Schein, munter schnellten die Köpfe empor, und ein so ungehemmtes helles Gelächter schallte mir entgegen, daß mich wahrhaftig deucht, es sei euch allen, die ich von nah und fern versammelt sehe, homerischer Götterwein, gewürzt mit Vergißdasleid, zu Kopfe gestiegen, und saßet doch vorher so bedrückt und verängstigt da, als kämet ihr eben aus des Trophonius Höhle. Aber, wie es allemal der Welt im Frühling geht – sobald die Sonne ihr schönes goldenes Antlitz der Erde wieder enthüllt oder nach dem bösen Winter der neue Lenz mit schmeichelndem Zephyr die Fluren fächelt, steht über Nacht die ganze Natur in neuem Gewande, in neuen Farben, in neuer Jugend da –, so hat sich im Nu, sobald ich mich blicken ließ, euer ganzes Wesen verwandelt, und was gewiegte Redner mit einer langen und wohlstudierten Ansprache kaum zustande bringen – ich meine, die schlimmen Sorgen verscheuchen –, ist mir mit dem ersten Schritt vor euch hin gelungen.
Warum ich aber heute in dieser ungewöhnlichen Tracht auftrete, sollt ihr sofort vernehmen, falls ihr geruht, mir euer Ohr zu leihen – aber bitte nicht das, womit ihr euch einen frommen Prediger anhört, sondern das andere, das ihr so munter spitzt, sobald ein Marktschreier, ein Hanswurst oder ein Narr in der Schellenkappe seine Witze reißt. Es kam mich nämlich die Lust an, vor euch für ein Stündchen den Sophisten zu spielen – nicht einen von den modernen, die auf den hohen Schulen die Gelbschnäbel mit verzwicktem Unsinn stopfen und zu mehr als weibermäßiger Ausdauer im Zanken abrichten – behüte! Ich halte mich an das Beispiel jener Alten, die von dem anrüchigen Titel »der Weise« nichts wissen wollen und sich bescheiden nur Freunde der Weisheit, Sophisten, nannten. Und da sie nichts lieber taten, als auf Götter und Helden Lobreden halten, so werdet auch ihr eine Lobrede hören; nur gilt sie nicht Herkules und nicht Solon, sondern mir selbst, der Torheit. Ich pfeife nämlich auf jene Weisen, die es gleich bodenlose Dummheit und Unverschämtheit heißen, sobald sich einer selbst lobt. Sei es so dumm, wie sie wollten – wenn sie nur einräumen, es stehe mir gut. Was stimmte nun schöner zusammen, als wenn die Torheit selbst ihren Ruhm ausposaunt und selbst ihr Loblied singt? Denn wer vermöchte mich besser zu geben als ich mich selbst? Der müßte mich schon genauer kennen als ich. Ohnehin will mir das viel passender vorkommen, als was die vornehmen und weisen Herren insgemein tun. Die pflegen in einer Art Scham, die das Gegenteil ist, sich einen katzbuckelnden Redekünstler oder phrasendreschenden Poeten zu bestellen und zahlen ihm Honorar, um aus seinem Munde ihr Lob sich anzuhören, will heißen, eine Lüge dicker als die andere; dabei spreizt sich unser schamhafter Mann wie ein Pfau, und mächtig schwillt ihm der Kamm, wenn der ausgeschämte Lobhudler ihn, den Wicht, einem Gott vergleicht, wenn er ihn preist als vollendetes Muster einer jeden Tugend – himmelweit weiß sich jener selbst davon entfernt –, wenn er die Krähe mit fremden Federn aufputzt, den Mohren weißwäscht, aus einer Mücke einen Elefanten macht. Und schließlich: ich halte es mit dem Sprichwort, das da sagt: »Lobe dich ruhig selbst, wenn es kein anderer für dich tun will.« Freilich muß ich dabei sagen, daß die Undankbarkeit – oder ist es Faulheit? der Menschen mich befremdet. Denn alle machen mir eifrig den Hof und sonnen sich gern in meiner Gnade, aber unter so vielen Generationen ist nicht einer gewesen, der mit dankbaren Worten der Torheit ein Kränzchen gewunden hätte. Dagegen ein Busiris, ein Phalaris, das Fieber, die Mücken, der Haarschwund und dergleichen Plagen fanden genug Leute, die sich das Öl und den Schlaf nicht reuen ließen, bis die Lobrede feingedrechselt neben der ausgebrannten Lampe lag.
Was ihr von mir zu hören bekommt, ist allerdings bloß eine richtige Stegreifrede, kunstlos, doch ehrlich. Und meint mir nicht, das sei nach Rednermanier gelogen, nur um mein Genie recht leuchten zu lassen. Ihr kennt das ja: rückt einer auf mit einer Rede, über der er dreißig Jahre gebrütet hat – oft ist sie auch gestohlen –, so schwört er euch, er habe sie in drei Tagen wie spielend hingeschrieben oder gar diktiert. O nein – ich liebte es von jeher, alles zu sagen, was mir Dummes just auf die Zunge kommt. Nur erwartet nicht, daß ich mich nach der Schablone der gewöhnlichen Redner definiere oder gar disponiere.
Ein übler Anfang wäre beides; denn eine Kraft, die in der ganzen Welt wirkt, läßt sich in keine Formel bannen, und eine Gottheit zerstückelt man nicht, zu deren Verehrung sich alle Kreatur zusammenfindet. Was sollte auch eine Definition? Sie würde euch nur einen Umriß, ein blutleeres Schattenbild zeigen, und habt mich doch da in aller Leibhaftigkeit vor euern Augen und seht in eigener Person die wahre Geberin aller Gaben, das Wesen, das jedes Volk in seiner Sprache die Torheit heißt.
Doch wozu das noch sagen? Auf meinem Gesicht steht deutlich genug zu lesen, wer ich bin; und sollte einer behaupten, ich sei Minerva oder die weise Sophia, so lehrt ein Blick in meine Augen, daß er lügt, selbst wenn mir die Sprache fehlte, der ehrlichste Spiegel der Seele. Von Schminke weiß ich nichts, nichts spricht mein Mund, als was ich denke, und vom Scheitel bis zur Sohle bin ich echt. Drum können auch die mich nicht verleugnen, die mit Bedacht sich von der Weisheit Maske und Titel borgen und darin stolzieren wie der Affe im Purpur und der Esel in der Löwenhaut: trotz aller Verstellung gucken irgendwo die Eselsohren heraus. Eine undankbare Gesellschaft! Wenn irgendjemand, so gehören sie zu meiner Fahne; sie aber schämen sich vor den Leuten meines Namens und werfen ihn allerorts dem an den Kopf, den sie beschimpfen wollen. Da sie nun faktisch Idioten sind, sich aber als Philosophen aufspielen, dürften wir sie nicht Idiotosophen taufen? Ich gedenke es nämlich auch in den Fremdwörtern den modernen Stilisten gleichzutun, denen es ein himmlisches Vergnügen macht, wie ein Blutegel zwei Zungen zu weisen, und die ein Meisterwerk zu vollbringen meinen, wenn sie in ihr Latein alle Augenblicke eine griechische Vokabel wie einen bunten Stickfaden einflechten, auch wo sie nicht hinpaßt; und fehlt ihnen ein Fremdwort, so graben sie aus schimmligen Folianten ein paar veraltete Wörter aus und hoffen, damit dem Leser etwas vorzumachen: wer sie versteht, soll sich nur ungeniert etwas einbilden, und wer sie nicht versteht, soll um so besser vom Schreiber denken, je schlechter er ihn versteht; ist es doch eine besondere Liebhaberei meiner Leute, vor dem Fremdesten sich am tiefsten zu verbeugen. Wer mehr auf sich hält, muß zumindest verständnisvoll nicken und klatschen und wie der Esel mit den Ohren wackeln, damit man meint, er sei durchaus auf der Höhe. Doch lassen wir das – zurück zum Thema!
Meinen Namen also wüßtet ihr, meine – ja, wie soll ich euch titulieren? Sagen wir einfach Meistertoren; denn hätte eine höhere Weihe Göttin Torheit an ihre Bekenner zu vergeben? Aber weil nicht eben viele von meiner Herkunft etwas wissen, so versuche ich nun, davon zu erzählen – die Musen seien mir gnädig.
Mein Vater ist nicht das Chaos, nicht der Orkus, nicht Saturn, nicht Iapetus oder ein anderer abgedankter und vermoderter Gott, sondern Plutos, der Reichtum in Person. Er ist, trotz Hesiod und Homer und auch trotz Jupiter selbst, allein der Menschen und Götter Vater; ein Wink seiner Brauen genügt, um jetzt wie ehedem die ganze Welt mit allem, was heilig und unheilig darinnen ist, auf den Kopf zu stellen; sein Wille beherrscht den Krieg, den Frieden, Armeen, Räte, Gerichte, Versammlungen, Heiraten, Verträge, Bündnisse, Gesetze, Künste, Kurzweil, Arbeit – der Atem geht mir aus –, kurz alles, was die Menschen im Staat und im Hause beschäftigt; ohne ihn wäre das ganze Völklein der Götter von Dichters Gnaden, ja, offen gesagt, wären auch die Gottheiten erster Klasse überhaupt nicht am Leben oder könnten daheim sitzen und sehen, woher sie etwas Warmes kriegen; wer schlecht mit ihm steht, dem vermag auch Pallas nicht zu helfen, wer gut, darf ruhig Jupiter samt seinen Blitzen eine lange Nase machen. »Dessen Tochter zu sein, darf ich mich rühmen.« Und zwar schuf er mich nicht aus seinem Gehirn wie Jupiter die finstere, mürrische Pallas; nein, mit Neotes zeugte er mich, mit der leibhaftigen Jugend, der anmutigsten, schalkhaftesten Nymphe, und er tat es auch nicht in der Fron der öden Ehe wie der Vater jenes hinkenden Schmiedes – nein, er hatte sich ihr, was viel schöner, »in Liebe gesellet«, um mit Freund Homer zu reden.
Mein Vater war aber damals nicht etwa der Greis, den ihr aus Aristophanes kennt, der stockblinde Mümmel; ein frischer Jüngling war er, in dem »warm die Jugend pulste«, und außer der Jugend noch mehr der Nektar, den er just damals beim Göttergelage in größerer Fülle und Stärke sich heruntergegossen hatte.
Fragt ihr nach der Stätte meiner Geburt (man meint ja heutzutage, wie vornehm einer sei, komme vor allem darauf an, wo der Säugling den ersten Schrei tat): ich bin geboren nicht auf dem schwimmenden Delos, nicht aus dem Schaume des Meeres, nicht in gewölbter Grotte, nein, mitten auf den Inseln der Seligen, wo niemand sät und niemand pflügt und von selbst alles sprießt. Nicht Mühsal kennt man dort, nicht Alter, nicht Krankheit; nirgends auf den Fluren sieht man Knoblauch, Malven, Zwiebeln, Erbsen, Bohnen und dergleichen gemeines Gemüse, wohl aber umschmeichelt auf Schritt und Tritt der herrlichste Flor euch Augen und Nase: das Wunderblümchen Moly, das Allheilkraut Panacee, Vergißdasleid, Majoran, Ambrosia, Lotus, Rosen, Veilchen, Hyazinthen – eine wahre Treibhauspracht. In dieser Herrlichkeit kam ich zur Welt, und darum begann ich mein Leben auch nicht mit Weinen – mein erstes war, die Mutter herzig anzulächeln. Und wie gern lasse ich dem erhabenen Kroniden die Geiß, die ihn nährte: mir reichten ja zwei allerliebste Nymphen die Brust – Methe, die weinselige Tochter des Bacchus, und der Wildfang Apädia, die Tochter des Pan. Sie beide seht ihr hier im Verein meiner übrigen Hofdamen und Zofen. Ich stelle sie euch vor, sofern ihr es wünscht – freilich anders als griechisch tue ich es nicht.
Die also dort mit den hochgezogenen Brauen ist die selbstgefällige Philautia; die andere – ihre Augen lachen euch an und ihre Hände regen sich zum Klatschen – ist die schmeichelnde Kolakia; die dritte dort, die schlaftrunken einzunicken scheint, die gedächtnisschwache Lethe; die nächste, die beide Ellbogen aufstützt und die Hände verschränkt, die bequeme Misoponia; die folgende, die den Kranz von Rosen trägt und von Salben trieft, die freudentrunkene Hedone; die da mit dem irren, unsteten Blick die gedankenlose Anoia; ihre Nachbarin mit dem blühenden Gesicht und der stattlichen Leibesrundung die üppige Tryphe. Auch zwei männliche Gottheiten seht ihr bei den Mädchen – dort den ausgelassenen Komos, der bei keinem Gelage fehlt, und hier Hypnos, den Langschläfer. Das ist mein Gefolge, und ich sage euch: dank seinen treuen Diensten unterwerfe ich alle Welt meinem Willen und bin Königin über die Könige.
Abkunft, Erziehung und Hofstaat kennt ihr. Aber immer noch glaubt vielleicht einer, den Titel Göttin zu führen sei ich doch nicht befugt. Hört also brav zu, wenn ich euch nun zeige, welch große Dienste ich Göttern und Menschen erweise und wie weit meine göttliche Kraft reicht. Denn wenn der Mann recht hat, der einmal fein bemerkte, das erst mache zum Gott, den Menschenkindern Gutes zu tun, und wenn es in Ordnung ist, daß die in den Senat der Götter kamen, die dem Menschen den Weinbau, den Ackerbau oder eine andere nutzbringende Hantierung gelehrt haben, warum soll da nicht ich unter den Göttern die Erste sein und heißen, die ich allein allen alles schenke?
Zum ersten. Was könnte süßer, was kostbarer sein als das Leben an sich? Aber daß es entsteht – wer darf sich das gutschreiben außer mir? Denn nicht die Lanze der majestätischen Pallas, nicht die Ägis des wolkensammelnden Zeus erschafft oder verbreitet das Menschengeschlecht – bewahre! Der Göttervater und Menschenbeherrscher selbst, auf dessen Wink der ganze Olymp erbebt, muß ja seinen dreizackigen Blitz daheim lassen mitsamt seinem Titanenblick, mit dem er je nach Laune alle Götter zittern macht, und muß ganz wie ein Komödiant eine Maske anziehen, der Ärmste, sobald er einmal wieder tun will, was er nicht selten tut? ein Kindlein zeugen. Den Göttern ebenbürtig sind, wie sie meinen, die Stoiker. Aber zeigt mir einen dreifach, vierfach, hundertfach gesiebten Stoiker – auch er muß hier kapitulieren. Seinen Bart, das Zeichen des Weisen – der Bock führt freilich dasselbe –, mag er vielleicht behalten; aber seine hochmütigen Brauen muß er senken, seine gerunzelte Stirne muß er glätten, seine stahlharten Grundsätze muß er fallen lassen und muß eine Weile ein Kindskopf und Narr sein – mit einem Worte: mich, ja mich muß der Weise um Beistand bitten, will er Vater werden. Und warum nicht noch deutlicher reden, wie das doch meine Art ist? Was meint ihr: ist es der Kopf, das Gesicht, die Brust, die Hand, das Ohr, kurzum, ein sogenannter edler Teil, was einem Gott, was einem Menschen das Leben gibt?
Ich denke nein; vielmehr ein dermaßen törichtes, dermaßen lächerliches Etwas am Menschen ist der Stammhalter seines Geschlechts, daß man es, ohne zu lachen, gar nicht nennen kann; aber dieses Etwas ist der wahre heilige Quell, aus dem alle Wesen ihr Leben schöpfen, und nicht, wie der gute Pythagoras meinte, die Vierzahl.
Wo wäre ferner, ich bitte euch, der Mann, der noch Lust hätte, seinen Kopf in das Halfterband der Ehe zu strecken, wenn er, wie die Weisen tun, vorher die Schattenseiten dieses Standes bedacht hätte? Und welches Weib wollte mit einem Manne noch etwas zu schaffen haben, wenn es um die Gefahren und Schmerzen des Gebärens und die Plage des Aufziehens wüßte oder sich kümmerte? Verdankt ihr somit einem Ehebund euer Dasein, den Ehebund aber meiner Zofe, der unklugen Anoia, so werdet ihr verstehen, was ihr an mir habt. Und hat ein Weib einmal all das erlebt, wollte es nochmals dasselbe erleben, wenn nicht meine Lethe ihm gnädig dazu hülfe, es zu vergessen? Venus selbst wird es mir trotz aller Widerrede ihres Anbeters Lukrez nicht bestreiten, daß ohne mich ihre Kraft zu schwach ist und nicht zum Ziele gelangt. Es ist schon so: mein Werk ist jener Rausch, jenes lächerliche Getändel, dem die hochnäsigen Philosophen entstammen – Mönche heißt man sie heute – und die purpurgeschmückten Könige und die frommen Priester und schließlich alle die Götter der Poeten, eine so große Gesellschaft, daß sie im Olymp kaum Platz mehr findet, wie weit er sich auch dehnt.
Doch möchte es euch zu wenig bedeuten, daß ihr mir Pflanzstätte und Keim des Lebens verdankt; ich muß euch noch nachweisen, daß alles Schöne im ganzen Leben aus meiner Hand kommt.
Was ist nun aber das Leben, oder besser: ist das überhaupt ein Leben, wenn man sich daraus die Lust wegdenkt? Ich höre euer Nein – konnte ich doch wetten, daß keiner von euch so weise sei (oder so töricht? Nein, bleiben wir dabei: so weise sei), um anders zu denken; verschließen doch nicht einmal die Stoiker der Lust die Tür, auch wenn sie beharrlich dergleichen tun und ihr vor den Leuten tausend Schimpfwörter ins Gesicht schleudern – sie denken: verleiden wir sie den andern, so haben wir den doppelten Genuß. Doch nun sage mir einer bei Gott: wann wäre das Leben nicht trübselig, langweilig, reizlos, sinnlos, unerträglich ohne die Lust, das heißt, ohne die Würze der Torheit? Als Antwort könnte genügen, was der unvergleichliche Sophokles bezeugt, der über mich den prächtigen Ausspruch tat: »Die Torheit ist des Lebens schönster Teil«. Und doch – es sei euch Stück für Stück bewiesen.
Zum ersten. Wer weiß nicht, daß der Mensch nie wieder so fröhlich und der Liebling aller ist wie in der ersten Kindheit? Nun, was an den Kleinen tut es uns denn so an, daß wir sie abküssen und herzen und liebkosen, ja, daß auch der Feind an einem Kindlein zum Retter wird? Ist es nicht der verführerische Reiz der Torheit? Wohlweislich gab die kluge Natur den Neugeborenen ihn zum Angebinde: mit ihm sollten die wonnigen Geschöpfe alle Mühe der Wartung entgelten und Gunst und Schutz erschmeicheln können. Und dann die Jugendzeit! Wie hat doch jeder seine Freude an einem jungen Menschen, wie aufrichtig will ihm jeder wohl, wie eifrig fördert man ihn, wie dienstbereit streckt man ihm helfend die Hand entgegen? Woher aber diese Beliebtheit? Woher sonst, wenn nicht von mir? Denn daß er keine Gedanken hat, sich also auch keine macht, das ist mein Werk. Bei meiner Ehre: ist er erst älter und hat ihm Erfahrung und Studium schon etwas Mannesverstand beschert, so verblüht im Umsehen die Schönheit, verlöscht das Feuer, verstummt der Scherz, versiegt die Kraft. Und je weiter der Weg von mir wegführt, desto schwächer wird der Lebensgeist, bis endlich das mühselige Alter da ist, ein Greuel sich selbst so gut wie andern; ja, kein Mensch hielte es darin aus, wenn nicht ich wieder voll Erbarmen ihm an die Hand ginge: ich machs wie in den Gedichten die Götter, die ihre Schützlinge in der höchsten Not verwandeln, und rufe den alten Mann am Rande des Grabes noch einmal in die Kindheit zurück, solange es sein darf. Darum bezeichnet sie der Volksmund bei den Griechen nicht übel als »Nochmalskinder«.
Und die Methode meiner Verjüngungskur? Auch daraus will ich kein Geheimnis machen. Auf den Inseln der Seligen entspringt die Quelle rneiner lieben Lethe – denn was da in der Unterwelt fließt, ist bloß ein dünnes Bächlein –; zu ihr führe ich die Alten hin, aus ihr heiße ich sie den Trunk des Vergessens tun; dann löst sich langsam der quälende Druck, und sie werden wieder Kinder. »Ach geh doch!« so lacht man mich aus; »deine Alten sind einfach närrisch, sind nicht mehr bei Verstand.« Gewiß – aber das gerade heißt, wieder ein Kind sein. Oder ist das denn etwas anderes als ein Narr, als ein Mensch ohne Verstand? Oder macht uns ein Mensch in diesem Alter nicht deshalb so viel Freude, weil er so wenig Verstand hat? Denn vor einem Kinde, das klug sein will über sein Alter, entsetzt man sich wie vor einer Mißgeburt und bekreuzigt sich; und dabei gibt uns ein landläufiges Sprüchlein recht, das da sagt:
Behüt' mich Gott vor einem Kind,
Dem Weisheit von den Lippen rinnt!
Allein auch mit einem Greise, dem zu seiner reichen Erfahrung noch gleichwertige Kraft des Denkens und Schärfe des Urteils beschieden wäre, wollte schwerlich jemand Verkehr und Umgang haben, und darum mache ich ihn in Gnaden zum Narren. Mein Narr weiß nichts von den schweren Gedanken, die den Weisen foltern, mein Narr macht noch gern seine Späßchen bei einem Glase Wein und spürt nichts von dem Lebensüberdruß, dessen sich manch kräftiger Mann kaum erwehrt; nicht selten lernt er wieder das Wörtlein »Ich liebe dich« – ein armer Tropf, wenn er bei Verstande wäre! Er ist bei alledem dank meiner Gnade glücklich, ist bei den Freunden willkommen, ist auch zu einem lustigen Streich noch wohl zu brauchen. Es steht doch auch bei Homer zu lesen, honigsüß habe Nestor gesprochen, Achilles aber gallig, und derselbe Dichter weiß, daß die greisen Trojaner, die auf der Stadtmauer oben saßen, fein und lieblich wie die Zikaden zirpten. Und das ist ein Trumpf, mit dem das Alter die Kindheit noch aussticht: die ist freilich köstlich, aber stumm und muß verzichten auf den Hauptspaß im Leben – aufs Schwatzen. Nehmt dazu, daß die Alten gerade an den Jüngsten den Narren gefressen haben und umgekehrt die Jüngsten am liebsten bei den Alten sind, ganz wie Homer sagt: »Wie doch gesellet der Gott stetsfort den Gleichen zum Gleichen!« Was unterscheidet sie denn auch, als der eine Runzeln hat und mehr Geburtstage zählt? Sonst sind die Greise genau wie die Kinder: silbern ist ihr Haar, zahnlos ihr Mund, zwerghaft ihr Wuchs; ihr Labsal ist Milch; sie stammeln, sie plappern, sind kindisch, vergeßlich, gedankenlos. Je mehr es dem Alter zugeht, desto näher kommen sie wieder der Kindheit, bis sie wie Kinder, des Lebens gar nicht müde, des Todes gar nicht gewärtig, fortwandern aus dem Dasein.