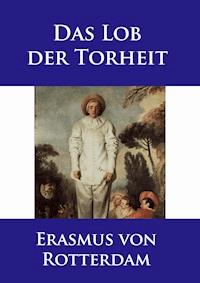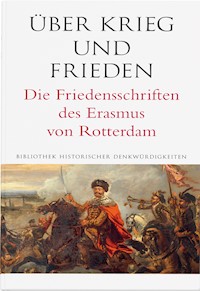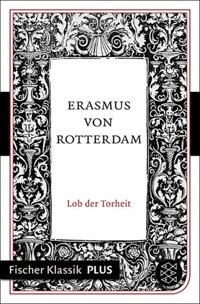10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit scharfsinniger Kritik und humanistischem Idealismus stellt dieser klassische Text die drängende Frage nach Frieden in einer von Auseinandersetzungen geprägten Welt – und ist damit heute von erschütternder, doch wegweisender Aktualität.
Im kriegs- und konfliktgebeutelten Europa verleiht Erasmus von Rotterdam 1517 der Friedensgöttin Pax eine Stimme: Ihre Klage über den heillosen Zustand der Welt ist zugleich Anklage der Mächtigen und Aufruf eines jeden Einzelnen dazu, die verheerenden Folgen von Krieg und Gewalt nicht hinzunehmen. Sie erinnert daran, die Hoffnung auf Frieden nicht aufzugeben und sich allen politischen Wirren zum Trotz für Versöhnung und Frieden einzusetzen, statt mit Waffen durch Dialog, Vernunft und Menschlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Desiderius Erasmus von Rotterdam
Die Klage des Friedens
Übertragen und herausgegebenvon Kurt Steinmann
Insel Verlag
QUERELA PACISUNDIQUE GENTIUM EIECTAEPROFLIGATAEQUEDIE KLAGE DES FRIEDENSDER VON ALLEN VÖLKERNVERSTOSSEN UNDNIEDERGESCHLAGENWURDE
DER FRIEDE SPRICHT:
Wenn sich die sterblichen Menschen von mir, obwohl ich es zwar nicht verdiene, abwendeten, mich verstießen und niederschlügen, dies aber doch ihrem Interesse diente, würde ich nur das Unrecht an mir und ihre Rücksichtslosigkeit beklagen. Da sie mich nun aber niedergestreckt haben und damit sogleich den Quell allen menschlichen Glücks von vornherein von sich fernhalten und sich ein Meer von vielfältigen Plagen aufhalsen, muß ich nun mehr über ihr Unglück als über mein erlittenes Unrecht weinen, und ich sehe mich darum genötigt, jene zu bedauern und zu bemitleiden, denen ich lieber nur gezürnt hätte! Denn es ist in jedem Fall unmenschlich, einen Liebenden von sich fortzustoßen, es ist undankbar, sich von einem Wohltäter abzuwenden, es ist gewissenlos, den Begründer und Erhalter von allem zu mißhandeln. Und scheint es nicht geradezu der Gipfel der Tollheit, sich selbst die vielen außerordentlichen Segnungen, die ich mit mir bringe, zu versagen und dafür aus freien Stücken ein so widerwärtiges vielköpfiges Ungeheuer herbeizurufen, das tausendfältige Übel gebiert? Es ist richtig, sich über Verbrecher zu empören; doch die derart von Furien Gehetzten können wir nur beklagen. Sie sind gewiß aus keinem anderen Grund mehr zu beklagen, als daß sie sich selbst nicht beklagen, und sie sind um so unglücklicher, weil sie ihr eigenes Unglück nicht wahrnehmen, zumal es ja doch schon der erste Schritt hin zur Genesung ist, die Schwere der eigenen Krankheit zu erkennen. Wenn ich also wirklich jener Friede bin, der von Götter- und Menschenstimmen zugleich gepriesene Quell, der Schöpfer und Ernährer, der Mehrer, der Beschützer aller Güter im Himmel und auf Erden, wenn ohne mich nichts je gedeihlich, nichts sicher, nichts rein oder heilig, nichts den Menschen angenehm und den Himmlischen willkommen ist: wenn im Gegensatz zu alledem der Krieg ein für allemal ein wahrer Ozean jeglichen Übels ist, das es überhaupt in der Natur geben kann, wenn durch seine Schuld plötzlich das Blühende welkt, das Angesammelte zerfällt, das Gefestigte wankt, das Wohlgegründete untergeht, das Süße bitter wird, wenn der Krieg schließlich etwas so Unheiliges ist, daß er sich wie eine Pest im Nu auf jegliche Frömmigkeit und Religion auswirkt, wenn nichts für die Menschen tragischer ist als bereits ein einziger Krieg, nichts den Himmlischen verhaßter – dann frage ich beim unsterblichen Gott: Wer mag da glauben, daß es Menschen sind, mag glauben, daß sie auch nur ein Fünkchen gesunden Verstand besitzen, die mich, die so Segensreiche, mit solchem Aufwand, solcher Beflissenheit, solcher Anstrengung, soviel Tricks, soviel Mühen und Risiken zu verjagen trachten und sich eine Unmenge von Plagen so teuer einzuhandeln suchen?
Wenn mich die wilden Tiere auf diese Weise verschmähten, nähme ich es leichter hin und schriebe die mir zugefügte Schmach ihrer Natur zu, die ihnen ein grausames Wesen eingepflanzt hat; wenn ich stummem Vieh verhaßt wäre, würde ich es seiner Unwissenheit zugute halten, weil ihm jene Geisteskraft versagt ist, die allein meine trefflichen Eigenschaften erkennen kann. Aber welch empörender und mehr als befremdender Zustand: Die Natur brachte ein einziges Lebewesen hervor, das mit Vernunft begabt und für den göttlichen Geist empfänglich ist, sie erschuf ein einziges Wesen, das zu Wohlwollen und Eintracht fähig ist – und dennoch: Bei den grausamsten Bestien und beim noch so stumpfsinnigen Vieh fände ich wohl eher Platz als bei den Menschen! Selbst zwischen den so zahlreichen Himmelskörpern bestehen und wirken, mögen auch ihre Umlaufbahnen nicht dieselben, mag auch ihre Energie nicht die gleiche sein, doch seit Urzeiten Gesetze. Die einander bekämpfenden Kräfte der Elemente bewahren durch ihr stabiles Gleichgewicht einen ewigen Frieden und fördern, bei allem Widerstreit, durch Harmonie und wechselseitigen Austausch die Eintracht. Wie verläßlich ist doch im Körper der Lebewesen das harmonische Zusammenwirken der Organe, wie groß die Entschlossenheit zu gegenseitiger Verteidigung! Was ist so grundverschieden wie Leib und Seele? Und dennoch offenbart freilich erst ihre Trennung, mit welch engen Banden die Natur diese beiden verknüpft hat. Wie demnach das Leben nichts anderes ist als die Gemeinschaft von Leib und Seele, so besteht die Gesundheit im Zusammenklang aller Eigenschaften des Körpers. Die vernunftlosen Tiere verbringen ihr Dasein innerhalb ihrer eigenen Gattung gesittet und einträchtig. In Herden leben die Elefanten, in Scharen weiden Schweine und Schafe, in Schwärmen fliegen die Kraniche und Dohlen, die Störche, noch immer die Lehrmeister treuer Hingabe, halten ihre Versammlungen ab, und durch gegenseitige Hilfeleistungen schützen sich die Delphine. Bekannt ist die Eintracht im Ameisen- und Bienenstaat. Aber was fahre ich fort, über die zu sprechen, die zwar keine Vernunft, wohl aber Sinnesempfindung besitzen?
Sogar an Bäumen und Pflanzen kann man Freundschaft beobachten. Manche bleiben unfruchtbar, wenn man ihnen nicht ein männliches Exemplar beigesellt; der Weinstock umschlingt die Ulme1, den Weinstock liebt der Pfirsich. Die, die also sonst nichts empfinden, scheinen dennoch die Wohltat des Friedens zu empfinden. Die aber wieder, die keine Empfindungsfähigkeit besitzen, sind den Empfindungsfähigen immerhin dadurch nahe verwandt, daß sie Leben in sich haben. Was ist so gefühllos wie die Klasse der Minerale? Dennoch ließe sich sagen, daß auch ihnen ein Sinn für Frieden und Eintracht innewohnt. So zieht der Magnet das Eisen an und hält es fest. Welches Gesetz gilt selbst unter den grausamsten Raubtieren? Die Wildheit der Löwen richtet sich nicht gegen ihresgleichen. Der Eber wetzt seine blitzenden Hauer nicht gegen einen anderen Eber. Der Luchs hält mit dem Luchs Frieden. Die Schlange wütet nicht gegen die Schlange. Die Eintracht der Wölfe ist sogar sprichwörtlich geworden. Ich will hinzufügen, was noch erstaunlicher scheint: Die bösen Geister, die das Band der Eintracht zwischen Gott und Mensch zuerst zerrissen und noch heute zerreißen, haben gleichwohl unter sich ein Bündnis und halten ihre wie auch immer geartete Schreckensherrschaft durch gegenseitiges Einvernehmen aufrecht.
Einzig die Menschen, denen am meisten von allen die Einmütigkeit anstünde und die ihrer auch zuallererst bedürften, verbindet weder die sonst so mächtige und wirksame Natur noch die Erziehung, noch schweißen sie die zahlreichen Vorteile zusammen, die dieser Gleichgesinntheit entspringen würden, noch leitet sie schließlich die Wahrnehmung und Erfahrung so vieler Katastrophen zu gegenseitiger Liebe. Alle Menschen haben dieselbe Gestalt, dieselbe Stimme; und während die übrigen Arten der Lebewesen sich vor allem durch die Körperform unterscheiden, ist allein dem Menschen die Kraft der Vernunft verliehen, die unter seinesgleichen so ausgeprägt das gemeinsame Merkmal ist, daß er sie mit keinem der anderen Lebewesen teilt. Allein diesem Lebewesen ist die Sprache gegeben, die vorzüglichste Stifterin freundschaftlicher Beziehungen. Eingepflanzt sind ihm die Keime des Wissens und der Tugend sowie ein sanftes und friedliches Naturell, das zu gegenseitigem Wohlwollen neigt, damit es freudig um seiner selbst willen geliebt werde und es ihm Vergnügen bereite, anderen gute Dienste zu erweisen, es sei denn, daß einer durch schlimmen Eigennutz, wie durch Kirkes2 Zaubertränke verführt, vom Menschen zum Tier entartet. Daher rührt es offenbar, daß man allgemein alles, was das gegenseitige Wohlwollen betrifft, »menschlich« nennt. Die Natur schenkte ihm noch die Gabe der Tränen, dieses Kennzeichen eines Bitten zugänglichen Gemüts, wodurch er sich leicht wieder aussöhnt, wenn etwa ein kränkendes Wort gefallen ist und ein Wölklein den heiteren Glanz der Freundschaft trübt. Sieh, wie viele Mittel und Wege die Natur aufbot, um uns Eintracht zu lehren! Dennoch nicht zufrieden mit diesen Verlockungen zum friedfertigen Leben, wollte sie, daß die Freundschaft dem Menschen nicht nur ein Vergnügen, sondern auch eine Notwendigkeit sei. Deshalb teilte sie die körperlichen und geistigen Gaben so zu, daß niemand so ausgestattet ist, daß er nicht bisweilen durch eine Dienstleistung auch von Schwachen Hilfe erfährt, und sie verlieh nicht allen dieselben Gaben und im gleichen Maß, damit diese Ungleichheit durch gegenseitige Freundschaft wettgemacht werde. In manchen Gegenden wächst dies, in andern das, so daß allein schon der Bedarf den wechselseitigen Handel empfiehlt.
Den übrigen Lebewesen teilte die Natur eigene Waffen und Schutzvorrichtungen zu, damit sie sich mit ihnen schützen können; einzig den Menschen erschuf sie wehrlos und gebrechlich und durch gar nichts anderes gesichert als durch Bündnis und gegenseitige enge Beziehungen. Die Not ließ die Staaten erfinden, und die Not lehrte sie das Bündnis untereinander, damit sie sich so gegen die Gewalt von wilden Tieren und Räubern mit vereinten Kräften zur Wehr setzen könnten. So gibt es nichts in den menschlichen Belangen, was sich selbst genügt. Schon in den Uranfängen des Lebens wäre es mit dem Menschengeschlecht sofort vorbei gewesen, wenn nicht die eheliche Eintracht es nach seiner Erschaffung fortgepflanzt hätte. Der Mensch würde sicherlich nicht geboren werden oder müßte bald nach seiner Geburt sterben und just an der Schwelle des Lebens sein Leben verlieren, wenn nicht die freundliche Hand der Hebammen, wenn nicht das herzliche Pflichtgefühl der Ammen dem kleinen Wurm zu Hilfe eilten. Zu diesem Zweck pflanzte die Natur mit größter Leidenschaft jene Flämmchen inniger Zuneigung ein, so daß die Eltern jenes bereits lieben, was sie noch nicht gesehen haben. Hinzu fügte sie noch die Anhänglichkeit der Kinder an ihre Eltern, damit deren Hilfsbedürftigkeit durch den Beistand jener gelindert werde und jene enge Verbundenheit entstünde, die zwar von allen in gleicher Weise geschätzt, von den Griechen aber besonders zutreffend Antipelargosis3, das heißt »Storchenliebe«, genannt wurde. Dazu kommen noch die Bande der Blutsverwandtschaft und der Verschwägerung. Bei einigen tritt außerdem als zuverlässigste Stifterin des Wohlwollens die Ähnlichkeit des Naturells, der Interessen und der äußeren Erscheinung hinzu und bei vielen eine Art geheimer Seelenverwandtschaft und ein wunderbarer Antrieb zu gegenseitiger Liebe, den die Alten staunend dem Walten einer Gottheit zuschrieben.
Mit so vielen Beweisen lehrte die Natur Frieden und Eintracht, mit so vielen Lockmitteln fordert sie dazu auf, mit so vielen Stricken zieht sie, mit so vielen Beispielen drängt sie dazu! Und nach alldem: Welche Rachegöttin hat denn, um wirksam zu schaden, all diese Bindungen zerrissen, zerstört und zerschlagen und dafür eine unersättliche Kampfwut den Herzen der Menschen eingepflanzt? Wenn nicht die Gewöhnung zuerst das Befremden über und dann auch das Wahrnehmungsvermögen für das Böse schwinden ließe, wer würde glauben, daß diese Leute mit menschlicher Sinnesart begabt sind, die in unaufhörlichen Zerwürfnissen, Zwisten und Kriegen sich messen, einander befehden und Lärm und Aufruhr veranstalten? Schließlich stürzen sie durch Raubüberfälle, Blutvergießen, Totschlag und Zerstörungen alles in ein Chaos, das Sakrale wie das Profane, und keine Verträge sind je so heilig, daß sie die zu gegenseitiger Vernichtung sich austobenden Kampfhähne trennen könnten. Ohne daß es eines Zusatzes bedürfte, müßte der gemeinsame Name »Mensch« genügen, daß Menschen gut miteinander auskommen.
Nun gut: Die bei den Tieren äußerst wirkungsvolle Natur mag bei den Menschen nichts erreicht haben. Hat also Christus bei den Christen auch nichts erreicht? Mag die Unterweisung der Natur, die bei den Wesen ohne Denkvermögen den größten Einfluß hat, bei den Menschen zu wenig nachhaltig sein; warum aber überzeugt dann die Lehre Christi, obwohl sie doch jener gegenüber viel vortrefflicher ist, ihre Bekenner nicht von dem, was sie am dringlichsten rät, nämlich vom Frieden und vom gegenseitigen Wohlwollen? Oder gewöhnt sie ihnen wenigstens diesen so gottlosen und brutalen Wahnsinn, Kriege zu führen, ab? Wenn ich das Wort »Mensch« höre, laufe ich schnell hin wie zu einem speziell für mich geborenen Lebewesen, voll Zuversicht, daß ich dort Ruhe finden könnte; wenn ich den Ruhmestitel »Christen« höre, fliege ich noch schneller heran, voll Hoffnung, daß ich bei denen gewiß sogar als König werde herrschen können. Aber gerade da muß ich voll Scham und Verdruß sagen: Marktplätze, Gerichtshallen, Rathäuser und Kirchen erdröhnen an allen Ecken und Enden so vom Gekreische der Streithähne wie nirgends sonst bei den Heiden. So mißlich ist es, daß sogar die Schar der Advokaten, obgleich sie für einen Großteil des menschlichen Unglücks verantwortlich ist, doch nur eine geringe Zahl und eine einsame Insel im Meer der Streitenden bildet. Ich erblicke eine Stadt, und sogleich keimt Hoffnung auf, wenigstens zwischen denen herrsche ein gutes Einvernehmen, die von denselben Ringmauern umschlossen, von denselben Gesetzen geleitet werden und durch gemeinsame Gefahr verbunden sind, als seien sie Passagiere in einem Schiff. Aber, o ich Beklagenswerter! Auch hier muß ich davon Kenntnis nehmen, wie alles durch Entzweiung verseucht ist, so sehr, daß es kaum möglich ist, ein Haus zu entdecken, in dem ich wenigstens für ein paar Tage Unterschlupf finden könnte. Aber ich lasse das gemeine Volk beiseite, das wie das Meer von den Fluten seiner Leidenschaften fortgerissen wird.