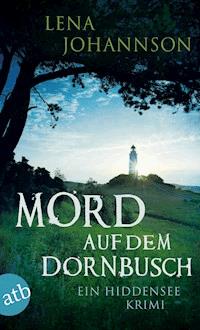6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lübeck im Jahre 1870. Marie Kröger, 16 Jahre alt, hat nur einen Traum: Sie will einmal Tänzerin werden. Doch als ihr älterer Bruder ums Leben kommt, soll sie die väterliche Konditorei übernehmen. Schweren Herzens fügt sich Marie dem Willen des schwerkranken Vaters und muss sich nun nicht nur den Respekt der Angestellten erkämpfen, sondern auch das Vertrauen der Kunden gewinnen – zu denen auch der russische Zar gehört. Hilfe erhofft sie sich von einem geheimnisvollen Marzipanrezept, das sich seit Generationen im Besitz ihrer Familie befindet. Nur Marie weiß, wo ihr verstorbener Bruder es aufbewahrte. Kann dieses Rezept Marie und die Konditorei vor dem Ruin retten? Das Marzipanmädchen von Lena Johannson: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Lena Johannson
Das Marzipanmädchen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Lübeck im Jahre 1870. Marie Kröger, 16 Jahre alt, hat nur einen Traum: Sie will einmal Tänzerin werden. Doch als ihr älterer Bruder ums Leben kommt, soll sie die väterliche Konditorei übernehmen. Schweren Herzens fügt sich Marie dem Willen des schwerkranken Vaters und muss sich nun nicht nur den Respekt der Angestellten erkämpfen, sondern auch das Vertrauen der Kunden gewinnen, zu denen auch der russische Zar gehört. Hilfe erhofft sie sich von einem geheimnisvollen Marzipanrezept, das sich seit Generationen im Besitz ihrer Familie befindet. Nur Marie weiß, wo ihr verstorbener Bruder es aufbewahrte.Kann dieses Rezept Marie und die Konditorei vor dem Ruin retten?
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Epilog
Glossar
Meiner Mutter,
die Marie an
Mut und Stärke
nicht nachsteht
Prolog
Sehr verehrte Gäste, Herr Bürgermeister, Freunde der Konditorei Andresen! Lübeck hat eine schwere Zeit hinter sich. Wir alle haben eine schwere Zeit hinter uns.« Frederick Andresen, Juniorchef der Konditorei, die in der Hansestadt seit über hundert Jahren ansässig war, blickte in die Runde. Die einen waren noch vom Krieg gezeichnet, die anderen strahlten voller Zuversicht aus bereits feisten Wohlstandsgesichtern. »Doch die ist Vergangenheit. Wie in unserer stolzen Heimatstadt üblich, blicken wir nach vorn, packen an und sehen einer großen Zukunft entgegen. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, heute am 15. Mai 1948 die Wiedereröffnung der Marzipanfabrik Andresen mit Ihnen zu feiern.«
Erster Applaus erklang. Andresen strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Er hatte die gleichen blonden ungestümen Locken, die seine Großmutter als junges Mädchen gehabt hatte.
Mit leuchtenden Augen fuhr er fort: »Ebenso erkläre ich hiermit den Süßen Salon für eröffnet. Möge diese Probierstube die gute Stube der Lübecker werden und viele Gäste, die unsere Hansestadt besuchen, mit ihren Köstlichkeiten anziehen.«
Sein Blick wanderte zu einem Stuhl, auf dem eine alte Dame saß. Ihr Rücken war trotz der vielen Jahre harter Arbeit sehr gerade, ihre Hände, die im Schoß lagen, waren krumm mit knotigen Fingern. In ihrem altmodischen weißen Spitzenkleid sah sie zerbrechlich aus. Das weiße Haar war mit Nadeln streng zurückgesteckt, die Augen hatte sie geschlossen. Ihre Kopfhaltung verriet Frederick jedoch, dass sie ihm aufmerksam zuhörte.
»Wie Sie sehen können, meine Damen und Herren, haben wir hier ein kleines Museum eingerichtet, denn nicht nur die Herstellung des feinsten Lübecker Marzipans ist interessant, sondern auch die wechselvolle Geschichte des Hauses Andresen. Ich verrate Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass es das Familienrezept für Marzipan ist, das uns so erfolgreich gemacht hat. Vielleicht wissen aber nicht alle von Ihnen, dass es im Laufe der Jahre immer wieder Versuche gegeben hat, eben dieses Rezept zu stehlen – auf die eine oder andere mal mehr, mal weniger perfide Weise.«
Die alte Dame zuckte kaum sichtbar zusammen.
»Auch davon wird in diesem Museum berichtet, damit die Nachwelt es nicht vergisst. Was Sie in diesem Museum nicht finden werden, ist die begehrte Rezeptur. Sie brauchen sich also gar nicht auf die Suche zu machen. Sie ist nach wie vor an einem geheimen Ort gut versteckt, den ausschließlich Familienmitglieder kennen. Ich bin übrigens noch Junggeselle. Falls eine der Herrschaften eine hübsche, gescheite Tochter haben sollte …«
Die Gesellschaft aus ausnahmslos betuchten Lübecker Kaufleuten und Regionalpolitikern lachte höflich. Natürlich befand sich niemand darunter, der auch nur daran gedacht hätte, sich das berüchtigte Rezept auf illegalem Weg anzueignen. Ebenso wenig war jemand anwesend, der eine Tochter im heiratsfähigen Alter hatte und nicht ein Auge auf den begehrten Andresen-Spross geworfen hätte.
»Die Geschichte des Marzipans in Lübeck ist untrennbar mit der meiner Familie verbunden. Bevor Sie gleich die neuen Kreationen unseres Hauses kosten dürfen, schenken Sie mir bitte noch wenige Minuten Ihr Gehör, denn ich möchte Ihnen in Kürze ebendiese Geschichte erzählen.«
I
Marie Kröger stampfte wütend mit dem Fuß auf, dass der zerkratzte Parkettboden, dem die Jahre all seinen Glanz genommen hatten, unter ihr vibrierte.
»Aber ich will Tänzerin werden. Und wenn Sie immer wieder mit den Grundschritten anfangen, nur weil ein neues Mädchen in die Gruppe kommt, dann schaffe ich es nie!«
»Willst du dich wohl mäßigen, Marie!« Fräulein Mühsam, die Ballettmeisterin und Schwester des Lübecker Apothekers, der in derselben Straße wohnte wie die Krögers, blickte streng auf Marie hinunter. Ihre kurz geschnittenen Haare klebten an ihrem Kopf, als wären sie mit Leim eingestrichen. Überhaupt, der Kopf! Irgendwie sah er aus, als wäre er zu klein geraten. Wie ein Streichholzköpfchen saß er auf einem viel zu langen dünnen Körper. Die dürren Arme verschränkte Fräulein Mühsam nun, und sie kniff die Augen zusammen. »Nur weil ein neues Mädchen in die Gruppe gekommen ist? Dann glaubst du wohl, du bist etwas Besseres als dieses Mädchen.«
Marie wollte protestieren, doch die Lehrerin fuhr bereits mit ihrer Strafpredigt fort: »Greta hat wie alle anderen hier das Recht, den Balletttanz von Grund auf zu studieren. Alle Elevinnen sind in meiner Stunde, um Anmut, Grazie und die Kunst des Tanzens zu erlernen.«
»Das will ich doch auch«, fiel Marie ihr eifrig ins Wort.
»Willst du mich wohl nicht unterbrechen«, wies Fräulein Mühsam sie zurecht. Sie begann in dem großen Zimmer, das bis auf ein Klavier und drei Hocker vollkommen leer war, auf und ab zu gehen. Der Rock ihres schlichten grauen Leinenkleides raschelte leise. »Du hast nicht die nötige Disziplin, um jemals Tänzerin zu werden. Du sehnst dich auf unanständige Weise nach Ruhm, aber du bist nicht bereit, dafür hart zu arbeiten.«
»Doch«, brach es aus Marie heraus. »Ich will ja dafür arbeiten. Nichts würde ich lieber tun, aber in Ihren Stunden geht es einfach nicht vorwärts.«
Die übrigen Schülerinnen, die bisher schweigend mit großen Augen und offenen Mündern den Disput verfolgt hatten, hielten es nicht mehr länger aus und begannen eifrig miteinander zu tuscheln. Die eine flüsterte der anderen etwas ins Ohr, die Nächste machte wieder einer anderen Zeichen. Man hörte das Knistern der weißen Ballettröcke. Die Lippen der Lehrerin verzogen sich zu einem eisigen spöttischen Lächeln.
»Wenn du glaubst, du kannst es mit einer anderen Lehrmeisterin zur Primaballerina bringen, dann sieh dich ruhig nach einer um. Nur zu, hier bist du nicht mehr willkommen!« Der letzte Satz fuhr wie ein Schwert durch die Luft. Das Tuscheln der Mädchen und das Rascheln der Röcke brachen schlagartig ab. Marie spürte, wie sich ein dicker Kloß in ihrem Hals bildete. Nein, sie würde nicht weinen. Nicht vor dieser blöden Mühsam und nicht vor den anderen dummen Gänsen.
Sie schluckte einmal und sagte dann laut, damit ihre Stimme nicht brüchig klang: »Das werde ich auch. Meine Eltern wollten mir schon lange eine bessere Ballettmeisterin suchen. Ich wollte es nicht. Aus Treue und Zuneigung zu Ihnen. Aber es scheint nun wohl das Beste zu sein.« Sie drehte sich auf dem Absatz um, dass ihre dicken Zöpfe nur so flogen, und verschwand mit stolz gerecktem Kinn aufrechten Schrittes in den dunklen Flur und von dort in das Nebenzimmer, wo die Schülerinnen ihre Straßenkleider während der Stunde aufbewahrten.
Marie freute sich diebisch über ihren Triumph. Nun gut, sie hatte etwas übertrieben, um nicht zu sagen gelogen. In Wahrheit lag sie ihrer Mutter seit Monaten in den Ohren, ihr endlich Privatunterricht zu bezahlen. Platz zum Üben gab es genug im Haus der Kaufmannsfamilie Kröger in der Beckergrube. Und die Kosten wären auch kein Problem gewesen. Aber ihre Mutter wollte davon nichts hören. Ihrer Meinung nach war Ballett der Anmut einer jungen Frau dienlich, daraus einen Beruf machen zu wollen hielt Margreth Kröger jedoch für Flausen im Kopf ihrer Tochter. Während diese ihr Ballettkleid gegen das cremefarbene Sommerkleid tauschte, dachte sie darüber nach, wie sie ihre Mutter von der Notwendigkeit einer Privatlehrerin überzeugen könnte. Vielleicht könnte ihr Bruder Johann-Alexander ein gutes Wort für sie einlegen, wenn er zurückkam. »Du bist hier nicht mehr willkommen«, hatte Fräulein Mühsam gesagt. Nun, das könnte man ihrer Mutter gegenüber wie einen Ausschluss vom Unterricht darstellen. Ein Ausschluss, der selbstverständlich völlig ohne Maries Schuld zustande gekommen war. Schließlich wollte sie nur möglichst viel für das Geld lernen, das ihre Eltern jeden Monat zahlten. Daraus konnte man ihr wohl kaum einen Vorwurf machen.
Sie packte das Bündel mit Kleid und Spitzenschuhen und schlich sich aus dem Zimmer, den Flur entlang und die dunklen Holzstufen hinab. Gewiss, sie hatte sich über den betroffenen Ausdruck auf dem Gesicht der Lehrerin gefreut, als sie davon gesprochen hatte, bisher aus Zuneigung und Treue auf Privatunterricht verzichtet zu haben. Jetzt tat es ihr schon wieder leid, und sie wollte Fräulein Mühsam um keinen Preis mehr in die Augen schauen müssen.
Marie trat aus dem großen weißen Haus, das direkt am Marktplatz stand. Helles Sonnenlicht tauchte die Szenerie in eine freundliche Atmosphäre. Mägde eilten mit Körben von einem Händler zum anderen, ein Pferdewagen rumpelte über das Kopfsteinpflaster. Das Rathaus reckte seine spitzen Türme in den blauen Himmel, der Backstein leuchtete rot. Hochstimmung ergriff sie. »Ich bin eine Tänzerin«, rief sie übermütig und drehte eine Pirouette. Zwei Jungen, die einen Korb mit Holz trugen, kicherten. Marie war das egal. Den ganzen Weg an der Marienkirche vorbei bis in die Beckergrube hüpfte sie mit wehenden Zöpfen, wie sie es als kleines Kind gern getan hatte. So eilig, dass sie ganz außer Atem war, als sie an ihrem Elternhaus mit der Nummer 13 ankam.
Auf der Straße vor dem dreigeschossigen Giebelhaus stand die Droschke von Dr. Grünbeck. Marie erkannte sie sofort, denn der Arzt war oft hier. Er war ein sehr guter Freund ihrer Eltern, ja, der ganzen Familie. Seit Maries ältester Bruder Enno vor vier Jahren in der Ostsee ertrunken war, kam Grünbeck mindestens einmal in der Woche zu ihrem Vater. Wilhelm Kröger war seit diesem schrecklichen Unfall verwirrt, fand sich in der Realität nicht mehr zurecht. Marie schüttelte den Gedanken an ihren Bruder und die Veränderung ihres Vaters ab. Sie verbot sich die trüben Erinnerungen, weil sie noch immer so schmerzten. Und sie wollte einfach daran glauben, dass ihr Vater irgendwann wieder wie früher sein würde. Ihr Ballettbündel unter dem Arm, lief sie um die Kutsche herum und strich über die weichen Mäuler der beiden braunen Pferde, die vor den Wagen gespannt waren. Sie schnaubten leise, warmer Atem strömte aus ihren Nüstern. Maries Blick wanderte durch den großzügigen Bogengang, der von der Straße zum Hinterhof mit dem Stall und den Unterkünften der Dienstboten und einiger Mitarbeiter der Konditorei Kröger führte. Dort stand eine zweite Droschke. Die ihres Bruders! Johann-Alexander war zurück. Marie stürmte ins Haus. Ballettrock und Spitzenschuhe ließ sie achtlos auf einen Stuhl in der Eingangshalle fallen. Zwei Stufen gleichzeitig nehmend, hastete sie die Treppe hinauf in die gute Stube. Johann-Alexander Kröger war mit seinem engsten Mitarbeiter Achim Oeverbeck nach Russland zu Zar Alexander II. gereist. Er hatte den russischen Zaren bei der Weltausstellung in Paris kennengelernt, wo er Pralinés und Marzipan präsentiert hatte. Maries Bruder hatte erzählt, dass der Zar eine umfangreiche Bestellung habe tätigen wollen, dann aber überstürzt abgereist sei, nachdem man ein Attentat auf ihn verübt habe. Jedoch nicht, wie Johann-Alexander stolz verkündet hatte, ohne eine Einladung an ihn zu hinterlassen, mit seiner Ware an den Zarenhof nach St. Petersburg zu reisen. Seit bald zwei Monaten hatte Marie ihren Bruder nicht mehr gesehen. Wie sie sich auf ihn freute! Sie war neugierig auf all die Geschichten, die er sicher zu erzählen hatte. Ganz bestimmt hatte er das Bolschoi-Ballett gesehen. Marie beneidete ihn flammend darum. Er würde ihr jede Einzelheit beschreiben müssen.
Sie betrat die gute Stube, blieb jedoch gleich an der Schwelle stehen. Die schweren dunkelroten Samtvorhänge vor den Fenstern waren zugezogen. Nur durch einen winzigen Spalt drangen die Strahlen der Augustsonne herein. In der schmalen Wand aus Licht konnte man unzählige winzige Staubkörnchen sehen, die gemächlich durch die Luft tanzten. Marie fragte sich, warum man nicht die Fenster öffnete, um den erfrischenden Wind hereinzulassen, der von der Ostsee nach Lübeck wehte. Allmählich hatten ihre Augen die Umstellung vom hellen Sommertag zum abgedunkelten Wohnraum bewältigt. Ihr Vater saß – wie fast immer seit Ennos Tod – in dem großen schweren Ohrensessel, der dicht am Fenster stand. Er starrte ausdruckslos vor sich hin. Allerdings kam es Marie so vor, als wäre sein Mund verkniffener als sonst. Und auf der Stirn zeigte sich eine tiefe Furche, die gestern noch nicht da gewesen war. Ihre Mutter saß auf dem kleinen Sofa, ganz in sich zusammengesunken, und neben ihr Dr. Grünbeck. Vor ihr auf dem Tisch war ein Glas Wasser.
»Geht es dir nicht gut, Mutter?«, fragte Marie und trat zögernd an den großen ovalen Tisch, auf dem wie immer eine weiße Spitzendecke lag und eine kleine Vase mit Blumen stand.
Margreth Kröger reagierte nicht. Marie bemerkte, dass der Arzt sie ansah. In seinem Blick lagen Schmerz und Mitleid. Angst packte ihr Herz und presste ihren Brustkorb zusammen, so dass das Atmen schwer wurde.
Sie wandte sich an Dr. Grünbeck: »Ist Mutter krank?«
»Es geht nicht um deine Mutter.« Achim Oeverbeck trat auf Marie zu. Sie hatte ihn bisher gar nicht bemerkt und starrte ihn erschrocken an. Er nahm ihren Arm und führte sie behutsam zum Kaminsofa. »Es geht um deinen Bruder«, sagte er leise.
Marie ließ sich auf das Sofa sinken. Sie wollte nicht hören, was Achim Oeverbeck zu sagen hatte. Sie wusste, dass es eine schlimme Nachricht sein würde.
»Das Beruhigungsmittel wirkt«, sagte Grünbeck. Er stand auf, nahm Margreth Krögers Arm und zog sie vorsichtig vom Sofa hoch. »Ich bringe sie zu Bett.« Und an Oeverbeck gewandt: »Erklären Sie Marie, was passiert ist. Ich bin gleich zurück.«
Als der Arzt dicht an Marie vorbeiging, ihre Mutter hinter sich herziehend, stieg ihr der intensive Geruch von Naphthalin in die Nase. Mottenkugeln waren die große Mode, und Dr. Grünbeck schien ein ganzes Arsenal davon in seinem Schrank zu haben.
Margreth Kröger und Dr. Grünbeck verließen das Zimmer. Marie starrte auf den dunkelbraunen Parkettboden. Sie hörte die Treppe knarren und die Schlafzimmertür ihrer Mutter schlagen. Seit Ennos Tod, seit ihr Vater nicht mehr er selbst war, schliefen die Eltern in getrennten Kammern. Wie gern wäre sie jetzt in ihr Zimmer geflohen, hätte sich in ihr Bett verkrochen, um morgen aufzuwachen und zu wissen, dass alles in bester Ordnung war. Aber nichts war in Ordnung.
Achim Oeverbeck nahm Maries Hand und knetete sie unsicher. »Johann-Alexander ist während der Überfahrt von St. Petersburg nach Travemünde sehr krank geworden. Er hatte Durchfall und hohes Fieber. Der Schiffsarzt vermutete, dass es Typhus sei. Er konnte nicht viel für deinen Bruder tun und dachte, dass ihm in Travemünde besser geholfen werden würde.«
Er machte eine Pause. Maries Blick bohrte sich weiter in eins der Astlöcher im Fußboden. Sie fühlte sich innerlich zerrissen. Einerseits wusste sie, was Achim Oeverbeck als Nächstes sagen würde, andererseits hoffte sie von ganzem Herzen, dass sie sich täuschte, dass Johann-Alexander in Travemünde oder Lübeck in einem Krankenhaus lag, schwerkrank und geschwächt zwar, aber am Leben.
»Dein Bruder hat die Überfahrt nicht überlebt. Er ist an Bord gestorben«, sprach er kaum hörbar das Schreckliche aus.
Wie durch ein Wattebällchen nahm Marie das Knarren der Treppe wahr. Dr. Grünbeck kam herein, und Achim Oeverbeck sprang hastig auf und dem Arzt entgegen. Er schien es wahrhaft eilig zu haben, das Trauerhaus zu verlassen.
Das Astloch, das Parkett, das Zimmer, alles verschwamm vor Maries Augen. Sie beobachtete die beiden Männer, die leise miteinander sprachen. Obwohl sie flüsterten, verstand Marie jedes Wort.
»Was wird jetzt aus der Konditorei? Es wird allerhöchste Zeit, dass dort wieder jemand die Führung übernimmt. Zu lange waren die Leute schon auf sich allein gestellt.« Oeverbeck kam zunehmend in Fahrt. »Und es muss sich dringend jemand um die Aufträge kümmern, die wir aus Russland mitgebracht haben. Wer soll dafür sorgen, dass alles pünktlich fertig wird?«
Grünbeck legte ihm eine Hand auf den Arm. »Na, wer soll das wohl tun? Sie natürlich, Achim. Aber auf einen Tag kommt es nun auch nicht mehr an. Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus. Die Reise war sicher anstrengend. Ich werde morgen um diese Zeit wieder hier sein. Dann wird Margreth entscheiden müssen, was aus der Firma werden soll. Ich habe keinen Zweifel, dass sie Sie zum Geschäftsführer bestellen wird. Geben wir ihr eine Nacht, zu weinen und zu ruhen. Für Entscheidungen ist morgen noch Zeit.«
Oeverbeck nickte, drückte dem Arzt die Hand, hob die andere halb zum Gruß in Maries Richtung, ließ sie dann aber wieder sinken und verließ eilig den Raum. Grünbeck setzte sich zu Marie auf das Kaminsofa. Er nahm ihre Hände in die seinen.
»Es tut mir so leid, Marie. Ich weiß, wie sehr du an deinem Bruder gehangen hast.«
Marie sah in das bestürzte Gesicht des väterlichen Freundes. Es sah grau und alt aus. Tränen rannen ihr über die Wangen.
»Typhus?«, fragte sie. »Warum hat er denn Typhus bekommen? Er war doch ganz gesund, als er nach St. Petersburg gereist ist.«
»Ich glaube nicht, dass es Typhus war. Oeverbeck sprach von Durchfall und Fieber. Er hat aber auch erzählt, dass Johann-Alexander heiser war, dass er kaum schlucken konnte und Atemstörungen bekam. Es ist anzunehmen, dass dein Bruder an Trichinose gestorben ist.«
Marie sah den Arzt verständnislos an.
»Er hat in Russland Fleisch zu sich genommen, das von Parasiten befallen war. Wird solches Fleisch verzehrt, wächst der Parasit im Körper des Menschen heran. Man hätte nichts für deinen Bruder tun können.« Er verstärkte den Druck seiner Hände, so dass Marie das Gefühl hatte, ihre Finger würden jeden Moment brechen. »Aber man kann vorbeugen. Hörst du, Marie? Hygiene! Hygiene ist das Allerwichtigste! Du darfst niemals Fleisch essen, wenn du nicht ganz sicher bist, dass es frisch ist. Und Fleisch muss immer durchgebraten oder gründlich gekocht werden. Und du musst dir die Hände waschen. Immer wieder. Bei jeder Gelegenheit.« Er ließ ihre Hände abrupt los und rieb sich die fast fiebrig glänzenden Augen. »Wir Ärzte hätten es so viel leichter, wenn sich alle Menschen mehr um die Hygiene kümmern würden.«
»Gewiss«, flüsterte Marie verwirrt.
»Du bist jetzt das Einzige, was deine Eltern noch haben. Du musst auf dich aufpassen«, beschwor er sie. Und nach einer kurzen Überlegung fügte er hinzu: »Wenn du dir nicht sicher bist, ob Speisen frisch sind, die dir angeboten werden, ob sie hygienisch zubereitet sind, dann lehne sie ab. Das Kröger’sche Marzipan ist nicht nur köstlich, sondern auch nahrhaft. Wenn du immer ein wenig davon bei dir hast, kannst du beruhigt andere Speisen ablehnen. Du wirst trotzdem gut versorgt sein.«
Marie hatte keine Ahnung, wovon Grünbeck sprach. Sie aß stets zu Hause, wo alle Lebensmittel von guter Qualität und exzellent zubereitet waren. Bei Ausflügen in ihr geliebtes Travemünde gingen sie nur in erstklassige Lokale. Wo also sollten ihr Speisen von zweifelhafter Herkunft oder Zubereitung angeboten werden?
»Pass auf dich auf«, ermahnte sie der Arzt noch einmal seufzend. Er war einen halben Kopf kleiner als Marie. Jetzt wirkte er geradezu winzig und sah erschöpft aus. Marie blickte zu ihrem Vater hinüber. Eine Träne hatte eine feuchte Spur auf seiner Wange hinterlassen.
»Ich werde auf mich aufpassen«, sagte sie beklommen.
»Braves Kind.« Er tätschelte ihre Hände, stand auf, nahm seine Tasche, die am Wohnzimmertisch lehnte, und ging zur Tür. »Ich sehe morgen nach deinen Eltern«, sagte er und verschwand dann grußlos.
Was war das nur für ein Alptraum! Marie dachte daran, sich jetzt in ihr Bett zu verkriechen. Aber sie mochte nicht allein sein. Sie blickte erneut zu ihrem Vater, der regungslos in seinem Sessel saß. Noch immer zwängte sich helles Sonnenlicht durch den Spalt zwischen den Vorhängen. Es war stickig und sehr heiß, aber Marie konnte sich nicht entschließen, die Fenster zu öffnen. Sie ließ die Welt ausgesperrt, ging zu ihrem Vater und setzte sich auf seinen Schoß, wie sie es als kleines Mädchen manchmal getan hatte. Wie eine Katze rollte sie sich zusammen und legte die Arme ihres Vaters um sich. So blieb sie sitzen, bis es dunkel wurde.
Der nächste Tag war schrecklich. Margreth Kröger weinte und klagte fast unablässig. Das Mittagessen räumte Therese, das Dienstmädchen, wieder ab, ohne dass jemand es auch nur angerührt hatte. Marie war erleichtert, als Dr. Grünbeck kam. Er fühlte Margreth Kröger den Puls und gab ihr ein sehr leichtes Beruhigungsmittel. Kurz nach seinem Eintreffen meldete Therese auch die Ankunft von Achim Oeverbeck.
»Margreth, meine Liebe«, sagte Grünbeck zu Maries Mutter, deren Schluchzen immer leiser wurde und schließlich abebbte, »ich habe mit Herrn Oeverbeck ausgemacht, dass er heute wieder herkommt. Es müssen Entscheidungen über die Zukunft der Konditorei getroffen werden.«
Margreth Kröger saß auf dem Sofa hinter dem Wohnzimmertisch. Das hochgeschlossene schwarze Kleid unterstrich die erschreckende Blässe ihrer Haut. Die rot geweinten Augen blickten müde.
»Was gibt es da wohl zu entscheiden?« Ihre Stimme klang von dem Beruhigungsmittel etwas schleppend. »Wilhelm ist nicht in der Lage, sich um die Geschäfte zu kümmern. Und bei Marie ist noch nicht einmal im Entferntesten ein Bräutigam in Sicht, der die Verantwortung übernehmen könnte. Dann werden wir also einen Geschäftsführer einstellen müssen, der nicht aus der Familie kommt.«
Grünbeck nickte. »Oeverbeck kennt die Abläufe in der Konditorei aus dem Effeff. Er ist ein tüchtiger junger Mann. Ich glaube, ihm kannst du diesen Posten mit gutem Gewissen anvertrauen.«
»Ich bin gerne bereit, werte Frau Kröger, alles für den Fortbestand und das Wachstum der Konditorei Kröger zu tun«, sagte Oeverbeck, der in diesem Moment die Stube betrat. »Auch wenn ich nicht zur Familie gehöre. Aber der Betrieb liegt mir am Herzen, als wäre er meine Familie.«
»Das weiß ich doch, mein Junge.« Margreth Kröger seufzte tief. Sie schien noch einen Moment zu zögern, dann sagte sie: »Tja, es wird wohl in der Tat das Beste sein, wenn du die Leitung der Konditorei übernimmst, Achim. Ich werde die nötigen Verträge aufsetzen lassen, sobald ich mich dazu in der Lage fühle. Bis dahin möchte ich dich bitten, deine Arbeit wieder aufzunehmen und die Abwicklung der Bestellungen in die Wege zu leiten.«
Aus seinem Lächeln sprach eine Freude, die Marie in Anbetracht der Situation nicht für angebracht hielt.
»Natürlich, Frau Kröger. Machen Sie sich keine Gedanken. Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen.«
»Nein!« Das war Wilhelm Kröger, der – zu Maries großer Überraschung – das Wort ergriff. »In dieser Familie ist immerhin noch ein Kind am Leben. Das ist der einzige rechtmäßige Geschäftsführer der Konditorei Kröger.«
Die Anwesenden starrten ihn mit aufgerissenen Augen ungläubig an. Nur Grünbeck wirkte mit einem Mal in höchstem Maße konzentriert.
»Aber Marie ist ein Mädchen!«, rief Margreth entsetzt.
»Sie hat keine Ahnung von geschäftlichen Dingen«, platzte es aus Oeverbeck heraus.
Marie fühlte sich elend. Natürlich hatten die beiden recht. Andererseits wusste sie nicht, warum eine Frau nichts mit geschäftlichen Dingen zu tun haben sollte. Sie war nicht dumm, und wenn ihr Vater den Wunsch hatte …
Grünbeck stand auf und ging zu Kröger hinüber.
»Hast du dir das gut überlegt, Wilhelm?«, fragte er und tastete nach dessen Puls. »Natürlich bist du noch immer der Chef, aber du hast dich viele Jahre nicht mehr um die Belange der Konditorei gekümmert«, formulierte er vorsichtig, während er aufmerksam die Augen des alten Freundes betrachtete. Tatsächlich hatte Wilhelm Kröger offiziell noch immer das Sagen in seinem Unternehmen. Man hätte ihn entmündigen müssen, um das zu ändern. Weil aber Johann-Alexander ohnehin mit allen Vollmachten ausgestattet gewesen war, die zum Führen des Betriebs notwendig waren, hatte niemand diesen höchst unerfreulichen Schritt für nötig erachtet.
»Ich halte Achim Oeverbeck für einen guten Mann. Du warst doch auch immer mit ihm zufrieden, und er genießt das volle Vertrauen von Johann-Alexander.« Grünbeck räusperte sich verlegen. »Er hat das Vertrauen genossen. Wie dem auch sei, ein rechtmäßiger Geschäftsführer der Konditorei Kröger, der zur Familie gehört, bist nach wie vor du. Wenn du Oeverbeck diesen Posten nicht zutraust, dann wäre es sicher das Beste, du würdest das Regiment wieder selbst in die Hand nehmen. Was, Wilhelm, das wäre doch was, oder?« Er lachte leise und klopfte seinem Freund aufmunternd auf die Schulter.
Margreth Kröger und Achim Oeverbeck tauschten irritierte Blicke. Marie sah von ihnen zu ihrem Vater hinüber – erwartungs- und hoffnungsvoll. Schließlich wollte sie Tänzerin werden und nicht Mitarbeiter kontrollieren, Pralinen kreieren und Gebäck verkaufen. Wenn ihr Vater nur wieder der Alte werden könnte. Der durch Ennos Tod ausgelöste Schock hatte ihn von der Realität abgeschnitten und in eine eigene Welt verdammt. Der Schock über den Tod von Johann-Alexander würde ihn in die Welt zurückholen, in der er so dringend gebraucht wurde. Es konnte nicht anders sein.
»Marie macht das.« Wilhelm Kröger klang sehr bestimmt.
»Aber Wilhelm, das geht doch nicht. Eine Frau in einer solchen Position. Und vollkommen ohne jegliche Erfahrung! Marie wird heiraten und Kinder …« Weiter kam Margreth nicht.
»Marie macht das«, wiederholte Wilhelm Kröger und lehnte sich in seinem Sessel zurück.
Marie verfolgte, wie Grünbeck, ihre Mutter und Oeverbeck abwechselnd auf ihren Vater einredeten. Sie hatten viele Argumente, die gegen Marie sprachen. Und die waren wirklich überzeugend. Nur interessierten sie ihn anscheinend nicht. Er hüllte sich wieder in Schweigen und würdigte die drei keines Blickes mehr.
Schließlich resignierte Grünbeck. »Wie es aussieht, Margreth, musst du dich dem Willen deines Mannes fügen oder dich bewusst über ihn hinwegsetzen. Ich fürchte allerdings, dann wäre es tatsächlich an der Zeit, Wilhelm zu entmündigen.«
Marie starrte erst Grünbeck und dann ihre Mutter an. Diese knetete unglücklich ihre Hände.
»Das kann ich doch nicht machen«, flüsterte sie verzweifelt.
Marie erkannte, wie schmerzlich der Kampf war, den ihre Mutter mit sich selbst auszutragen hatte. Sie musste sie von der Qual befreien.
»Und wenn ich es versuchen würde?«, fragte sie.
»Das ist doch nicht dein Ernst!«, rief Oeverbeck aufgebracht. »Du hast von nichts eine Ahnung.« Er wandte sich Margreth Kröger zu. »Wenn Marie Geschäftsführerin wird, ist das das Ende der Konditorei Kröger. So sicher wie das Amen in der Kirche!«
»Nun reißen Sie sich aber mal zusammen, junger Mann«, wies Grünbeck ihn zurecht. »Wenn das die Entscheidung der Familie ist, haben Sie sie zu akzeptieren.« Und versöhnlicher fügte er hinzu: »Außerdem darf ich doch wohl davon ausgehen, dass Sie Ihren Posten als Assistent der Geschäftsleitung behalten. Sie können Marie also mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit die Konditorei fortbesteht.«
Oeverbeck war vor Wut rot angelaufen. »Das haben Sie sich ja fein ausgedacht. Das Fräulein Kröger spielt die Chefin, und ich darf die Arbeit machen. Ohne mich!« Er sprang auf, stieß gegen den Tisch und hätte fast die Tischdecke und die Blumenvase zu Boden gerissen. Ohne ein Wort des Abschieds stürmte er aus dem Zimmer. Margreth seufzte gequält.
»Na, na, meine Liebe.« Grünbeck setzte sich zu ihr und tätschelte ihre kleine fleischige Hand. »Der beruhigt sich schon wieder. Du wirst sehen, morgen früh ist er in der Konditorei zur Stelle und macht den Mitarbeitern Beine.«
»Und ich?«, fragte Marie schüchtern.
Es war der 17. August 1870. Zum ersten Mal betrat Marie Kröger die Konditorei ihres Vaters nicht, um ein Schwätzchen mit ihrem Bruder zu halten oder sich Naschwerk zu stibitzen. Es war der erste Tag in ihrem Leben, an dem sie arbeiten sollte. Die Mitarbeiter mit ihren blau-weißen Uniformen, die Frauen mit gestärkten Schürzen und Häubchen, die Männer mit weißen Fliegen, standen bereits hinter den Ladentischen, wogen Pralinen ab und drapierten Plätzchen und Gebäck auf Platten und Etageren. Sie murmelten Worte des Beileids und eilten geschäftig umher, obwohl noch kein Kunde im Laden war. Marie ging nach einer kurzen Begrüßung rasch an den Männern und Frauen, die zum größten Teil schon lange für ihren Vater arbeiteten, vorbei in die hinteren Räume, wo bis vor kurzem Johann-Alexander sein Kontor hatte und wo auch Achim Oeverbecks Schreibtisch stand. Sie atmete tief ein. Marie hatte sich ganz genau zurechtgelegt, was sie Achim Oeverbeck sagen wollte. Sie mochte ihn und konnte seine Enttäuschung verstehen. Es war nur logisch, dass es ihm nicht gefiel, eine Chefin vor die Nase gesetzt zu bekommen, statt selbst den gesellschaftlichen und natürlich auch finanziellen Aufstieg zu vollziehen. Sie wollte nicht die Chefin spielen, wie er es am Vortag in seiner Wut ausgedrückt hatte. Wie hätte sie das auch tun können ohne jegliche Kenntnis von geschäftlichen Dingen? Sie wollte mit ihm und den anderen Angestellten zum Wohle der Firma und zur Zufriedenheit ihres Vaters zusammenarbeiten. Zaghaft klopfte sie an die Tür.
»Herein!« Oeverbecks Stimme klang noch immer gereizt und sehr bestimmt.
Marie spürte, wie ihre Knie weich wurden. Sie öffnete die Tür, trat ein und schloss sie gleich wieder hinter sich. Es musste niemand hören, was hier gesprochen wurde.
»Ach, die Frau Chefin ist auch schon da. Johann-Alexander und ich fangen morgens gewöhnlich um sieben Uhr mit unserer Arbeit an.«
»Ich weiß«, sagte Marie kleinlaut.
»Aber als Chefin kannst du natürlich selbst entscheiden, wann es dir beliebt, hier zu erscheinen.« Er schlug sich mit einer übertriebenen Geste die Hand vor den Mund. »Entschuldigen Sie. Vermutlich darf ich von heute an nicht mehr du sagen. Ich werde mir Mühe geben, mich schnell umzustellen.«
»Das ist doch Unsinn, Achim. Wir haben doch immer du zueinander gesagt. Warum sollte sich das ändern?«
»Schön«, erwiderte er und setzte sich hinter seinen Schreibtisch, auf dem sich Berge von Papier stapelten. »Mir ist es gleich.« Damit wandte er sich seinen Unterlagen zu und ließ Marie einfach stehen.
Sie spürte, wie sie allmählich wütend wurde. Wenn sie bisher auch nicht zur Geschäftsleitung gehört hatte, so war sie schließlich die Tochter seines Arbeitgebers. Er hatte sie mit Respekt zu behandeln.
Oeverbeck sah auf. »Und, was ist noch? Willst du mich vielleicht kontrollieren? Herzlich gern«, sagte er lachend. »Ich zeige dir die Abrechnungen, die Aufträge, die ich aus Russland mitgebracht habe, und die Bestellungen an die Mehl-, Mandel- und Gewürzhändler. Sicher kannst du dann beurteilen, ob ich meine Arbeit gut mache.« Er konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen.
»Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu kontrollieren«, entgegnete Marie böse und hilflos zugleich.
»Und warum bist du dann gekommen?« Er lachte nicht mehr, sondern sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. »Willst du dich hinter den Ladentisch stellen? Oder noch besser – kannst du mir vielleicht das Marzipanrezept verraten?« Er hatte sich hinter seinem Schreibtisch erhoben, war zu ihr gekommen und baute sich nun direkt vor ihr auf.
Marie, einen Kopf kleiner als Oeverbeck, machte sich gerade und reckte ihr Kinn, so gut sie konnte.
»Ich bin hier«, sagte sie, »weil es meines Vaters Wunsch ist. Es ist gewiss nicht mein Traum, in der Konditorei zu arbeiten. Wie du weißt, ist es mein sehnlichster Wunsch, Tänzerin zu werden. Aber ich werde Vater nicht enttäuschen.« Und leiser fügte sie hinzu: »Er hat zwei Söhne verloren. Da kann ihm seine Tochter nicht auch noch Kummer machen.«
Oeverbeck entspannte sich. Er sah mitleidig auf sie hinab. Marie wusste, dass sie auf dem richtigen Weg war.
»Ich will dir deinen Platz in der Firma nicht streitig machen. Ich will doch nur Vater zufriedenstellen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Lohn erhöht wird. Und wir werden zusammenarbeiten.«
Die nächsten Wochen verbrachte Marie in der Konditorei. Sie lernte allmählich die Waren kennen und erfuhr einiges über Buchhaltung, Bestellwesen und über die Händler, mit denen man Geschäfte machte. Anfangs zeigte sie großen Eifer. Sie war selbst überrascht, wie viel Spaß es ihr bereitete, jeden Tag früh aufzustehen und in die Konditorei zu gehen, die nur wenige Schritte vom Elternhaus entfernt auf der anderen Seite der Beckergrube lag. Am Nachmittag, wenn sie nach Hause kam, lief sie sofort zu ihrem Vater und erzählte ihm, was sie alles gemacht und gelernt hatte. Sie hoffte inständig, dass er auf sie reagieren, dass er wieder in die Realität zurückkehren würde, wenn sie seinen Wunsch erfüllte. Doch er reagierte nicht. Mit jedem Tag wuchs Maries Enttäuschung. Und gleichzeitig schwand ihr Eifer, sich in der Konditorei zu betätigen. Sie kam jeden Morgen ein bisschen später, ging früher nach Hause und hatte ihre Mutter überredet, ihr als Belohnung für das Opfer, das sie brachte, eine Tanzlehrerin ins Haus zu holen. Von Woche zu Woche nahmen die Ballettübungen mehr Platz ein. Oeverbeck hatte Marie einmal auf ihre mangelnde Disziplin angesprochen, dann ließ er sie jedoch in Ruhe. Marie hatte das nicht anders erwartet. Schließlich lag es nicht in seinem Interesse, ihr mehr Einsatz abzuverlangen. Im Gegenteil, er schien recht froh zu sein, nach seinem Gutdünken schalten und walten zu können. Und Marie war froh, dass er sie nicht unter Druck setzte. So spielte sich eine Routine ein, in der Achim Oeverbeck die Geschicke der Konditorei leitete, und Marie Kröger nur zum Schein die Geschäftsleitung innehatte. Bis zu der Nacht im Jahre 1871, als sich der Todestag von Johann-Alexander Kröger zum ersten Mal jährte.
Ihr Bruder stand vor ihr auf den Planken eines Schiffs. Vom Fieber hatte er einen Schweißfilm auf der Stirn und der Oberlippe. Seine sonst so rosigen, ein wenig rundlichen Wangen waren eingefallen, seine Haut hatte eine ungesunde gelblich-graue Farbe. Der Kahn, ein Seelenverkäufer, der auf Marie den Eindruck machte, als ob er jeden Moment auseinanderbrechen würde, kämpfte sich durch schwere See.
»Marie!«, rief Johann-Alexander gegen das Tosen des Sturms. Seine Stimme klang heiser. »Das Marzipan darf nicht verlorengehen!«
Marie sah sich um. Da war kein Marzipan an Bord. Es gab überhaupt keine Kisten oder Säcke, die darauf schließen ließen, dass dieses Schiff Waren transportierte.
»Das Marzipan ist unser Kapital«, keuchte Johann-Alexander weiter gegen den Sturm. Er war kaum noch zu verstehen, so brüchig war die Stimme, so laut schwoll das Brausen des Windes an. »Du musst mehr Marzipan machen. Der Zar will sein Marzipan haben. Hörst du, Marie? Das Marzipan …« Eine riesige Welle schlug auf das Schiff und erstickte alle weiteren Worte ihres Bruders. Plötzlich wurde der Kahn in die Höhe gehoben und stürzte gleich darauf in ein tiefes Wellental.
Marie war mit einem Schlag wach. Sie setzte sich auf und starrte mit klopfendem Herzen in die Dunkelheit. Noch immer rauschte es in ihren Ohren. Und sie spürte das wilde Auf und Ab des Schiffs, als hätte sie noch immer schwankende Planken statt einer ruhigen und sicheren Lagerstatt unter sich. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Trotzdem begann sie zu zittern und zog sich das dicke Daunenbett bis unters Kinn. Tränen traten ihr in die Augen. Der Verlust ihres älteren Bruders bereitete ihr noch immer Kummer. Und nun war er bei ihr gewesen. Zum Greifen nah! Wie sehr sehnte sie sich nach ihm, nach ihrem unbeschwerten Leben. Doch das war bereits mit dem Tod ihres ältesten Bruders Enno zu Ende gegangen. Es war an der Zeit, erwachsen zu werden. Marie blinzelte, bis die Tränen verschwanden. Sie atmete tief durch. In diesem Moment wusste sie, was sie zu tun hatte.
Am nächsten Morgen schlüpfte Marie noch vor den ersten Sonnenstrahlen in ihr gestärktes taubenblaues Leinenkleid. Sie steckte sich die langen Haare zu einem strengen Knoten zusammen und eilte in die Küche hinunter, wo Therese bereits den Ofen angefeuert und die Vorbereitungen für das Frühstück getroffen hatte. Das Mädchen erschrak, als sie Marie so früh erblickte.
»Gnädiges Fräulein, haben Sie mich erschreckt«, japste sie.
»Tut mir leid. Das lag nicht in meiner Absicht.« Marie lächelte ihr freundlich zu. »Würdest du mir bitte eine heiße Schokolade und ein Stück Brot mit Butter richten? Ich muss heute früh in die Konditorei.«
»Natürlich, gern«, antwortete Therese und machte sich sofort an die Arbeit. In ihrem Gesicht konnte Marie deutlich die Überraschung lesen. Sie würde gleich noch verwirrter dreinschauen.
»Und sei so gut, nachher einen Boten zu meiner Ballettlehrerin zu schicken. Sie soll heute nicht kommen.« Marie zögerte, seufzte einmal und fuhr fort: »Und morgen braucht sie auch nicht zu kommen. Ich werde es sie wissen lassen, wann ich wieder Zeit für meine Stunden habe.«
»Ich schicke jemanden zu ihr. Soll ich das Frühstück in der Stube richten?«
»Nein, das ist nicht nötig«, sagte Marie und nahm an dem großen Küchentisch aus grobgezimmertem Eichenholz Platz, der im Laufe der Jahre schon viele Schrammen und Kratzer hatte hinnehmen müssen. »Ich werde gleich hier frühstücken.«
»Wie Sie meinen.« Therese stellte den großen Becher mit dampfendem Kakao und den Teller mit dem dicken Kanten, den sie reichlich mit Butter bestrichen hatte, vor Marie auf den Tisch. An ihrem Ton erkannte diese, dass das Mädchen etwas auf dem Herzen hatte.
Marie sah zu ihr auf und fragte: »Nun, Therese, was geht dir durch den Kopf?« Sie biss in das frische Brot.
Therese zierte sich ein wenig, dann sagte sie: »Seit diese Ballettlehrerin ins Haus kommt, haben Sie immer mehr Zeit mit dem Tanzen und Üben verbracht. Und …« Sie suchte offenbar nach den richtigen Worten. »Und immer weniger …« Wieder ließ sie den Satz unbeendet, starrte auf ihre ineinander verschlungenen Finger und schien um die passende Formulierung zu ringen.
»Und immer weniger im Geschäft«, ergänzte Marie.
Therese blickte erschrocken auf ihre Schuhspitzen, die unter der langen Schürze hervorlugten. So ausgesprochen klang es wie ein Vorwurf. Doch sie hatte es bestimmt nicht so gemeint. Es war ganz und gar nicht ihre Art, die Tochter des Hauses zu kritisieren oder ihr gar einen Vorwurf zu machen. So etwas nahm sie sich nicht heraus. Dennoch konnte Marie förmlich Thereses Gedanken lesen. Sie lächelte.
»Du hast ja recht, ich habe die Konditorei sträflich vernachlässigt. Aber ab heute wird das anders.«
Therese blickte auf. Die Furcht war aus ihrem Gesicht gewichen und hatte sich in Neugier verwandelt.
»Aber ich dachte, Sie wollten Tänzerin werden, zum Ballett gehen. Nur deshalb habe ich gefragt. Ich wollte nicht …«
»Schon gut«, unterbrach Marie sie und trank den letzten Schluck Kakao. »Es ist der Wunsch meines Vaters, dass ich mich um die Konditorei kümmere. Also werde ich mich darum kümmern.« Damit stand sie auf, strich ihr Kleid glatt und begab sich zu ihrer Arbeit. Auf Therese machte sie sicher einen sehr entschlossenen Eindruck, doch tief in ihrem Innern sah es ganz anders aus. Zwar hatte sie in der Nacht nach ihrem Alptraum einen Entschluss gefasst, doch sie erinnerte sich noch allzu gut an Achims Reaktion vor einem Jahr, als man sie ihm vor die Nase gesetzt hatte. Zwischen ihnen war nur Friede eingekehrt, weil sie sich aus allem Geschäftlichen herausgehalten hatte. Wenn sie nun voll einsteigen würde, konnte sie sich seiner erneuten Gegenwehr sicher sein. Sie war schrecklich nervös. Wie konnte sie ihm nur begreiflich machen, dass sie nun doch aktiv in die Geschäftsleitung eingreifen wollte? Sollte sie ihm etwa von ihrem Traum erzählen? Er würde sie nur auslachen.
Als sie die Beckergrube überquerte, fiel ihr Blick in das Schaufenster des Hutmachers. Die Ausstellung von Waren in großen Fenstern, die von der Straße sichtbar waren, kam immer mehr in Mode. Das war die Idee! Die Konditorei Kröger hatte noch kein solches Schaufenster. Sie würde Achim vorschlagen, eines einzurichten. Er sollte wissen, dass sie durchaus Kenntnis von Entwicklungen und dem Fortschritt hatte. Bestimmt würde er sie loben und ihre Mitarbeit nicht mehr als Belastung, sondern als Bereicherung begreifen. Beflügelt von dem Gedanken, rauschte Marie fröhlich lächelnd in die Konditorei, grüßte die verdutzten Angestellten, die sie so früh noch nicht erwartet hatten, und eilte geradewegs zu Oeverbecks Kontor. Vor der Tür holte sie noch einmal tief Luft, bevor sie klopfte und eintrat. Sie wollte unbedingt alles richtig machen.
Oeverbeck war anscheinend nur wenige Minuten vor ihr eingetroffen. Gerade war er dabei, seinen Gehrock an den hölzernen Haken zu hängen, der in der Ecke neben dem klobigen Eichenschrank angebracht war. Erstaunt zog er die Augenbrauen in die Höhe.
»Marie! Ist etwas geschehen?«
»Guten Morgen, Achim. Nein, alles in Ordnung.« Sie spürte, dass ihre Hände vor Aufregung feucht wurden.
»Was kann ich für dich tun?«, fragte er, sehr um einen freundlichen Ton bemüht, doch Marie konnte deutlich erkennen, dass er auf der Hut war.
»Wir müssen reden, Achim. Über das Geschäft.«
Er sah sie misstrauisch an, sagte aber nichts.
Marie hatte sich einige Sätze zurechtgelegt. Sie deutete zaghaft auf den Stuhl, der dem seinen gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches stand.
»Darf ich?«
Oeverbeck nickte, wartete, bis sie Platz genommen hatte, und setzte sich dann ebenfalls. Er ließ sie dabei keine Sekunde aus den Augen.
»Es geht um Folgendes«, begann Marie. »Es ist dir sicher nicht entgangen, dass ich in den letzten Monaten meine Ballettstunden intensiviert habe.« Sein überraschtes Gesicht sagte ihr, dass ihre Taktik aufging. Sie wollte ihn in Sicherheit wiegen, nicht gleich das Thema anschneiden, auf das er schlecht zu sprechen war. »Leider hat sich nicht der erwünschte Erfolg eingestellt. Es scheint, als wäre ich nicht zur Primaballerina geboren.« Sie lachte leise, obwohl es ihr schwerfiel, ihm diese Erklärung aufzutischen. Im Grunde ihres Herzens war sie nämlich noch immer der Überzeugung, dass in ihr ein Talent schlummerte. Und sie hatte auch wirklich gute Fortschritte gemacht, seit sie Einzelstunden bekam. Doch das spielte jetzt keine Rolle mehr, und so war es auch gleich, ob Achim sie nur für mittelmäßig begabt hielt oder nicht. »Mit anderen Worten, ich muss mir überlegen, was ich mit meinem Leben anfangen will. Immerhin werde ich bald achtzehn. Ich habe eine Schulbildung genossen, und daraus sollte ich nun etwas Gescheites machen, denke ich. Warum also nicht den Wunsch meines Vaters erfüllen und die Geschicke der Konditorei lenken?« Bevor er antworten konnte, fügte sie hinzu: »Gemeinsam mit dir natürlich, denn ohne dich schaffe ich das niemals.« Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, das seine Wirkung anscheinend nicht verfehlte. Statt aufzubrausen, wie er es vor einem Jahr getan hatte, sah er sie wohlwollend an.
»Aus der kleinen Marie ist eine schöne junge Frau geworden«, sagte er mit einem Glanz in den Augen, der seine Worte unterstrich. »Liegt es da nicht nahe, dass sich bald ein Kavalier findet, der dich heiraten wird? Ich bin sicher, dass es bis dahin nicht mehr lange dauern wird. Warum solltest du die Zeit verschwenden, indem du dich mit Dingen beschäftigst, um die du dich nach der Hochzeit ohnehin nicht mehr kümmern wirst?«
Marie teilte seine Einstellung absolut nicht. »Wer sagt denn, dass ich der Konditorei den Rücken kehre, nur weil ich einen Mann zum Heiraten gefunden habe?«
Seine Miene verfinsterte sich.
»Und überhaupt, es ist doch nicht sicher, dass ich einen tüchtigen, aufrichtigen Mann finde. Ich kann doch wohl schlecht meine Zukunft auf die Hoffnung bauen, dass es so sein wird. Nein, Achim, ich muss mein Leben in die eigene Hand nehmen.«
»Was für eine kuriose Geisteshaltung! Nein wirklich, Marie, du solltest deine Zeit nutzen und dich auf die Aufgaben einer guten Haushaltsführung vorbereiten. Das ist eine sinnvolle Beschäftigung, die eine Frau in die eigenen Hände nehmen sollte.«
Marie spürte, wie ihre Wangen zu glühen begannen. Sie ärgerte sich über die Art, wie er sie behandelte. Mit seiner Gegenwehr hatte sie gerechnet, aber gerade deshalb hatte sie sich ja diese Argumentation zurechtgelegt. Sie wollte den Eindruck vermitteln, als wüsste sie nicht, was sie mit sich anfangen sollte, wenn sie nicht in der Konditorei unterkommen könnte. In ihrer Vorstellung hätte er sie gar nicht zurückweisen dürfen. Was tun? Sie musste ihre Taktik ändern. Sollte sie ihm von ihrem Traum erzählen? Nein, das würde ihn auf keinen Fall überzeugen.
»Du denkst sicher, eine Frau versteht nichts von geschäftlichen Dingen, aber da irrst du. Ich habe in dem letzten Jahr viel gelernt, zumindest am Anfang. Und ich habe auch früher oft aufmerksam zugehört, wenn Johann-Alexander von der Konditorei und der Zunft erzählt hat. Haushaltsführung ist nichts für mich, Achim.« Dann fiel ihr das Schaufenster des Hutmachers wieder ein. »Außerdem glaube ich, dass eine Frau andere Ideen hat als ein Mann. Wir könnten uns wunderbar ergänzen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass wir noch immer kein Schaufenster haben. Dabei ist das doch die große Mode. Wir sollten unbedingt eines einrichten und darin unsere kostbarsten und besten Marzipanfiguren ausstellen.«
Oeverbeck verzog verächtlich den Mund. »Die große Mode wird bald wieder vorbei sein.«
»Das glaube ich nicht«, widersprach Marie. Sie ließ ihrer Begeisterung freien Lauf. »Die angesehensten Kaufleute in Lübeck wissen den Vorteil zu schätzen. Sie brauchen ihre Waren nicht mehr in Ausstellungen zu präsentieren, zu denen sie eigens einladen müssen, sondern können sie jederzeit und jedermann vorzeigen. Ganz ohne Mühe. Bestimmt wird den Passanten, die unser Marzipan und Konfekt sehen, das Wasser im Mund zusammenlaufen, und sie können gar nicht anders, als einzutreten und etwas zu kaufen.« Sie strahlte. Jetzt musste Achim einsehen, dass sie recht hatte.
»Marzipan«, schnaubte er. »Ich höre immer Marzipan. Damit sollten wir lieber keine Werbung machen.«
»Aber warum denn nicht?« Sie war verwirrt und musste wieder an die Worte ihres Bruders in ihrem Traum denken. Sie sah ihn vor sich, wie er keuchend und fiebrig auf sie einredete. »Das Marzipan ist unser Kapital«, sagte sie halb zu Oeverbeck und halb zu sich selbst.
Er sprang auf und kam um den Schreibtisch herum. Von oben herab schaute er sie an und verschränkte die Arme.
»Das war es vielleicht einmal, Fräulein Kröger, als noch unter Aufsicht deines Bruders nach dem alten Familienrezept produziert wurde. Aber das ist lange vorbei.«
Marie erhob sich ebenfalls von ihrem Stuhl. Sie wollte sich nicht länger so klein und hilflos fühlen. Stolz reckte sie das Kinn und machte sich gerade. Haltung hatte sie im Ballettunterricht gründlich gelernt.
»Und warum weiß ich nichts davon?« Sie blickte ihm so streng in die Augen, wie es ihr nur möglich war.
»Wie bitte?«
»Warum wurde ich nicht informiert? Ich bin Geschäftsführerin der Konditorei Kröger und habe mich darauf verlassen, dass alles zum Besten läuft.«
»O ja, das war sicher sehr bequem, sich auf den Oeverbeck zu verlassen, nicht wahr? Du konntest hübsch im Tüllröckchen herumhüpfen, während ich die ganze Arbeit und den Ärger mit dem Zaren hatte. Und nun fällt dir mit einem Mal ein, dass du die Geschäftsführerin bist, und du tauchst hier auf, um mir Vorwürfe zu machen.«
Marie schnappte kurz nach Luft. Allmählich wurde sie wirklich wütend. Sie hatte es im Guten versucht. Wenn Achim sich weiterhin stur stellte, musste sie sich eben seinem Ton anpassen.
»Es war durchaus nicht meine Absicht, dir Vorwürfe zu machen. Aber ich sehe, dass es ein Fehler war, deinen Fähigkeiten so blind zu vertrauen. Vor einem Jahr habe ich meine Stellung hier nach dem Willen meines Vaters übernommen und mir einen Überblick verschafft. Du hast mir den Eindruck vermittelt, die Geschäfte liefen gut und reibungslos und du hättest alles unter Kontrolle. Darum habe ich mir erlaubt, mich ein wenig zurückzuziehen.«
»Ein wenig?«, unterbrach er sie barsch. »Du hast dich kaum noch sehen lassen.«
Sie drehte sich von ihm weg und ging einige Schritte auf und ab. »Zugegeben, ich habe mein Engagement hier zurückhaltend dosiert, denn ich wollte dir das Gefühl geben, dass du der erste Mann in der Konditorei bist. Ich wollte dir zeigen, dass ich dir vertraue und dich nicht kontrolliere, wie du mir zu Beginn vorgehalten hast. Ich muss jetzt einsehen, dass das falsch war.« Sie drehte sich mit einem Schwung zu ihm um und blickte ihm wiederum direkt in die Augen. »Ich werde diesen Fehler kein zweites Mal machen. Ab jetzt möchte ich über alles informiert werden und an allen Entscheidungen teilhaben. Als Erstes will ich, dass du Preise für ein Schaufenster einholst. Es soll das schönste und modernste der gesamten Beckergrube sein.«
Oeverbeck starrte sie mit offenem Mund an. Die Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Maries Wangen dagegen glühten vor Aufregung.
»Und jetzt will ich wissen, warum es Ärger mit dem Zaren gegeben hat und welche Probleme wir in der Marzipanproduktion haben.« Sie nahm wieder Platz und wartete auf seinen Bericht.
Oeverbeck schien von ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Zielstrebigkeit so überrascht zu sein, dass er sich auf seinen Stuhl plumpsen ließ und zu erklären begann.
»Bei dem Marzipanrezept handelt es sich um ein Familiengeheimnis. Nur dein Vater und deine Brüder wussten, welche Zutaten benötigt werden.«
»Aber es ist doch allgemein bekannt, dass Mandeln, Zucker und Puderzucker die einzigen Zutaten sind«, unterbrach sie ihn.
»Eben nicht. Erstens gehört noch eine Zutat in das Kröger’sche Marzipan, die mir aber nicht bekannt ist, und zweitens entscheidet das Mischungsverhältnis von Zucker und Mandeln über die Güte des Resultats. Ich habe vor einem Jahr gehörig herumexperimentiert und versucht die bestellte Ware an den Zarenhof zu liefern. Schließlich habe ich nach dem allgemein üblichen Rezept herstellen lassen, und das Ergebnis war meiner Ansicht nach zufriedenstellend. Doch der Zar war sehr ungehalten. Seiner Meinung nach hätten wir versucht ihn zu betrügen.«
»Hast du ihm die Situation denn nicht erklärt?«
Langsam gewann Oeverbeck seine Fassung und damit auch seine überhebliche Haltung ihr gegenüber zurück.
»Typisch Frau! Du glaubst doch nicht, dass der Zar sich für unsere Probleme interessiert hätte. Er wollte einfach nur das unvergleichliche Kröger’sche Marzipan, das er in Paris gekostet hat. Bekommen hat er gewöhnliches Naschwerk, wie es jeder seiner Hof-Zuckerbäcker hätte herstellen können. Das waren jedenfalls seine Worte. Ein glatter Betrug in seinen Augen.«
»Da hat er recht!« Marie war wütend und schockiert. Es wurde wirklich Zeit, dass eine Frau das Regiment übernahm. Selbstverständlich hätte man dem Zaren die Situation erklären können. Sie war sicher, er hätte Mitgefühl und Verständnis gehabt.
»Er hat nur einen Bruchteil dessen bezahlt, was wir ihm berechnet haben. Einen Hungerlohn haben wir für unsere Arbeit bekommen. Davon konnten wir kaum die Zutaten bezahlen. Und du sagst, er hat recht?«
»Natürlich. Schließlich hat er ja auch nur einen Bruchteil dessen bekommen, was er bestellt hatte.«
»So ein Unsinn!« Jetzt schoss die Farbe regelrecht in sein Gesicht zurück. Er sah aus, als stünde er kurz vor der Explosion. »Ich habe sämtliche Posten geliefert, die er deinem Bruder aufgegeben hat. Nicht wenige Nächte habe ich zusammen mit den Arbeitern hier gesessen und lebensgroße Gänse, Karpfen und Rosen geformt und geschminkt. Ich habe sogar eine ganze Marzipantorte zusätzlich geschickt, damit er unseren guten Willen sieht.«
»Du hast dich also bereits im Voraus entschuldigt, weil du wusstest, dass er nicht die erwartete Qualität bekommen würde? Sehr geschickt, muss ich schon sagen …« Marie schüttelte den Kopf. Sie überlegte kurz, dann fragte sie: »Wie ist das Verhältnis mit Russland jetzt?«
»Es gibt kein Verhältnis mehr«, antwortete Oeverbeck. Er klang müde und resigniert. »Wir haben auf einen Großteil des Geldes verzichtet, und nun herrscht eisiges Schweigen.«
»Hm.« Marie dachte nach.
Sie wusste, dass immer mehr Konditoren und Bonbonhersteller Marzipan anboten, seit der Zunftzwang gefallen war. Ihr Vater brachte, wenn er das Haus mal verließ, Kostproben der Konkurrenz mit und reichte sie Marie schweigend. Jedes Mal stellte sie fest, dass Farbe, Konsistenz und vor allem der Geschmack nicht mit dem Kröger’schen Marzipan mithalten konnten. Die Masse war zu süß oder zu bitter, zu klebrig oder zu krümelig. Nur das Kröger’sche Marzipan hatte den unvergleichlichen Schmelz. Die würzig-süße Masse leistete den Zähnen nur sanften Widerstand, ließ sich sogar mit der Zunge am Gaumen zerdrücken, zerfiel oder verformte sich aber niemals, solange man sie noch vorsichtig zwischen zwei Fingern hielt, um zunächst den köstlichen Duft einzusaugen. Verschwand ein Stückchen zwischen den Lippen, breitete sich das Aroma ohne Verzögerung im Mund aus. Es war nicht zuckrig, sondern angenehm süß mit einem Hauch, der, wäre er nur etwas kräftiger, bitter zu nennen wäre. Hinzu kam diese edel-blumige Nuance, die Marie bereits ein Gefühl von Wärme und Trost vermittelt hatte, als sie noch ein kleines Kind war. All das waren Eigenschaften, die ausschließlich auf das Marzipan der Konditorei Kröger zutrafen. In der Kombination hatte kein Konkurrenzprodukt sie je erreicht. Das stellte Marie wieder und wieder fest, wenn ihr Vater Proben mitbrachte. Immer wenn sie missbilligend eine Schnute gezogen und das fremde Konfekt von sich geschoben hatte, war um seinen Mund ein leises Lächeln aufgetaucht. Gesprochen hatte er darüber nie. Hätte Marie doch bloß auch zwischendurch das eigene Marzipan gekostet, ihr wäre sofort aufgefallen, dass es nicht mehr das unverwechselbar feine Aroma hatte, sondern nur noch gewöhnlich schmeckte. Aber sie hatte mit Rücksicht auf ihre Figur – eine Ballerina durfte auf keinen Fall auch nur ein Gramm zu viel auf den Hüften haben – kaum noch Süßigkeiten zu sich genommen. Außer eben denen, die ihr Vater ab und zu mitbrachte. Was er ihr reichte, hatte sie nie ablehnen wollen, weshalb sie bei allen anderen Gelegenheiten zurückhaltender gewesen war. Ein schlimmer Fehler, wie sich nun herausstellte.
»Noch ist es nicht zu spät, Achim«, sagte Marie versöhnlich. »Ich weiß, wo Johann-Alexander das Rezept aufbewahrt hat. Natürlich wusste ich, dass es ein Familiengeheimnis sein sollte, aber ich dachte doch, dass du so eng mit meinem Bruder zusammengearbeitet hast, dass du inzwischen selbst weißt, wodurch das Konfekt seine hohe Qualität erhält.«
»Du weißt, wo das Rezept ist?«
»Ja«, sagte sie schlicht und lächelte ihn zaghaft an. »Du siehst, du brauchst mich.«
»Du solltest eher begriffen haben, wie gefährlich es ist, wenn nur einer das Geheimnis kennt. Ich sollte das Rezept auch kennen.« Er machte eine kurze Pause. »Falls dir einmal etwas zustößt oder du dich doch einmal zur Heirat entschließt.«
Sein Grinsen wirkte auf Marie zwar einerseits wie ein Versöhnungsangebot, andererseits blieben seine Augen dabei kalt. Sie hatte ein ungutes Gefühl. Sie reagierte nicht auf seinen Einwand, denn innerlich sträubte sie sich dagegen, ihn einzuweihen. Sie hätte keinen Grund dafür benennen können. Aber schließlich musste es ja auch an irgendetwas gelegen haben, dass ihr Bruder Achim nie das Rezept verraten hatte.
Sie räusperte sich. »Du kümmerst dich also um das Schaufenster, und ich werde nach dem Kröger’schen Familienrezept Marzipanmasse herstellen. Es wäre schön, wenn du mir sagen könntest, wie viel wir in der nächsten Zeit benötigen. Und dann werde ich einen Brief an den Zaren aufsetzen, ihm erklären, warum er nicht die erwartete Qualität erhalten hat, um Verzeihung für unser ungeschicktes Verhalten bitten und ihm wieder Ware anbieten.«
»Das kannst du nicht tun!«
Marie stand auf. »Du hast recht, besser, wir schicken ihm gleich eine Kostprobe mit, damit er sich überzeugen kann, dass alles wieder beim Alten ist.«
»Aber wie stehe ich denn dann da?«
»Nicht sehr gut, das ist wahr. Wir werden ihm erklären, dass du ihn nicht mit unseren Problemen belästigen wolltest. Im Grunde entspricht das doch auch der Wahrheit.« Sie war schon im Begriff, das Kontor zu verlassen, drehte sich an der Tür aber noch einmal um. »Vielleicht wäre es angebracht, wenn ich die Kostprobe selbst nach Russland bringen würde.«
Oeverbeck schoss von seinem Stuhl in die Höhe.
»Was? Hast du jetzt völlig den Verstand verloren?«
»Johann-Alexander war bei vollem Verstand, als er nach Russland gereist ist. Ich nehme nicht an, dass du auch an ihm gezweifelt hast.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Er sagte mir einmal, es sei immer gut, die Geschäftsbeziehungen ganz persönlich zu pflegen. Ich werde mich bei der Gelegenheit gleich als Geschäftsführerin und Nachfolgerin meines Bruders vorstellen. Gut möglich, dass ich in der feinen russischen Gesellschaft neue Kunden gewinnen kann, wenn ich vor Ort bin.« Damit ließ sie Oeverbeck stehen und eilte zurück in das elterliche Haus, um das Marzipanrezept aus seinem Versteck zu holen.
Rosenwasser, natürlich, das war die Substanz, die dem Marzipan seinen unvergleichlich feinen Geschmack verlieh. Marie prägte sich das Mischungsverhältnis, das sie dem Rezept entnommen hatte, ein. Und gleich würde sie sich auf den Weg zu Apotheker Mühsam, dem Bruder ihrer ehemaligen Ballettlehrerin, machen, dessen Name unten auf dem Zettel stand. Joachim-Alexander hatte bei ihm stets das Rosenwasser gekauft und sich darauf verlassen können, dass er zu niemandem ein Sterbenswörtchen über die Ingredienz verlieren würde, die Kröger junior regelmäßig in unbeschrifteten großen Flaschen bei ihm abholte. Doch vorher wollte sie noch rasch zu ihrem Vater gehen, um die Neuigkeiten zu berichten. Irgendwann musste er doch einmal reagieren. Sie lief hinunter ins Wohnzimmer. Dort saß er wie an den meisten Tagen am Fenster, ohne jedoch hinauszusehen.
»Hallo, Vater«, begrüßte Marie ihn. Er drehte nicht einmal den Kopf. »Stell dir vor«, sprudelte sie los, »der russische Zar war mit unserem Marzipan nicht zufrieden. Und er hat nicht die volle Summe gezahlt, die Oeverbeck in Rechnung gestellt hatte.« Sie ging vor dem Sessel ihres Vaters auf und ab und berichtete alles, was sie erfahren hatte. Natürlich erzählte sie auch, wie sie mit der Situation umzugehen gedachte und kam sich dabei sehr klug und wie eine richtige Geschäftsfrau vor. Marie war so mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkte, wie ihr Vater sie zunächst nur mit den Augen fixierte, dann den Kopf drehte, um sie beobachten zu können, wie sie redend durch die Stube spazierte. »Und ein Schaufenster müssen wir haben.« Endlich sah sie ihren Vater an und stellte verblüfft fest, dass er sie anlächelte. »Papusch!« So hatte sie ihn als kleines Mädchen oft genannt. Marie stand wie angewurzelt da und versuchte ihn nicht wieder in seine Isolation entkommen zu lassen. Sie stammelte: »Papusch, was hältst du davon? Oeverbeck war offen gestanden nicht sehr angetan. Aber man hat heute Schaufenster. Und sie haben auch wirklich Vorteile.« Sie holte Luft, um einen Vortrag über den Nutzen der Präsentationsflächen hinter Glas zu halten, doch ihr Vater unterbrach sie, indem er ihr die Hand entgegenstreckte.
»Komm her, meine Kleine.«
Marie spürte, wie ihr ein Kloß in die Kehle stieg. Sie ging zu ihm und setzte sich auf die Armlehne seines Sessels. Früher hatten sie immer so beieinandergesessen, wenn es etwas zu besprechen gab. Wenn sie im Unterricht aufgefallen war, weil sie meinte, etwas besser als der Lehrer zu wissen, oder weil sie mal wieder mit ihrer Nachbarin getuschelt hatte. Aber auch wenn sie Sorgen hatte, war sie stets lieber zu ihrem Vater als zu ihrer Mutter gegangen. Er war immer der ruhigere von beiden. Margreth Kröger regte sich leicht auf, war hektisch und konnte schlecht zuhören. Ihr schien für alles die Geduld zu fehlen. Außerdem war sie penibel mit allem, was ihr Haus betraf. Hätte sich Marie zu ihr auf die Armlehne des Sofas gesetzt, hätte sie es wichtiger gefunden, ihre Tochter auf eine ordentliche Sitzhaltung auf dem Sofa aufmerksam zu machen, und ihr zu erklären, wie schnell Polstermöbel sich abnutzten, wenn man sie nicht ihrer Bestimmung gemäß strapazierte, als auf ihre Sorgen einzugehen.
Maries Vater nahm ihre Hand und streichelte sie zärtlich. Dann sah er ihr sehr ernst und auch sehr wach in die Augen, wie er es lange nicht mehr getan hatte.
»Du triffst die Entscheidungen in der Konditorei. Wenn du sagst, wir bekommen ein Schaufenster, dann bekommen wir auch eins. Und wenn du mit Oeverbeck nicht zufrieden bist …«
»Doch«, beeilte Marie sich zu sagen. »Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn täte. Er kennt die Geschäfte von A bis Z.« Sie wollte keinesfalls, dass ihr Vater schlecht von ihm dachte. Das wäre nicht fair gewesen. Schließlich hatte ihr Bruder sich stets auf ihn verlassen können, und er hatte für die Konditorei ein Vielfaches von dem geleistet, was Marie bisher zustande gebracht hatte. »Nur manchmal scheint er Neuem gegenüber nicht sehr aufgeschlossen zu sein. Aber wir kommen schon zurecht.« Glücklich strahlte sie ihren Vater an, denn in diesem Moment hatte sie tatsächlich den Eindruck, dass alles gut werden könnte.
»Gut!« Wilhelm Kröger ließ Maries Hand los. Sie fürchtete, dass er im nächsten Augenblick wieder in seine Lethargie fallen könnte.
»Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht selbst nach Russland reisen sollte«, sagte sie schnell.
Erneut sah ihr Vater sie eindringlich an. Dann wiegte er den Kopf hin und her. »Hast du dir das auch gut überlegt? So eine Reise ist eine große Strapaze, die dir Kraft und Gesundheit rauben kann.« Er schluckte und sah hinunter auf den Parkettboden. Trotzdem konnte Marie Tränen in seinen Augen erkennen. Es war völlig klar, woran er dachte. Und auch sie musste gegen die Traurigkeit ankämpfen, die bei dem Gedanken an ihren Bruder in ihr aufstieg und ihr die Kehle zuschnüren wollte.
»Ich erinnere mich«, sagte sie nach einer Weile, »dass Johann-Alexander davon überzeugt war, dass es wichtig ist, sich persönlich um die Kundschaft zu bemühen. Vor allem, wenn es sich um solche Kundschaft handelt.«
»Also schön.« Wilhelm Kröger räusperte sich. »Geh ins Amtshaus der Schiffer. Dort wirst du jemanden finden, der nach St. Petersburg fährt und dich mit der Ware mitnehmen kann.«
Eigentlich hatte Marie fast gehofft, ihr Vater würde ihr den ganzen verrückten Plan ausreden. Achim Oeverbeck hatte vielleicht nicht unrecht, wenn er vermutete, sie habe den Verstand verloren. Begleiten würde er sie sicher nicht. Und allein als Frau auf so einer Reise …