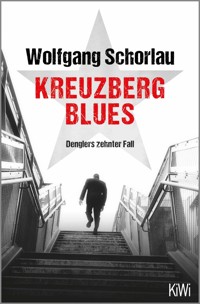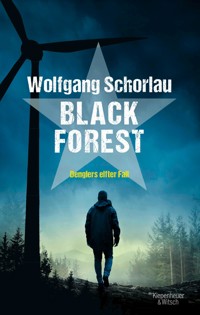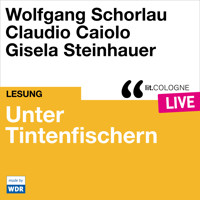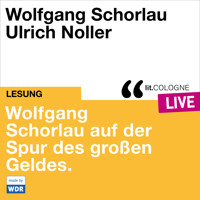9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dengler ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Ein Attentat, das Deutschland erschütterte. Ein Ermittler, der die Wahrheit ans Licht bringt. Das Bundeskriminalamt bittet seinen früheren Zielfahnder und heutigen Privatermittler Georg Dengler um Mithilfe: Er soll die Akten der damaligen Sonderkommission Theresienwiese über den verheerenden Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980 prüfen. Dengler denkt zunächst, es sei ein leichter Auftrag, doch schon bald entdeckt er die ersten Widersprüche. Warum wurde in dem Abschlussbericht der Sonderkommission behauptet, es handele sich bei dem Attentäter um einen Einzelgänger, während glaubhafte Zeugenaussagen ihn unmittelbar vor der Tat mit weiteren Personen gesehen haben? Als Dengler tiefer in den Fall eintaucht und unbequeme Fragen stellt, gerät er selbst ins Fadenkreuz mächtiger Interessen. In»Das München-Komplott« entwickelt Wolfgang Schorlau aus realen Geschehnissen einen packenden Politthriller, der von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält. Alle Fälle von Georg Dengler: - Die blaue Liste - Das dunkle Schweigen - Fremde Wasser - Brennende Kälte - Das München-Komplott - Die letzte Flucht - Am zwölften Tag - Die schützende Hand - Der große Plan - Kreuzberg Blues - Black ForestDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Das München-Komplott
Denglers fünfter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Wolfgang Schorlau
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Wolfgang Schorlau
Wolfgang Schorlau lebt und arbeitet als freier Autor in Stuttgart. Neben den acht »Dengler«-Krimis »Die blaue Liste« (KiWi 870), »Das dunkle Schweigen« (KiWi 918), »Fremde Wasser« (KiWi 964), »Brennende Kälte« (KiWi 1026), »Das München-Komplott« (KiWi 1114), »Die letzte Flucht« (KiWi 1239), »Am zwölften Tag« (KiWi 1337) und »Die schützende Hand« hat er die Romane »Sommer am Bosporus« (KiWi 844) und »Rebellen« (KiWi 1399) veröffentlicht und den Band »Stuttgart 21. Die Argumente« (KiWi 1212) herausgegeben. 2006 wurde er mit dem Deutschen Krimipreis und 2012 mit dem Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Das Bundeskriminalamt bittet seinen früheren Zielfahnder und heutigen Privatermittler Georg Dengler um Mithilfe: Er soll die Akten der damaligen Sonderkommission Theresienwiese über den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980 prüfen. Dengler denkt, es sei ein leichter Auftrag, doch schon bald entdeckt er die ersten Widersprüche. Warum wurde in dem Abschlussbericht der Sonderkommission behauptet, es handele sich bei dem Attentäter um einen Einzelgänger, während glaubhafte Zeugenaussagen ihn unmittelbar vor der Tat mit weiteren Personen gesehen haben? Dengler ermittelt und steht plötzlich selbst im Fadenkreuz mächtiger Interessen.
In seinem neuen Roman entwickelt Wolfgang Schorlau aus realen Geschehnissen eine Geschichte, die aus dem Kalten Krieg bis in unsere Zeit reicht und den Leser bis zur letzten Seite in Atem hält.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Prolog
Erster Teil
Die Freunde und die Unbekannte
Sprechpuppe
Anruf vom BKA
Geheimnis
Sternzeichen
Allein
Der Präsident
Erste Liebe
Großmutters Tod
Warum
Am Sauknochen nagen
Martin Klein
Feigheit zahlt sich nicht aus
Hochgefühl
G 96338225
In Wiesbaden
Waage
New York, 28. Februar 2009
Kein Mord ohne Motiv
Schmoltkes Rückkehr
Die Akte Becker
Zusammensein am Abend
Die große Lage
Partnertausch
München. Elmar Becker
Zweiter Teil
Münchener Ermittlungen
Task Force Berlin 1
Ein neues Horoskop
Plymouth, 7. Juni 2009
Hans Leitner
Das zerstörte Gesicht
Die Vertreibung aus der Küche
Farnsworth House, 8. Juni 2009
Task Force Berlin 1: Gisela Kleine
Am Morgen
Die Rede
Task Force Berlin 1: Im Lageraum
Wehrsport
Operation angelaufen
Wieder ein Team
Auf der Spur
Diskussion
Suchen Sie das Field Manual 30–31
Abhörprotokoll
Die Liebe und der Krimi
Streng geheim
Charlotte und Jan
Leitner zu überwachen
Tübingen. Im Boulanger
Harmlos
Venedig, 24. Juni 2009
Das Richtige zur richtigen Zeit
Die Bombe
Überwachung
Kein Mann nur für eine Nacht
Auf die Frauen
Der beamtete Staatssekretär
Am Morgen danach
Observationsberichte
Unauffindbar
Abhörprotokolle
Büro Dr. Huber
Freundinnen
Ein Plan
Kein Wort zu niemand
Belanglosigkeiten
Bericht Betty Gerlach
Die zweite Nacht: Charlotte und Jan
Field Manual
Karlsruhe
Das Video
Heimfahrt
Dengler verzweifelt
Termin beim Präsidenten
Frischer Mut
Dritter Teil
Nicht identifizierbarer Account
Asservate
Gladio
Charlotte von Schmoltke trifft Dengler
Noch eine Information
Arbeitsplan
Drei Schläge
Nur noch ein paar Wochen
Komm nach Berlin
Akten
Tritt ins Gesicht
Zweiter Tag in der Stasi-Unterlagenbehörde
Charlotte sucht Jan
Waffendepots
Große Verluste
Kein Zufall
Engel forscht
Enttarnt
Phantombilder
Amazing Grace
Enttäuschung
Es war ein Unglück
Verabredung im Hafen
Ein Gespräch
Containerlager
Geständnisse
Dengler stirbt
Charlotte verwirrt
Blechlawine
Verdammt echt
Noch einmal München
Niemand spricht über Betty
In Trabzon
Epilog
Anhang
Nachwort
Informationen zum Buch
Leseprobe »Black Forest«
Allen aufrechten Polizisten gewidmet!
Ich weiß Bescheid.
Ich kenne die Namen der Verantwortlichen für das, was Staatsstreich genannt wird (und das in Wirklichkeit eine Serie von Staatsstreichen darstellt, in Gang gesetzt als Schutzsystem der Macht).
Ich kenne die Namen der Verantwortlichen des Massakers von Mailand vom 12.12.1969.
Ich kenne die Namen der Verantwortlichen für die Massaker von Brescia und von Bologna der frühen Monate des Jahres 1974.
Ich kenne die Namen von denjenigen, die zwischen einer Messe und der anderen den alten Generälen die Anordnungen erteilt haben und diese des politischen Schutzes versicherten.
Ich kenne alle diese Namen und ich kenne alle diese Tatsachen (Attentate auf Institutionen und Massaker), derer sie sich schuldig gemacht haben.
Ich weiß Bescheid. Aber ich habe keine Beweise. Ich habe nicht einmal Indizien.
Ich weiß, weil ich ein Intellektueller bin, ein Schriftsteller, der versucht, das, was geschieht, zu verfolgen.
Pier Paolo Pasolini, am 14. November 1974 im »Corriere della Sera«, wenige Monate bevor er unter noch immer nicht geklärten Umständen erschlagen wurde.
Prolog
München, Theresienwiese
Georg Dengler überquerte den Bavariaring. Die Vormittagssonne wärmte sein Gesicht. Es war ruhig. Wenig Verkehr, kaum Menschen. Nur ein silberner Audi schlich untertourig die breite Straße hinauf. Im Schatten der Bäume am Rande der Wiesn radelte eine Gruppe Männer in T-Shirts des Fußballclubs 1860 München. Eine junge Frau, die einen Kinderwagen vor sich herschob, kam ihnen entgegen. Einige der Männer winkten ihr zu. Die Frau tat so, als bemerke sie es nicht, und lächelte erst, als die Gruppe an ihr vorbeigefahren war. Dengler schmunzelte unwillkürlich. Er fühlte sich ausgeruht und entspannt. Was für ein schöner Tag!
Ein paar Schritte weiter blieb er stehen. Er war angekommen. Halbkreisförmig umschrieb eine riesige Cortenstahlplatte den Platz, an dem die graue Stele mit der Inschrift stand: »Zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlags vom 26.9.1980«. Rundherum – im Boden und in der Stahlplatte – waren splitterförmige Eisenteile eingelassen. Dengler wurde kalt bei dem Gedanken, dass sie von dem Anschlag selbst stammen könnten. Tödliche Waffen einer schrecklichen Explosion. Hätten nicht ein paar Blumen am Rand gelegen, das Mahnmal hätte einen tristen Eindruck auf ihn gemacht.
Eine Gruppe von Männern und Frauen im Nordic-Walking-Look kam ihm entgegen. Sie benutzten Stöcke, die auf dem Teerboden unrhythmisch klackten. Sie redeten laut, lachten, scherzten und waren bald auf der anderen Seite des Rings verschwunden. Ein Liebespaar schlenderte Händchen haltend über den Platz.
Die Sonne blendete ihn.
Plötzlich sah ich eine Stichflamme, die 20 Meter hoch war.
Dengler zog die Luft tief durch die Nase ein. Sie roch nach Margeriten und Kräutern, deren Namen er nicht kannte. Immer noch erinnerte diese große karge Fläche an die Wiese, die sie einmal gewesen war, obwohl sie mittlerweile von geteerten Straßen durchzogen war, breit wie Landebahnen. Er bemerkte einen kleinen roten Bagger, der hundert Meter entfernt Erde aushob, um Platz für neue Kiesflächen zu schaffen. Und trotzdem ist es noch immer eine Wiese, dachte er.
Ein Pärchen auf Rollschuhen glitt an ihm vorbei. Beide trugen enge kurze Hosen aus einem glänzend schwarzen Stoff. Sie hielten sich an den Händen, und Dengler sah den verliebten Blick des jungen Mannes und das strahlende Lachen der hübschen Frau. Mit einer eleganten Bewegung stoppten sie vor der Straße, rollten weiter und überquerten sie, ohne sich loszulassen.
Da erfolgte ein ungeheurer Schlag, der die ganze Festwiese erschütterte.
Es muss ein lauer Spätsommerabend gewesen sein. Damals. Leichter Regen war gefallen. Ein angenehmer Regen. Er hatte die Stimmung auf dem großen Fest nicht verdorben. Wahrscheinlich waren die Menschen dankbar für die Abkühlung gewesen.
Danach war es zunächst totenstill. Dann laute Schreie.
Er schloss die Augen und stellte sich die Nacht vor fast dreißig Jahren vor. Gut gelaunte Frauen. Angeheiterte Männer. Manche wohl auch betrunken. Und Kinder. Sie alle gehen und stehen dicht nebeneinander. Fast eine viertel Million Menschen sind auf der Wiesn. Es ist schon spät am Abend, kurz nach 22 Uhr. Das Riesenrad dreht sich noch. Aus der Geisterbahn dringen schrille Schreie. Dichte Scharen drängen schon zum Ausgang. In einer halben Stunde wird das Fest für diesen Tag zu Ende sein.
Ein schöner Tag.
Dengler blinzelte. Die Sonne wärmte sein Gesicht, seine Brust, seine Beine. Er trug Jeans und ein weißes Leinenhemd. Unter den Arm hat er die Mappe geklemmt, die sie ihm gestern Abend gegeben hatten. Er hatte die Berichte gelesen, die Zeitungsartikel und die Vernehmungsprotokolle.
Der Mann, der eben noch vor mir stand, lag plötzlich zehn Meter weiter von mir entfernt. Beide Beine waren abgerissen.
Er überblickte den großen Platz. Eine »Sonderfreifläche«. Merkwürdig, dass ihm gerade jetzt die Behördenbezeichnung wieder einfiel. Lag es an dem Gespräch gestern Abend?
Ich habe bloß geschrien, ich habe gedacht, ich habe keinen Kopf mehr. Die Leute lagen alle rum, zerfetzt, mit abgerissenen Armen und Beinen und Köpfen.
Dengler ging die geteerte Straße hinunter. Einmal wollte er die gesamte Wiesn zu Fuß überqueren.
Ein Inlineskater überholte ihn. Mit ruhigen Beinbewegungen, als wolle er sich vom Boden abstoßen. Etwas weiter entfernt zog ein Modellflugzeug Loopings am Himmel.
Vor mir lag ein Kind. Der ganze Körper war zerfetzt, der Bauch offen.
Bis spät in die Nacht hatte Dengler in der Akte gelesen. Bis in den Schlaf hatten ihn die Szenen verfolgt. Jetzt holten sie ihn wieder ein. Bilder, Stimmen, Schreie, der Geruch von Blut.
Die mörderische Ladung der Bombe aus Nägeln, Schrauben, Muttern und kantigen Metallstücken flog 40 Meter weit.
Er musste eine Entscheidung treffen. Wollte er sich mit diesem Verbrechen beschäftigen? Mit dem größten Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, bei dem 13 Menschen starben, 200 verletzt wurden, 68 davon sehr schwer?
Wir standen am Haupteingang – plötzlich dieser Lichtpilz und ein wahnsinniger Wind. Wir waren so von Menschen eingekeilt, dass wir gar nicht stürzen konnten. Ich sah nach unten – Blut, Blut, Blut.
In der blauen Mappe stecke nur ein kleiner Ausschnitt der Akten, vor allem Presseberichte, hatten sie zu ihm gesagt. Wenn Sie bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, erhalten Sie die vollständigen Unterlagen. Mehr als 80 Aktenordner.
Einem Verkäufer hatte die Druckwelle eine Handvoll Lose weggefegt. Während die Menschen schrien und verbluteten, suchte er wie ein Irrer nach seinen Losen.
Er ging die geteerte Schneise hinunter. Auf dem Platz waren etliche Halfpipes für Skateboarder aufgebaut. Zwei Jungs sprangen von ihren Brettern, drehten sich einmal um die eigene Achse, landeten wieder auf den Skateboards, fuhren weiter, wendeten und wiederholten das Manöver.
Sie waren großzügig gewesen. Sie hatten ihm eine Suite im Bayerischen Hof reserviert. Auf dem Dachgarten hatten sie gestern Abend gegessen. Sie hatten sich Mühe gegeben. Dann hatte der Präsident gesagt: Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir möchten, dass Sie noch einmal den Fall des Attentats auf das Münchner Oktoberfest untersuchen.
Überall wälzten sich verstümmelte Menschen schreiend in ihrem Blut. Ich kümmerte mich zunächst um ein zwölfjähriges Kind. In seinem Bauch steckte ein fingerdicker Splitter.
Er war lange Polizist gewesen. Er hatte unzählige Tote gesehen. Er hatte Menschen erschossen. Aber in dieser Nacht hörte er die Schreie der Verletzten und träumte, er wate in Blut.
Er verließ die Theresienwiese über die Matthias-Pschorr-Straße und drehte sich noch einmal um.
Die St.-Paul-Kirche ragte über die Dächer der Stadt hinaus, als sei sie einst schon als Fotomotiv gebaut worden.
Er wählte die Nummer, die sie ihm gegeben hatten.
»Ich brauche Bedenkzeit«, sagte er. »Zwei Tage.«
Erster Teil
Die Freunde und die Unbekannte
Im Sommer 2009 stand die Welt vor einem Abgrund. Im vollen Bewusstsein ihres Handelns hatten Banken einander Pakete mit faulen amerikanischen Immobilienkrediten weiterverkauft. Solange die Immobilienpreise in den USA weiter gestiegen waren, war dieses Geschäft risikolos gewesen. Mit jedem weiteren Verkauf der sinnlosen Papiere machten die Banken ein gutes Geschäft. Jeder von ihnen wusste, dass die Blase irgendwann einmal platzen würde, aber jede Bank hoffte, dass ausgerechnet sie zu diesem Zeitpunkt die Papiere verkauft haben würde. Das Ganze glich dem beliebten Kinderspiel »Reise nach Jerusalem«: Zehn Kinder laufen im Kreis um neun Stühle, während Musik spielt. Wenn die Musik stoppt, müssen sich alle setzen. Ein Kind findet keinen Stuhl mehr und hat verloren.
Als die Blase platzte, hatten die Institute das Zweihundertfache des Weltsparaufkommens als Kredite vergeben, und so fanden nur wenige von ihnen einen Platz auf den Stühlen. Die Finanzwelt bebte, als Lehman Brothers Inc. mit einem Schuldenberg von 200 Milliarden Dollar pleiteging. Nun misstraute jede Bank der anderen. Sie liehen sich gegenseitig kein Geld mehr, der internationale Geldverkehr kam zum Erliegen, und die Welt stand plötzlich vor dem Chaos.
Regierungen spendeten Milliardenbeträge, um zu retten, was nicht mehr zu retten war. Ein marodes System.
Während die gleichen Figuren, die die Krise verursacht hatten, im Kanzleramt hofiert wurden und sich dort feixend in Gesprächsrunden fotografieren ließen, die zur Krisenbehebung einberufen waren, traten Staat und Konzerne mit nie erlebter Härte nach unten. Kaisers Kaffee, ein zur Tengelmann-Gruppe gehörendes Einzelhandelsunternehmen, kündigte nach 31 Jahren Betriebszugehörigkeit der Kassiererin Barbara E., weil sie angeblich zwei Leergutbons im Wert von 80 Cent und 30 Cent, die ein Kunde vergessen hatte, für sich eingelöst hatte. Nachweisen konnte das Gericht dies der Kassiererin nicht. Die Verdachtskündigung wurde trotzdem von zwei Instanzen der Arbeitsgerichte in Berlin bestätigt.
Der 29-jährige Mehmet Güler, der bei der Mannheimer Gesellschaft für Abfallentsorgung arbeitete, kassierte eine fristlose Kündigung, weil der zweifache Vater ein Kinderbettchen aus dem Container zog, das für die Schrottpresse bestimmt war.
Ein Empfänger von Hartz IV, jener staatlich verordneten Armut, wollte sein Einkommen von 351 Euro im Monat aufbessern und setzte sich hinter Pappschild und Blechdose bettelnd in die Göttinger Innenstadt. Er hatte nicht mit jenem Sachbearbeiter des Sozialamtes der Stadt Göttingen gerechnet, bei dessen Behörde der bettelnde Mann als »Kunde« gemeldet war und der in der Mittagspause an ihm vorbeilief. Der Beamte sah genau hin und verschickte einige Tage später einen Brief an den bettelnden Mann: »In den letzten Tagen habe ich Sie mehrfach gesehen, wie Sie vor dem Rewe-Supermarkt … gebettelt haben. Zuletzt lagen am 3. 1. 2009 in der Mittagszeit circa sechs Euro und heute gegen 13 Uhr etwa 1,40 Euro in einer Blechdose.« Der pflichtgetreue Staatsdiener rechnete die Beträge hoch und kündigte an: »Ich beabsichtige daher, … einen Betrag von 120 Euro als Einkommen durch Betteln anzurechnen.« Künftig werde er nur noch 231 Euro Unterstützung aus Hartz IV monatlich erhalten.
Öffentlich wurden nur jene Schikanen, die bis zum Bundesarbeitsgericht drangen.
Im Sommer 2009 sah es so aus, als wollte die herrschende Klasse testen, wie weit sie es treiben könne, als sollte in einem riesigen gesellschaftlichen Experiment untersucht werden, wie viel Ungerechtigkeit die Gesellschaft ertragen könne. So als sollte in einem riesigen Laboratorium erforscht werden, was geschehen müsse, damit die Menschen auf die Barrikaden gingen.
Aber es gab keine Barrikaden.
Noch nicht.
Er hatte noch nicht zugesagt, aber er hatte sich entschieden. Es waren zwei einfache Gründe und ein tieferer komplizierter Grund, die Georg Dengler dazu bewogen, den Fall anzunehmen. Er erklärte sie seinen Freunden abends, als sie gemeinsam im Basta saßen, ihrem Stammlokal: Erstens würde er gut bezahlt werden, und zweitens würde sich die Arbeit auf das Studium der Akten beschränken. Vielleicht komme eine Zeugenbefragung oder zwei dazu. Mehr aber wohl nicht. Die Tat lag dreißig Jahre zurück. Viele Zeugen lebten nicht mehr, andere erinnerten sich kaum noch. Die meisten der ermittelnden Polizisten würden nun den Ruhestand genießen oder ebenfalls bereits gestorben sein. Dreißig Jahre ist eine lange Zeit, sagte Dengler.
Über den tieferen Grund, diesen Auftrag anzunehmen, gab Georg Dengler weder sich selbst noch seinen Freunden aufrichtig Rechenschaft. Er spürte nur eine tiefe dunkle Stimmung in seinem Gemüt, die er sich nicht erklären konnte. Ob sie damit zusammenhing, dass das Bundeskriminalamt bei diesem Fall sein Auftraggeber sein würde? Mehr als fünfzehn Jahre war Dengler Zielfahnder beim BKA gewesen, bevor er den Dienst quittiert und sich als Privatermittler in Stuttgart selbstständig gemacht hatte. Seine Kündigung hatte damals etwas von Notwehr an sich. Die Vorgaben für die Ermittler waren immer einseitiger geworden. Manche Ermittlungsstränge durfte er nicht weiter verfolgen, obwohl es wichtige Spuren waren. Er sah sich damals vor die Alternative gestellt: entweder aufrichtig zu bleiben und zu gehen oder sich zu beugen und genauso ein hemmungsloser Kriecher zu werden wie viele seiner Kollegen. Er wollte sich nicht brechen lassen und ging.
Er hatte diesen Entschluss nie bereut. Und doch …
Das BKA war für ihn in seinen jungen Jahren eine Art Heimat gewesen. Der Behörde warf er daher nichts vor. Dem damaligen Präsidenten schon. Und nun gab es einen neuen Chef. Seit langer Zeit stand wieder einmal ein Polizist an der Spitze des Amtes und nicht ein Jurist, der von Polizeiarbeit keine Ahnung hatte.
Dieser Präsident hatte ihn um Hilfe gebeten. Er hatte ihn in ein teures Hotel eingeladen und ihm seine Wertschätzung offen gezeigt. Konnte er sich dem entziehen? War er insgeheim nicht doch noch immer ein Polizist?
Seine drei besten Freunde saßen mit ihm zusammen am langen Tisch im Hinterzimmer des Basta. Mario, Martin und Leopold. Mario war Künstler. Er war der Kreative in der Runde. Mario stand für die Überlegenheit des Gefühls über den Verstand. In seinem Atelier in der Reinsburgstraße schuf er große farbige Bilder, die alle von dem gleichen Sammler gekauft wurden, dessen Namen er vor allen geheim hielt, sogar vor Anna, seiner Frau. Erst vor Kurzem hatten die beiden geheiratet, und seither sprach Mario fast jeden Abend, an dem die Freunde sich trafen, vom romantischen Glück der Ehe. Mit Anna zusammen betrieb er in seiner Wohnung das St. Amour, ein Ein-Tafel-Restaurant. Er kochte leidenschaftlich gern und gut, und so war das St. Amour zu einem Geheimtipp in der Stadt geworden. Vor allem in Künstlerkreisen hatte sich herumgesprochen, dass man nirgendwo so außergewöhnlich und so gut essen konnte wie in Marios Wohnzimmer.
Georg Dengler und Mario kannten sich schon seit ihrer Kindheit. Sie waren in Altglashütten aufgewachsen, einem kleinen Ort im Schwarzwald. Beide waren als Kinder Außenseiter im Ort gewesen, beide waren sie vaterlos aufgewachsen, und vielleicht war das der Grund, warum die beiden Einzelgänger letztlich Freunde geworden waren. Dabei hätten sie unterschiedlicher nicht sein können: Dengler war ein Grübler, Mario dagegen war impulsiv. Dengler hatten seine langen Beamtenjahre beim Bundeskriminalamt mehr gefärbt, als er es selbst für möglich hielt. Obwohl er im BKA vieles erlebt hatte, das er nicht billigte, war sein Glauben an die Institutionen des Staates nicht nachhaltig erschüttert. Dengler hielt Staat, Polizei und Justiz für wichtige Einrichtungen, ohne sie war ein zivilisiertes Leben für ihn nicht denkbar. Mario hingegen träumte von einer Revolution der Künstler, von einem Aufstand der Kunst gegen die Macht des Geldes. Ihm war Unordnung bedeutend lieber als Ordnung, Chaos war ihm ein natürlicher Glückszustand, und auferlegte Pflicht hasste er aus tiefer Überzeugung.
Leopold Harder war ein hagerer Mann Ende dreißig. Sein Markenzeichen war die schwarze runde Brille, die ihn schon von Weitem als Intellektuellen verriet. Er war Journalist, arbeitete im Wirtschaftsressort einer der beiden Tageszeitungen der Stadt. Er hatte durch seine Recherchen Georg Dengler bereits in einigen Fällen geholfen. Dengler schätzte die zurückhaltende Gründlichkeit seines Freundes, seinen Sachverstand und die Fähigkeit, komplexe ökonomische Zusammenhänge in einfachen Worten zu erklären. Dengler kannte keinen klügeren Menschen.
Mario und Leopold hatten Dengler geraten, den Auftrag des BKA anzunehmen. Nur Martin Klein schien dazu nichts sagen zu wollen. Er starrte hinüber zur Tür. Eine Frau war eingetreten und hatte sich an die Bar gestellt. Sie sah sich suchend um.
Mario, der Kleins Blick folgte, pfiff durch die Zähne. Die Frau war hochgewachsen, dunkelhaarig, nicht hinreißend schön, aber attraktiv, sie hatte etwas Spanisches, Rassiges an sich – gebräunte Haut, schwarze Augen, eine gute Figur, die durch das kurze schwarze Kleid, das sie trug, perfekt betont wurde. Am auffälligsten aber war ihre Haltung. Sie zeichnete jene unwiderstehliche Attraktivität aus, die selbstverständliches Selbstbewusstsein bewirkt.
»Kennst du die Frau?«, fragte Mario Martin Klein, der immer noch zur Bar hinüberstarrte.
Klein schüttelte den Kopf.
»Leider nicht.«
»Soll ich sie an den Tisch bitten? Vielleicht trinkt sie ein Glas mit uns?«
»Auf keinen Fall. Was soll so eine Frau mit uns anfangen?«
Martin Klein war der Älteste der vier Freunde. Es ärgerte ihn, dass ihm als einzigem der Freunde bereits Haare aus der Nase und den Ohren wuchsen. Jeden Morgen kontrollierte er ihren Wuchs. Früher war er ihnen mit einer Nagelschere zu Leibe gerückt, doch seit er in einem türkischen Film gesehen hatte, wie ein Istanbuler Friseur seinen Kunden diesen lästigen Makel mit einem Feuerzeug abgeflammt hatte, versuchte er dies auch. Daher rührte die kleine Brandblase unterhalb seines rechten Nasenlochs, und diese Blase war der Grund, warum er auf keinen Fall wollte, dass diese schöne Frau an ihren Tisch kam. Eitelkeit war eine seiner kleineren Schwächen.
Klein lebte davon, dass er Horoskope für einige Frauenmagazine verfasste, und auch das wöchentliche Horoskop im »Aktuellen Sonntag« stammte aus seiner Feder. Er verdiente damit nicht schlecht, aber er litt unter seiner Arbeit, weil er Astrologie für einen Schwindel hielt, einen harmlosen zwar, einen Aberglauben, für den aus ihm unerfindlichen Gründen hauptsächlich Frauen anfällig waren. Es grämte ihn zusehends, dass er sich daran beteiligen musste, um über die Runden zu kommen.
»Niemandem leuchtet es ein, warum die Kraft der Sterne erst zum Zeitpunkt der Geburt wirken soll«, erklärte er. »Diese angeblich so mächtigen Kräfte durchdringen die Mauern und die Isolierung von Krankenhäusern und Kreißsälen, die selbst Handystrahlung absorbieren, aber gegen die dünne Schutzschicht von Mutterleib und Plazenta, die durchlässig ist für Sauerstoff und anderes, da versagen diese kosmischen Energien. Wer glaubt denn so was?«
Klein lebte im ersten Stock des Hauses, in dem sich auch das Basta befand. Er hatte Georg Dengler kennengelernt, als dieser vor einigen Jahren in das gleiche Haus einzog. Seitdem waren sie Nachbarn und Freunde.
Klein konnte den Blick nicht von der Frau an der Theke lassen.
Sie hatte sich ein Glas Primitivo bestellt, was ihm gefiel. Offensichtlich besaß sie auch in dieser Frage einen guten Geschmack.
Klein lebte schon lang allein. Früher einmal, und bei diesem Gedanken lächelte er still vor sich hin, hatte er eine nicht unbeträchtliche Wirkung auf Frauen gehabt. Aber er hatte sich damit abgefunden, dass dieses Kapitel für ihn abgeschlossen war. Das war nicht angenehm, aber nicht zu ändern. Die Paarungszeit war für ihn vorbei.
Um so beunruhigender war, dass diese Frau ihn so aufwühlte. Er betastete seine Brandblase unter der Nase. Sie würde sofort sehen, dass er sich die Nasenhaare mit einem Feuerzeug abgeflammt hatte – dass er überhaupt Haare in der Nase hatte. Altwerden ist nichts für Feiglinge, dachte er und bemerkte, dass er dem Gespräch seiner Freunde schon seit einiger Zeit nicht mehr folgte.
»Also, Martin, ich schau mir das jetzt nicht mehr länger an«, sagte Mario und stand auf.
Er ging hinüber zur Bar und sprach die Frau an. Er sagte etwas, was Klein nicht verstand, dann zeigte er mit einer einladenden Geste an den Tisch mit den vier Freunden. Klein verfluchte – und bewunderte ihn. Er hätte es nie gewagt, diese Frau anzusprechen. Selbst wenn er keine Brandblase unter der Nase gehabt hätte.
In diesem Augenblick vibrierte Denglers Handy, das vor ihm auf dem Tisch lag. »Unbekannte Rufnummer«, zeigte das Display an.
Sprechpuppe
Um sechs Uhr klingelte der Wecker. Eben noch war sie im Traum nackt am Rednerpult des Bundestages gestanden und hatte in die grölenden Gesichter ihrer Kollegen gesehen. Es dauerte einen Augenblick, bis sie begriff, dass es nur ein Albtraum gewesen war. Erleichtert tastete sie nach dem Wecker. Dann warf sie sich noch einmal auf den Rücken und starrte die Decke an. Nicht einmal Harald war da. Dann wäre alles leichter. Er könnte ruhig weiterschlafen, aber sie könnte sich noch mal an ihn schmiegen.
Sie lächelte.
Sie hatten sich aneinander gewöhnt. Es war nicht leicht gewesen. Vor allem für sie. Vielleicht würden sie sogar ein Kind bekommen. Sie verhütete nicht mehr, allerdings schliefen sie seit Monaten nicht miteinander. Sie war immer viel zu müde.
Schluss, dachte sie. Schluss mit diesen Gedanken.
Ich bin wieder einmal viel zu spät nach Hause gekommen. Zwei Uhr ist es wohl gewesen.
Sie schloss die Augen. Sie war so müde. Sie wollte weiterschlafen. Unbedingt. Nichts schien in diesem Augenblick wichtiger als Schlaf. Doch dann stieg aus den nebeligen Schichten ihres Unterbewusstseins die Erinnerung herauf, dass in einer halben Stunde eine hellwache Journalistin anrufen würde und sie dem Deutschlandfunk ein Interview zu geben hatte.
Stöhnend setzte sie sich auf. Ihr Kopf schmerzte. Sie hatte zu viel getrunken. Sie hatte sich vorgenommen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Nur an den Gläsern zu nippen. Aber das war gar nicht so einfach. Gestern Abend, wo war sie da gewesen? Ihr fiel es wieder ein. In Hannover. Sie hatte auf einer Veranstaltung des Beamtenbundes in Hannover gesprochen. Auf der Rückfahrt nach Berlin hatte sie im Fond ihres Dienst-A8 nicht schlafen können. Das war ungewöhnlich. Seit sie vor vier Jahren Parlamentarische Staatssekretärin geworden war, konnte sie in jeder Situation einnicken, ein Sekundenschläfchen halten, im Auto, im Flugzeug, in nahezu jedem Transportmittel konnte sie schlafen – und sei es nur für einen Augenblick. Sehr erfrischend waren diese kleinen Pausen. Aber gestern hatte es nicht geklappt. Sie hatte gegrübelt. Über die NPD-Verbotssache. Wieder einmal. Es war erschreckend: In vier Monaten war Bundestagswahl, und sie hatte immer noch nichts erreicht.
Vier Jahre, dachte sie. Fast vier Jahre lang war sie nun schon Parlamentarische Staatssekretärin im Innenministerium.
Ich bin alt geworden in dieser Zeit, dachte sie. Und ich habe in meinem Hauptanliegen nichts erreicht.
Es war nicht sicher, ob sie nach der Wahl noch einmal Staatssekretärin werden würde. Im Moment war schwer vorherzusagen, wie die Wahlen ausgehen würden. Selbst wenn die Konservative Partei wieder die Regierung bilden würde, war nicht sicher, ob ihr erneut das Innenministerium zufiel. Wie viel Zeit blieb ihr noch? Zu wenig, um etwas zu bewirken.
Wirklich?
Sie stand auf, streckte die Arme und dehnte sich.
Um was ging es eigentlich bei dem Interview?
Sie schaute in den Papieren nach: Um eine Grundgesetzänderung, mit der man die Piraten vor Somalia besser bekämpfen konnte. Die Journalisten würden sicher wissen, dass dieses Thema der Regierung nur die Gelegenheit bot, um das Grundgesetz für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren aufzulockern. Sie musste sich auf Fragen in dieser Richtung wappnen. Sie würde alles abstreiten, obwohl die Journalisten wussten, dass es genau darum ging, und sie wusste, dass die Journalisten wussten …
Noch unsicher auf den Beinen ging sie ins Bad und stellte die Dusche an. Wie würde ihr Tag weitergehen? Neben dem Telefon lag die Mappe mit ihrem Tagesplan. Das Papier quoll heraus. Neun Uhr: Frühstück mit irgendjemand von ver.di. Da ging es um die geplante Änderung der Beamtenbesoldung. Dann Arbeitsgruppe Innenpolitik der CDU, danach im Kanzleramt die Koalitionsrunde. Anschließend tagte der Innenausschuss. Am Nachmittag Einweihung eines neuen Olympiastützpunktes. Wo nur? In Stralsund? Nein, Stralsund war es nicht, aber doch irgendein Ort im Osten. Im Ablaufplan würde es stehen, der Fahrer würde schon wissen, wo er sie heute hinzufahren hatte.
Das ist wieder einer meiner Horrortermine, dachte sie. Drei Stunden Hinfahrt, drei Stunden Rückfahrt, eine halbe Stunde Grußwort. Am Abend Empfang des Bundesverbandes der Sicherheitsirgendwas. Mit Rede. Vielleicht konnte sie im Auto den Text überfliegen. Notwendig war das aber nicht. Bitter dachte sie, dass sie das immerhin in den vier Jahren gelernt hatte: Fremde Texte mit Überzeugung vorzulesen, so als ob man sie selbst geschrieben und nicht eben zum ersten Mal gesehen habe. Pünktlich würde sie sowieso nicht sein.
Warum das Büro die Termine immer so eng setzte? Hab ich nicht schon hundertmal gesagt, dass sie mich nicht zu Tode hetzen sollen?
Eine Sprechpuppe bin ich, dachte sie plötzlich. Ich rase von Ort zu Ort und lese Reden vor, die ich nicht kenne. Mit Inhalten, die das Büro ausgearbeitet hat.
Vor ein paar Tagen hatte sie zufällig auf dem Ministerstockwerk dem Gespräch zweier Beamter zugehört. Sie standen beieinander am Kopierer, Akten in der Hand, und hörten sie nicht kommen.
»Die Minister kommen und gehen«, hatte der eine gesagt.
»Und die Staatssekretäre auch«, der andere, und dann hatten sie sie erschrocken bemerkt und waren hastig auseinandergegangen.
Sie hatten recht. Was hatte sie schon erreicht? Dabei war sie doch mit einem wichtigen Ziel in dieses Amt eingetreten. Nichts hatte sie erreicht. Wie ein Hamster lief sie im Rad. Auf hohem Niveau, sicher. Die Beamten scharwenzelten um sie herum. Die Interessenverbände sowieso. Frau Staatssekretärin hier, Frau Staatssekretärin dort. Vorgegebene Unterwürfigkeit. Ja, wie ein Hamster. Aber ein Hamster in einem teuren Auto. In besten Kostümen. In erstklassigen Transportmitteln. Gut bezahlt. Mit viel Geld. Manchmal fühlte sie sich richtig mächtig.
Aber doch nur eine Sprechpuppe.
Kein Privatleben.
Keine eigene Meinung.
Keine Aufmerksamkeit.
Kein Freiraum.
Das war ihr Leben.
Selbst der Kontakt mit den Bürgern war schwerer geworden. Eine einfache Abgeordnete konnte man leichter ansprechen als sie. Aber nun, mit all den Insignien der Macht ausgestattet, dem Dienst-Audi, den Referenten, der Begrüßung durch Oberbürgermeister, schien es ihr, als hätten nur noch Verrückte den Mut, mit ihr zu sprechen. Bei einem der letzten Auftritte hatte eine Frau um die vierzig sie bedrängt. Wie die Regierung mit dem Datum 21. 12. 2012 umgehen würde? Ob es Einsatzpläne für diesen Tag gebe? Sie hatte die Frau irritiert angesehen, die so gewisslich auf sie einsprach, als müsse jedermann wissen, was dieses Datum bedeutete. Charlotte wusste es nicht, und die Frau erklärte ihr schließlich, dass an diesem Tag der Kalender der Maya ende. Und damit ende für die Mayas auch die Geschichte der Welt. Selbst seriöse Wissenschaftler beschäftigten sich seit Langem mit den möglichen Folgen. Verheerende Schäden seien zu erwarten, sagte die Frau, und die Regierung müsse doch endlich das Volk aufklären.
Es war der fanatische Glanz in den Augen der Frau, der sie warnte. Auch eine Art unterdrückter Bereitschaft zu Gewalt, die sie mehr ahnte als spürte. Die Maya hätten ihres Wissens weder über eine Schriftsprache noch über das Rad verfügt, sagte sie, da traue sie ihren kalendarischen Fähigkeiten auch nicht allzu sehr. Die Frau holte tief Luft, schrie und fuhr ihr mit langen roten Fingernägeln ins Gesicht. Drei Wochen lang sah man die Schrammen, und sie musste sich den milden Spott ihres Mannes anhören.
Früher, ohne das Amt, war ihr Leben anders gewesen: Als junge Abgeordnete hatte sie den damaligen Innenminister mit ihren Fragen gepeinigt: Warum werden die Neonazis der NPD nicht verboten? Warum unternehmen Sie nichts? Und einmal hatte sie sogar gesagt: Warum decken Sie die braune Soße, Herr Minister? Das hatte ihr einen Ordnungsruf des Präsidenten eingebracht. Aber ihre Hartnäckigkeit damals und die Aufmerksamkeit, die sie dafür in der Presse und bei der jetzigen Kanzlerin fand, hatten sie in dieses Amt gespült.
Aber sie hatte nichts erreicht. Die Neonazis wurden immer dreister. Im Osten kontrollierten sie schon komplette Landstriche. »Befreite Gebiete«, nannten sie es. Bald würde es dort eine Doppelherrschaft geben.
Und sie schwieg.
Das Telefon klingelte.
»Guten Morgen, Frau von Schmoltke, sind Sie bereit für unser Morgeninterview?«, fragte eine frische Frauenstimme. »Wir sind in zwanzig Sekunden auf Sendung.«
»Ich bin bereit«, sagte sie und richtete sich auf.
Anruf vom BKA
»Bundeskriminalamt. Spreche ich mit Georg Dengler?«
»Ja, bitte?«
»Na, Süßer, wie geht es dir?«
»Hallo – wer spricht da? Marlies, bist du das?«
Dengler stand auf und ging hinüber zur Bar. Auf halbem Weg kam ihm Mario mit der gut aussehenden Frau entgegen. Die beiden gingen zu ihrem Tisch, und Dengler sah aus dem Augenwinkel, dass die Frau sich auf seinen Platz setzte.
»Klar. Freut mich, dass du dich noch an mich erinnerst.«
Marlies war zu der Zeit, als Georg Dengler noch Zielfahnder beim Bundeskriminalamt gewesen war, die Sekretärin von Dr. Scheuerle gewesen, dem Leiter der Abteilung Terrorismus und Denglers Chef. Sie waren sich einig gewesen, dass Scheuerle ein großer Idiot war, der alle Beamten terrorisierte, die ihre Arbeit machten, und diese Übereinstimmung hatte ihn, neben einigen Gläsern Weißwein, dazu bewogen, spätabends mit ihr in ihre Wohnung zu gehen. Es war ein dringender Einsatz, der die Liebesnacht verhinderte. Marlies hätte gern einen neuen Versuch unternommen, aber Dengler ließ sich nicht mehr darauf ein.
»Ich bin befördert worden«, sagte Marlies.
»Oh, Gratulation! Das heißt …?«
»Ich arbeite nun im Büro des BKA-Präsidenten. Und der will dich sprechen. Passt es gerade?«
»Nicht ideal, aber es geht schon.«
»Scheint eilig zu sein. Er kam nämlich direkt aus einem Gespräch mit der Staatssekretärin, als er dich sprechen wollte. Ich verbinde … Vielleicht sehen wir uns mal? Tschüss!«
Dengler ging raus ins Freie.
»Schneider hier. Herr Dengler? Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber ich brauche eine Entscheidung von Ihnen. Sie nehmen unser Angebot an?«
»Ich nehme es an, Herr Dr. Schneider«, sagte Dengler.
»Das freut mich sehr. Können wir uns noch mal sehen? Zeitnah?«
Der Präsident sprach plötzlich sehr schnell. »Können wir uns morgen in Stuttgart treffen?«
Sie verabredeten sich für den nächsten Tag.
Geheimnis
Charlotte Gräfin von Schmoltke stammte aus einer alten schwäbischen Adelsfamilie. Die Familiengeschichte lag wie ein Glorienschein, aber manchmal auch wie ein bedrückender Nebel über ihrem Leben. Der Großvater war Offizier der Wehrmacht gewesen und hatte zur Widerstandsgruppe um General Olbricht gehört. Die Nazis erschossen ihn nach dem misslungenen Attentat zusammen mit Olbricht, Stauffenberg und anderen in der Nacht vom 21. Juli 1944 im Bendlerblock.
Sie kannte ihren Großvater nur von alten Fotografien, aber in diesen Bildern war er stets präsent. Im Wohnzimmer der Familie hing ein Porträt in Öl, das ihn als erwachsenen Mann in Uniform zeigte. Das Bild, bereits sehr nachgedunkelt, die Farben rissig und splitterig, wirkte auf sie wie eine programmatische Schrift, wie ein vorgegebenes Muster, dem sie zu folgen hatte. Seine Überzeugung darf man niemals verraten, schien der mahnende Blick zu sagen. Für das, was man für richtig hält, muss man notfalls auch bereit sein zu sterben, so wurde sie erzogen, das war ihre Überzeugung, und diese Haltung strahlte sie mit einer klaren Selbstverständlichkeit aus.
Über die Triebkräfte ihrer politischen Karriere machte sich Charlotte keinerlei Illusionen. Sie verdankte alles dem Großvater. Man schmückte sich gerne mit ihrem Namen. Seit sie denken konnte, schon als Kind, stand sie jedes Jahr am 20. Juli, dem Gedenktag des Attentats Stauffenbergs auf Hitler, auf Friedhöfen, an Denkmälern und manchmal auch in Berlin an der Hinrichtungsstätte. Sie hörte den Reden der Politiker zu. Schon als Jugendliche dachte sie manchmal, dass sie die gestanzten Worte alle schon einmal gehört hatte, und sie versuchte die Reden im Geist mitzusprechen, vorherzusehen, welche Worte als Nächstes folgen würden. Es gelang oft. Sie kannte die Gesten, mit denen sie die Kranzschleifen zurechtzupften, und das ernste Mienenspiel bei den kurzen Minuten stillen Gedenkens. Sie kannte das plötzliche Umschalten auf Erleichterung oder geschäftigen Alltagsjargon, wenn die Fernsehkameras ausgeschaltet waren.
Sie war von klein auf gewöhnt, gefilmt zu werden. Aber sie durfte nicht jubelnd rufen: »Guck mal, das da bin ich!«, wenn sie sich auf den Bildern der Tagesschau erkannte. Als Kind immer an der Hand der Großmutter. Sie unterdrückte den Jubel-Impuls. Haltung. Darauf kam es an. Und sie hatte Haltung. Schon als Vierjährige.
Ihre Großmutter hatte sie geprägt. Wenn sie darüber nachdachte, und das tat sie in den letzten Monaten immer öfter, dann war sie von den Großeltern mehr geformt worden als von den Eltern.
Die Großmutter war es, die ihr durch ihr Beispiel Haltung beibrachte. Noch auf dem Sterbebett saß sie kerzengerade, den unbeugsamen Rücken gegen das große Kissen gelehnt. Unantastbar. Unberührbar. Und unerreichbar. Ewiges Vorbild. Die Großmutter war nicht nur Vorbild, sondern auch dauernde Mahnerin: »Sitz aufrecht, Kind!«, war ein Standardsatz. Sie war es auch, die einen Stock zwischen Stuhl und Rücken klemmte, um sie zu zwingen, gerade zu sitzen. Sitz wie eine von Schmoltke. Geh wie eine von Schmoltke. Aufrecht. Geradlinig. In Pose und Charakter.
Ihr entging nicht, dass es zwischen ihrer Großmutter und ihrer Mutter Spannungen gab. Manchmal lagen sie in der Luft wie eine Gewitterwolke, manchmal waren sie kaum zu spüren, aber verschwunden waren sie nie. Es hing wohl zusammen mit etwas, das die Großmutter die Hippie-Phase der Mutter nannte. Es klang so, als habe die Mutter einmal Schande über die von Schmoltkes gebracht, als sei sie weggelaufen vor der Pflicht, die Tochter eines Widerstandskämpfers zu sein. Die Mutter beherrschte die typische Schmoltke-Haltung auch, aber sie konnte sie an- und ausschalten wie das elektrische Licht, und unter der anerzogenen Fassade lag eine warme Herzlichkeit, die der adlig-untadeligen Großmutter fehlte.
Trotz dieser Spannungen schien es einen Pakt zwischen den beiden Frauen zu geben. Ihre Mutter schien keine Einwände zu haben, dass die Großmutter sich der Enkelin annahm, als sei es ihr eigenes Kind und als ginge es darum, das Erbe des Großvaters an das kleine Mädchen weiterzugeben.
Sternzeichen
Als Dengler an den Tisch zurückkehrte, saß die junge Frau immer noch an seinem Platz, und der Kellner stellte gerade eine neue Flasche Grauburgunder auf den Tisch.
»Hallo, ich bin die Betty«, sagte sie und streckte Dengler die Hand entgegen. »Betty Gerlach.«
»Erfreut«, sagte Dengler und deutete einen Handkuss an.
Er wunderte sich, dass Martin Klein ihn wütend ansah.
Außerdem hielt Klein auf seltsame Art die rechte Hand vor den Mund. Das sah komisch aus, wie ein Mundschutz gegen die Schweinegrippe, und Dengler überlegte, ob er eine Bemerkung darüber machen sollte. Als er den Zorn in Kleins Augen sah, verzichtete er darauf.
Mario führte das große Wort.
»Stell dir vor, Betty ist Waage. Ausgeglichen, um Harmonie bemüht. Gerechtigkeitsliebend.«
»Endlich jemand an diesem Tisch, der an Horoskope glaubt«, sagte Dengler zu ihr.
»Und wie«, antwortete sie strahlend. »Vielleicht haltet ihr mich für verrückt, aber bisher haben sie meinem Leben immer im richtigen Augenblick den entscheidenden Hinweis gegeben. Bei allen wichtigen Entscheidungen habe ich meinem Horoskop vertraut, und ich bin nie schlecht damit gefahren.«
Und nach einer kleinen Pause sagte sie: »Was bist du denn für ein Sternzeichen?«
»Widder.«
»Und dein Aszendent?«
»Keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, was ein As…«
»Aszendent!«
»Keine Ahnung, was das genau ist.«
»Wann hast du Geburtstag?«
»Am 23. März.«
»Na, komm schon. Und in welchem Jahr? Und zu welcher Uhrzeit kamst du auf die Welt?«
»Ich bin nicht sehr beschlagen in astrologischen Sachen. Aber wir haben hier am Tisch einen Spezialisten …«
Da traf ihn unter dem Tisch ein mit voller Wucht ausgeführter Tritt. Dengler sah auf und starrte in Martin Kleins wütende Augen. Die Hand hatte er vom Mund genommen, und die Brandblase funkelte. Klein hob einen Finger vor den Mund und schüttelte fast unmerkbar den Kopf.
Verwirrt wechselte Dengler das Thema.
»Das war gerade meine alte Behörde. Ich hab zugesagt.«
»Es geht um einen alten Fall«, fügte er mit Blick auf Betty hinzu, die ihn irritiert ansah. »Eine Sache von 1980, in der neue Ermittlungen aufgenommen werden sollen.«
»Bist du etwa Polizist?«, fragte Betty und sah ihn erschrocken an.
»Polizist? Mehr als ein Polizist! Das ist der berühmte Sherlock Holmes«, rief Mario. »Der Sherlock Holmes von Stuttgart. Und mein Name ist«, er stand auf und machte eine Verbeugung, »Dr. Mario Watson.«
Alle lachten. Leo goss Wein nach. Nur Martin verzog keine Miene. Die Hand hatte er nun wieder vor den Mund gelegt.
»Du bist Privatdetektiv?«, sagte Betty, nachdem sie getrunken hatten. »Toll. Ich habe noch nie einen Privatdetektiv kennengelernt. Was macht ihr anderen?«
»Mario ist Künstler«, sagte Georg Dengler. »Er malt. Und er betreibt ein legendäres Ein-Tafel-Restaurant in seinem Wohnzimmer. Leopold und Martin …«, er zögerte, weil ihn Martin schon wieder so merkwürdig ansah, »… schreiben für die Stuttgarter Zeitungen.«
»Eine merkwürdige Mischung seid ihr.«
»Die beste, die man sich vorstellen kann«, sagte Leopold. »Und was machen Sie?«
»Ich bin in der Modebranche.«
»Catwalk. Ein Model! Hab ich mir schon gedacht.«
Betty lachte laut.
»Nein. Ich entwerfe die Kleider, die die Models vorführen.«
»Das ist ja auch viel besser«, sagte Klein.
Nachdem sich Betty Gerlach wenig später verabschiedet hatte, hob Mario erneut sein Glas: »Lasst uns auf die Bekanntschaft dieser schönen Frau trinken.«
Sie stießen an.
»Ich glaube«, sagte Mario, »einer von uns hat sich heute Abend in sie verliebt.«
»So ein Quatsch«, sagte Martin Klein.
Allein
Natürlich war es undenkbar gewesen, dass sie, die Enkelin des berühmten schwäbischen Widerstandskämpfers, eine Schulklasse wiederholen musste. Eher schicken wir das Kind nach Salem, sagte die Großmutter. Die Mutter schien eine Ehrenrunde im Gymnasium nicht so schlimm zu finden. Charlottes Noten sanken rapide, als die Hormone zu revoltieren begannen, und ihre Leistungen am Uhland-Gymnasium in Tübingen waren so schwach, dass jede andere Schülerin wohl nicht zu retten gewesen wäre.
Der Rektor befürchtete jedoch eine schlechte Presse, und das feine Netz aus verständnisvollen, nachsichtigen Lehrern und teuren Nachhilfelehrern sowie die ständigen Appelle an Haltung und Familienehre bewirkten, dass sie die Versetzung jedes Mal schaffte. Mit Beginn der Oberstufe war die kritische Phase überwunden: Charlotte mauserte sich zu einer guten, teilweise sogar herausragenden Schülerin und bestand das Abitur mit einer Durchschnittsnote, die es ihr erlaubte, sich in Tübingen für Jura einzuschreiben.
Schon ein paar Jahre zuvor hatte ihre Mutter sie beim Hockeyclub und in der Jungen Union angemeldet. Allein im Hockeyspiel riss der unsichtbare Schutzschild des Großvaters. Es war ein robustes Spiel, und manchmal kam es ihr so vor, als sei sie gerade wegen ihres Großvaters bevorzugtes Ziel von Hieben mit dem Ellbogen oder manch übertriebenem bodycheck geworden. Trotzdem: Im Spiel spielte ihr Name und ihr Herkommen keine entscheidende Rolle. Da kam es darauf an, dass sie den Ball ins gegnerische Tor brachte oder ihn sich zumindest nicht von einem Gegenspieler abnehmen ließ. Sie liebte dieses Spiel. Sie trainierte. Ausdauertraining. Krafttraining. Lauftraining. Sie wurde eine recht passable Mittelfeldspielerin, und auf wenige Dinge war sie so stolz wie auf ihre Schnelligkeit und die präzisen Ballabgaben.
In der Jungen Union trug sie Großvaters Name von allein nach oben. Sie wurde in den Ortsvorstand berufen, kaum war sie ein halbes Jahr dabei. Sie merkte schnell, dass man sich mit ihr schmückte. Man war dezent: Zu den schlimmen Besäufnissen, den Bordellbesuchen im Stuttgarter Rotlichtviertel nahm man sie nicht mit. Großvater schützte sie davor, aber seine Aura isolierte sie auch, machte sie einsam.
Sie konnte sich inmitten einer überfüllten Vorlesung über Steuerrecht einsam fühlen. Sie fühlte sich mutterseelenallein auf den Kongressen des RCDS, dem sie jetzt angehörte. Sie beteiligte sich nicht an dem Geschacher um Vorstandsposten, und dennoch fielen diese fast zwangsläufig an sie. Sie hatte einen Namen, sie sah nicht schlecht aus, sie wirkte frisch und formulierte klug und geradeaus.
Und trotzdem war sie allein.
Der Präsident
»Sie bekommen von uns einen Dienstausweis auf Ihren Namen ausgestellt. Ich habe ihn dabei. Sie können damit Befragungen durchführen. Sie können sich damit überhaupt bewegen, als gehörten Sie wieder zu uns. Sie werden einen Ansprechpartner in Wiesbaden bekommen, der Sie in jeder Hinsicht unterstützt. Logistisch – was auch immer.«
Der Präsident des Bundeskriminalamtes saß an einem der Fensterplätze im Cube, dem neuen schicken Restaurant im Städtischen Museum, und sah Dengler nachdenklich an. Dr. Schneider war eigens noch einmal nach Stuttgart gekommen, um Denglers Zusage persönlich entgegenzunehmen. Dengler war so viel Aufmerksamkeit vom BKA nicht gewöhnt. Sie hatten gut gegessen, dann beide einen doppelten Espresso bestellt. Dengler trank seinen mit einem kräftigen Schuss Milch, der Präsident schaufelte zwei gehäufte Löffel Zucker in seine Tasse.
»Mir liegt viel an Ihrer Meinung zu diesem Fall, und vielleicht finden Sie ja auch etwas Neues, etwas, das man bisher übersehen hat.«
Dr. Michael Schneider hatte sich viel vorgenommen und wollte einiges verändern. Schließlich wusste er aufgrund seiner eigenen Polizeilaufbahn, wo die Beamten der Schuh drückte. Er fühlte sich als einer von ihnen, auch wenn dieses Gefühl der Zugehörigkeit nicht immer von den Untergebenen erwidert wurde. Schneider hatte sich der braunen Vergangenheit des Amtes, die bis in die Sechzigerjahre andauerte, gestellt und dazu eine historische Forschungsreihe in Auftrag gegeben. Er hatte auch für einen neuen Ton in Wiesbaden gesorgt, für mehr Offenheit und Transparenz bei den Entscheidungen, dafür, dass »Ermittlungsreisen« in andere Länder nicht mehr nur von den Vorgesetzten, den Arbeitsgruppenleitern, durchgeführt werden konnten, sondern von tatsächlich ermittelnden Kollegen.
All das hatte ihm im Haus nicht nur Freunde eingebracht, wie Georg Dengler aus den Erzählungen seines ehemaligen Kollegen Jürgen Engel erfahren hatte, der seit vielen Jahren schon in der Identifizierungskommission des BKA arbeitete.
Dr. Schneider hob seine Aktentasche auf und zog ein Blatt Papier heraus. Dann schob er ihm einen Ausweis über den Tisch.
»Ihr neuer Dienstausweis«, sagte er. »Das Foto haben wir von der Meldestelle entliehen. Außerdem habe ich hier für Sie ein abhörsicheres Funktelefon. Bitte quittieren Sie den Empfang.«
Dengler unterschrieb und steckte Ausweis und Handy ein.
»Wir werden Ihnen die Akten der damaligen Sonderkommission schicken, die das LKA in München gebildet hatte. Wenn Sie irgendetwas finden – gehen Sie diesen Spuren nach.«
Er stand auf.
»Das BKA hat eine Reihe von fähigen Beamten verloren – vor meiner Zeit. Sie gehören dazu. Wenn Sie jemals Ihre Entscheidung rückgängig machen wollen, lassen Sie es mich wissen. Aber zunächst arbeiten Sie diesen Fall noch einmal auf. Sie kennen ja Hauptkommissar Engel. Er wird Ihr Verbindungsmann zu mir sein.«
Dengler schmunzelte. Respekt, dachte er. Dr. Schneider wusste von seiner Freundschaft zu Engel und machte sie sich zunutze. Er mochte Leute, die ihre Hausaufgaben gemacht hatten.
»Engel ist noch im Urlaub und wird sich bei Ihnen melden, sobald er zurück ist. Die Presseberichte haben Sie ja. Ich habe Ihnen in diesem Ordner noch einige Dokumente zusammengestellt. Die komplette Akte kommt per Spedition. Bis dahin können Sie sich weiter einlesen.«
Der Präsident zahlte die Rechnung, und dann verabschiedeten sich die Männer mit einem kräftigen Händedruck.
Erste Liebe
Harald war ihr nie aufgefallen, obwohl er auch im RCDS Mitglied war. Er strebte nach keinem Amt, nur selten meldete er sich zu den Trupps, die Plakate klebten oder sie in der Stadt aufstellten.
»Darf … darf ich dich zu einem Glas Champagner einladen?«, fragte er sie eines Tages.
Sie blieb verblüfft stehen.
»Champagner? Denkst du, ich trinke am helllichten Tag Champagner?«
»Na ja, oder was man sonst so – trinkt.«
In deinen Kreisen, dachte sie. Dieser Wicht wollte sagen: Was man sonst so in deinen Kreisen trinkt.
Beinahe wäre sie wütend geworden. Da sah sie, dass er schwitzte. Eine Schweißperle wuchs auf der Oberlippe, und ein feuchter Film bedeckte seine Wangen und seine Stirn.
Er muss all seinen Mut aufgebracht haben, um mich anzusprechen, dachte sie. Und das wiederum fand sie rührend.
Dass dieser unscheinbare Jüngling zwei so widersprüchliche Emotionen innerhalb kürzester Zeit bei ihr ausgelöst hatte, fand Charlotte dann immerhin so beachtenswert, dass sie sagte, auf einen Kaffee käme sie mit.
Als sie schließlich in einem der typischen Tübinger Studentencafés saßen, tat es ihr schon wieder leid. Harald bekam den Mund nicht auf, sodass sie harte Konversationsarbeit betreiben musste, wie die Großmutter es genannt hätte. Sie karikierte einen ihrer Professoren, der schüchterne Junge lachte und taute ein wenig auf. Auch das hatte sie von der Großmutter gelernt. Wenn du schüchterne Männer knacken willst, stell Fragen. Interessiere dich einfach dafür, was sie machen. Dann reden sie von alleine.
Es funktionierte: Harald studierte Medizin und wollte später einmal Gehirnchirurg werden. Tatsächlich sprudelte er über, als er von seinen Plänen und Absichten erzählte. Es interessierte sie nicht, aber sie hörte zu und feuerte ihn hin und wieder mit einer Zwischenfrage an, um über die schreckliche Stille zwischen ihnen hinwegzukommen.
»Mit dir kann man sich sehr gut unterhalten«, sagte er schließlich.
Zu ihrer eigenen Überraschung nickte sie, als er vorschlug, nach Stuttgart zu einer Tanzveranstaltung zu fahren. Er hatte sich den Golf seiner Mutter geliehen. Sie würden in vierzig Minuten dort sein.
Er schleppte sie in ein altmodisches Tanzcafé am Kleinen Schlossplatz.
Die Besucher waren fast alle im Alter ihrer Mutter.
Eine polnische Kapelle spielte einen Stehblues.
»Magst du tanzen?«
Sie nickte.
Auf der Tanzfläche war er ähnlich unbeholfen wie im Gespräch. Er legte den rechten Arm auf ihren Rücken und schaukelte sie nahezu im Stehen auf der Tanzfläche. Sie merkte, wie er die Luft anhielt, als er langsam, Millimeter für Millimeter, die Finger den Rücken entlang Richtung Po schob.
Als er dann seine Brille abnahm, um besser Wange an Wange tanzen zu können, hätte sie am liebsten schreiend die Tanzfläche verlassen. Gleichzeitig rührte sie diese Geste.
Deshalb sagte sie »gern«, als er sie nach Hause brachte und sie fragte, ob er sie wiedersehen dürfe.
Ihre Großmutter hielt die Bedeutung der körperlichen Liebe für überbewertet, und sie hatte keine Hemmungen, darüber zu sprechen. Der praktische Ton, den sie dabei anschlug, befremdete Charlotte wegen des leicht tiermedizinischen Klangs, aber gleichzeitig amüsierte er sie auch.
Ob sie schon einen Freund habe, wollte der Vater, der ihre Erziehung den beiden Frauen in der Familie überließ, einmal beim Abendessen wissen. Schließlich komme sie doch jetzt in das Alter, in dem man sich naturgemäß für Jungs interessiere.
Charlotte mochte nicht darüber reden, und es war die Großmutter, die ihr zu Hilfe eilte.
»Also, ich weiß nicht«, sagte sie unvermittelt, »ich finde, das Thema Sex wird völlig überschätzt.«
Schlagartig war es still am Tisch.
»Ich habe eigentlich nicht über Sex gesprochen«, sagte der Vater, aber alle warteten auf weitere Erklärungen der Großmutter.
»Na ja«, fuhr sie unwillig fort. »Wegen dem bisschen Jucken so viel Aufregung. Und das soll angeblich die Weltgeschichte verändert haben?«
Alle lachten, aber vielleicht war es dieser praktische, nüchterne Blick, der Charlotte dazu brachte, eine Einkaufsliste aufzustellen für jene Dinge, die sie für das nächste Treffen mit Harald brauchte.
Kondome, das war klar.
Und Alkohol. Das würde auch nicht schaden. Ihr schwante, dass Harald etwas zum Auflockern brauchen würde.
Also zwei Flaschen Champagner.
Kerzen?
Romantische Stimmung?
Überflüssig. Aber vielleicht brauchte er so was, um in Stimmung zu kommen. Mittlerweile war sie neugierig und fühlte sich, als würde sie zu einer Expedition in ein exotisches Land aufbrechen.
Musik?
Was hörte Harald gern?
Vielleicht etwas Stehbluesartiges?
Was sollte sie anziehen?
Was würde er verführerisch finden?
CDs: Kuschelrock 1-8 und ein tragbarer CD-Spieler.
All das packte sie in ihren großen Rucksack und machte sich auf zu dem großen Fest der Medizinstudenten.
Großmutters Tod
Von der Krankheit ihrer Großmutter erfuhr sie durch einen Anruf ihrer Mutter. Sie hatte beim Dekan angerufen, und der hatte sofort seine Sekretärin in den Vorlesungssaal im Hegel-Bau geschickt.
»Komm sofort nach Hause«, sagte Mutter. »Du musst dich von Großmutter verabschieden.«
Sie war in ihren alten Alfa Spider gestiegen und nach Hause gerast. Die Großmutter lag in ihrem Schlafzimmer, aufgerichtet, ein riesiges Kopfkissen im Rücken. Kerzengerade wie immer.
»Setz dich«, sagte sie.
Charlotte setzte sich auf die Bettkante und nahm Großmutters Hand. Das hatte sie schon früher so gemacht, als sie noch ein Kind gewesen war. Sie merkte erst an dem salzigen Geschmack in ihrem Mund, dass sie weinte.
»Wir haben keine Zeit für Sentimentalitäten«, sagte die Großmutter. »Es geht zu Ende mit mir, und du musst einige Dinge über die Familie erfahren.«
Ihr Atem rasselte. Offensichtlich hatte sie Schmerzen.
»Schick mir nachher den Arzt herein. Aber jetzt hör mir gut zu.«
»Soll ich nicht lieber gleich …«
»Nein, hör zu.«
Sie rang einen Augenblick um Luft.
»Dein Großvater«, sagte sie dann leise, »dein Großvater war kein Held. Er war ein Feigling.«
Charlotte konnte die Schmerzen fast selbst spüren, die ihre Großmutter bei jedem Atemzug quälten.