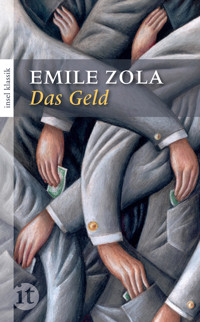1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In 'Das Paradies der Damen' von Emile Zola wird die Geschichte von Denise Baudu erzählt, die nach dem Tod ihres Vaters gezwungen ist, in Paris bei ihrem Onkel, dem Besitzer eines Kaufhauses namens 'Das Paradies der Damen', zu arbeiten. Zola präsentiert ein realistisches Bild des Lebens im 19. Jahrhundert und setzt sich dabei kritisch mit dem Aufstieg der Kaufhäuser und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft auseinander. Sein Schreibstil ist präzise und detailliert, wodurch der Leser tief in die Welt der Protagonisten eintauchen kann. Das Buch gehört zum literarischen Naturalismus und reflektiert Zolas Interesse an sozialen Problemen und Ungerechtigkeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Paradies der Damen
Books
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Denise kam mit ihren beiden Brüdern zu Fuß vom Bahnhof Saint-Lazare. Sie waren eben erst von Cherbourg angekommen und hatten die ganze Nacht auf der harten Bank eines Eisenbahnwagens dritter Klasse zugebracht. Sie führte den kleinen Pépé an der Hand, während Jean ihr folgte; alle drei waren müde von der Reise und fühlten sich wie verloren in dieser ungeheuren Stadt Paris. Ihre erstaunten Blicke irrten über die hohen Häuser hinweg; bei jeder Straßenkreuzung erkundigten sie sich nach der Rue de la Michodière, wo ihr Onkel wohnte. Als sie endlich auf der Place Gaillon ankamen, blieb das Mädchen überrascht stehen.
»Schau einmal, Jean!« rief sie.
Wie angewurzelt standen sie da und schmiegten sich fest aneinander in ihren abgetragenen schwarzen Kleidern; sie waren in Trauer um den Tod ihres Vaters. Denise, ein für seine zwanzig Jahre recht schmächtiges Mädchen, trug in der einen Hand ein bescheidenes Bündel, während auf der anderen Seite ihr kleiner Bruder, der fünfjährige Pépé, an ihrem Arm hing. Hinter ihr stand Jean, ein sechzehnjähriger Bursche, der strotzte vor Kraft und Gesundheit.
»Ist das ein Geschäft!« fügte sie nach einer Weile bewundernd hinzu.
Es war ein Modewarenhaus an der Ecke der Rue de la Michodière und der Rue Neuve-Saint-Augustin, dessen Auslagen im milden Licht dieses Oktobermorgens in hellen Farben erstrahlten. Vom Kirchturm von Saint-Roch schlug es eben acht; auf dem Bürgersteig sah man nur Leute, die ihrer Arbeit nachgingen: Beamte, die in ihre Büros hasteten, Hausmädchen, die in den Läden Einkäufe zu besorgen hatten. Vor dem Eingang des Warenhauses standen zwei Gehilfen auf einer Doppelleiter und waren dabei, verschiedene Wollwaren auszuhängen. In einer Auslage nach der Rue Neuve-Saint-Augustin kniete ein anderer Gehilfe mit dem Rücken zum Fenster und legte blauen Seidenstoff sorgfältig in Falten. Im Innern des Geschäfts, in dem noch keine Kunden zu sehen waren und wo auch das Personal erst nach und nach eintraf, summte es aber schon wie in einem erwachenden Bienenkorb.
»Donnerwetter!« rief Jean. »Da kann Valognes sich ja verstecken ... Dein Geschäft war lange nicht so schön.«
Denise nickte zustimmend. Sie hatte bei Cornaille, dem ersten Modewarenhändler von Valognes, zwei Jahre gearbeitet. Als sie jetzt plötzlich vor diesem Haus, vor diesem großartigen Geschäft stand, vergaß sie in ihrem Staunen alles übrige. An der stumpfen Ecke, die auf die Place Gaillon ging, befand sich eine hohe Glastür, die bis zum Zwischenstock reichte, umrahmt von kunstvoll zusammengesetztem, reich vergoldetem Zierat. Zwei sinnbildliche Figuren, lachende Frauengestalten, entrollten ein Band, auf dem zu lesen war: » Zum Paradies der Damen«. Dann folgte die Reihe der Auslagen längs der Rue de la Michodière und der Rue Neuve-Saint-Augustin, wo sie außer dem Eckgebäude noch je zwei Häuser einnahmen, die zu Erweiterungszwecken angekauft und vor kurzem erst eingerichtet worden waren. Das Geschäft erschien fast endlos mit seinen Schaufenstern im Erdgeschoß und seinen Spiegelscheiben im Zwischenstock, hinter denen man geschäftiges Treiben beobachten konnte.
»Zum Paradies der Damen«, las Jean und lachte vor sich hin. Er war ein hübscher Junge, der in Valognes schon seine kleinen Weibergeschichten gehabt hatte. »Das zieht die Leute an!«
Doch Denise stand immer noch versunken vor der Auslage zu seiten des Haupteingangs. Hier lag, sozusagen auf dem Gehsteig, ein ganzer Haufen von billigen Waren, Gelegenheitsartikel, welche die Kunden im Vorbeigehen anziehen sollten. Lange Bahnen der verschiedensten Stoffe ergossen sich aus dem Zwischenstock herab und flatterten wie Fahnen in allen Farben, schiefergrau, meerblau, olivgrün. Daneben hingen gleichsam als Umrahmung des Eingangs schmale Pelzstreifen als Kleiderbesatz herab. Unten schließlich waren in Fächern und auf Tischen mitten unter Stößen von Stoffresten Berge von Waren aufgestapelt, die für eine Kleinigkeit zu haben waren: gewirkte Handschuhe und Schals, Kopftücher, Leibchen, eine förmliche Ausstellung von Wintersachen in bunten, scheckigen, gestreiften Mustern. Es war ein riesiger Jahrmarkt; das Geschäft schien vor Überfülle bersten und seinen Überfluß auf die Straße ausschütten zu wollen.
Onkel Baudu war vergessen. Selbst der kleine Pépé, der keinen Augenblick die Hand seiner Schwester losließ, riß erstaunt die Augen auf. Ein rollender Wagen zwang sie alle drei, die Mitte des Platzes, wo sie bisher gestanden hatten, zu verlassen; unwillkürlich wandten sie sich der Rue Neuve-Saint-Augustin zu, folgten den Schaufenstern und blieben vor jeder Auslage stehen. Die letzte aber übertraf alles, was sie bisher gesehen hatten. Hier war eine Ausstellung von Seiden-, Atlas- und Samtstoffen in den prächtigsten Farben gezeigt: ganz oben die Samte, vom tiefsten Schwarz bis zum zarten Milchweiß; weiter unten die Atlasstoffe in Rosa, in Blau, in weichen Farbtönen; noch tiefer schließlich die Seidenstoffe, eine ganze Skala des Regenbogens, da ein Stück zu einer Schleife aufgebauscht, dort ein anderes in Falten gelegt, wie zum Leben erwacht unter den geschickten Händen der Dekorateure. Zu beiden Seiten aber waren in ungeheuren Stößen jene beiden Seidenarten aufgehäuft, die eine ausschließliche Spezialität des Hauses bildeten: »Pariser Glück« und »Goldhaut«, zwei Artikel, die eine Umwälzung im Modehandel hervorrufen sollten.
»Ach, diese Seide zu fünf Franken sechzig!« rief Denise, ganz hingerissen von dem »Pariser Glück«, aus.
Jean begann sich zu langweilen.
»Wo ist die Rue de la Michodière?« fragte er einen Vorübergehenden.
Man bezeichnete ihm die erste Straße rechts. Alle drei gingen denselben Weg zurück und um das Geschäft herum. Als sie in die Straße einbogen, wurde Denise durch ein anderes Schaufenster angelockt, in dem Damenkonfektionsartikel ausgestellt waren. So etwas hatte sie noch nie gesehen, sie blieb starr vor Bewunderung stehen. Da gab es Mäntel für jede Gelegenheit, vom einfachen Ballumhang zu neunundzwanzig Franken bis zum schweren Samtmantel, der mit achtzehnhundert Franken ausgezeichnet war. Auf den rundlichen Busen der Schaufensterpuppen bauschte der Stoff sich auf, die betonten Hüften ließen die zierliche Taille noch mehr hervortreten; der fehlende Kopf war durch eine große weiße Preistafel ersetzt, während die Spiegel zu beiden Seiten der Auslage in genau berechnetem Spiel die Figuren endlos vervielfältigten und so die Straße mit diesen schönen, verkäuflichen Frauen bevölkerten, die an Stelle des Kopfes eine große Tafel trugen, auf der in weithin sichtbaren Ziffern ihr Preis zu lesen war.
»Famos!« rief Jean, der keinen anderen Ausdruck für seine Bewunderung fand.
Auch er stand unbeweglich mit offenem Munde da. Beim Anblick all dieses weiblichen Luxus war er errötet vor Vergnügen. Er war hübsch wie ein Mädchen, von einer Schönheit, die er seiner Schwester geraubt zu haben schien, mit rosig schimmernder Haut, blondem, gelocktem Haar, verführerisch frischen Lippen und hellen Augen. Neben ihm erschien Denise noch unbedeutender mit ihrem schmalen Gesicht, der matten Farbe und dem fahlen Haar. Pépé mit dem hellblonden Kinderschopf drückte sich enger an sie, wie von einem unbestimmten Verlangen nach Liebkosungen getrieben. Sie bildeten eine so seltsame, reizende Gruppe, diese drei Blondköpfe in ihren abgenützten Trauerkleidern, das ernste Mädchen zwischen dem hübschen Kind und dem prächtigen Jüngling, daß die Vorübergehenden sich lächelnd nach ihnen umwandten.
Auf der Schwelle eines Ladens auf der anderen Seite der Straße stand seit einigen Augenblicken ein dicker, weißhaariger Mann mit breitem, gelblichem Gesicht und beobachtete die Gruppe. Mit zornfunkelnden Augen und zusammengekniffenen Lippen hatte er nach den Auslagen des »Paradieses der Damen« hinübergesehen, und der Anblick des Mädchens mit seinen beiden Brüdern erbitterte ihn noch mehr. Was hatten die Taugenichtse vor dieser marktschreierischen Auslage zu gaffen?
»Und der Onkel?« fragte Denise plötzlich, wie aus einem Traum auffahrend.
»Wir sind in der Rue de la Michodière«, sagte Jean. »Hier muß er wohnen.«
Sie hoben die Köpfe und blickten sich um. Da sahen sie gerade vor sich oberhalb der Tür, in welcher der dicke Mann stand, ein grün gestrichenes Firmenschild, auf dem in gelber, verwaschener Schrift zu lesen war: »Vieil Elbeuf, Tuch- und Flanellhandlung Baudu, vormals Hauchecorne«. Es war ein schmales Haus mit schmutziggrauem Verputz, eingezwängt zwischen den hohen Nachbargebäuden. Denise, in Gedanken noch bei den Herrlichkeiten des gegenüberliegenden Warenhauses, betrachtete überrascht den niedrigen Laden im Erdgeschoß, über dem ein ebenfalls nicht sehr hoher Zwischenstock mit halbmondförmigen Fenstern lag, die ihm das Aussehen eines Gefängnisses gaben. Rechts und links sah man zwei finstere, verstaubte Auslagen, in denen man undeutlich einen Haufen Stoffe erkennen konnte. Die offene Ladentür schien in einen feuchten, dunklen Keller zu führen.
»Da ist's«, sagte Jean.
»Nun, dann wollen wir hineingehen. Komm, Pépé!«
Sie fühlten sich alle drei scheu und unsicher. Als ihr Vater gestorben war, hinweggerafft von dem gleichen Fieber, dem einen Monat zuvor ihre Mutter erlegen war, hatte zwar der Onkel Baudu in der ersten Gefühlsregung über diesen doppelten Todesfall seiner Nichte geschrieben, es werde sich in seinem Hause stets ein Plätzchen für sie finden, wenn sie nach Paris kommen wolle, um hier ihr Glück zu versuchen; allein seit jenem Brief war fast ein Jahr verflossen, und Denise bereute jetzt, daß sie Valognes so plötzlich verlassen hatte, ohne ihren Onkel vorher zu verständigen. Er kannte sie gewiß nicht mehr, denn er war nie wieder in seine Heimat gekommen, seitdem er fortgegangen war, um als kleiner Gehilfe bei dem Tuchhändler Hauchecorne einzutreten, dessen Schwiegersohn er schließlich geworden war.
»Herr Baudu?« entschloß sich Denise endlich den dicken Herrn zu fragen, der sie noch immer verwundert betrachtete.
»Der bin ich!« lautete die Antwort.
Denise errötete und fügte stotternd hinzu:
»Ah, um so besser!... Ich bin Denise, und das ist Jean und das Pépé... Wie Sie sehen, sind wir gekommen, lieber Onkel.«
Baudu schien höchlichst betroffen. Seine großen, geröteten Augen flackerten in seinem gelblichen Gesicht, seine zögernden Worte zeigten seine Verwirrung. Er war offenbar tausend Meilen weit von dieser Familie entfernt, die ihm so unvermutet in seinen Laden fiel.
»Was, ihr hier?« wiederholte er mehrmals. »Aber ihr wart doch in Valognes! Warum seid ihr denn nicht dortgeblieben?«
Mit ihrer weichen, etwas zitternden Stimme erklärte sie ihm alles. Nach dem Tod ihres Vaters, der in seiner Färberei alles verwirtschaftet hatte, war sie gleichsam als die Mutter der beiden Kinder zurückgeblieben. Was sie bei Cornaille verdiente, reichte nicht hin, um alle drei zu ernähren. Jean arbeitete zwar bei einem Kunsttischler, der sich mit dem Aufarbeiten antiker Möbel beschäftigte, aber er verdiente keinen Sou dabei. Dagegen gewann er Geschmack an alten Dingen und begann Figuren aus Holz zu schnitzen. Eines Tages fand er irgendwo ein Stück Elfenbein und machte einen Kopf daraus; diese Arbeit gefiel einem vorübergehenden Herrn dermaßen, daß er den Geschwistern wenig später zuredete, nach Paris zu gehen, wo er für Jean einen Platz bei einem Elfenbeinschnitzer gefunden hatte.
»Jean fängt also morgen bei seinem neuen Lehrherrn an«, schloß Denise. »Ich brauche kein Lehrgeld zu bezahlen, Kost und Wohnung hat er frei. Ich dachte mir, daß ich und Pépé schon irgendwie unser Fortkommen finden werden. Schlimmer als in Valognes kann es uns doch hier nicht gehen.«
Eines allerdings verschwieg sie: eine Liebesgeschichte Jeans. Er hatte an ein junges Mädchen, die Tochter einer adeligen Familie der Stadt, Briefe geschrieben und über eine Mauer hinweg Küsse mit ihr ausgetauscht. Daraus war ein kleiner Skandal entstanden, der sie bestimmt hatte, Valognes zu verlassen. Sie begleitete ihren Bruder hauptsächlich nach Paris, um über ihn zu wachen; denn ihr Herz war von wahrhaft mütterlicher Besorgnis erfüllt, wenn sie diesen schönen und munteren Jungen sah, den alle Frauen anhimmelten.
Onkel Baudu konnte sich noch immer nicht fassen. Er begann wieder zu fragen.
»Hat denn dein Vater euch nichts hinterlassen? Ich dachte, er habe einen Sparpfennig. Ich habe ihm in meinen Briefen oft genug geraten, diese Färberei nicht zu übernehmen. Ein gutes Herz, aber nicht für zwei Sou Verstand! ... Und du bist mit diesen Jungen zurückgeblieben und hast sie versorgen müssen?!«
Sein galliges Gesicht belebte sich; er sah nicht mehr so finster drein wie vorhin, als er das »Paradies der Damen« betrachtet hatte. Plötzlich bemerkte er, daß er den Eingang verstellte.
»So kommt herein«, rief er, »wenn ihr schon hier seid! Kommt herein, das ist gescheiter, als vor den Dummheiten dort drüben Maulaffen feilzubieten.«
Nach einem letzten Zornesblick auf das Geschäft gegenüber machte er den Kindern Platz, so daß sie eintreten konnten. Zugleich rief er Frau und Tochter.
»Elisabeth, Geneviève! Kommt, hier sind Gäste für euch!«
Aber Denise und die beiden Jungen zögerten angesichts des dunklen Ladens. Noch geblendet vom hellen Licht der Straße, blinzelten sie mit den Augen, tasteten sich mit den Füßen voran und rückten enger zusammen.
»Kommt, kommt!« wiederholte Baudu seine Einladung.
Er klärte Frau und Tochter in kurzen Worten auf. Frau Baudu war sehr blaß, offenbar bleichsüchtig, mit grauen Haaren, farblosen Augen und blutleeren Lippen; Genevieve, bei der sich die Krankheit ihrer Mutter noch deutlicher zeigte, war gebrechlich und farblos wie eine im Schatten aufgewachsene Pflanze. Nur eine Fülle von prächtigen schwarzen Haaren verlieh ihr einen etwas schwermütigen Reiz.
»Kommt herein!« sagten nun auch die beiden Frauen. »Seid willkommen!«
Sie ließen Denise hinter einem Ladentisch Platz nehmen. Pépé setzte sich sogleich auf ihre Knie, während Jean, an einen Schrank gelehnt, neben ihr stand. Sie wurden allmählich sicherer und blickten im Laden umher, an dessen Dunkelheit sich ihre Augen langsam gewöhnten. Düstere Warenballen türmten sich bis zur Decke empor. Der Geruch der Tücher und Stoffe wurde durch die Feuchtigkeit des Fußbodens noch verstärkt. Zwei Gehilfen und eine Verkäuferin waren im Hintergrund damit beschäftigt, weißen Flanell fortzuräumen.
»Der kleine Herr da möchte vielleicht etwas essen?« sagte Frau Baudu und wies lächelnd auf Pépé.
»Nein, danke«, erwiderte Denise; »wir haben in einem Cafehaus vor dem Bahnhof eine Tasse Milch getrunken.«
Als sie merkte, daß Genevieve aufmerksam das leichte Bündel betrachtete, das sie neben sich auf den Boden gelegt hatte, fügte sie hinzu:
»Ich habe den Koffer auf dem Bahnhof gelassen.«
Sie errötete, denn ihr wurde nun klar, daß man den Leuten nicht in dieser Weise mit der Tür ins Haus fallen durfte. Schon in der Eisenbahn hatte sie gleich nach der Abfahrt von Valognes Gewissensbisse empfunden; darum hatte sie auch ihren Koffer auf dem Bahnhof zurückgelassen und den Kindern vor der Stadt draußen ein Frühstück geben lassen.
»Nun wollen wir einmal kurz und in aller Offenheit miteinander reden«, sagte Baudu mit einemmal. »Ich habe dir geschrieben, das ist wahr. Aber seither ist fast ein Jahr verflossen, und das Geschäft ging sehr schlecht, mein Kind...«
Er hielt inne, von einem Gefühl erfaßt, das er sich nicht anmerken lassen wollte. Frau Baudu und Geneviève schlugen die Augen nieder.
»Es ist eine schwere Zeit, die vorübergehen wird«, fuhr der Onkel fort. »Da habe ich keine Sorge... Aber ich mußte mein Personal einschränken; es sind nur noch drei Angestellte da, und dies ist keineswegs der geeignete Zeitpunkt, jemand vierten einzustellen. Kurz: ich kann dich nicht ins Haus nehmen, wie ich es dir versprochen habe, mein armes Kind.«
Ganz blaß und bestürzt hatte Denise zugehört.
»Schon recht, Onkel!« stotterte sie endlich mühsam. »Ich werde mich bemühen, anderswo unterzukommen.«
Die Baudus waren keine schlechten Menschen. Aber sie klagten ständig darüber, daß sie niemals Glück gehabt hätten. Als das Geschäft noch gut ging, hatten sie fünf Söhne zu erziehen gehabt, von denen drei in jungen Jahren gestorben waren; der vierte war ein Taugenichts geworden, der fünfte als Hauptmann nach Mexiko gegangen. So blieb ihnen nur Geneviève. Alle Kinder hatten viel Geld gekostet, und den letzten Rest seines Kapitals hatte Baudu an den Kauf eines alten Hauses in Rambouillet gewendet, von wo seine Frau herstammte. Jetzt ärgerte er sich, daß ihm diese drei Kinder so ins Haus hereingeschneit kamen.
»Man muß sich doch anmelden«, sagte er, verdrossen über seine eigene Härte. »Du hättest mir einen Brief schicken können, und ich hätte dir geantwortet, daß ihr besser bleibt, wo ihr seid. Als dein Vater starb, habe ich dir freilich geschrieben, was man bei solchen Gelegenheiten schreibt. Und nun fallt ihr mir so unvermutet ins Haus, ohne vorher ein Wort zu sagen ...«
Jean war blaß geworden. Denise drückte Pépé an sich; zwei schwere Tränen fielen auf ihre Hände, und sie wiederholte:
»Lassen Sie nur, Onkel; wir gehen schon.«
Es entstand ein verlegenes Schweigen. Dann sagte er in mürrischem Ton:
»Ich will euch ja nicht vor die Tür setzen. Da ihr einmal hier seid, werdet ihr bei uns übernachten; dann werden wir weitersehen.«
Frau Baudu und Genevieve entnahmen jetzt aus einem Blick des Familienoberhauptes, daß sie sich um die Sache kümmern dürften. Alles wurde geregelt. Mit Jean brauche man sich nicht weiter zu beschäftigen, hieß es, da er ja schon am folgenden Tag in die Lehre gehen wolle. Pépé wäre bei Frau Gras sehr gut aufgehoben, einer alten Frau, die in der Rue des Orties eine geräumige Erdgeschoßwohnung besaß und Kinder unter zehn Jahren für vierzig Franken monatlich in volle Verpflegung nahm. Denise bemerkte, sie habe genügend Geld, um für den ersten Monat die Pension zu bezahlen. Es handelte sich also bloß darum, sie selbst unterzubringen.
»Hat nicht Vinçard eine Verkäuferin gesucht?« fragte Genevieve.
»Richtig, das ist wahr!« rief Baudu. »Wir wollen nach dem Essen zu ihm gehen. Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist.«
Diese Familienberatung war durch keine Kundschaft gestört worden. Der Laden blieb leer und finster. Die beiden Gehilfen und die Verkäuferin im Hintergrund setzten unter Flüstern und Tuscheln ihre Arbeit fort. Doch jetzt traten drei Damen ein, und Denise blieb mit dem Kind allein. Sie küßte Pépé, tief betrübt bei dem Gedanken an die bevorstehende Trennung. Anschmiegsam wie ein Kätzchen barg der Kleine schweigend seinen Kopf an der Brust der Schwester. Als Frau Baudu und Genevieve zurückkamen, erklärten sie Pépé für sehr artig, und Denise versicherte, daß er niemals Lärm mache, daß er ganze Tage still und ruhig bleibe und nur nach Zärtlichkeit verlange. Bis zum Essen sprachen die drei Frauen von diesem und jenem, von Kindern, von der Hauswirtschaft, vom Leben in Paris und in der Provinz; das Gespräch floß in kurzen, allgemeinen Sätzen dahin wie unter Verwandten, die einander noch nicht genau kennen und verlegen sind. Jean stand unbeweglich auf der Schwelle und beobachtete das Treiben auf der Straße; von Zeit zu Zeit lächelte er den vorübergehenden Mädchen zu.
Um zehn Uhr kam ein Dienstmädchen. Gewöhnlich wurde um diese Stunde für Herrn Baudu, Geneviève und den ersten Gehilfen der Tisch gedeckt. Um elf Uhr aßen Frau Baudu, der zweite Gehilfe und die Verkäuferin.
»Die Suppe ist aufgetragen!« rief der Onkel Denise zu.
Als in dem kleinen Speisezimmer, das an den Laden stieß, alles bei Tisch saß, rief er nach dem ersten Gehilfen, der noch auf sich warten ließ.
»Colomban!«
Der junge Mann entschuldigte sich, er habe die Flanelle fertig einräumen wollen. Er war mit seinen fünfundzwanzig Jahren körperlich kräftig, aber schwerfällig und hatte verschmitzte Gesichtszüge. In seinem biederen Gesicht mit dem großen, weichen Mund saßen zwei Augen, in denen die Schlauheit funkelte.
»Ach was, alles zu seiner Zeit!« sagte Baudu, der ein Stück kalten Kalbsbraten zerlegte mit der Vorsicht und Geschicklichkeit des geübten Hausvaters, der jede Portion mit dem Auge auf ein Quentchen abzuwägen weiß.
Er gab jedem seinen Anteil und schnitt sogar das Brot vor.
»Aber du ißt ja nicht, mein Kind?« meinte er nach einer Weile zu Denise. »Da wir jetzt Zeit haben zu plaudern: sag, warum hast du dich denn in Valognes nicht verheiratet?«
»Oh, Onkel! Wo denken Sie hin? Ich mich verheiraten!... Und die Kleinen?«
Sie fand den Gedanken so seltsam, daß sie darüber lachte. Und dann – welcher Mann würde sie auch zur Frau nehmen, sie, die keinen Sou besaß, schmächtig war wie eine Drossel und nicht einmal hübsch? Nein, nein; sie würde sich niemals verheiraten; sie hatte genug mit den beiden Kindern.
»Das ist nicht richtig«, sagte der Onkel. »Eine Frau braucht immer einen Mann. Wenn du einen braven Mann gefunden hättest, lägst du nicht mit deinen Brüdern auf der Straße wie die Zigeuner.«
Er hielt inne, um mit ebensoviel Sparsamkeit wie Gerechtigkeit eine Schüssel Kartoffeln mit Speck aufzuteilen, die das Dienstmädchen gebracht hatte. Dann fuhr er fort, während er mit dem Löffel auf Colomban und Geneviève zeigte:
»Schau, die zwei werden im Frühjahr heiraten, wenn das Geschäft im Winter gut läuft.«
So war es Tradition im Haus. Der Gründer, Aristide Finet, hatte seine Tochter Desirée seinem ersten Gehilfen Hauchecorne zur Frau gegeben; Baudu, der mit sieben Franken in der Tasche in das Geschäft eingetreten war, hatte Elisabeth, die Tochter Hauchecornes, geheiratet, und er war entschlossen, seine Tochter Geneviève samt dem Tuchladen seinem Angestellten Colomban zu überlassen, sobald nur die Geschäfte eine Wendung zum Besseren nehmen würden. Die Sache war seit drei Jahren abgemacht; er schob die Heirat nur eines Bedenkens wegen hinaus: in seiner eigensinnigen Rechtschaffenheit wollte er das Geschäft, das er blühend übernommen hatte, seinem Nachfolger nicht in schlechterem Stand übergeben.
Denise beobachtete Colomban und Geneviève. Sie saßen bei Tisch nebeneinander, aber sie wirkten ganz ruhig, da gab es kein Erröten, kein Lächeln. Seit dem Tag seines Eintritts rechnete Colomban mit dieser Ehe. Er hatte die verschiedenen Stufen gewissenhafter Ausbildung im Haus zurückgelegt, war zuerst Lehrling, dann Gehilfe geworden und zuletzt in den privaten Bereich der Familie einbezogen worden. All dies hatte er geduldig abgewartet, hatte das geregelte Leben eines Uhrwerks geführt und Geneviève wie ein ausgezeichnetes, ehrbares Geschäft betrachtet. Die Gewißheit, daß er sie besitzen werde, hatte dazu geführt, daß er kein Verlangen nach ihr empfand.
Auch das Mädchen hatte sich daran gewöhnt, ihn zu lieben, aber mit dem Ernst ihrer zurückhaltenden Natur und einer tief eingewurzelten Neigung, deren sie sich selbst kaum bewußt war. Ihre Zärtlichkeit hatte sich in diesem Erdgeschoß des alten Paris entfaltet, sie war wie eine Kellerblüte. Seit zehn Jahren kannte sie nur ihn, an seiner Seite verlebte sie ihre Tage hinter den Tuchstapeln im Dunkel des Ladens; und morgens und abends saßen sie nebeneinander in diesem engen Speisezimmer, wo es kühl war wie in einem Brunnen. Sie hätten draußen im freien Feld, unter dem Laubwerk der Bäume nicht verborgener, nicht unbewußter leben können. Nur ein Zweifel, eine Regung der Eifersucht konnte das junge Mädchen eines Tages zu der Entdeckung bringen, daß es sich in dem mitschuldigen Dunkel dieses Ladens, in der Leere seines Daseins und seiner inneren Unausgefülltheit gänzlich und für immer verschenkt hatte.
»Aber nun ist genug geplaudert, machen wir den andern Platz!« schloß der Tuchhändler und hob die Tafel auf.
Jetzt gingen Frau Baudu, der andere Gehilfe und die Verkäuferin zu Tisch. Denise blieb allein in der Nähe der Tür und wartete, bis ihr Onkel Zeit finden werde, mit ihr zu Vinçard zu gehen. Pépé spielte zu ihren Füßen, Jean hatte seinen Posten auf der Schwelle wieder eingenommen. Fast eine Stunde lang beobachtete Denise aufmerksam die Vorgänge im Geschäft. Ab und zu erschien Kundschaft, allein der Laden verlor nichts von seiner anfänglichen Muffigkeit, seinem Halbdunkel, in dem der ganze alte, rechtschaffene, einfache Handel seinen traurigen Niedergang zu beklagen schien. Um so interessanter war das Treiben gegenüber im »Paradies der Damen«, dessen Auslagen man durch die offene Tür sehen konnte. Schon seit dem Morgen empfand Denise eine innere Versuchung. Dieses ungeheure Warenhaus, in das sie binnen einer Stunde mehr Leute eintreten sah als bei Cornaille in sechs Monaten, verwirrte sie und zog sie an; eine unklare Furcht rang in ihr mit dem Verlangen, dort anzufangen. Der Laden ihres Onkels hingegen erweckte ein Gefühl des Unbehagens in ihr. Es war eine Geringschätzung, die sie nicht hätte begründen können, aber sie hegte nun einmal eine unwillkürliche Abneigung gegen die eisige Höhle dieses alten Geschäfts.
»Die haben wenigstens Kunden«, flüsterte sie vor sich hin. Sogleich bereute sie ihre Worte, als sie die Tante neben sich bemerkte. Frau Baudu stand ganz niedergeschmettert da, ihre glanzlosen Augen auf das Ungeheuer da drüben gerichtet, bei dessen Anblick ihr in stummer Verzweiflung die Tränen kamen. Geneviève dagegen beobachtete mit steigender Unruhe Colomban, der sich unbelauscht wähnte und mit entzückten Blicken die Verkäuferinnen der Konfektionsabteilung betrachtete, deren Ladentische man hinter den Fensterscheiben des Zwischenstocks sehen konnte. Baudu mit seinem galligen Gesicht begnügte sich damit, zu sagen:
»Nur Geduld! Es ist nicht alles Gold, was glänzt!«
Er preßte die Lippen aufeinander und wandte sich ab, um nicht länger Zeuge des lebhaften Treibens da drüben sein zu müssen.
»Wir wollen zu Vincard gehen«, sagte er. »Arbeitsplätze sind jetzt sehr gesucht; morgen wäre es vielleicht schon zu spät.«
Bevor er ging, gab er dem zweiten Gehilfen den Auftrag, Denises Koffer vom Bahnhof zu holen. Frau Baudu, der Denise Pépé anvertraut hatte, erklärte, sie wolle den freien Moment dazu benützen, den Kleinen nach der Rue des Orties zu Frau Gras zu bringen, um mit ihr ein Übereinkommen zu treffen. Jean versprach seiner Schwester, den Laden nicht zu verlassen.
»Wir sind in zwei Minuten dort«, sagte Baudu zu seiner Nichte, während sie durch die Rue Gaillon gingen. »Vinçard hat sich auf Seiden spezialisiert, sein Geschäft läuft noch einigermaßen. Natürlich hat er zu kämpfen wie jeder, obgleich er ein Geizkragen ist, wie man ihn nicht leicht wieder findet. Ich denke, er wird sich wegen seines Rheumatismus bald zurückziehen.«
Das Geschäft Vinçards befand sich in der Rue Neuve-des-Petits-Champs in der Nähe der Passage Choiseul. Es war sauber und hell, ganz modern, aber klein und nur mit einem dürftigen Warenlager versehen. Baudu und Denise trafen Vinçard in angelegentlicher Unterredung mit zwei Herren.
»Lassen Sie sich nicht stören«, rief der Tuchhändler; »wir haben Zeit und können warten.«
Er trat aus Höflichkeit in die Tür zurück und flüsterte seiner Nichte zu:
»Der Magere ist Zweiter in der Seidenabteilung beim ›Paradies der Damen‹; der Dicke ist ein Fabrikant aus Lyon.«
Denise merkte, daß Vinçard sein Geschäft Herrn Robineau, dem Angestellten aus dem »Paradies der Damen«, aufschwatzen wollte. Er versicherte, sein Haus sei eine wahre Goldgrube. Obgleich er vor Gesundheit strotzte, unterbrach er sich zuweilen, um zu stöhnen und über seine verdammten Schmerzen zu klagen, die ihn daran hinderten, sein Glück wahrzunehmen. Doch Robineau schnitt ihm ungeduldig das Wort ab; er wisse sehr wohl, sagte er, daß für Modeartikel eine kritische Zeit gekommen sei, und er führte eine Seidenfirma an, die durch die Nachbarschaft des »Paradieses der Damen« bereits zugrunde gerichtet sei. Doch Vinçard ereiferte sich und rief laut:
»Ach ja! Der Untergang dieses Gimpels Vabre war ja vorauszusehen! Seine Frau hat alles verschlungen ... Und dann bin ich fünfhundert Meter weit weg, während Vabre sich Tür an Tür neben seinem Konkurrenten befand.«
Jetzt mischte Gaujean, der Seidenfabrikant, sich ein. Die Stimmen wurden leiser. Er beschuldigte die großen Warenhäuser, daß sie die französische Industrie ruinierten; ihrer drei oder vier diktierten allen übrigen die Preise und beherrschten den Markt. Der einzige Weg, sie zu bekämpfen, sei die Begünstigung des Kleinhandels, besonders der Spezialgeschäfte, denen die Zukunft gehöre. Er stellte denn auch Robineau einen weitgehenden Kredit in Aussicht.
»Sehen Sie nur, wie das ›Paradies der Damen‹ sich Ihnen gegenüber benommen hat! Da gibt es keine Rücksicht auf geleistete Dienste. Seit langem war Ihnen die Stelle des Ersten in Ihrer Abteilung zugesagt; da kam dieser Bouthemont an, niemand weiß, woher, und nahm Ihnen den Posten vor der Nase weg.«
Die Wunde, die man Robineau durch diese Ungerechtigkeit geschlagen hatte, war noch frisch. Allein er zögerte, sich selbständig zu machen. Das Geld gehöre nicht ihm, erklärte er; seine Frau habe sechzigtausend Franken geerbt, und er wollte sich lieber beide Hände abhacken lassen, als dieses Geld in zweifelhafte Geschäfte zu stecken.
»Nein, ich kann mich nicht entschließen«, sagte er endlich. »Lassen Sie mir Bedenkzeit; wir werden noch darüber reden.«
»Wie Sie wollen«, erwiderte Vinçard und suchte seinen Verdruß zu verbergen. »Es liegt ja nicht in meinem Interesse, das Geschäft zu verkaufen. Hätte ich nicht solche Schmerzen ...«
Dann wandte er sich an Baudu und fragte:
»Womit kann ich Ihnen dienen?«
Der Tuchhändler, der mit einem Ohr gelauscht hatte, stellte Denise vor; sie habe zwei Jahre in der Provinz gearbeitet, und da Vinçard eben eine Verkäuferin suche ...
Vinçard tat ganz verzweifelt.
»Ach, jetzt ist's zu spät! Acht Tage lang habe ich mich umgesehen, und vor zwei Stunden habe ich eine eingestellt!«
Alles schwieg. Denise schien so bestürzt, daß Robineau sie teilnahmsvoll betrachtete und sich eine Bemerkung erlaubte.
»Ich weiß, daß bei uns in der Konfektionsabteilung jemand gesucht wird.«
Baudu konnte einen Ausruf nicht unterdrücken.
»Bei Ihnen? Nein, danke bestens!«
Dann stand er ganz verlegen da. Denise war tief errötet. Sie würde es niemals wagen, dachte sie, in dieses große Warenhaus einzutreten, aber der Gedanke erfüllte sie doch mit Stolz.
»Warum denn nicht?« fragte Robineau überrascht. »Das wäre doch für das junge Fräulein recht günstig? Ich rate ihr, sich morgen bei der Direktrice, Frau Aurélie, vorzustellen. Es kann ihr ja nichts Schlimmeres passieren, als daß sie nicht angenommen wird.«
Um seinen Ärger zu vertuschen, verlor sich der Tuchhändler in allerlei verworrenes Gerede. Er kenne Frau Aurélie, meinte er, oder vielmehr ihren Mann, den Kassierer Lhomme, dem doch ein Omnibus den rechten Arm abgefahren habe. Dann kam er ganz unvermittelt wieder auf Denise zu sprechen.
»Es ist übrigens ihre Sache«, sagte er; »sie kann tun, was sie will.«
Mit einem Gruß verließ er den Laden. Vinçard begleitete ihn bis zur Tür und drückte ihm nochmals sein Bedauern aus. Denise war schüchtern mitten im Laden stehengeblieben und wartete begierig auf nähere Auskünfte von Robineau. Allein sie wagte kein Wort hervorzubringen, grüßte endlich und sagte:
»Vielen Dank, mein Herr.«
Auf der Straße eilte Baudu, wie von seinen Gedanken getrieben, rasch fort und zwang seine Nichte, fast zu laufen. In der Rue de la Michodière wollte er eben in seinen Laden treten, als ein benachbarter Kaufmann, der auf der Schwelle seines Geschäftes stand, ihn durch einen Wink herbeirief. Denise blieb stehen, um auf ihn zu warten.
»Was gibt's, Vater Bourras?« fragte der Tuchhändler.
Bourras war ein hochgewachsener Greis mit einem Prophetenkopf, langem Haar und Bart und durchdringenden Augen unter den dichten, buschigen Brauen. Er betrieb einen Handel in Spazierstöcken und Regenschirmen, übernahm auch Ausbesserungen und drechselte sogar Regenschirmgriffe, was ihm im Stadtviertel den Ruf eines Künstlers eingetragen hatte. Denise betrachtete erstaunt sein Haus. Es war ein altes Gebäude, eingekeilt zwischen dem »Paradies der Damen« und einem großen Haus im Stil Ludwigs XIV. Man konnte sich gar nicht erklären, wie es in diesen schmalen Spalt hineingeraten war, in dem seine beiden niedrigen Stockwerke schier erdrückt wurden.
»Denken Sie sich: er hat dem Besitzer meines Hauses geschrieben und ihm angeboten, es zu kaufen!« sagte Bourras empört zu dem Tuchhändler.
Baudu erbleichte noch mehr und zuckte zusammen. Da ließ Bourras seinem Zorn freien Lauf.
»Solange ich lebe, soll er keinen Stein davon besitzen! Mein Vertrag läuft noch zwölf Jahre ... Wir werden schon sehen!«
Das war eine offene Kriegserklärung. Keiner von beiden hatte das »Paradies der Damen« beim Namen genannt. Baudu schüttelte den Kopf, dann ging er mit hängenden Schultern nach Hause und murmelte still vor sich hin:
»Mein Gott! Mein Gott!...«
Denise, die dieses Gespräch mit angehört hatte, folgte ihrem Onkel. Auch Frau Baudu kehrte eben mit Pépé heim. Sie erzählte, Frau Gras sei jederzeit bereit, den Kleinen zu übernehmen.
»Nun, wie war's bei Vinçard?« fragte sie.
Der Tuchhändler berichtete von seinem erfolglosen Weg, dann fügte er hinzu, jemand anderer habe seiner Nichte eine Stelle angeboten. Den Arm nach dem »Paradies der Damen« ausgestreckt, sagte er verächtlich:
»Die da drüben!«
Die ganze Familie fühlte sich dadurch verletzt. Beim Abendessen endlich brach der seit dem Morgen zurückgedrängte Strom der Empörung unaufhaltsam los.
»Es ist natürlich deine Sache, du bist ja frei in deiner Entscheidung«, wiederholte zunächst Baudu. »Wir wollen dich nicht beeinflussen ... Aber wenn du wüßtest, was das für ein Haus ist!« In abgebrochenen Sätzen erzählte er die Geschichte dieses Octave Mouret. Ein Glückspilz sondergleichen! Da kam dieser Bursche aus dem Süden nach Paris mit der liebenswürdigen Keckheit eines Abenteurers, und schon am nächsten Tag hatte er Weibergeschichten. Schließlich war er auf frischer Tat ertappt worden. Es hatte einen Skandal gegeben, von dem noch heute im ganzen Stadtviertel gesprochen wurde. Und dann hatte er plötzlich und auf unerklärliche Weise Frau Hedouin erobert, die ihm das »Paradies der Damen« in die Ehe einbrachte.
»Die arme Caroline!« unterbrach ihn Frau Baudu. »Sie war eine entfernte Verwandte von mir. Wenn sie noch am Leben wäre, hätten sich die Dinge anders entwickelt. Sie würde nie zugeben, daß wir zugrunde gerichtet werden... Er hat auch sie umgebracht! Ja, mit seiner Bauerei! Als sie eines Morgens die Arbeiten besichtigte, stürzte sie in ein Loch, und drei Tage später war sie tot. Sie, die niemals krank gewesen war, die immer so gesund und schön war! Das Haus da ist mit Blut gebaut – man möchte fast meinen, daß es ihm Glück gebracht hat«, schloß sie, ohne Mourets Namen zu nennen.
Doch der Tuchhändler zuckte verächtlich die Schultern über solche Ammenmärchen.
»Ich glaube, Caroline, die selbst ein wenig romantisch veranlagt war, hat sich von den abenteuerlichen Plänen dieses Menschen gefangennehmen lassen. Kurz, er hat sie überredet, das Haus zur Linken und dann auch das zur Rechten anzukaufen, und hat selbst als Witwer noch zwei Gebäude dazuerworben. So ist dieses Warenhaus größer und immer größer geworden und droht uns heute alle zu verschlingen. Aber nur Geduld! Die Großtuer werden sich noch den Hals brechen. Mouret macht jetzt eine gefährliche Zeit durch; ich weiß es. Er hat sein ganzes Vermögen in diese tollen Erweiterungen und in die Reklame hineingesteckt. Um sich Geld zu verschaffen, hat er alle seine Angestellten überredet, ihre Ersparnisse bei ihm anzulegen. Er steht also jetzt ohne einen Sou da, und wenn nicht ein Wunder geschieht und es ihm nicht gelingt, seinen Umsatz zu verdreifachen, wie er hofft, so wird man einen Krach erleben, einen Krach! ... Ha, ich bin nicht schadenfroh, aber an diesem Tag werde ich illuminieren, mein Wort darauf!«
So wetterte er fort. Hatte man je so etwas gesehen? Ein Modewarengeschäft, wo alles zu haben war, ein Basar also! Auch das Personal paßte dazu, ein Haufen Stutzer, die herumhantierten wie in einem Bahnhof; sie behandelten die Waren und die Käufer wie Pakete, verließen ihren Chef und wurden entlassen für nichts, mit einem einzigen Wort; diese Menschen hatten keine Anhänglichkeit, keine Sitten, kein Verständnis für das Geschäft! Die Kunst bestand schließlich nicht darin, viel zu verkaufen, sondern teuer zu verkaufen! Er nahm Colomban zum Zeugen: der war noch in der guten alten Schule erzogen, der wußte Bescheid!
»Du bist der letzte, mein Lieber!« erklärte er gerührt. »Nach dir kommt keiner mehr von deinem Schlag. Du bist mein einziger Trost, denn wenn ein solcher Trödelmarkt heute Handel genannt wird, dann verstehe ich nichts mehr von der Sache, dann will ich lieber abtreten.«
Geneviève betrachtete von der Seite den lächelnden Colomban, und in ihren Blicken lag etwas wie ein Argwohn, das Verlangen zu sehen, ob er, von Gewissensbissen getrieben, bei diesen Lobsprüchen nicht erröten werde. Allein er blieb ruhig wie immer, mit gutmütigem Gesichtsausdruck, nur um seinen Mund lag eine schlaue Falte.
Baudu fuhr indessen fort mit seinen Anklagen gegen diese Leute da drüben, die sich in ihrem Kampf ums Dasein benahmen wie die Wilden und es schließlich so weit brachten, daß sie ihr Familienleben gänzlich zerstörten. Man brauchte sich doch nur die Lhommes anzusehen. Sie hatten draußen auf dem Land ihren Besitz neben dem seinen, daher kannte er sie. Alle drei, Vater, Mutter und Sohn, waren im »Paradies der Damen« angestellt, aber man traf sie kaum jemals zusammen; ständig waren sie außer Haus, nur am Sonntag aßen sie daheim, im übrigen schienen sie im Restaurant zu leben. Nein, nein, meinte er, sein Speisezimmer sei zwar nicht übermäßig groß und könnte auch etwas mehr Licht und Luft vertragen, aber hier sei er zu Hause, bei den Seinen. Und er blickte in dem kleinen Raum umher, insgeheim zitternd bei dem Gedanken, die Tollhäusler da drüben könnten, wenn sie seine Firma vollends ruiniert hätten, ihn eines Tages aus diesem Loch vertreiben, wo er sich zwischen Frau und Tochter so behaglich fühlte.
»Ich sage das alles nicht, um dir die Lust zu vergällen«, meinte er schließlich, zu Denise gewandt. »Wenn es dir etwas nützt, in dieses Haus einzutreten, dann tu es nur. Ich will dich nicht zurückhalten. Aber ich frage dich, die du doch auch etwas vom Geschäft verstehst, ob es einen Sinn hat, daß ein einfaches Modewarenhaus alles mögliche feilbietet? Früher, als es noch einen rechtschaffenen Handel gab, verstand man unter Modewaren einfach Stoffe und weiter nichts. Heute denken diese Leute nur daran, auf Kosten anderer alles an sich zu reißen. Das ganze Stadtviertel jammert schon darüber. Dieser Mouret richtet sie alle zugrunde. Ich selbst habe bisher nicht allzu sehr zu klagen. Er schadet mir, das ist sicher; aber er führt vorläufig nur Damenstoffe, leichtere für Kleider und schwere für Mäntel. Herrenartikel dagegen kauft man immer noch bei mir, Samt für Jagdanzüge, Livreestoffe und dergleichen; ganz zu schweigen von Flanellen und Wolltuchen, in denen er wohl schwerlich so gut sortiert ist wie ich. Aber er fordert mich heraus; gerade vor unserer Tür, mitten in seiner Tuchauslage prahlt er mit seinen buntesten Konfektionsartikeln wie ein Jahrmarktschreier, um die jungen Mädchen damit zu ködern. Auf Ehre, ich würde mich schämen, zu solchen Mitteln zu greifen. Seit nahezu hundert Jahren ist mein Geschäft bekannt, und ich habe es nicht nötig, an meiner Tür solchen Köder für Maulaffen auszuhängen. Solange ich lebe, bleibt der ›Vieil Elbeuf‹ so, wie ich ihn übernommen habe, mit seinen vier Auslagen rechts und links und sonst nichts!«
Seine Erregung griff allmählich auf die ganze Familie über. Nach kurzem Stillschweigen erlaubte sich Geneviève die Bemerkung:
»Unsere Kunden bleiben uns treu, Papa. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben ... Heute waren Frau Desforges und Frau von Boves wieder da. Ich erwarte auch Frau Marty, die sich Flanellstoffe ansehen wollte.«
»Und ich«, erklärte Colomban, »habe gestern von Frau Bourdelais einen Auftrag bekommen. Allerdings hat sie dabei einen englischen Cheviot erwähnt, der da drüben um zehn Sous billiger zu haben ist als bei uns.«
»Wenn man bedenkt«, sagte Frau Baudu mit ihrer kraftlosen Stimme vor sich hin, »daß wir dieses Haus gekannt haben, als es noch nicht größer war als eine Hutschachtel ... Ja, meine liebe Denise, als die Brüder Deleuze es gründeten, bestand es aus einem Wandschrank, in dem kaum fünf Ballen Stoff Platz hatten, und einer einzigen Auslage nach der Rue Neuve-Saint-Augustin. Der Laden war so klein, daß man sich darin gerade umdrehen konnte. Und damals war der ›Vieil Elbeuf‹ schon sechzig Jahre alt und sah genauso aus wie heute ... Ja, das hat sich alles geändert, sehr geändert!«
Sie schüttelte den Kopf, außerstande, dieses Drama zu begreifen. Sie war im »Vieil Elbeuf« geboren, sie liebte dieses Haus bis in seine feuchten Wände, lebte nur für es und durch es. Einst war es ihr Ruhm gewesen, das mächtigste im ganzen Stadtviertel; dann hatte sie zusehen müssen, wie die Konkurrenz gegenüber allmählich emporwuchs, anfangs mißachtet, später an Bedeutung dem eigenen Unternehmen gleich und nun eine immer gefährlichere Bedrohung. Sie ging am Abstieg ihres Hauses selber langsam zugrunde, sie fühlte, an dem Tag, an dem das Geschäft schließen mußte, würde es auch mit ihr zu Ende sein.
Erneut herrschte Stillschweigen. Baudu trommelte mit den Fingern auf dem Wachstuch des Tisches einen Marsch. Er fühlte sich müde, bedauerte fast, in dieser Weise wieder einmal sein Herz erleichtert zu haben.
»Unnützes Gerede!« rief er endlich. »Um zu einem Ende zu kommen: tu, was du für richtig hältst. Wir haben dir die Verhältnisse erklärt, das ist alles. Schließlich ist es deine Sache.«
Er drängte sie mit seinem Blick zu einer entschiedenen Antwort. Aber Denise, die durch diese Einzelheiten keineswegs abgeschreckt war, sondern sich nur noch mehr für das »Paradies der Damen« interessierte, begnügte sich damit, zu sagen:
»Kommt Zeit, kommt Rat, Onkel.«
Sie sprachen davon, bald zu Bett zu gehen, weil die Kinder müde seien. Da es aber erst sechs Uhr war, wollte sie selbst noch ein Weilchen im Laden bleiben. Die Nacht war hereingebrochen; draußen fiel seit einiger Zeit ein feiner, dichter Regen.
Denise gab der Versuchung nach und trat in die Tür. Der Anblick, den das »Paradies der Damen« in dieser späten Abendstunde bot, nahm das Mädchen vollends gefangen. In dieser großen Stadt, die im strömenden Regen schwarz und stumm dalag, in diesem ihr unbekannten Paris erstrahlte das Warenhaus wie ein Leuchtfeuer, es schien alles Licht und alles Leben der Stadt in sich zu vereinigen.
Als Denise sich umwandte, sah sie, daß die Baudus erneut hinter ihr standen. Es zog sie unwillkürlich immer wieder vor dieses Schauspiel, das ihnen doch das Herz brach. Geneviève war sehr blaß; sie hatte beobachtet, daß Colomban abermals die vor den Fenstern vorbeihuschenden Schatten der Verkäuferinnen im Zwischenstock betrachtete; und während Baudu vor verhaltener Wut fast erstickte, hatten sich die Augen Frau Baudus still mit Tränen gefüllt.
»Nicht wahr, du stellst dich morgen drüben vor?« fragte der Tuchhändler endlich seine Nichte, von der Ungewißheit verzehrt und doch zugleich in dem sicheren Gefühl, daß sie dem ›Paradies der Damen‹ bereits verfallen sei wie alle anderen.
Sie zögerte etwas, dann sagte sie sanft:
»Ja, Onkel, wenn es Sie nicht zu hart ankommt.«
Zweites Kapitel
Am folgenden Tag um halb acht Uhr morgens fand sich Denise vor dem »Paradies der Damen« ein. Sie wollte sich dort vorstellen und anschließend Jean zu seinem Lehrherrn bringen, der weit weg im Faubourg du Temple wohnte. Da sie gewohnt war, zeitig aufzustehen, war sie zu früh dran; die Angestellten kamen selber erst spärlich an, und da sie sich lächerlich zu machen fürchtete, ging sie noch eine kleine Weile auf und ab.
Es wehte ein kalter Wind, der das Pflaster bereits getrocknet hatte. Aus allen Straßen kamen jetzt eiligen Schrittes die Angestellten, den Kragen hochgeschlagen, die Hände in den Taschen, gleichsam überrascht von diesem ersten Winterschauer. Die meisten gingen allein und verschwanden im Hintergrund des Warenhauses, ohne mit ihren Kollegen ein Wort zu wechseln oder sie auch nur anzublicken. Andere kamen zu zweien oder dreien; in lebhaftes Gespräch vertieft, nahmen sie die ganze Breite des Bürgersteigs ein. Und alle warfen, bevor sie eintraten, mit der gleichen Handbewegung den Rest ihrer Zigarre oder Zigarette in den Rinnstein.
Denise bemerkte, daß mehrere der Männer sie im Vorübergehen anblickten. Da nahm ihre Schüchternheit noch zu. Sie fühlte nicht mehr die Kraft, ihnen zu folgen, und beschloß zu warten, bis der Strom der Angestellten versiegte. Sie errötete bei dem Gedanken, unter der Tür zwischen all diesen Männern hin- und hergestoßen zu werden. Um den Blicken zu entgehen, machte sie langsam die Runde um die Place Gaillon.
Als sie zurückkam, fand sie vor dem »Paradies der Damen« einen langen, blassen, schlaksigen Jüngling, der gleich ihr seit einer Viertelstunde hier zu warten schien.
»Fräulein«, fragte er sie endlich mit stotternder Stimme, »sind Sie vielleicht Verkäuferin hier in diesem Haus?«
Sie war so verblüfft darüber, von einem ihr unbekannten jungen Mann angesprochen zu werden, daß sie nicht sogleich antwortete.
»Ich möchte nämlich gern hier unterkommen«, fuhr er noch verlegener fort, »und ich dachte, daß Sie mir vielleicht Auskunft geben könnten.«
»Ich würde Ihnen gern helfen«, antwortete sie endlich; »aber es geht mir wie Ihnen; ich will mich auch vorstellen.«
»Ach so! Ganz recht!« sagte er, völlig außer Fassung.
Nun erröteten sie alle beide; schweigend und schüchtern standen sie einander gegenüber, gerührt durch die Ähnlichkeit ihrer Lage und doch zu zaghaft, um sich gegenseitig laut einen guten Erfolg zu wünschen. Als schließlich keiner von beiden mehr etwas zu sagen wußte und ihre Verwirrung nur größer wurde, gingen sie linkisch auseinander und warteten einige Schritte entfernt, jeder für sich.
Immer noch kamen Angestellte. Denise hörte sie ihre Spaße machen, wenn sie an ihr vorüberkamen und ihr einen Seitenblick zuwarfen. Sie wurde immer verlegener, das Ziel so vieler Blicke zu sein, und entschloß sich gerade, einen Spaziergang von einer halben Stunde durch das Stadtviertel zu machen, als der Anblick eines jungen Mannes, der raschen Schritts aus der Rue Port Mahon kam, sie einen Augenblick zurückhielt. Es mußte ein Abteilungsleiter sein, denn alle Angestellten grüßten ihn. Er war groß, die Haut zart und hell, der Bart sorgfältig gepflegt; seine Augen, die er im Vorbeigehen einen Moment auf ihr ruhen ließ, waren goldbraun und samtweich. Er war längst mit gleichgültiger Miene im Warenhaus verschwunden, als sie noch immer unbeweglich, wie gebannt von diesem Blick dastand, von einer seltsamen Erregung ergriffen, in der ein Gefühl des Unbehagens überwog. Wieder kam die Angst über sie; sie ging langsam die Rue Gaillon, dann die Rue Saint-Roch hinab in der Hoffnung, ihren Mut wiederzufinden.
Der junge Mann war mehr als ein Abteilungsleiter; es war Octave Mouret selbst. Er hatte die verflossene Nacht nicht geschlafen; nach einer Abendgesellschaft bei einem Wechselagenten war er mit einem Freund und zwei Frauen, die sie hinter den Kulissen eines kleinen Theaters aufgelesen hatten, noch essen gegangen. Sein zugeknöpfter Mantel verbarg den Frack und die weiße Krawatte. Er stieg rasch in seine Wohnung hinauf, um sich zu waschen und die Kleidung zu wechseln. Als er in sein Arbeitszimmer, das im Zwischenstock lag, zurückkehrte und an seinem Schreibtisch Platz nahm, war er wieder frisch, sein Blick war klar, er war völlig beim Geschäft, als habe er zehn Stunden in seinem Bett zugebracht. Das geräumige Arbeitszimmer hatte eichene, mit grünem Rips überzogene Möbel. Die einzige Zierde des Raumes war ein Bild: das Porträt jener Frau Hédouin, von der man im Stadtviertel noch immer sprach. Octave bewahrte ihr ein zärtliches Andenken und zeigte sich im Gedächtnis sehr dankbar dafür, daß sie ihm durch die Heirat ein Vermögen zugebracht hatte. Bevor er daran ging, die Wechsel zu unterschreiben, die auf seinem Tisch lagen, warf er auch jetzt ein Lächeln zu dem Bild empor, das Lächeln eines Glücklichen. Hier vor ihren Augen fand er sich immer wieder ein, um zu arbeiten, wenn er sich die Zerstreuungen eines jungen Witwers gegönnt hatte, wenn er aus den Schlafzimmern heraus war, in die er sich in seinem Bedürfnis nach Vergnügen verirrt hatte.
Es klopfte an die Tür. Ohne eine Antwort abzuwarten, trat ein junger Mann ein, groß und hager, mit schmalen Lippen, spitzer Nase, elegant gekleidet, die langen Haare, in denen schon einige graue Strähnen zu sehen waren, glatt nach hinten gestrichen. Mouret schaute einen Moment auf, dann sagte er, ohne seine Arbeit zu unterbrechen:
»Gut geschlafen, Bourdoncle?«
»Danke, sehr gut«, erwiderte der junge Mann, der mit vertraulicher Ungezwungenheit im Raum umherging.
Bourdoncle, Sohn eines armen Pächters aus der Umgebung von Limoges, war gleichzeitig mit Mouret im »Paradies der Damen« eingetreten zu einer Zeit, als das Geschäft noch kaum mehr als die Ecke der Place Gaillon einnahm. Sehr klug, sehr tätig, schien er damals ganz dazu angetan, seinen Kameraden zu verdrängen, der, weniger ernsthaft veranlagt, ständig mit Weibergeschichten zu tun hatte. Allein Bourdoncle hatte nicht den genialen Zug dieses leidenschaftlichen Provenzalen, es fehlte ihm dessen kühner Schwung, seine überwältigende Liebenswürdigkeit. Übrigens hatte er sich mit sicherem Instinkt vom ersten Augenblick an widerstandslos dem andern gebeugt. Als Mouret seinen Angestellten den Rat erteilt hatte, ihr Geld in seinem Geschäft anzulegen, hatte Bourdoncle als einer der ersten nachgegeben und ihm sogar eine Erbschaft anvertraut, die ihm von einer Tante unerwarteterweise zugefallen war. Und nachdem er alle Stufen emporgeklettert war, erst Verkäufer, dann Zweiter, schließlich Leiter der Seidenabteilung, war er schließlich einer der Stellvertreter des Inhabers geworden, der geschätzteste und angesehenste, einer der sechs Teilhaber, die den Chef in der Leitung des Hauses unterstützen, eine Art Ministerrat unter einem absoluten Herrscher. Jeder von ihnen überwachte ein Teilgebiet; Bourdoncle hatte die Oberaufsicht.
»Und wie haben Sie die Nacht zugebracht?« fragte er vertraulich.
Als Mouret ihm erwiderte, daß er gar nicht zu Bett gegangen sei, schüttelte er den Kopf und brummte:
»Sehr unvernünftige Lebensweise!«
»Wieso denn?« meinte der andere vergnügt. »Ich bin weniger müde als Sie. Sie haben vom Schlaf verklebte Augen; Sie werden ganz schwerfällig, wenn Sie allzu solide sind. Amüsieren Sie sich: das muntert die Gedanken auf.«
Sie stritten oft freundschaftlich über diesen Gegenstand. Bourdoncle hatte anfangs seine Geliebten geprügelt, weil sie, wie er sagte, ihn nicht schlafen ließen. Jetzt gestand er offen, daß er die Frauen hasse. Indessen hatte er sicherlich auswärts Zusammenkünfte, von denen er nicht sprechen wollte, so wenig berührten sie sein Inneres; er begnügte sich damit, im Geschäft die weiblichen Kunden auszubeuten, wobei er sich voller Verachtung über die Leichtfertigkeit ausließ, mit der sie ihr Geld für so manchen unnützen Tand vergeudeten. Mouret dagegen tat sehr entzückt, war in Gegenwart der Frauen stets verführerisch, liebenswürdig und fortwährend in neue Liebschaften verwickelt. Und diese Liebschaften waren gleichsam eine Reklame für sein Geschäft; man war versucht zu sagen, daß er das ganze schöne Geschlecht in einer einzigen Umarmung umfange, um es desto sicherer zu betören und sich dienstbar zu machen.
»Ich habe gestern auf dem Ball Frau Desforges gesehen«, fuhr er fort. »Sie war reizend.«
»Aber Sie haben nicht etwa anschließend mit ihr gegessen?« fragte sein Teilhaber.
»Wo denken Sie hin!« rief Mouret. »Sie ist viel zu anständig für so etwas, mein Lieber ... Nein, soupiert habe ich mit Héloise, der kleinen Schauspielerin aus den Folies. Sie ist dumm wie eine Gans, aber sehr drollig!«
Er nahm ein neues Bündel Wechsel zur Hand und fuhr fort zu unterschreiben. Unterdessen ging Bourdoncle im Zimmer auf und ab. Von Zeit zu Zeit warf er einen Blick durch die hohen Fensterscheiben auf die Rue Neuve-Saint-Augustin; dann kam er zum Schreibtisch zurück und sagte:
»Sie werden sich rächen.«
»Wer denn?« fragte Mouret zerstreut.
»Nun, die Frauen.«
Diese Bemerkung versetzte Mouret erst recht in heitere Stimmung; er kehrte die Brutalität hervor, die sich unter all der Anbetung der Frauen verbarg. Verächtlich zuckte er die Achseln, um gleichsam damit auszudrücken, daß er sie wie leere Säcke abschütteln werde, sobald sie ihm zum Aufbau seines Vermögens verholfen hätten. Bourdoncle aber wiederholte eigensinnig:
»Sie werden sich rächen ... Es wird sich eine finden, die alle übrigen rächt; es ist ein Verhängnis mit den Frauen.«
»Da habe ich keine Angst!« rief Mouret. »Diese eine ist noch nicht geboren. Wenn sie kommt, wird sie an mir ihren Gegner finden.«
Sie schwiegen; man hörte nichts als das Gekritzel der Feder Mourets. Auf seine kurzen Fragen gab Bourdoncle dann Auskunft über den großen Sonderverkauf von Winterartikeln, der am nächsten Montag stattfinden sollte. Es war ein gewagtes Unterfangen, die ganze Existenz des Hauses stand dabei auf dem Spiel; die im Stadtviertel umlaufenden Gerüchte waren nicht unbegründet.
Mouret hatte sich mit dem Elan eines Künstlers in dieses Unternehmen gestürzt, mit einem solchen Aufwand, mit einer solchen Leidenschaft für das Kolossale, daß er auch heute noch, trotz seiner ersten Erfolge, seine Teilhaber zuweilen in Bestürzung versetzte. Man tadelte ihn im stillen, daß er allzu rasch vorgehe; man beschuldigte ihn, daß er in gefährlichem Maße das Lager erweitert habe, ohne noch zu wissen, woher er die zusätzliche Kundschaft nehmen sollte; insbesondere zitterte man, als man sah, daß er alles Geld auf eine Karte setzte, ganze Berge von Waren anhäufte, ohne Rücklagen zu behalten.
Doch als Bourdoncle sich jetzt erlaubte, seine Besorgnisse über die allzu schnelle Erweiterung einiger Abteilungen des Hauses zu äußern, deren Rentabilität noch ungewiß war, lachte Mouret zuversichtlich und rief:
»Lassen Sie's gut sein, mein Lieber, das Haus ist noch immer zu klein.«
Der andere war völlig verblüfft, von einer Angst erfaßt, die er gar nicht zu verbergen suchte. Das Haus zu klein! Ein Modewarenhaus, in dem es neunzehn Abteilungen gab und das vierhundertdrei Angestellte beschäftigte!
»Trotzdem«, sagte Mouret. »Ehe anderthalb Jahre vergehen, werden wir uns vergrößern müssen. Ich denke ernstlich daran. Gestern abend hat Frau Desforges mir versprochen, mich mit einem Herrn bekannt zu machen ... Kurz, wir werden später noch darüber reden, wenn die Sache spruchreif ist.«
Bevor sie nun aber zu ihrem üblichen Rundgang ins Geschäft hinuntergingen, besprachen sie noch einige Einzelheiten miteinander. Sie sahen sich das Muster eines Abreißblocks an, den sich Mouret für die Verkaufsabrechnungen ausgedacht hatte. Er hatte nämlich festgestellt, daß die sogenannten Ladenhüter um so rascher abgesetzt wurden, je größer die Provision war, die er seinen Angestellten gab. Daraufhin hatte er etwas völlig Neues eingeführt. Er beteiligte seither seine Angestellten an allem, was sie umsetzten, und gab ihnen Prozente für den kleinsten Stoffrest, für den geringsten Artikel, den sie verkauften. Diese Einrichtung hatte einen wahren Kampf ums Dasein unter den Angestellten entfacht, einen Kampf, der den Geschäftsinhabern zugute kam.
Das Muster wurde für gut befunden. Auf dem oberen Teil des Blocks wie auf dem Abriß waren Abteilung und Nummer des Verkäufers angegeben; dann befanden sich auf beiden Teilen gleiche Rubriken für die Meter- oder Stückzahl, die Art des Artikels und den Preis; der Verkäufer hatte das Blatt nur zu unterzeichnen, bevor er es an der Kasse abgab. Auf diese Weise war die Überprüfung sehr einfach, es genügte, die abgegebenen Kassenzettel mit den in den Händen der Angestellten gebliebenen Kontrollabschnitten zu vergleichen. Jede Woche konnten so die Verkäufer ihre Provisionen abheben, ohne daß ein Irrtum möglich war.
»Wir werden weniger bestohlen werden«, bemerkte Bourdoncle zufrieden; »das war ein ausgezeichneter Gedanke von Ihnen.«
»Ich habe diese Nacht noch an andere Dinge gedacht«, sagte Mouret. »Ich hätte Lust, den Leuten unserer Abrechnungsstelle eine Prämie für jeden Fehler auszusetzen, den sie in den Kassenblocks entdecken. So sind wir sicher, daß sie die Prüfung sorgfältig vornehmen.«
Er begann zu lachen, während der andere ihn bewundernd anblickte.
»Also gehen wir hinunter«, meinte er dann. »Wir müssen uns um den Sonderverkauf nächste Woche kümmern. Die Seidenstoffe sind gestern angekommen? Bouthemont wird wohl in der Annahmestelle sein.«
Bourdoncle folgte ihm. Die Warenannahme lag im Keller nach der Rue Neuve-Saint-Augustin zu. Zu ebener Erde befand sich ein verglaster Vorraum, in dem die ankommenden Waren abgeladen wurden. Nachdem sie gewogen waren, glitten sie auf einer Rutschbahn in die Tiefe.
Einen Augenblick blieb Mouret hier stehen. Es herrschte reger Betrieb: lange Reihen von Kisten kamen die schräge Bahn herab, von unsichtbaren Händen auf den Weg geschickt. In dem fahlen Licht, das durch die breiten Kellerfenster hereinfiel, war eine Schar von Männern damit beschäftigt, die herabgleitenden Sendungen in Empfang zu nehmen, eine andere Gruppe hatte die Aufgabe, unter der Aufsicht des Abteilungsleiters die Kisten und Ballen zu öffnen. Die Betriebsamkeit einer Werkstatt erfüllte den ganzen Keller.
»Ist alles da, Bouthemont?« fragte Mouret einen kräftig gebauten jungen Mann, der eben dabei war, den Inhalt einer Kiste festzustellen.
»Es wird wohl jetzt alles angekommen sein«, erwiderte Bouthemont. »Aber ich werde den ganzen Vormittag mit der Abnahme vollauf zu tun haben.«
Der Abteilungsleiter stand an einem großen Tisch, und während einer seiner Verkäufer Stück für Stück die Seiden aus der Kiste nahm und vor ihm stapelte, verglich er jeden Posten mit den Angaben auf dem Begleitschein. Um sie herum reihte sich Tisch an Tisch, sämtlich vollgepackt mit Waren, die von einem Heer von Angestellten geprüft wurden. Es war ein allgemeines Auspacken, ein scheinbares Durcheinander von Stoffen, die unter lebhaftem Stimmengewirr hin- und hergewendet, geprüft und schließlich ausgezeichnet wurden.
Bouthemont, der in seinem Fach schon einen gewissen Ruf genoß, hatte ein rundes, gutmütiges Gesicht, einen pechschwarzen Bart und schöne, braune Augen. Er war etwas prahlerisch veranlagt, für den Verkauf nicht sonderlich geeignet, im Einkauf dagegen unbezahlbar. Sein Vater, der in Montpellier ein kleines Modewarengeschäft führte, hatte ihn nach Paris geschickt, damit er etwas Rechtes lerne. Als es ihm aber genug erschienen war und er den Sohn hatte zurückrufen wollen, damit er das väterliche Geschäft übernehme, hatte der junge Mann sich geweigert, Paris zu verlassen. Seither hatte sich die Kluft zwischen Vater und Sohn mehr und mehr vertieft. Der Alte hielt an seinem Kleinhandel fest und war ganz empört, als er sehen mußte, daß ein einfacher Angestellter das Dreifache von dem bekam, was er selbst verdiente. Der Sohn dagegen machte sich lustig über den Betrieb daheim, prahlte mit seinen Errungenschaften und stellte alles auf den Kopf, wenn er zuweilen nach Hause kam. Gleich den übrigen Abteilungsleitern bezog er außer seinen dreitausend Franken Jahresgehalt noch eine Umsatzprovision. Er hatte im Einkauf völlig freie Hand, reiste fast jeden Monat nach Lyon, um bei den Fabriken seine Bestellungen aufzugeben, und mußte nur von Jahr zu Jahr in einem bestimmten Verhältnis den Umsatz seiner Abteilung steigern.
Bourdoncle hatte mittlerweile einen der Stoffe zur Hand genommen, dessen Griffigkeit er mit der Miene des Fachmanns prüfte. Es war eine Seide mit blau-silberner Webkante, das berühmte »Pariser Glück«, mit dem Mouret einen entscheidenden Schlag führen wollte.
»Die Seide ist wirklich sehr gut«, murmelte Bourdoncle.
»Und vor allem wirkungsvoll«, bemerkte Bouthemont. »Bleibt es dabei: wir zeichnen sie mit fünf Franken sechzig aus? Sie wissen, das ist knapp der Einkaufspreis.«
»Ja, fünf Franken sechzig«, erwiderte Mouret lebhaft; »wenn es nach mir allein ginge, würde ich sie mit Verlust weggeben.«
Der Abteilungsleiter lachte laut auf.
»Das wäre mir nur angenehm; sie ginge dann dreimal so schnell weg, und mir liegt ja daran, daß recht viel verkauft wird.«
Bourdoncle hingegen blieb ernst und kniff die Lippen zusammen. Er bezog seine Prozente vom Reingewinn, folglich hatte er kein Interesse an herabgesetzten Preisen. Die Kontrolle, die er übte, war hauptsächlich darauf gerichtet, die Auszeichnung zu überwachen, damit Bouthemont, um seine Umsätze zu vergrößern, nicht mit zu niedrigen Spannen arbeitete.
»Wenn wir sie mit fünf Franken sechzig abgeben, ist es so gut wie mit Verlust verkauft«, bemerkte er, »denn wir dürfen unsere sehr beträchtlichen Unkosten nicht vergessen. Überall sonst würde man sie für sieben Franken verkaufen.«
Mouret wurde ärgerlich, schlug mit der flachen Hand auf die Seide und rief erregt:
»Das weiß ich ja, und deshalb will ich meinen Kunden ein Geschenk damit machen! Mein Lieber, Sie werden die Frauen niemals verstehen. Begreifen Sie denn nicht, daß sie sich um den Stoff reißen werden?«
»Natürlich! Und je mehr sie sich darum reißen, desto größer ist unser Verlust.«
»Wir werden an diesem Artikel einige Centimes verlieren. Was weiter? Ist das ein Unglück, wenn es uns damit gleichzeitig gelingt, alle Frauen anzulocken, ihnen mit unserer Warenmenge die Köpfe so zu verdrehen, daß wir mit ihnen anfangen können, was wir wollen, und sie den Inhalt ihrer Börsen ungezählt bei uns lassen? Die ganze Kunst, mein Lieber, besteht darin, sie Feuer fangen zu lassen, und dazu bedarf es eines Artikels, der ihnen schmeichelt, der Aufsehen erregt. Dann können Sie alles andere so teuer verkaufen wie woanders – sie werden immer glauben, es bei Ihnen billiger zu bekommen. Die ›Goldhaut‹ zum Beispiel, diesen Taft zu sieben Franken fünfzig, der überall zum selben Preis verkauft wird, werden sie ebenfalls für ein besonders günstiges Angebot halten, und das wird genügen, um unseren Verlust am ›Pariser Glück‹ zu decken. Warten Sie nur ab! Ich will, daß das ›Pariser Glück‹ in acht Tagen die ganze Stadt in Aufruhr bringt, verstehen Sie? Es ist das große Los, es wird uns den Sieg sichern und uns zum Erfolg führen. Man wird von nichts anderem als von diesem Stoff reden. Sie sollen sehen, wie das unsere Konkurrenz im Kleinhandel trifft! Begraben lassen können sie sich allesamt, diese Trödler, die in ihren Kellern nach und nach am Zipperlein eingehen!«
Die Angestellten ringsum lächelten und lasen ihm die Worte vom Munde ab. Er hörte sich gern reden und wollte immer recht behalten. Und Bourdoncle gab wieder einmal nach.
»Den Fabriken ist am schlimmsten dabei zumute«, bemerkte nun Bouthemont. »In Lyon ist man wütend auf Sie; die Leute behaupten, daß Ihre niedrigen Preise sie zugrunde richten. Sie wissen, daß Gaujean mir mit aller Entschiedenheit den Krieg erklärt hat. Er will lieber den kleinen Häusern langfristige Kredite gewähren, ehe er meine Preise annimmt.«
Mouret zuckte die Achseln.
»Wenn Gaujean nicht zur Vernunft kommt«, sagte er, »wird er den kürzeren ziehen. Was wollen die Leute denn? Wir bezahlen bar und nehmen alles, was sie produzieren. Da ist es doch das wenigste, zu verlangen, daß sie billiger arbeiten! Im übrigen kommt es darauf an, daß das Publikum zufrieden ist.«
Einen Augenblick sah Mouret noch den Arbeiten zu, dieser Geschäftigkeit beim Auspacken der Waren, die allmählich den Keller fast bis an die Decke füllten; dann entfernte er sich wortlos, mit der Miene eines Feldherrn, der mit seinen Truppen zufrieden ist. Bourdoncle folgte ihm.
Langsam durchschritten sie den Kellerraum; durch die in gleichmäßigen Abständen angebrachten Fenster fiel ein mattes Licht herein; in den dunklen Winkeln, den schmalen Gängen brannten ständig Gasflammen. Im Vorübergehen warf Mouret einen Blick auf die Heizung, die am nächsten Montag zum erstenmal in Betrieb genommen werden sollte. Weiter links, nach der Place Gaillon zu, lagen die Küche und die Speiseräume, ehemalige Keller, die in kleine Säle umgewandelt worden waren. Endlich gelangte er am anderen Ende des Geschosses in den Warenabgang. Hierher kamen alle Pakete, die die Kunden nicht mitgenommen hatten. Sie wurden auf langen Tischen nach Zustellungsbereichen sortiert; über eine breite Treppe, die gerade dem »Vieil Elbeuf« gegenüber mündete, wurden sie dann in Wagen verladen.