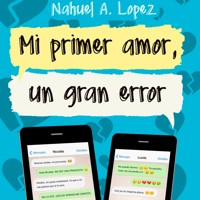15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der Kampf eines indigenen Volkes gegen seine Vernichtung
Nahuel Lopez, der seine Wurzeln in Chile hat, dem Land der Mapuche-Indiander, erzählt Geschichten von Menschen, denen er begegnet ist, bei denen er gewohnt, mit denen er Freundschaft geschlossen hat. Menschen vom Stamm der Mapuche, einem südamerikanischen, vom Aussterben bedrohten Indianer-Volk. Sie kämpfen einen aussichtslosen Kampf gegen eine gnadenlose Gesellschaft, in der für sie kein Platz mehr zu sein scheint. Die Mapuche gehören zu den Ärmsten der Armen, sie haben keine Lobby, keine Waffen, keine Rechte – sie haben nur sich selbst, ihren Glauben und ihren Willen zu überleben. Diesen Menschen will Nahuel Lopez mit diesem Buch eine Stimme geben, den Skandal der Menschenrechtsverletzung publik machen und so einen Funken Hoffnung säen.
- Ein ergreifendes Buch mit einer humanitären Botschaft
- Mit zahlreichen Fotos
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
In den Regionen Bío-Bío und la Araucanía im Süden Chiles lebt die größte ethnische Minderheit des Landes, die indigene Gemeinschaft der Mapuche, die sich selbst als die »ersten Chilenen« bezeichnet. Laut der letzten Volkszählung von 2002 gehören ihr offiziell 604.349 Menschen an, etwa 4 % der Bevölkerung. Die Mapuche selbst gehen aber von einer weitaus größeren Zahl aus, von 900.000 bis 1,4 Millionen. Grund für diese Diskrepanz ist laut Mapuche-Organisationen die Tatsache, dass nur die auf dem Land lebenden Mapuche von der Statistik erfasst werden; die in die Großstädte abgewanderten blieben aber unberücksichtigt.
Das Leben der Mapuche in Chile ist gegenwärtig geprägt von Landraub, Entrechtung und daraus resultierender Gewalt. Angehörige der Minderheit wehren sich gegen die Übernahme ihres Landes durch Konzerne beziehungsweise sie fordern zuvor enteignetes Land zurück, wobei es zum Teil zu Landbesetzungen kommt. Die von aufeinanderfolgenden chilenischen Regierungen vorangetriebene wirtschaftliche Nutzung natürlicher Ressourcen im Gebiet der Mapuche, insbesondere der Wälder, bedroht die Existenzgrundlage der Minderheit.
Diese Auseinandersetzungen bilden die bis dato letzte Phase eines Konfliktes, der bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht, als der chilenische Staat mit militärischer Gewalt das traditionelle Land der Mapuche drastisch reduzierte und an chilenische und ausländische Siedler zur Nutzung übergab. Der damit begonnene Prozess wurde fortgesetzt und erreichte einen neuen Höhepunkt unter der Militärdiktatur und der Herrschaft des Generals Pinochet. Auch nach der Rückkehr Chiles zur Demokratie gab es keine wesentliche Entspannung. Die demokratischen Regierungen hielten ihre in Wahlkämpfen gegebenen Versprechen an die Mapuche nicht, stattdessen entsandten sie immer mehr Polizei in die Region. Widerstand seitens der Mapuche wurde mit den Gesetzen der Pinochet-Zeit verfolgt, die unverändert gültig geblieben sind.
In den vergangenen Jahren fordert der Konflikt immer wieder Menschenleben, vor allem werden junge Mapuche Opfer tödlicher Polizeigewalt. Die Täter werden selten belangt, verhängte Strafen werden meist nachträglich abgemildert oder zur Bewährung ausgesetzt.
Menschenrechtler fordern seit den Tagen der Diktatur, dass die Rechte der Mapuche geschützt, ihre Kultur sowie ihre Traditionen respektiert und sie in wichtige Entscheidungen und Prozesse, die sie und ihre Region betreffen, einbezogen werden, damit ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in Chile möglich wird. Diese Verantwortung lastet auch auf der gegenwärtigen Regierung Chiles.
Tilman Zülch
Gesellschaft für bedrohte Völker e. V. (GfbV)
Prolog
Meine Mutter stammt aus Kiel und träumte schon immer von der großen, weiten Welt. Vor allem träumte sie von fernen Ländern und exotischen Menschen. Ich erinnere mich noch an ihren chinesischen Freund Ping-Hao: ein kleiner Mann mit blauschwarzen Haaren und einer großen Umhängetasche, der sich – jedenfalls meiner kindlichen Erinnerung nach – ausschließlich von Schlangen und Spinnen ernährte. Auch mit einigen Afghanen hatte sich meine Mutter damals angefreundet. Sie machten hypnotisierende Musik mit sonderbaren Zupfinstrumenten und silbernen Trommeln und sangen dazu mit ihren weichen Stimmen. Einer von ihnen unterhielt ein Restaurant in unserer Nachbarschaft. Man hockte dort im Schneidersitz auf bunten Teppichen und aß, und jede Stunde wurde die Arbeit angehalten, wenn sich der Koch und die Kellner gen Mekka ausrichteten und zu beten begannen. Es war ein kleines bisschen Hindukusch am Hamburger Grindel-Viertel.
Zweifellos also fühlte sich meine Mutter zum Exotischen hingezogen. Und da kam mein Vater gerade recht. Er war damals ein chilenischer Halbrevolutionär, mit langen Haaren und einem beeindruckenden Schnauzer, und hatte mit seiner Nickelbrille etwas John-Lennon-haftes an sich. Ein flammender Anhänger Leo Trotzkis, weshalb er in seiner Studentenzeit in Chile nur El Trotzko-Lopez genannt wurde. Über Brasilien war er irgendwann nach München gekommen und anschließend als Philosophiestudent in Hamburg gelandet. In der Freizeit versuchte er sich als Kaffeehausliterat österreichischer Schule mit dicken Büchern, einer Pfeife und literweise Kaffee.
Chilenen waren jedenfalls damals, als meine Eltern sich kennenlernten, Mitte der siebziger Jahre also, schwer angesagt in Deutschland. Es war die Zeit der großen Solidarität: Salvador Allende, der demokratisch gewählte Präsident, war von General Augusto Pinochet mithilfe der CIA gleichermaßen spektakulär wie hinterhältig und brutal gestürzt worden. Und all jene, die das Land verlassen mussten oder nun nicht mehr zurückkonnten, weil sie, wie mein Vater, politisch eine andere Weltsicht vertraten, galten in Deutschland als bewundernswerte Sonderlinge, manchem gar als eine schützenswerte Art. Vor allem bei Studenten standen Chilenen hoch im Kurs, und meine Mutter sah in meinem Vater all ihre Sehnsüchte plötzlich erfüllt.
Als ich auf die Welt kam, bestand meine Mutter darauf, dass ich einen Namen erhalten solle, der auf meine Wurzeln verwies. Mit Wurzeln meinte sie keineswegs die chilenischen, im weiteren Sinne also die spanischen. Und ganz bestimmt auch nicht die deutschen. Sie meinte die Wurzeln meines Ursprungs, also die der Mapuche-Indianer, was zwar jeder Grundlage entbehrte, denn von meiner Familie war keiner Mapuche, aber es machte sich gut. Vielleicht hoffte meine Mutter insgeheim, dass der Name eine abfärbende Wirkung auf mich haben würde und sich das Exotische vielleicht so in meine DNA eingraviert. Jedenfalls wurde nicht versäumt, ob nun von meinen Eltern oder von Bekannten, meist auf chilenischen Solidaritätsfesten, mich über die Bedeutung meines Namens immer wieder aufzuklären. Und zwar in bester linker Tradition, mit pädagogischem Impetus und Verweis auf die raue und ursprüngliche Natur dieses tapferen Volkes. Und wer weiß, es gibt ja Experten, die durchaus behaupten, jeder Name besitze einen eigenen Charakter und würde so den Lebensweg seines Trägers vorherbestimmen. Ich kann das weder bestätigen noch widerlegen. Jedenfalls habe ich an mir bislang nichts auffällig Anderes entdecken können als bei meinen Freunden aus Hamburg, die allesamt Jan hießen oder Philipp oder Daniel und mit denen ich damals sofort den Namen getauscht hätte.
Heute haben sich meine Zweifel am eigenen Namen weitestgehend verzogen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Nahuel, auch wenn der Name nach über dreißig Jahren noch immer seine Tücken mit sich bringt. Noch heute muss ich ihn umständlich buchstabieren, wenn ich mich vorstelle. Und ich weiß natürlich auch schon, was dann wieder kommt: Namel, Nowel, Nahül, Manel, bitte wie noch mal?
»Nahuel«, sage ich dann und erzähle meine kleine Geschichte. Dass der Name von den Mapuche abstammt, einem indianischen Volk in den araukanischen Wäldern. Auf Deutsch »Puma«, für die chilenischen Ureinwohner ein heiliges Tier. Ich ergänzte meine Erzählung dann gerne auch noch um ein paar hübsche Verzierungen, die zwar etwas abenteuerlich daherkamen, die aber auch keiner Prüfung ernsthaft standhalten mussten. Denn wer kennt hier in Deutschland schon die Mapuche?
So jedenfalls war es vor meiner Reise. Ich schummelte mich immer etwas durch damit. Und wenn dann interessierte Nachfragen folgten, fühlte ich mich auch immer ein wenig wie ein Betrüger, für all die kleinen Flunkereien, die ich gerne noch hinterherschickte, um die Geschichte noch mal aufzuhübschen. Es war eben auch zu einfach, mit spontanen Zusätzen die Geschichte zu würzen. Je älter ich aber wurde, desto unbefriedigter ließ es mich selbst zurück. Ich wollte mehr wissen von diesen Menschen, deren Namen ich trug, von den Ureinwohnern des Südens, die auch hierzulande das Interesse weckten, sobald man von ihnen erzählte. Wer waren diese Mapuche? Und was konnten sie uns erzählen?
Vor einigen Jahren las ich Pablo Nerudas wunderbare Memoiren »Ich bekenne, ich habe gelebt«. Gleich auf den ersten Seiten geht es um seine große Liebe zur Natur und zu den Ureinwohnern Araukaniens, die ihn selbst so beeinflusst hatten in seinem Denken und Handeln. Er schreibt von Temuco, seinem Heimatort, von den unzähligen Eisenwarenhandlungen, die es dort gab, und erinnert sich, dass diese eine Art Ersatzbeschilderung verwendeten, die ganz ohne Schriftzeichen auskam. Er berichtet von gewaltigen Blattsägen, riesigen Kochtöpfen, zyklopischen Hängeschlössern, antarktischen Schöpflöffeln und von kolossalen Stiefeln. Diese Art der Beschilderung, so Pablo Neruda, sei in Temuco absolut notwendig gewesen, da die Indios, die dort in großer Zahl lebten, oftmals weder lesen noch schreiben konnten. Die meisten von ihnen waren Analphabeten, denn ihre Kultur kannte keine Verschriftlichung. Neruda beschreibt all das mit einer großen Zuneigung: die Mapuche, der ewige Regen seiner Kindheit, die einzigartige Flora und Fauna dieser Region. »Wer den chilenischen Wald nicht kennt, kennt diesen Planeten nicht.« Das war seine Losung für ein vollkommenes Leben. Was also hielt mich noch auf? Ich musste Nerudas Ruf nach Araukanien folgen.
Ankunft im Paradies
»Das Land, das nie wirklich eines war und doch noch immer existiert, lag nun so sanft und unbekümmert da, als sei der Frieden hier zuhause.«
NAHUEL LOPEZ
Es war einer der frühen Januartage des Jahres 2011, sonnig noch und warm, eine brodelnde Abendluft, als ich zum ersten Mal hier einfuhr. Von einem windigen Autovermieter aus Santiago de Chile hatte ich mir wider besseres Wissen einen silbernen Mietwagen aufschwatzen lassen – einen kleinen Japaner, für derartige Landausflüge gänzlich ungeeignet. Siebenhundert Kilometer waren es bis hierher von der Hauptstadt in den Süden, die berühmte Ruta 5 entlang, die wie ein ewig langer Schnürsenkel aus Asphalt die beiden amerikanischen Kontinente durchzog, von Alaska bis Feuerland, um irgendwann in dieses Meer aus Bäumen einzutauchen, einst die sagenumwobenen Wälder Araukaniens.
Unter mir polterten die Kieselsteine. Umhüllt von einer wilden Wolke aus hellem Sandstaub, die mein »Silberpfeil« um mich herum aufwarf, fuhr ich durch kleine Alleen hindurch, in ein Tal hinein, überquerte einen Fluss, um mich dann wieder schwerfällig hinaufzukämpfen. Schließlich wurden die ersten Häuser sichtbar, gelbe, blaue, grüne und braune Holzhütten, aus deren Schornsteinen dunkler Rauch quoll und sein Aroma von verbranntem und feuchtem Holz über die Ebene legte. Das Land, das nie wirklich eines war und doch noch immer existiert, lag nun so sanft und unbekümmert da, als sei der Frieden hier zuhause.
Vor mir tat sich die Comunidad Ponotro auf, eine von unzähligen kleinen Gemeinden der Mapuche, versprenkelte Relikte einer vergangenen Zeit. Zwei nachtschwarze Augen blitzten aus der sich langsam lichtenden Staubwolke auf, die Augen eines fröhlichen Gesichts auf einem Fahrrad. »Hola Tio!«, rief das kleine Gesicht in seinem Ringelshirt, das in einem Mordstempo, winkend und sich vor Freude beinahe überschlagend, über die Schotterpiste auf mich zuraste, um den Besucher zu begrüßen. Es war Nachito, eines der drei Kinder der Familie, dessen sechstes Mitglied ich von nun an war, wenn man die drei Hunde nicht mitzählte.
Es wurde bereits dunkel, als ich mein Gepäck aus dem Auto kramte. Um mich herum der fünfjährige Nachito, der neugierig jede meiner Taschen nach interessanten Mitbringseln untersuchte und staunte und staunte und nicht einmal genug Wörter für all die Fragen zu kennen schien, die aus ihm rauspurzelten. Mit dabei waren der kleine Alén und Tochter Millaray, die älteste der drei Geschwister. Vater Jaime, ein kleiner und stämmiger Mapuche-Mann mit flusigem Bart und einem Che-Guevara-Gesicht, stand neben seiner Frau Angelica, lächelte mir freundlich zu und beobachtete mit Seelenruhe das große Treiben rund um den Ankömmling. Ein eisiger Wind kratzte jetzt über das Land hinweg. Es roch nach Meer und frischen Blüten. Ich atmete ein – so tief, wie es nur ging, und über mir leuchtete der Himmel der Araucanía, ein Becken irisierender Kristalle. Und wenn es nicht so kitschig wäre und so unendlich falsch, dann könnte man fast sagen, es war wie die Ankunft im Paradies.
Natürlich war ich nicht der erste Besucher hier in diesem abseitigen Fleckchen Erde am Pazifischen Ozean. Seitdem die Spanier vor etwa fünfhundert Jahren als erste Fremde ins Reich der Mapuche eingedrungen waren, übte das Leben der Menschen hier eine exotische Faszination aus auf Abenteuerhungrige von Übersee. Vor allem Europäer waren hier immer wieder auf der Suche gewesen nach Reinheit, Echtheit, nach so etwas wie Glück. Gerade hier bei uns gab es ein ausgeprägtes Abenteurertum und eine sonderbar esoterische Sehnsucht nach dem ursprünglichen und unverdorbenen Naturmenschen, diese Bewunderung für den edlen Wilden. Der spanische Dichter Alonso de Ercilla y Zúñiga hatte die Ureinwohner Araukaniens in seinem berühmten Werk La Araucana vor fünfhundert Jahren so getauft, ein Begriff, der später von den Romantikern, vor allem aber auch von Jean-Jacques Rousseau geprägt und auf abenteuerliche Weise idealisiert wurde.
Eines der wohl bizarrsten Kapitel dieses uns sehr eigenen Abenteurerdrangs ist wohl das um den Franzosen Orélie-Antoine de Tounens, oder wie er sich später nannte: Orélie-Antoine I., durch Gottes Gnaden und den Willen der Indianer des Südens des amerikanischen Kontinents, König von Araukanien und Patagonien. Thronfolger und Herr dieses seinerzeit von Orélie-Antoine begründeten Hauses Araukanien und Patagonien ist heute sein Nachfahre, Philipp Boiry Raynaud, selbsternannter Prinz Philipp I.
Orélie-Antoine de Tounens jedenfalls war mindestens skurril, wenn nicht gar vollkommen verrückt. Mit Anfang zwanzig begann er zunächst eine Karriere als Prokurist beim Arbeitsgericht im französischen Périgueux. Seine eigentliche Leidenschaft aber waren die Abenteuerbücher jener Jahre, Reiseberichte aus fernen Ländern und von wilden Menschen, denen er in Gedanken nachgereist war und sich der Illusion hingab, eines Tages die hispanoamerikanischen Republiken auf dem Kontinent unter dem Dach eines Königreichs zu vereinen. Seines Königreichs natürlich. Seit seiner Kindheit hatte er davon schon geträumt und dieses Ziel seither auch nie mehr aus den Augen gelassen.
1858 landete der damals 33-jährige de Tounens nach mehrwöchiger Überfahrt mit einem Schiff tatsächlich im Norden Chiles. Von Coquimbo aus verschlug es den Franzosen zunächst nach Valparaíso, wo er Spanisch lernte und seine exzentrischen Pläne verfeinerte. 1860 erreichte er mit ein paar wenigen Gefolgsleuten die Araucanía, ein zu jener Zeit schwer umkämpftes Gebiet, das Land der Mapuche.
Es war die letzte Phase der »Guerra de Arauco«, dem Krieg zwischen den Mapuche und den chilenischen Independentistas, den Unabhängigkeitskämpfern, die sich von der spanischen Krone losgesagt hatten und nun aus dem zerfurchten Land ein ganzes machen wollten. Die Unabhängigkeitskämpfer beherrschten damals bereits das Gebiet von der Atacama-Wüste bis zum Bío Bío-Fluss, dessen Verlauf von den Anden bis zum Pazifik die natürliche Grenze darstellte, auf die sich die Spanier mit den Mapuche nach über dreihundert Jahren des Blutvergießens geeinigt hatten. Doch die Chilenen erkannten diese Grenze nicht an. Auch der restliche Teil des Landes, der seit jeher den Mapuche gehörte, sollte nun chilenisches Territorium sein. Daran hatte sich diese letzte und vielleicht blutrünstigste Etappe in der langen Reihe schwerer Auseinandersetzungen mit den Ureinwohnern hier entzündet. Auseinandersetzungen, die ihnen bis heute den Nimbus der Unbesiegbarkeit verleihen und ihren Ruf als ein Volk von Kriegern und Kämpfern zementierten.
Orélie-Antoine de Tounens jedenfalls witterte hier seine historische Chance. Er reiste in die Araucanía, einem Gebiet, das damals für Wingkas, wie die Mapuche alle Fremden noch heute nennen, eigentlich unzugänglich war. Dies hätte den sicheren Tod der Abenteurer bedeuten können. Doch de Tounens gewann das Vertrauen der Mapuche. Und er freundete sich mit einem Lonco an, mit Quilapán, dem Häuptling einer der vielen Comunidades, die zusammengenommen das Volk der Mapuche bilden.
Vielleicht war es ja de Tounens bizarres Äußeres, der lange und lockige Bart und die schulterlangen schwarzen Haare, oder dieser etwas wirre Blick, der ihn für die Mapuche unverdächtig machte. Vielleicht war es auch die Tracht der Mapuche, die er zu tragen pflegte, immer in einen schweren Poncho gewickelt und mit einem Trailonco um die Stirn. Möglicherweise war es aber auch diese unverrückbare Überzeugung, die ihm innewohnte, hier, weitab seiner Heimat, seine eigene Bestimmung zu finden. Quilapán jedenfalls schien von de Tounens Vorhaben überzeugt, eine konstitutionelle Monarchie mit ihm zu begründen, einen eigenen Staat, um sein Volk gegen die Aggressoren aus dem Norden zu verteidigen.
Wie genau die Krönungszeremonie schließlich ablief, und ob die dem Zeremoniell beiwohnenden Mapuche auch wussten, was genau da vor sich ging, das lässt sich nicht rekonstruieren. Ein absurdes Unterfangen war es allemal. Die Mapuche als Ganzes gab es eigentlich nicht, sie standen nie unter der Führung eines Einzelnen. Das Volk war ein aus unzähligen Stämmen zusammengestückeltes Geflecht, aufgeteilt in autonome Comunidades, in Gemeinden, die wiederum aus wenigen Großfamilien bestanden mit dem Lonko, dem Stammesführer, als Oberhaupt und verschiedenen spirituellen Autoritäten.
Orélie-Antoine de Tounens aber wähnte sich am Ziel seiner Träume. Via Zeitungsanzeige verkündete er seinen Anspruch auf den neu geschaffenen Thron und auf ein Gebiet, das sich seiner Ansicht nach vom Pazifik bis zum Atlantischen Ozean erstreckte, und von Rio Negro bis hinunter zur Magellanstraße reichte. Eine Fläche etwa doppelt so groß wie das heutige Deutschland. Neben der Zeitungsannonce verfasste de Tounens dann auch noch einen Brief an den Kanzler der chilenischen Republik und erklärte darin feierlich seine Herrschaft. Vielleicht war de Tounens doch noch nicht ganz so übergeschnappt, wie mancher Historiker ihn an diesem Punkt der Geschichte zeichnet. Immerhin wollte der exzentrische Abenteurer damals auch den französischen Botschafter für sein Vorhaben auf seine Seite ziehen, was ihm eine gewisse Sicherheit garantiert hätte, sollte sich die chilenische Regierung mit seinem Anspruch auf den Thron doch nicht arrangieren können. Der aber hatte kein Interesse, in dieses sonderbare Vorhaben seines Landsmannes mit hineingezogen zu werden, und erklärte de Tounens kurzerhand für dement.
1862 nahmen die chilenischen Truppen den Abenteurer fest. Sie hatten genug vom merkwürdigen Störenfried, der ihre territorialen Vorhaben zu durchkreuzen suchte. De Tounens wurde der Prozess gemacht, zunächst wanderte er ins Gefängnis nach Angol, schließlich verlegte man ihn in die Irrenanstalt nach Santiago. Zu jener Zeit hätte dies eigentlich den sicheren Tod bedeutet, wäre ihm nicht in letzter Minute doch noch der französische Botschafter zu Hilfe geeilt und hätte seine Abschiebung nach Frankreich erwirkt. De Tounens war dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen.
Aber so leicht ließ er sich nicht abschütteln. Nur sieben Jahre später schon war Orélie-Antoine de Tounens zurück in der Araucanía. Doch das Land, was er nun vorfand, war ein anderes. Die Mapuche-Gebiete unterhalb des Rio Bío Bío waren von den chilenischen Truppen eingenommen. Die nächste Etappe der Kolonisierung hatte begonnen. Die Mapuche konnten den chilenischen Truppen nicht mehr wirklich etwas entgegensetzen. Mit Speeren, Steinschleudern und Pferden war gegen die Feuerkraft dieser hochmodernen Armee einfach nichts zu machen. Coronel Cornelio Saavedra Rodriguez, der oberste Befehlshaber dieser blutrünstigen Operation, die noch heute euphemistisch »la Pacificación de la Araucanía« genannt wird, die »Befriedung Araukaniens«, als ginge es hier darum, Chile von den furchterregenden Indianern zu befreien, leistete in diesen wenigen Jahren ganze Arbeit: Es war der stabsmäßig organisierte Genozid am Volk der Mapuche. Schätzungsweise 300.000 Ureinwohner kamen damals ums Leben, ein Ereignis, das sich bis heute eingebrannt hat in die DNA dieser Menschen.
Und in diese aufgeladene Atmosphäre platzte also unser König wieder hinein. Oberst Saavedra hatte nun ganz andere Sorgen. Als er erfuhr, dass Orélie-Antoine de Tounens seine schrägen Phantasien noch immer nicht aufgeben wollte und sich erneut hier befand, da setzte Saavedra ein Kopfgeld auf den armen Irren aus. De Tounens, so hatte es sich Saavedra geschworen, sollte ein für alle Mal verschwinden.
Der selbsternannte König ahnte, dass die Stunde geschlagen hatte. Auf die erneute Hilfe seines Botschafters konnte er nicht hoffen. Und die Mapuche selbst waren an diesem Punkt der Ereignisse längst zu schwach und ihre Gebiete zu durchsetzt von den chilenischen Truppen, als dass de Tounens hier noch hätte Sicherheit finden können. Er beschloss also, sein Abenteuer an dieser Stelle abzubrechen – und floh. Zunächst nach Buenos Aires, von dort aus mit dem Schiff zurück nach Frankreich.
Sein Lebenstraum bestand zwar fort. Weitere zwei Male noch macht er sich noch auf den Weg über den Atlantik, doch Argentinien ließ ihn nicht wieder einreisen, man zwang ihn jedes Mal zur Rückkehr. Die Mapuche sah er nie wieder.
Seine letzten Jahre verbrachte de Tounens als einsamer »König im Exil«. In einem kleinen Pariser Apartment installierte er seine hoheitliche Residenz und verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Adelstiteln. Offiziell anerkannt wurde sein Königreich nie. Doch noch heute kann man in der Dordogne, im Südwesten Frankreichs, auf seinem gut gepflegten Grabstein folgende Inschrift lesen: Hier ruht Tounens Orélie-Antoine I., König von Araukanien und Patagonien. Das Land der Mapuche blieb bis zuletzt sein großer Traum vom Paradies.
Jaime und seine Familie – vom Versuch, ein Mapuche zu bleiben
»Wenn der Geist im Gleichgewicht ist, geht es auch dem Körper gut.«
JAIME
Drei Wochen hatte er mich ignoriert. Drei Wochen, in denen er mich keines Blickes würdigte, in denen er auf keinen meiner Versuche einging, mit ihm Freundschaft zu schließen. Da half kein Lachen, da halfen auch keine Süßigkeiten und derlei hilflose Bestechungsversuche eines Erwachsenen, sich in das Herz des Kindes hineinzuschleichen. Ich war für ihn wie Luft. Da war einfach nichts zu machen. Drei ganze Wochen lang.
Dann plötzlich nahm er meine Hand, führte mich hinaus und zeigte auf das dicke Schwein, das mitten auf dem Feld stand und uns anstarrte, als sei gerade eben ein Blitz vor ihm eingeschlagen. Djiii, sagte er, oder so ähnlich und reckte seine wurstigen Fingerchen in Richtung Schwein. Sprechen konnte er noch nicht, aber dieses Djiii sagte trotzdem alles. Von einem Tag auf den anderen hatte Alén, dieser eigenwillige kleine Mann, für sich beschlossen, dass er mich nun akzeptieren würde hier in seiner Welt. Ich war ein Eindringling für ihn, der zunächst erst mal beobachtet werden musste. Und das ging eben nicht von jetzt auf gleich. Nicht bei Alén. Nach drei Wochen jedenfalls hatte ich seine kritische Begutachtung überstanden und seither wich er nicht mehr von meiner Seite.
Alén war gerade mal zwei Jahre alt. Er war das kleinste Mitglied der Familie, und eindeutig auch der Dickköpfigste von allen. Angelica konnte mit ihrem Sohn richtige Machtkämpfe austragen. Wenn er etwas nicht wollte, dann kniff er seine nachtschwarzen Augen zusammen, lief rot an, stampfte mit seinen winzigen Beinchen auf den Boden und verweigerte sich jeglicher Kooperation. Er war noch kein laufender Meter und hatte schon den Charakter eines Löwen. Tagelang konnte er einem die Freundschaft verweigern, wenn es ihm gerade nicht in den Kram passte, was man gesagt oder getan hatte. Der Grund dafür war nicht immer auszumachen. Davor waren selbst seine Eltern nicht gefeit. Seine Geschwister, und vor allem Nachito, der Mittlere, amüsierten sich gerne über ihren kleinen Bruder, was Alén dann wiederum nur noch wütender machte, bis dieser wie ein alter grummeliger Greis aus der Haut fuhr und seinem Bruder mit einem Kochlöffel, oder was er sonst gerade zur Hand hatte, eins über den Latz zog. Nein, mit Alén war nicht gut Kirschen essen. Er ließ sich einfach nichts gefallen. Von seinem älteren Bruder schon mal gar nicht.
Meist war aber schon nach zwei Minuten wieder alles beruhigt. Jaime zeigte in solchen Momenten liebevolle Strenge, redete seinem Sohn zart ins Gewissen, was es denn auszusetzen gebe an diesem oder jenem, und erklärte ihm geduldig, dass seine Wut auf die anderen überhaupt nicht notwendig sei. Trotz einer gewissen Verstimmung sah Alén es dann auch ein, was ihm sein Vater da erzählte. Der kleine Alén war kein Tyrann, auch wenn sich seine Verstimmungen, wie gesagt, über Tage noch dahinziehen konnten. Er war einfach ein liebevolles Kerlchen mit einem eigensinnigen Kopf. Jeder wusste, wie er Alén zu nehmen hatte. Und Jaime stellte, in solchen wutschnaubenden Momenten seines Sohnes, hinter vorgehaltener Hand, aber mit väterlichem Stolz, amüsiert fest, dass Alén jenes seiner drei Kinder sei, das das wildeste Blut abbekommen habe. Er sei eben ein echter Mapuche. Und als er das Wort Mapuche aussprach, leuchtete Jaimes großes und freundliches Che-Guevara-Gesicht noch mal ganz besonders auf.
Millaray war neben den beiden draufgängerischen Brüdern die ausgleichende Dritte. Sie war die Älteste und somit auch diejenige, die Verantwortung zu tragen hatte für die kleineren Geschwister. Wenn Angelica vormittags auf dem Feld arbeitete oder mal das Haus für mehrere Tage verlassen musste, um etwa ihre Eltern zu besuchen, die in einer anderen Comunidad drei Busstunden entfernt lebten, übernahm Millaray die Rolle der Hausfrau.
Als Angelica vor einigen Monaten mit dem Leben rang, wurde Millaray die Verantwortung für ihre Brüder zuteil. Angelica hatte eine Lebererkrankung, dünn und dünner war sie geworden, keiner wusste genau, was mit ihr los war. Sie gingen zu einer Machi, die spirituelle Autorität in der Comunidad, und sie suchten auch den nächsten Arzt im öffentlichen Krankenhaus auf. Eine Situation völliger Unsicherheit für die gesamte Familie. Eine Krankenversicherung hatten sie nicht. Sie hatten auch keinerlei Einkommen, durch das sie diese hätten bezahlen können. An Geld mangelte es ständig. Selbst für das Allernötigste war meist nichts da. Sie hatten keinen Strom, obwohl der Staat irgendwann überirdische Leitungen in die Comunidad verlegt hatte. Doch leisten konnte sich den Strom hier eigentlich keiner. Meist waren selbst die dringendsten Lebensmittel nicht erschwinglich, die neben dem Selbstangebauten benötigt wurden. Strom und Krankenversicherung waren purer Luxus.
Sie waren also auf die ärztliche Grundversorgung angewiesen. Diese aber ist in Chile so unzureichend und schlecht, dass nicht wenige unbehandelt an ihren Krankheiten sterben, bevor diese überhaupt diagnostiziert worden sind. Die Krankenhäuser, vor allem in ländlichen Regionen, sind völlig veraltet, die Ärzte und Krankenschwestern überlastet. Von der Metropole Santiago scheinen diese Landstriche hier so weit entfernt, wie Sibirien von Deutschland. In diesen Monaten der Krankheit also, die für die Familie ein Hoffen und Bangen mit dem Schicksal war, hatte Milla den Platz ihrer Mutter eingenommen. Sie kochte in diesen Wochen das Essen für ihre Geschwister, holte sie morgens aus dem Bett und las ihnen abends Geschichten zum Einschlafen vor. Sie wickelte den kleinen Alén und beruhigte Nachito, wenn diesen wieder die Angst einholte, die Mutter könne vielleicht nie wiederkehren.
Sie war ja selbst noch ein Kind von gerade mal acht Jahren. Aber sie wusste, dass es nun auch auf sie ankommen würde, ganz besonders auf sie, denn Jaime musste sich um die Landarbeit kümmern, um die Tiere, um das Auskommen. »Ich musste stark sein«, sagte sie irgendwann zu mir. »Ich wollte stark sein. Für meine Mutter. Ich wusste, dass ich ihr so zumindest etwas helfen kann.« Ein paar Tränen kullerten über ihr mondrundes Gesicht, als sie das sagte. »Ich habe seitdem immer Angst, dass sie sterben könnte und wir alleine bleiben.« Sie erschrak, als sie das sagte, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und bat mich darum, das für mich zu behalten. »Sie sollen nicht denken, dass ich schwach bin.« Es war, als spräche aus ihr die Erfahrung eines Menschen, der weit mehr erlebt hatte, als in ein Kinderleben eigentlich hineinpasste. Ein Mensch, der die Folgen eines solchen Verlustes rational durchdenken konnte. Der stark sein musste. Stärker als andere. Denn für sie, für die Mapuche, als Teil der Ärmsten in Chile, in einem Land, in dem das Sozialsystem so durchlässig ist wie ein Schweizer Käse und die Diskriminierung noch so dauerhaft präsent, wie die Bergspitzen der Anden, für diese Menschen war Schwäche reine Lebensgefahr. Angelica war noch immer gezeichnet von ihrer Krankheit, als ich zu ihnen kam. Es war die Pankrea, wie sich später herausstellte, ihre Bauchspeicheldrüse war angegriffen. Genaueres hatten die Ärzte auch nach einem Jahr noch nicht sagen können. Doch der Satz ihrer Tochter, »Ich habe seitdem immer Angst, dass sie sterben könnte und wir alleine bleiben«, fing die ganze Brüchigkeit dieser Situation hier ein, in der sie tagtäglich lebten.
Frau Professor nannten sie Millaray scherzhaft. Sie war bereits in der zweiten Klasse und ihre große Leidenschaft war das Lesen. Sie konnte ganze Nächte hindurch heimlich mit einer Kerze im Bett verbringen. Nicht selten mussten die Eltern mitten in der Nacht noch einmal nachsehen, ob Milla auch tatsächlich schlief, damit sie am nächsten Morgen rechtzeitig zur Schule kam.
Ihr Lieblingsbuch war ein Klassiker: »Der letzte Mohikaner« von James Fenimore Cooper in einer Kinderversion. Sie hatte es schon einige Male durchgelesen, aber die Geschichte faszinierte sie noch immer. Ich ertappte sie irgendwann an einem Baum hockend, tief in das Buch vergraben. Als sie mich kommen hörte, blickte sie auf, lächelte und bat mich, neben sich Platz zu nehmen. »Kennst du das Buch?«, fragte sie. »Das ist unsere Geschichte«, sagte sie. Und aus ihrem Munde klang das nicht wie ein Klischee, sie meinte es tatsächlich so. Der Mohikaner war ihr Held dieser Tage. Sie sah ihr eigenes Schicksal in diesen berühmten Indianern aus Nordamerika gespiegelt. Die Tragödie des Untergangs einer uralten Kultur, mindergeschätzt und letztlich zerstört von den weißen Invasoren in ihrer Gier nach Land und Profit.