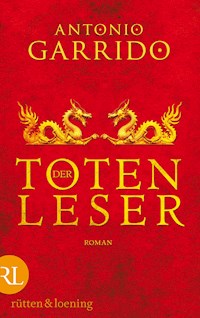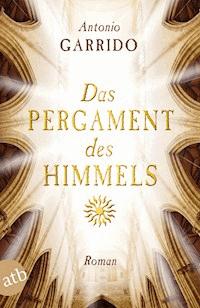
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal des Abendlandes.
Die junge Byzantinerin Theresa will Pergamentmacherin werden - ein Unding in der Würzburger Zunft des Jahres 799. Ihr Aufbegehren löst eine Katatrophe aus und mit knapper Not entkommt sie nach Fulda. Dort verwickelt sie der strenge Kirchenmann Alkuin von York, Ratgeber Karls des Großen, immer tiefer in die mörderischen Intrigen um eine gefälschte Urkunde. Von diesem Dokument hängt nicht weniger als die Herrschaft über das Abendland ab ...
"Ein farbenprächtiges Tableau." NRZ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 819
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Das Schicksal des Abendlandes
Die junge Byzantinerin Theresa will Pergamentmacherin werden – ein Unding in der Würzburger Zunft des Jahres 799. Ihr Aufbegehren löst eine Katatrophe aus, und mit knapper Not entkommt sie nach Fulda. Dort verwickelt sie der strenge Kirchenmann Alkuin von York, Ratgeber Karls des Großen, immer tiefer in die mörderischen Intrigen um eine gefälschte Urkunde. Von diesem Dokument hängt nicht weniger als die Herrschaft über das Abendland ab.
»Ein farbenprächtiges Tableau.« NRZ
Antonio Garrido
Das Pergament des Himmels
Roman
Aus dem Spanischen von Anja Lutter
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
II
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
III
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
IV
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
V
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
VI
Kapitel 30
Epilog
Alles ist ein Roman
Über Antonio Garrido
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Zu Würzburg, Franken.
Im Jahr unseres Herrn Jesus Christus799.
Und der Teufel kam und blieb.
»Ich weiß nicht, wozu ich noch schreibe: Gestern ist Theresa gestorben, und vielleicht werde ich ihr bald nachfolgen. Heute haben wir nichts gegessen. Was ich im Skriptorium bekomme, reicht kaum für uns. Alles ist wüst und öd. Die Stadt stirbt.«
Gorgias legte die Wachstafel auf den Boden und streckte sich auf der blanken Pritsche aus. Er betete für die Seele seiner Tochter. Bevor er in den Schlaf sank, dachte er an die schrecklichen Tage, die der Hungersnot vorangegangen waren.
I
1
An Allerheiligen wollte es in Würzburg nicht hell werden. Die Tagelöhner auf den Feldern deuteten besorgt zum Himmel, der sich dunkel blähte wie der Leib einer trächtigen Kuh. Die Hunde, die das Unheil witterten, heulten, und kurz darauf ging ein solcher Sturzregen auf die Erde nieder, dass selbst die bedächtigsten Bauern zitternd das Ende der Welt nahe wähnten.
Theresa lag fröstelnd in einem unruhigen Halbschlaf, geängstigt von dem grimmigen Trommeln bedrohlich lauten Hagels, der das Hüttendach aus Weidengeflecht in Stücke zu schlagen drohte, und versuchte den Moment des Aufstehens hinauszuzögern. Ihr war bewusst, dass sie sich beeilen musste, wollte sie nicht am wichtigsten Tag ihres Lebens zu spät in der Werkstatt sein. Warum nur lief ihr bei dem Gedanken an die Prüfung, die sie so sehr herbeigesehnt hatte, ein Schauer über den Rücken? Ein Schauer, der nichts mit dem Unwetter zu tun hatte.
Erst eine Woche zuvor hatte der Pergamentermeister Korne ihren Wunsch, die Gesellenprüfung abzulegen, aufs Schärfste zurückgewiesen. Er tobte und donnerte, so etwas habe es bei den pergamentarii noch niemals gegeben, eine Frau, die Geselle werden wolle, und als sie ihn daran erinnerte, dass die festgesetzten zwei Jahre, nach deren Ablauf jeder Lehrling die Aufnahme in das Handwerk fordern konnte, verstrichen waren, regte er sich umso mehr auf.
»Jeder Lehrling, der einen schweren Pergamentballen heben kann«, hatte er verächtlich geschnaubt.
Gestern nun war Korne am Ende des Tages in der Werkstatt erschienen und hatte sie mürrisch davon in Kenntnis gesetzt, dass er ihrer Bitte entsprechen wolle und die Prüfung unverzüglich stattfinden werde.
Dieser plötzliche Sinneswandel machte Theresa misstrauisch, und trotz ihrer Freude über die Nachricht hörte sie nicht auf, darüber zu grübeln, was Korne wohl zu diesem Umschwung bewogen haben mochte. Der Prüfung selbst fühlte sie sich durchaus gewachsen: Sie konnte ein Pergament aus Lammhaut von einem Ziegenvelin unterscheiden, sie straffte und spannte die feuchten Häute besser als der Meister selbst, und sie verstand es, Spuren von Pfeilen und Bissen in einer Weise zu tilgen, dass die Tierhäute danach so weiß und rein leuchteten wie das Hinterteil eines Neugeborenen. Und das war es schließlich, worauf es ankam.
Als Theresa endlich den schäbigen Fellüberwurf zurückschlug, spürte sie, wie bitterkalt es über Nacht geworden war. Sie richtete sich auf und tastete im Dunkeln nach der verschlissenen Decke, die wie ein Vorhang ihre Pritsche von der ihrer Eltern trennte. Sie nahm sie ab, wickelte sich darin ein und schlang sich ein Stück Seil um die Taille. Dann schlich sie sich leise hinaus. Nachdem sie im Hof, zitternd vor Kälte und nur von einem schmalen Dachüberhang vor dem Hagel geschützt, ihre Notdurft verrichtet hatte, wusch sie sich mit einer Handvoll Wasser und lief über einen Teppich aus eichelgroßen, eisigen Körnern zurück ins Haus. Drinnen zündete sie ein rußiges Öllämpchen an und kauerte sich auf die große, eisenbeschlagene Truhe. Das Licht erhellte nur schwach den niedrigen rechteckigen Raum, in dessen Mitte in einer im Boden ausgehobenen Mulde sich kleine bläuliche Flammen mühten, ein wenig Wärme zu verströmen. Es war der einzige Raum des Hauses, in ihm musste die ganze Familie Platz finden.
Die Kälte und die Nässe schmerzten Theresa, und als das Feuer endgültig zu verglimmen drohte, warf sie vorsichtig ein wenig Torf hinein und stocherte mit einem Stock in der Glut. Mit klammen Fingern griff sie nach einem Topf und machte sich daran, die angebrannten Grützereste vom Vorabend herauszuschaben, als sie in ihrem Rücken eine Stimme hörte.
»Darf man fragen, was zum Teufel du hier treibst? Schnell wieder ins Bett mit dir.«
Theresa wandte sich um und blickte ihren Vater entschuldigend an. Sie hatte ihn nicht wecken wollen.
»Es ist wegen der Prüfung. Ich kann nicht schlafen«, erklärte sie mit gedämpfter Stimme.
Gorgias reckte sich, brummte etwas vor sich hin und trat an die Herdstelle. Der Schein der Flammen, die, von Theresas Unruhe angesteckt, aufgeregt durcheinander tanzten, erhellte sein knochiges Gesicht unter dem zerzausten grauen Haarschopf. Er setzte sich neben Theresa und legte ihr den Arm um die Schultern.
»Es ist nicht die Prüfung, meine liebe Tochter. Es ist diese elende Kälte, die uns noch alle ins Grab bringen wird«, flüsterte er, während er ihr die Hände rieb. »Und lass doch diese trockene Grütze, die würden ja die Ratten nicht mehr anrühren. Rutgarda wird schon etwas zum Frühstück für uns finden. Aber du solltest diese Decke nachts wirklich lieber zum Zudecken benutzen, statt sie da mitten ins Zimmer zu hängen. Du brauchst vor uns doch nicht so schamhaft zu sein.«
»Aber das tue ich nicht aus Scham, Vater«, widersprach Theresa. »Ich hänge die Decke auf, damit ich Euch nicht störe, wenn ich noch lese.«
»Es ist mir gleich, warum du das machst. Eines Morgens wirst du starr wie ein Eiszapfen hier liegen, und dann spielt der Grund auch keine Rolle mehr.«
Theresa lächelte und schabte weiter Grützereste aus dem Topf. Sie hielt sie ihrem Vater hin, der sie gierig hinunterschlang, während er ihr zuhörte.
»Aber es ist wirklich nicht die Kälte, Vater. Gestern, als Korne einwilligte, mir die Prüfung abzunehmen, da hat er mich so seltsam angesehen. Ich weiß nicht … Sein Blick hatte etwas Furchteinflößendes.«
Gorgias strich seiner Tochter zärtlich über das Haar, das im flackernden Licht des Feuers schimmerte wie schwarzblaue Tinte, und beteuerte, dass alles gut gehen würde.
»Du kennst dich doch mit Pergamenten besser aus als der alte Korne selbst. Der ärgert sich nur, dass seine Söhne nach zehn Jahren in seinem Handwerk immer noch nicht die Haut eines Esels von einer Handschrift des heiligen Augustinus unterscheiden können. Nachher wird er dir ein paar Bogen zum Binden geben, du wirst es vortrefflich hinbekommen und die erste Pergamentergesellin im Frankenreich werden. Ob es Korne nun gefällt oder nicht.«
»Ich weiß nicht, Vater … Er wird nicht zulassen wollen, dass eine frischgebackene …«
»Und was tut es schon, wenn er nicht will? Korne mag Pergamentermeister sein, aber die Werkstatt gehört immer noch Wilfred, und vergiss nicht, dass auch er dabei sein wird.«
»Wollen wir es hoffen!«, sagte Theresa und stand auf.
Langsam sickerte ein wenig graues Morgenlicht durch den groben Holzladen vor dem einzigen Fensterloch. Auch Gorgias erhob sich, streckte und dehnte sich noch einmal wie eine Katze.
»Also gut. Warte, ich trockne nur schnell meine Griffel, dann begleite ich dich bis zur Werkstatt. Bei diesem Unwetter lasse ich dich nicht allein durch die Stadt spazieren.«
Während Gorgias sein Schreibzeug zusammenpackte, schob Theresa den schweren Riegel vor der Eingangstür zurück, öffnete sie einen Spaltbreit und blickte durch einen wild wogenden grauen Vorhang aus Regen und Eis auf die zerbrechlich wirkenden Dächer der Unterstadt. Im Schutze der Stadtmauern drängten sich die armseligen kleinen Holzhütten aneinander wie zu magere, nasse Schafe, die sich gegenseitig das Stück Boden streitig machten, mit dem sie sich begnügen mussten, während in der Oberstadt die befestigten Bauten stolz wie das Vieh des Fürsten die Straßen und Plätze schmückten.
»Beim heiligen Erzengel Gabriel!«, rief Gorgias aus, als habe er das Unwetter völlig vergessen. »Endlich kommt dein neues Kleid einmal zu Ehren!«
Theresa musste trotz ihrer Verzagtheit lächeln. Vor einigen Monaten hatte der Vater ihr ein wunderschönes Kleid geschenkt, tiefblau wie der Himmel in einer Sommernacht, das zu ihrem rabenschwarzen Haar passte, über das sich manch aschblonde Fränkin den Mund schon zerrissen hatte. Das Kleid hatte sie zu ihrem achtzehnten Geburtstag bekommen, aber sorgsam für eine besondere Gelegenheit aufbewahrt.
Bevor sie, beide in grobgewebte Umhänge gehüllt, aus dem Haus gingen, trat sie an den Strohsack, auf dem ihre Stiefmutter schlief, und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Wünscht mir Glück«, flüsterte sie ihr ins Ohr.
Rutgarda brummte etwas und nickte. Doch als die Tür hinter den beiden zugefallen war, betete sie, dass Theresa die Prüfung nicht bestehen möge.
Vater und Tochter stiegen, so zügig es ging, den morastigen Weg zur Schmiede an der Ecke hinauf, wobei sich Gorgias trotz des peitschenden Regens in der Mitte der Straße hielt, denn in den dunklen Winkeln konnte sich alles mögliche Schurkenpack verbergen. In der Rechten trug er eine unnütz gewordene Fackel, den linken Arm hatte er Theresa um die Schultern gelegt und sie so noch zusätzlich mit in seinen Umhang gehüllt.
Sie waren schon bis zur Bogenstraße gekommen, als Theresa einfiel, dass sie ihre Wachstafeln vergessen hatte.
»Lauft weiter, Vater. Ich bin gleich zurück.«
Erschrocken wollte Gorgias sie aufhalten, doch schon war seine Tochter in der Menge der Bauern verschwunden, die ihr wie nasses Vieh entgegendrängten. Viele der kleinen Gassen hatten sich bereits in Sturzbäche verwandelt, Holzscheite, kaputte Körbe, tote Hühner und ein Bündel von Lumpen rauschten an Theresa vorbei. In der Gerberpassage kletterte sie über einen Wagen, der quer zwischen zwei überfluteten Häusern eingekeilt war, und rannte die Alte Straße hinab. Als sie atemlos an der Rückseite ihres Häuschens ankam, überraschte sie einen Gassenjungen, der eben den Fensterladen aufbrechen wollte. Diese dreckige kleine Ratte! Wütend versetzte sie ihm einen tüchtigen Stoß, doch der Bursche dachte nicht daran, das Weite zu suchen, sondern lief geradewegs zum Nachbarhaus hinüber und stieg dort ein. Theresa schickte ihm einen Fluch hinterher, machte sich hastig an der Tür zu schaffen und betrat ihr Zuhause, das tapfer dem Unwetter standhielt. Ihre Stiefmutter war nirgends zu sehen. Zielstrebig steuerte sie auf die Truhe zu, kurz ruhte ihr Blick auf der smaragdgrün eingebundenen Bibel, die ihrem Vater so am Herzen lag; dann suchte sie ihre Schreibutensilien und die Wachstafeln heraus. Sie bekreuzigte sich, verstaute alles unter ihrem Umhang und eilte, so schnell die übelriechenden, gurgelnden Wasserbäche es erlaubten, zu der Stelle zurück, wo ihr Vater immer noch besorgt und vor Kälte zitternd stand und auf sie wartete.
Gemeinsam stiegen sie weiter bergan in Richtung Domplatz. Zahlreiche Gassen waren bereits überschwemmt, ganze Hausdächer segelten durch die Luft wie im Herbst das trockene Laub. Und plötzlich ergossen sich die schmutzigen Wassermassen in gewaltigem Schwall in die Unterstadt und verschlangen im Nu fast das ganze Labyrinth aus armseligen Hütten und Häusern. Die Verwüstung war ungeheuerlich.
Und doch gab dies alles Theresa nicht einmal eine annähernde Vorstellung davon, welche Schrecken die nächsten Tage bringen sollten. Trotz der Gebete, die alle ohne Unterlass gen Himmel schickten, verwandelte der unaufhörlich peitschende Regen die Felder innerhalb kürzester Zeit in schlammige Tümpel. Es setzte starker Schneefall ein, der Main gefror und schloss die kleinen Fischerboote in sich ein. Die Wege, die Würzburg mit Frankfurt verbanden, wurden unpassierbar, die Stadt war von der Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Waren vollständig abgeschnitten. Der nicht mehr weichende Frost machte die Reste der eingeholten Ernte zunichte, und das letzte Vieh krepierte elendiglich. Als nach und nach die Vorräte zur Neige gingen und der Hunger um sich griff wie eine Epidemie, sah sich mancher Bauer gezwungen, sein Land zu verschleudern. Wer sonst nichts hatte, musste seine eigene Familie verkaufen.
Von den Unvernünftigen, die den Schutz der Stadtmauern verließen und in die Wälder flohen, hörte man nie wieder etwas.
Mit einem Mal war jeder Gang durch Würzburgs Gassen zu einem Alptraum geworden – überall lauerte die Gefahr, unter den Trümmern einstürzender Gebäude begraben zu werden. Die Menschen schlossen sich in ihren Häusern ein und warteten auf ein Wunder; nur ein paar vorwitzige Kinder trafen sich heimlich weiter bei den Müllhaufen vor den Toren der Stadt, um die eine oder andere Ratte zu fangen, aus der sich später ein trauriger Braten zubereiten ließ. Voller Stolz schwangen die kleinen Helden ihre Beute, wenn sie nach Hause zu ihren hungrigen Familien zurückkehrten.
Binnen kürzester Zeit säumten Leichen die Straßen der Innenstadt. Die ersten Toten hatte man noch auf dem kleinen Friedhof bei der Holzkirche der heiligen Adela bestattet, doch bald fanden sich keine freiwilligen Totengräber mehr, und die Kadaver lagen überall verstreut in den Gassen. Trotz der Kälte schwollen manche Leichname an wie Kröten, meist aber wurden sie vorher von den Ratten zernagt. Während die Mütter sich verzweifelt mühten, etwas Essbares aufzutreiben, um mehr als nur ein wenig heißes Wasser auf den Tisch zu bringen, wurden viele Kinder vor Schwäche krank. Nach kaum zwei Wochen war die ganze Stadt vom Gestank nach Tod und Verwesung durchdrungen, und die Domglocken untermalten das gespenstische Bild mit düsterem Klang.
Schon in den Wochen vor Allerheiligen hatte die Natur verrückt gespielt, und große Teile der Wintervorräte waren in der allgegenwärtigen Nässe verdorben. Lediglich in der alten Zitadelle, die sich Wilfred der Krüppel als gräfliche Residenz eingerichtet hatte, verfügte man noch über ausreichend Obst und Gemüse aus den Gärten hinter den Festungsmauern. Zudem wurden im Innenhof Vieh und Geflügel gehalten, so dass karge Gemüsekost durch Käse und Eier ergänzt werden konnte. Und was den Weizen betraf, so versprach die von Wilfred verhängte Rationierung eine hinlängliche Versorgung für die wenigen Begünstigten, ohne dass die Vorräte allzu schnell zur Neige gehen würden.
Graf Wilfred ließ es nicht unberührt, mit ansehen zu müssen, wie die übrigen Würzburger hungerten und darbten, während seine Leute mit dem Nötigsten versorgt waren; doch er fügte sich ergeben den Plänen des Allmächtigen, denn er wusste, dass solches Unglück die Vergeltung für schwere Sünde war. Das hatte er am eigenen Leibe erfahren müssen, als er vor etlichen Jahren in den Bergen von einem Steinschlag überrascht worden war. Der Fels hatte ihn unter sich begraben, und als es seinen Dienern endlich gelang, ihn zu befreien, waren seine Beine schon vom Brand befallen und mussten ihm abgenommen werden. Er erkannte damals, dass dieses Unglück ihm vom Herrn gesandt worden war, und ließ sich in der Kirche, die sein Vater in der Festung hatte errichten lassen, zum Priester weihen. Erst als er das Erbe der Grafschaft antrat, ließ er die kirchliche Arbeit ruhen und widmete sich fortan der Regierung seines Landes.
Um die Hungersnot einzudämmen, befahl Wilfred, Weizen an all diejenigen zu verteilen, die sich besonders verdient gemacht hatten. Außerdem schob er die Einziehung des Zehnten auf und befreite die Pachtbauern von der Fronarbeit, die sie als Gegenleistung für die Nutzung seines Bodens zu verrichten hatten. Doch vermochten all diese Maßnahmen nur wenigen Menschen über die argen Zeiten hinwegzuhelfen.
Zu Theresas Glück fiel von dem Wohlstand der Festung auch für die Bediensteten in den Werkstätten der Diözese etwas ab. Als Vergütung für ihre harte Arbeit bei den Pergamentherstellern erhielt sie einen Scheffel Weizen in der Woche, eine Ration, mit der sich die größte Not der Familie in diesen schlimmen Wochen überbrücken ließ. Es gab nur wenige Frauen, die in den Werkstätten beschäftigt waren, die meisten Mägde der Grafschaft waren entweder zur Erbauung der Männer vorgesehen oder leisteten ihren Dienst in der Küche.
Als Lehrling bei den Pergamentarii hatte es Theresa wahrlich nicht leicht. Ständig musste sie sich schamlose Blicke, Bemerkungen über die Größe ihrer Brüste oder gar zudringliche Berührungen gefallen lassen. Andererseits, so empfand sie es, wurde sie für all diese Ärgernisse hundertfach entschädigt, in den kostbaren Augenblicken zur letzten Stunde nämlich, da sie endlich mit den Pergamenten allein in der Werkstatt zurückblieb. Dann legte sie die frisch aus dem Skriptorium eingetroffenen Bogen übereinander, doch anstatt die Lagen gleich zusammenzunähen, vertiefte sie sich mit glühenden Wangen in die Lektüre. Die Psalmbücher und Schriften der Kirchenväter und selbst die heidnischen Codices, die sie fieberhaft verschlang, entlohnten sie für die harte Arbeit am Tage und schürten in ihr den Gedanken, ihr könnte dereinst womöglich anderes im Leben vergönnt sein als Brot zu backen und Kessel zu schrubben.
Theresas Vater Gorgias, Schreiber im gräflichen Skriptorium, hatte sich sehr für die Aufnahme seiner Tochter eingesetzt, nachdem der unglückliche Ferdinand, der vor ihr dort Lehrling gewesen war, sich in einem unachtsamen Moment an einer Hand sämtliche Sehnen durchtrennt und damit seine Zukunft zerstört hatte. Der Pergamentermeister Korne hatte Gorgias’ Mühen von Anfang an zu hintertreiben versucht und wurde nicht müde, gegen den unbeständigen Charakter des Weibes zu wettern. Er führte die natürliche Neigung der Frau zu Streit und Klatsch sowie ihre monatlichen Blutungen an und erklärte, sie sei darüber hinaus nicht in der Lage, mit den schweren Ballen zu hantieren. Kurzum – Weiblichkeit war seiner Ansicht nach unvereinbar mit einer Arbeit, die Wissen und Geschicklichkeit gleichermaßen erforderte. Allerdings beherrschte Theresa das Lesen ebenso wie das Schreiben – Fertigkeiten von unzweifelhaftem Wert an einem Ort, wo Muskeln im Überfluss vorhanden waren, an Talent jedoch arger Mangel bestand. Und so wurde sie denn, wenn auch erst dank der Vermittlung des Grafen, zu guter Letzt als Lehrling aufgenommen.
Als Rutgarda diese Nachricht zu Ohren gekommen war, hatte sie sich fürchterlich aufgeregt. Ja, wenn das Mädchen geistig zurückgeblieben wäre oder krank, dann hätte sie diesen Entschluss womöglich verstanden. Doch Theresa war eine sehr ansehnliche junge Frau, vielleicht etwas zu schlank für den Geschmack der fränkischen Burschen, aber mit starken Hüften und üppiger Brust, ganz zu schweigen von ihrem Gebiss, das lückenlos und strahlend weiß war wie bei kaum einer sonst. Jedes andere Mädchen an ihrer Stelle würde sich einen guten Ehemann suchen, der sie schwängerte und für sie sorgte. Aber nein: Theresa musste ihre Jugend verschwenden, indem sie sich in einer alten Pfaffenwerkstatt vergrub, wo sie sich irgendeinem unnützen Schreibkram hingab und das Gerede zu ertragen hatte, dem die Frauen dort ausgesetzt waren. Und das Ärgerlichste an der ganzen Sache: Rutgarda war davon überzeugt, dass keinen anderen als Gorgias die Schuld an dieser Misere traf. Das Mädchen war den aberwitzigen Vorstellungen ihres Vaters erlegen, der immer nur in der Vergangenheit lebte, seiner geliebten Heimat Byzanz nachtrauerte und vom Nutzen des Wissens und der Größe der alten Dichter faselte, als würde er von diesen Weisen auch nur einen Teller Bohnen geschenkt bekommen. Die Jahre würden vergehen, und eines Tages würde die Kleine plötzlich feststellen, dass ihr Fleisch welk und ihr Mund zahnlos war, und dann würde sie es bitter bereuen, dass sie sich keinen Mann gesucht hatte, der sie ernährte und beschützte.
Doch als mit jenem Winter das schreckliche Unheil über Würzburg kam, musste Rutgarda anerkennen, dass der Weizen, den Theresa zusätzlich zu der mageren Ration ihres Vaters heimbrachte, sie immerhin mit halbwegs vollem Magen zu Bett gehen ließ.
Als Theresa und Gorgias sich bis zur Höhe des Aussichtspunktes durchgekämpft hatten, kam ihnen eine Gruppe von Wachsoldaten entgegen, die in Richtung Stadtmauer hinabmarschierten. Kurz darauf hatten Vater und Tochter das Schlimmste überstanden, sie bogen in die Ritterstraße ein und liefen weiter zum Domplatz. Der Regen ließ für einen Moment nach, als wollte er die Häuser der Reichen hier oben schonen. Sie gingen um die Kirche herum, und schon tauchte hinter dem Baptisterium das Werkstattgebäude auf, ein niedriger, breiter Holzbau, in dessen Fensterhöhlen bereits ein flackerndes Licht zu sehen war. Der Regen verwandelte sich langsam in nassen Schnee.
Nur noch wenige Schritte trennten sie vom Eingang, als sich plötzlich ein Schatten aus der Dunkelheit löste und auf sie zustürzte. Gorgias reagierte überraschend schnell, doch es gelang ihm nur noch, Theresa von sich wegzustoßen. Schon blitzte ein Messer auf, die Fackel, die als Waffe hätte dienen können, fiel herunter und rollte unaufhaltsam die Straße hinab. Theresa sprang zurück und schrie auf, als ihr Vater und der Angreifer, ineinander verkeilt, zu Boden gingen. Verzweifelt rannte sie los, um in der Werkstatt Hilfe zu holen, erreichte die Tür und hämmerte auf sie ein. Sie spürte, wie ihr die Haut an den Fingerknöcheln aufplatzte, doch sie schrie und hämmerte weiter gegen die Tür. Hinter sich hörte sie das Keuchen der beiden Männer, die um ihr Leben rangen. Mit all ihrer Kraft schlug sie auf die verfluchte Tür ein, doch niemand antwortete. Hätte sie gekonnt, sie hätte sie eingeschlagen und denjenigen, der das Licht angezündet hatte, aus dem Haus gezerrt. Außer sich vor Zorn und Angst, wandte sie sich um und lief zurück, nun aus vollem Halse um Hilfe schreiend. Da hörte sie die erstickte Stimme ihres Vaters, der ihr japsend zurief, sie solle sich in Sicherheit bringen.
Doch Theresa blieb stehen, sie wusste nicht, was sie tun sollte. Plötzlich kamen die beiden verbissen miteinander ringenden Körper ins Rollen und stürzten über die Böschung. Theresa fielen die Soldaten ein, denen sie kurz zuvor begegnet waren, und in der Hoffnung, sie einzuholen, rannte sie wieder die Straße hinunter. Bevor sie den Aussichtspunkt erreichte, hielt sie jedoch abermals inne. Würde sie den Trupp schnell genug finden und die Männer überzeugen können, mit ihr zu kommen? Entschlossen packte sie sich einen schweren Stein, der am Wegesrand lag, und machte kehrt. Schon von weitem sah sie zwei Gestalten, die sich über einen seltsam verkrümmt daliegenden Mann beugten. Als sie näher kam, erkannte sie Korne und einen seiner Söhne, die sich mühten, den reglosen Körper ihres Vaters anzuheben.
»Um Gottes willen, Theresa!«, rief Korne. »Lauf schnell und sag meiner Frau, sie soll einen Kessel Wasser aufsetzen. Dein Vater ist schwer verletzt.«
Theresa ließ den Steinbrocken fallen, rannte strauchelnd die Anhöhe hinauf zur Wohnung des Pergamentarius und schrie aus Leibeskräften nach Kornes Frau. Früher war hier ein Lager für die Werkstatt untergebracht gewesen, doch im vergangenen Jahr hatte Korne es zum Wohnraum ausgebaut. Seine beleibte Frau erschien verschlafen mit einem Kienspan in der Hand am Fenster.
»Bei allen Heiligen! Was ist denn das für ein Geschrei?«, rief sie hinunter und bekreuzigte sich.
»Mein Vater! Schnell, bei der Liebe Gottes!«, flehte Theresa verzweifelt und drückte die Tür auf.
Die Frau verschwand im Haus und polterte stolpernd die Treppe herunter, wobei sie sich den eilig übergeworfenen Umhang zuhielt, der ihre Blöße nur notdürftig bedeckte. Sie war gerade unten am Treppenabsatz angekommen, als Korne von der Werkstatt her nach ihr rief.
»Das Wasser, Frau, hast du es noch nicht fertig?«, wetterte er. »Und Licht. Wir brauchen mehr Licht.«
Theresa lief ihnen in die Werkstatt nach und wühlte fieberhaft in dem Durcheinander von Werkzeugen, die auf den Arbeitstischen verteilt lagen. Sie fand ein paar Öllampen, doch sie waren leer. Schließlich entdeckte sie unter allen möglichen Resten zwei Kerzen. Eine rollte unter den schweren Arbeitstisch und verschwand im Halbdunkel. Theresa griff nach der anderen und beeilte sich, sie anzuzünden. Inzwischen hatten Korne und sein Sohn die Tierhäute von einem der anderen Tische geschafft, um Gorgias darauf zu betten. Der Pergamentarius wies Theresa an, die Wunden zu säubern, aus denen permanent dunkles Blut sickerte, während er selbst ein paar Messer zusammensuchte, doch das Mädchen schien ihn nicht zu hören. Mit der Kerze in der Hand stand sie bei ihrem Vater und starrte entsetzt auf die klaffende Verletzung an seinem Handgelenk. Niemals zuvor hatte sie eine solche Wunde gesehen! Das Blut sprudelte regelrecht hervor, durchtränkte Kleidung, Tierhäute und Codices, und Theresa war wie gelähmt. Gorgias durfte nicht sterben! Einer von Kornes riesigen Kötern kam herangetappt und begann das Blut aufzulecken, das auf den Boden tropfte, doch in dem Augenblick kehrte sein Herr zurück und vertrieb den Hund mit einem Fußtritt.
»Leuchte mal hier«, befahl er.
Theresa hielt die Flamme an die bezeichnete Stelle. Der Pergamentermeister riss eine Haut von einem der Rahmen herunter und breitete sie auf dem Boden aus. Mit Hilfe eines Messers und einer hölzernen Latte schnitt er die Haut in Streifen und knotete die Enden zusammen.
»Zieh ihm die Sachen aus«, herrschte er Theresa an. »Und du, Frau, bring mir endlich das Wasser!«
»Herr im Himmel! Was ist denn bloß geschehen?«, rief seine Frau erschrocken aus. »Seid Ihr verletzt?«
»Hör auf herumzuschwatzen und bring endlich den verdammten Topf«, fluchte Korne und schlug mit der Faust auf den Tisch.
Theresa hatte begonnen, ihren Vater zu entkleiden, doch Bertharda, Kornes Frau, schob sie beiseite und zog ihm die Kleider vom Leib, bis er ganz nackt war. Dann wusch sie ihn sorgfältig mit einem Rest von der Tierhaut und dem frisch erhitzten Wasser. Korne prüfte eingehend die Verletzungen und stellte mehrere Schnitte am Rücken und einige weitere an der Schulter fest. Am meisten Sorge bereitete ihm jedoch die tiefe Wunde am rechten Arm.
»Drück mal hier drauf«, sagte Korne, während er Gorgias’ Arm hochhielt.
Theresa gehorchte, ohne auf das Blut zu achten, das auf ihr Kleid troff.
»Los, Junge«, sagte der Pergamentmacher zu seinem Sohn. »Lauf zur Festung und hol den Chirurgen. Sag ihm, es ist dringend.«
Obwohl es draußen mittlerweile heftig zu schneien begonnen hatte, rannte der Junge los, und Korne wandte sich Theresa zu.
»Und jetzt pass auf: Wenn ich es dir sage, beugst du seinen Ellbogen und drückst ihm dann den Arm gegen die Brust. Hast du das verstanden?«
Theresa nickte, ohne den Blick von ihrem Vater abzuwenden. Tränen strömten ihr über die Wangen.
Der Pergamentarius band den Ledergurt oberhalb der Wunde um den Arm und wickelte ihn mehrmals darum, bevor er ihn fest zuzog. Kurz schien es, als würde Gorgias das Bewusstsein wiedererlangen, doch es war nur ein Krampf. Wenigstens war es Korne gelungen, die Blutung zu stillen. Er machte Theresa ein Zeichen, und sie beugte Gorgias’ Ellbogen, wie der Meister sie geheißen hatte.
»Gut. Das Wichtigste haben wir geschafft. Die anderen Wunden scheinen weniger tief zu sein, man wird allerdings abwarten müssen, was der Chirurg sagt. Dein Vater hat wohl auch ein paar heftige Schläge abbekommen, aber wie es aussieht, sind die Knochen alle an ihrem Platz. Wir wollen ihn zudecken, damit er nicht auskühlt.«
In dem Augenblick begann Gorgias stark zu husten und zu würgen. Sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz. Unter halbgeöffneten Lidern sah er Theresa einen Moment an, ehe er sie erkannte.
»Dem Himmel sei Dank«, stieß er stockend hervor. »Geht es dir gut, meine Tochter?«
»Ja, Vater«, schluchzte sie. »Ich wollte die Soldaten zu Hilfe holen und bin losgelaufen, sie zu suchen, aber ich habe sie nicht mehr eingeholt und dann, als ich zurückkam …«
Theresa brachte den Satz nicht zu Ende, ihre Stimme erstickte in Tränen. Gorgias nahm mühsam mit der Linken ihre Hand, zog sie zu sich und schaute sie begütigend an. Er wollte etwas sagen, doch er musste wieder husten und verlor erneut das Bewusstsein.
»Komm, er muss sich jetzt ausruhen«, sagte Bertharda und fasste Theresa behutsam am Arm. »Und hör auf zu weinen, das hilft auch niemandem weiter.«
Theresa nickte. Kurz dachte sie daran, Rutgarda Bescheid zu geben, doch sie verwarf den Gedanken. Sie wollte die Werkstatt aufräumen, solange sie auf den Chirurgen warteten. Und wenn sie dann wüsste, wie schwer die Verletzungen tatsächlich waren, würde sie der Stiefmutter sagen, was geschehen war. Unterdessen nahm Korne eine Schale mit Öl zur Hand und beeilte sich, die Lampen aufzufüllen.
Im Schein der entzündeten Lämpchen glich der große, vollgestopfte Raum einer von vielen Fackeln erleuchteten Höhle. Theresa machte sich wie betäubt daran, das Durcheinander aus Nadeln, Messern, Hämmern, Pergamenten und Leimtiegeln aufzuräumen, die zwischen den Tischen und Rahmen herumlagen. Sie sortierte die Werkzeuge wie gewohnt nach ihrer Funktion und legte, nachdem sie sie sorgfältig gereinigt hatte, jedes an seinen Platz. Dann wandte sie sich ihrer Werkbank zu, um zu prüfen, ob die Platte sauber und noch genügend Talk und Politur vorhanden waren. Schließlich trat sie wieder zu ihrem Vater.
Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis Zenon, der Chirurg, eintraf, ein schmutziges und zerzaustes kleines Männlein, das einen starken Geruch nach Schweiß und billigem Wein verströmte. Er trug einen großen Sack über der Schulter und wirkte so verschlafen, als habe man ihn direkt aus dem Bett geholt. Ohne Gruß betrat der Mann die Werkstatt, schaute sich rasch um und wandte sich gleich dem Tisch zu, auf dem Gorgias lag und stoßweise atmete. Er öffnete seinen Sack und packte eine kleine metallene Säge, mehrere Messer sowie ein kleines Lederbeutelchen aus, dem er einige Nadeln und eine Rolle Faden entnahm. Der Wundarzt legte die Instrumente auf Gorgias’ Bauch und bat um etwas mehr Licht. Dann spuckte er sich mehrmals in die Hände, rieb an dem angetrockneten Blut an seinen Fingernägeln herum und packte mit festem Griff die Säge. Theresa erbleichte, als der schmächtige Mann das Werkzeug dem Ellbogen ihres Vaters näherte, doch zum Glück sägte er nur Kornes improvisierte Aderklemme auf. Das Blut begann wieder zu fließen, was Zenon ungerührt geschehen ließ.
»Gute Arbeit, obwohl ein wenig zu fest zugezogen«, sagte er. »Habt Ihr noch mehr Lederstreifen?«
Korne reichte ihm ein langes Stück, der Chirurg griff danach, ohne den Blick von Gorgias zu wenden. Geschickt band er den Arm ab und machte sich mit einer Unbekümmertheit daran zu schaffen, als ginge es darum, eine Gans zu füllen.
»Jeden Tag dasselbe«, brummte er, den Kopf über die Wunde gebeugt. »Gestern haben sie der alten Bertha den Bauch aufgeschlitzt, in der Unteren Straße. Und vor zwei Tagen hat man Sidericus, den Böttcher, gefunden, den Schädel hatten sie ihm an der Hoftür eingeschlagen. Und wofür? Weiß der Himmel, was sie bei dem armen Teufel gesucht haben, er konnte ja kaum seine eigenen Kinder ernähren.«
Zenon schien etwas von seinem Handwerk zu verstehen. Er flickte Haut und Muskeln mit dem Geschick einer Näherin zusammen, wobei er zwischendurch immer wieder auf das Messer spuckte, um es sauber zu halten. Als er mit dem Arm fertig war, kamen die übrigen Wunden an die Reihe, die er mit einer dunklen Salbe aus einem Holztiegel bestrich. Zum Schluss verband er den Arm mit ein paar Leintuchfetzen, welche er ungeachtet der Flecke, die darauf prangten, für frisch gewaschen erklärte.
»So«, sagte er und wischte sich die Hände am Brustlatz ab. »Das wär’s. Ein wenig Schonung und Pflege, und in ein paar Tagen …«
Theresa, die sich im Hintergrund gehalten hatte, während der Chirurg sich an ihrem Vater zu schaffen machte, unterbrach ihn.
»Wird er wieder gesund werden?«
»Kann schon sein … Kann aber auch nicht sein.«
Er lachte schallend. Dann langte er in seinen Sack und brachte einen Flakon mit einer dunklen Flüssigkeit zum Vorschein. Theresa nahm an, es handele sich um eine Art Tonikum, doch der Arzt entkorkte das Gefäß und genehmigte sich einen tiefen Schluck.
»Beim heiligen Pankratius! Dieser Trank erweckt Tote wieder zum Leben. Willst du auch?«, sagte der kleine Mann und hielt Theresa die Flasche unter die Nase.
Sie schüttelte den Kopf. Da hielt der Chirurg sein Elixier mit einem Achselzucken Korne hin, der dankend zugriff und einen großzügigen Schluck nahm.
»Messerstiche sind wie Kinder: Zustande kommen sie alle auf die gleiche Weise, aber um zu sehen, was am Ende dabei herauskommt, heißt es Geduld aufbringen«, meinte der Arzt munter. »Ob er wieder gesund wird oder stirbt, liegt nicht in meiner Hand. Der Arm ist gut genäht, aber die Wunde ist tief, und vielleicht haben die Sehnen etwas abbekommen. Wenn er sich völlig schont und in einer Woche keine Pusteln und Abszesse auftreten, kommt er vielleicht durch. Hier, nimm das«, sagte er und zog einen kleinen Leinenbeutel aus seinem Rock. »Trag ihm viermal täglich von diesem Pulver auf, und die Wunde sollte möglichst nicht gewaschen werden.«
Theresa nickte.
»Was mein Honorar angeht …«, sagte das murkelige Männlein und gab Theresa einen Klaps auf den Hintern, »sei unbesorgt, das wird Graf Wilfred schon erledigen.« Wieder lachte er schallend, während er seine Siebensachen zusammenpackte.
Theresa errötete vor Zorn. Sie hasste es, wenn Männer sich derartige Freiheiten herausnahmen, und hätte Zenon nicht soeben ihren Vater behandelt, Gott weiß, ob sie ihm nicht mit der eigenen Weinflasche geradewegs eins über seinen dummen Schädel gegeben hätte. Doch bevor sie sich empören konnte, hatte der Chirurg bereits die Hand an der Tür und verließ trotz der grimmigen Kälte fröhlich pfeifend das Haus.
Unterdessen war Bertharda in die Wohnung hinaufgestiegen und mit ein paar Schmalzkuchen zurückgekehrt.
»Ich habe auch einen für deinen Vater mitgebracht«, meinte sie lächelnd.
»Ich danke Euch. Gestern haben wir kaum ein Schälchen Grütze gehabt«, seufzte Theresa. »Wisst Ihr, mit dem Essen langt es einfach vorne und hinten nicht mehr. Meine Mutter sagt, wir müssen uns glücklich schätzen, dabei steht sie kaum noch aus dem Bett auf, so schwach ist sie.«
»So geht es uns doch allen, Mädchen«, erwiderte die Frau. »Lägen Wilfred die Bücher nicht so am Herzen, hätten wir heute überhaupt nichts zu beißen als unsere Fingernägel.«
Theresa nahm ein Küchlein und biss so vorsichtig hinein, als fürchtete sie, ihm weh zu tun. Dann nahm sie einen größeren Bissen und ließ sich genussvoll die Süße von Milch und Zimt auf der Zunge zergehen. Gierig machte sie sich über den nächsten Happen her und fuhr sich mit der Zunge über die Mundwinkel, um nicht den kleinsten Krümel zu verschenken. Dann verstaute sie das restliche Stück in einer Tasche ihres Kleides, um es später ihrer Mutter zu bringen. Sie schämte sich ein wenig, dass sie diese köstliche Wonne genoss, während ihr Vater ohnmächtig auf dem Tisch lag, doch der Hunger war stärker als alle Gewissensbisse. Wie tröstlich konnte der Geschmack von warmem Fett sein! Da hörte sie ein Husten und wandte sich rasch um.
Ihr Vater war aufgewacht. Theresa stürzte zu ihm hin, sie wollte ihn daran hindern aufzustehen, doch Gorgias ließ sich nicht abhalten. In größter Unruhe blickte er um sich, als suchte er etwas. Korne hatte ihn beobachtet und kam herbeigeeilt.
»Meine Tasche! Wo ist meine Tasche?«
»Beruhigt Euch, Gorgias. Eure Tasche ist hier«, sagte Korne und deutete auf den Beutel, der achtlos neben der Tür lag.
Gorgias wälzte sich umständlich vom Tisch und humpelte mühsam zur Tür. Als er sich zu seiner Tasche hinunterbückte, fuhr ihm ein jäher Schmerz durch die Glieder; er hielt inne, knurrte, dann öffnete er den Beutel und sah hinein. Mit dem gesunden Arm wühlte er fieberhaft zwischen seinen Schreibgeräten herum und fluchte; immer wieder schaute er sich suchend um. Außer sich vor Ärger schüttete er die Tasche aus. Tintenverschmierte Federkiele und Griffel ergossen sich über den Fußboden.
»Wer hat es genommen? Wo ist es?«, schrie er.
»Wo ist was?«, fragte Korne.
Gorgias warf ihm einen zornigen Blick zu, doch dann biss er sich auf die Zunge und wandte den Kopf ab. Wieder und wieder kramte er in seinem Beutel, stülpte ihn von innen nach außen, bis er einsehen musste, dass wirklich nichts mehr darin war. Langsam richtete er sich auf, schleppte sich zu einem Hocker und ließ sich darauffallen. Er schloss die Augen und brabbelte etwas vor sich hin. Es sah so aus, als betete er leise für seine Seele.
*
2
Am späten Vormittag holten die Stimmen der jungen Burschen, die befangen an ihren Tischen arbeiteten und ab und zu dem Verletzten auf seinem Notlager verstohlene Blicke zuwarfen, Gorgias in die Welt der Lebenden zurück. Die ganze Zeit hatte er stumm dagelegen, mit leerem Blick vor sich hin gestarrt und kaum registriert, wenn Korne zu ihm sprach oder Theresa seine Wange streichelte. Doch nun nahm sein Gesicht nach und nach wieder klarere Züge an, einen Moment noch schaute er ein wenig verwirrt drein und hob dann den Kopf, um Korne zu sich zu rufen. Der Pergamentarius zeigte sich erfreut, dass es dem Kranken besser zu gehen schien, doch als Gorgias sich nach dem Mann erkundigte, der ihn überfallen hatte, verfinsterte sich Kornes Miene, und er erklärte barsch, sich an keine Einzelheiten zu erinnern.
»Als wir Euch zu Hilfe kamen, hatte der Kerl jedenfalls schon das Weite gesucht.«
Gorgias verzog das Gesicht und fluchte leise vor sich hin. Dann stand er mühsam auf und begann wie ein gefangenes Tier in der Werkstatt auf und ab zu laufen. Er versuchte sich das Gesicht seines Angreifers ins Gedächtnis zu rufen, doch sosehr er sich anstrengte, es wollte ihm nicht gelingen. Es war zu dunkel gewesen, und der Überfall war so unerwartet gekommen, dass er den Schurken nicht erkannt hatte. Schließlich entschied Gorgias, es sei das Beste, sich ins Skriptorium zurückzuziehen und dort in Ruhe nachzudenken.
Nachdem Gorgias in den Schnee hinausgehumpelt war, legten die Arbeiter ihre Befangenheit ab, und bald kehrte wieder die gewohnte Betriebsamkeit ein. Die Lehrjungen streuten Erde auf die Blutflecke am Boden und säuberten den Tisch, während die Gesellen über die Unordnung schimpften. Theresa sprach ein kurzes Gebet für die Genesung ihres Vaters und widmete sich dann gewissenhaft ihren Aufgaben. Als erstes räumte sie den Unrat vom Vortag weg und sortierte die unbrauchbaren Lederreste aus, um sie in die Abfalltonne zu geben, wo sie dann so lange vor sich hin rotteten, bis die Tonne voll war. Zu ihrem Pech quoll das Fass bereits über, sie musste also den stinkenden Inhalt in die Tonkrüge umfüllen, in denen das Leder eingeweicht wurde; nach dem Weichen wurde es dann zerstampft und gekocht, um so den Leim herzustellen, den die Gesellen später als Klebstoff verwendeten. Es kostete sie jedes Mal eine gehörige Überwindung, diese unangenehme Arbeit zu erledigen, doch tapfer biss sie die Zähne zusammen. Als sie fertig war, legte sie sich zum Schutz gegen die unaufhörlich fallenden Flocken einen Sack über und trat hinaus in den baufälligen Innenhof, wo unter freiem Himmel die Becken lagen, in denen die abgezogenen Tierhäute geschnitten, enthaart und geschabt wurden.
Sie schaute sich um.
Die tiefen quadratischen Bassins, sieben an der Zahl, waren um den Brunnen in der Mitte so angeordnet, dass die abgezogenen Felle leicht von einem ins andere geschafft werden konnten, wo sie entsprechend behandelt wurden. Theresa betrachtete die milchigen Häute, die auf der Wasseroberfläche trieben wie abgezehrte Kadaver. Sie verabscheute den beißenden Gestank, den dieser Ort verströmte.
Einmal, als sie unter einer starken Erkältung litt, hatte sie Korne gebeten, er möge ihr ein paar Tage freigeben, da die Feuchtigkeit und die Ätzmittel in den Bassins Gift für ihre Lungen waren, doch sie hatte nur eine kräftige Ohrfeige und verächtliches Gelächter geerntet. Niemals mehr hatte sie danach protestiert. Sie hatte ihr Kleid gerafft, so tief eingeatmet, wie es eben ging, und war mit angehaltenem Atem in die Becken gestiegen, um die klebrigen, ineinander verschlungenen Klumpen umzurühren.
Sie stand da und schaute angewidert auf die Bassins, als jemand von hinten an sie herantrat.
»Ekelst du dich immer noch? Oder meinst du vielleicht, für die Nase einer Pergamentergesellin sei das nichts?«
Theresa wandte sich um und sah Korne hämisch grinsen. Nur zwei faulige Zähne waren ihm geblieben, hässlich blitzten sie vor dem Dunkel seines Rachens auf. Er stank nach Weihrauch wie üblich, denn er verwendete ihn überreichlich, um seinen eigenen ranzigen Geruch zu überdecken. Im Grunde hätte sie Korne gerne erklärt, was sie beschäftigte, doch sie nahm sich zusammen und senkte den Kopf. Sie würde nicht mehr auf seine Provokationen hereinfallen. Und wenn er nach einem Vorwand suchte, um sie zu entlassen, würde er sich anstrengen müssen.
»Nun, wie auch immer«, fuhr der Pergamentmacher überraschend sanft fort, »ich wollte dir sagen, dass ich sehr gut verstehe, wie du dich fühlen musst: dein Vater verletzt … du beunruhigt und völlig durcheinander … natürlich, das verstehe ich vollkommen. Sicherlich nicht der rechte Augenblick, um dich einer so bedeutenden Prüfung zu unterziehen. Darum also und weil ich deinen Vater sehr schätze, bin ich bereit, die Prüfung um eine angemessene Frist aufzuschieben.«
Theresa atmete erleichtert auf. Es stimmte, das Bild ihres blutüberströmt daliegenden Vaters ging ihr nicht aus dem Kopf, die Hände zitterten ihr, und wenngleich sie sich trotz allem für die Prüfung gewappnet fühlte – es würde ihr helfen, wenn sie erst einmal wieder richtig zu sich kommen konnte.
»Ich bringe nur ungern die Planung durcheinander, aber ich danke Euch sehr für Euer Angebot. Ein paar Tage Aufschub wären sicher günstig …«
»Ein paar Tage? Nein, nein«, feixte Krone. Plötzlich hatte seine Stimme nichts Sanftes mehr. »Der Aufschub der Prüfung würde bedeuten, dass du bis zum nächsten Jahr warten musst. So ist es vorgesehen, und das weißt du nur zu gut. Aber in deinem Zustand … Schau dich doch an: du zitterst, bist ganz verstört … Zweifellos wird es das Beste sein, das Ganze zu verschieben.«
Lauernd blickte er sie an.
Theresa musste widerstrebend einsehen, dass Korne recht hatte. Wenn ein Kandidat auf die Prüfung verzichtete, konnte er nicht vor Jahresfrist erneut antreten. Für einen kurzen Moment hatte sie geglaubt, der Meister würde angesichts der Umstände eine Ausnahme machen. Wie töricht sie war!
»Also?«, drängte der Pergamentarius.
Theresa war unschlüssig. Ihre Hände waren schweißnass, und das Herz schlug ihr bis zum Hals. Kornes Vorschlag schien nicht vollkommen abwegig, aber niemand konnte vorhersehen, was in zwölf Monaten sein würde. Wenn sie allerdings die Prüfung jetzt wagte und nicht bestand, würde sie keine zweite Chance bekommen. Zumindest nicht, solange Korne bei den Pergamentmachern das Sagen hatte, denn er würde ihr Scheitern als Bestätigung dessen nehmen, was er seit Jahr und Tag verkündete: dass Frauen zu nichts anderem taugten als zum Gebären.
Eine Weile standen sie schweigend vor den Bassins, wie schwarze, drohende Vierecke stachen sie aus dem Weiß des Schnees hervor. Ungeduldig begann der Pergamentarius gegen ein kleines Fass zu trommeln. Theresa war drauf und dran, klein beizugeben, sie fror und fühlte sich ganz allein. Wenn nur ihr Vater hier wäre! Er hatte sich nie von Korne schikanieren lassen. Ihre Lippen formten bereits das entscheidende Wort, das Kornes Triumph bestätigen würde – doch im letzten Augenblick besann sie sich eines anderen. Nein, sie würde Korne zeigen, dass sie tüchtiger war als alle seine Pergamentersöhne zusammen! Wenn sie wirklich Gesellin werden wollte, musste sie sich den Problemen stellen, und wenn sie die Prüfung aus irgendeinem Grund nicht bestehen sollte, würde sich vielleicht ein paar Jahre später doch die Gelegenheit zur Wiederholung ergeben. Schließlich war Korne nicht mehr der Jüngste und wäre dann womöglich gar nicht mehr am Leben … Sie blickte Korne direkt in die Augen und teilte ihm mit entschlossener Stimme mit, dass sie die Prüfung noch an diesem Vormittag ablegen wollte.
Der Pergamentermeister verzog keine Miene. Nur seine Augen blinzelten böse. »Gut. Wenn es so ist, kann das Spektakel ja beginnen.«
Theresa wandte sich zum Gehen. Sie war eben im Begriff, die Werkstatt zu betreten, da ließ der schneidende Ton des Meisters sie zusammenzucken.
»Darf man erfahren, wo du jetzt hin willst?«, schnaubte er, und seine Nasenlöcher blähten sich wie Pferdenüstern.
Theresa sah ihn erstaunt an. »Ich wollte noch die Messer schleifen, bevor der Graf kommt, und …«
Korne tat erstaunt. »Der Graf? Was hat denn der damit zu tun?«
Theresa war sprachlos. Ihr Vater hatte ihr doch noch am Morgen versichert, dass Wilfred ihrer Prüfung beiwohnen würde!
»Ach ja«, erinnerte sich Korne ganz plötzlich, »Gorgias hatte so etwas erwähnt. Aber als ich gestern beim Grafen war, machte er einen so beschäftigten Eindruck, dass ich ihn nicht mit einer derart läppischen Formalität belästigen wollte. Und da du ja offenbar bestens mit allen möglichen unerwarteten Ereignissen zurechtkommst, wird es wohl auch kein Hindernis sein, wenn der Graf nicht zugegen ist. Oder doch?«
Langsam dämmerte es Theresa, dass es weder Nächstenliebe war, die Korne bewogen hatte, ihrem Vater zu helfen, noch etwa Rücksicht auf sie, als er anbot, die Prüfung zu verschieben. Er hatte Gorgias geholfen, weil er wusste, dass das Schicksal der Pergamenterwerkstatt und folglich auch sein eigenes von der Arbeit des Skriptoriums abhing. Wie hatte sie bloß – und sei es nur für einen Augenblick – an den guten Willen des Meisters glauben können … Nun war sie diesem Schuft ausgeliefert, und dass sie ihr Handwerk verstand würde ihr nicht viel nützen. Sie senkte den Kopf, doch sie wollte Korne das Feld nicht kampflos überlassen. Wie nur konnte sie sich wehren? Plötzlich hellte sich ihre Miene auf.
»Sonderbar.« In arglosem Ton wandte sie sich an den Pergamentarius. »Mein Vater versicherte mir nicht nur, dass Wilfred zugegen sein werde; er sagte mir auch, der Graf interessiere sich sehr für meine Fortschritte und wolle mein erstes Pergament gerne behalten. Ein Pergament, das ich, wie Ihr wisst, mit meinem Zeichen zu versehen habe«, schloss sie feierlich. Und betete, dass Korne die Lüge schlucken würde. Vielleicht hatte sie ja doch noch eine Chance.
Der Pergamentmacher schien nicht recht zu wissen, was er von dieser Geschichte halten sollte. Falls dies tatsächlich Wilfreds Wunsch war, durfte er es nicht riskieren, dagegen zu verstoßen. Das spöttische Grinsen verschwand aus seinem Gesicht, doch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Denn im Grunde war es völlig unerheblich, was der Graf meinte oder sagte – das Mädchen würde die Prüfung nicht bestehen. Zumindest nicht, solange er, Korne, Meister der Pergamentarii war.
Er bedachte Theresa mit einem eisigen Blick und wandte sich wortlos ab. In der Werkstatt rief er die Lehrlinge und Gesellen zusammen. Sofort ließen sie von ihrer Arbeit ab und strömten in den frostkalten Innenhof, wo das Examen stattfinden sollte. Die Lehrjungen schubsten und drängelten, um sich wie bei einer Theateraufführung die besten Plätze zu sichern; die Gesellen stellten sich am Rand auf, wo man vor dem unablässig fallenden Schnee geschützt war. Einer der jungen Kerle kam mit einem Korb verschrumpelter Äpfel an und verteilte sie unter den neugierigen Zuschauern. Korne trat vor und klatschte ein paar Mal in die Hände.
»Wie Ihr wisst, ersucht unsere junge Theresa um die Aufnahme in unser Handwerk.« Gelächter erhob sich. »Dieses Mädchen hier«, er deutete mit der einen Hand auf Theresa, während er sich mit der anderen in den Schritt griff, »will geschickter sein als ihr, geschickter als meine Söhne und sogar als der Meister selbst. Eine Frau! Die sich vor Angst in ihre Röcke scheißt, wenn sie einen Hund bellen hört! Und trotzdem besitzt sie die Frechheit, eine Arbeit tun zu wollen, die die Natur den Männern zugedacht hat.«
Einer der Lehrjungen schleuderte einen Apfelgriebs in Theresas Richtung, der sie mitten ins Gesicht traf. Ein anderer tat wie ein Mädchen, das sich ängstlich wegduckt und davonläuft, und erntete stürmischen Beifall, bis Korne die Posse beendete und seine Ansprache fortsetzte.
»Frauen, die Männerarbeit verrichten … Kann mir vielleicht jemand erklären, wie eine Frau hier arbeiten und gleichzeitig, wie es sich gehört, für ihren Mann sorgen kann? Wer soll denn für ihn kochen und waschen? Wer kümmert sich um die Kinder? Oder soll sie die womöglich mit hierher schleppen, damit wir alle etwas davon haben?« Wieder erhob sich wieherndes Gelächter. »Und wenn der Sommer kommt und es schwül und heiß wird, und wenn ihr Kittel dann von Schweiß durchtränkt ist und sich ihre Brüste darunter abzeichnen … Wird sie uns wohl zumuten, dass wir unsere Blicke abwenden und unser Verlangen unterdrücken? Oder wird sie uns zum Lohn für unsere Qualen ihre Äpfelchen anbieten?«
Die Handwerker grölten, zwinkerten sich vielsagend zu und stießen sich gegenseitig in die Seiten, während sie Korne applaudierten.
Theresa pochte das Blut in den Adern. Bis jetzt hatte sie geschwiegen, aber nicht einen Augenblick länger würde sie den Spott und die Demütigungen dieser widerlichen Kerle erdulden.
»Was geht es Euch an, wie ich für meinen Mann sorgen werde?«, erhob sie laut ihre Stimme. Ein Raunen ging durch die Menge. »Und meine Brüste … Da sie Euch offenbar so sehr beschäftigen, werde ich Eure Frau bitten, sich des Mangels anzunehmen, den Ihr anscheinend leidet. Und nun würde ich gern mit der Prüfung beginnen, wenn Ihr nichts dagegen habt.«
Korne verschlug es die Sprache, mit solch dreister Entgegnung hatte er nicht gerechnet, und erst recht nicht damit, dass Theresas Worte von den Männern mit anerkennenden Pfiffen quittiert würden. Wutschnaubend griff sich der Pergamentarius den Korb mit den übriggebliebenen Äpfeln, suchte einen besonders fauligen heraus und baute sich höhnisch grinsend vor Theresa auf. Ohne seinen niederträchtigen Blick von ihr abzuwenden, stieß er seine beiden verbliebenen Hauer in den Apfel und streckte ihr dann schmatzend die speicheltriefende Frucht hin.
»Na, auch Appetit?«
Angewidert betrachtete Theresa den Wurm, der sich in dem fauligen Fruchtfleisch wand. Ungerührt biss Korne noch einmal zu, schluckte den halben Griebs samt Wurm hinunter und schleuderte den Rest in das hinterste Becken. Dann band er sich die Haare zu einem albernen Zöpfchen zusammen, trat an das Becken und spuckte verächtlich hinein.
»Hier hast du deine Prüfung«, sagte er und nahm das Holzgitter herunter, das zum Schutz über das Bassin gelegt war. »Mach mir die Haut fertig und zeig, ob du den Titel verdienst, nach dem es dich so sehr verlangt.«
Theresa presste die Lippen zusammen. Häute entfleischen und für die Bearbeitung herrichten gehörte eindeutig nicht zu den Aufgaben eines Gesellen, aber wenn es das war, was Korne wollte, würde sie das Beste daraus machen. Sie schaute auf die schmierige Schicht aus Blut und Fett, die auf der Oberfläche schwamm. Mit Hilfe eines Holzspatens schob sie die glibberigen Fetzen auseinander, die sich durch die Kalklauge gelöst hatten, und fischte nach der Haut, die sie bearbeiten sollte. Sie zog den Spaten mehrmals durch das ganze Becken, doch sie konnte sie nicht finden. Mit fragendem Blick wandte sie sich zu Korne um.
»Doch, doch, die Haut ist da drin,« blaffte er sie an. »Streng dich gefälligst ein bisschen an!«
Theresa starrte auf das Becken, sie wusste, zur Mitte hin wurde es richtig tief. Hier kamen die Felle gleich nach dem Abziehen hinein. Gefasst zog sie sich schließlich die Stiefel aus, raffte ihren Rock und stieg mit angehaltenem Atem in die eisige Kalklauge. In dem Bassin schwammen Hautstücke und Brocken von geronnenem Blut, vermischt mit dem in den Einweichbecken üblichen Dreck. Unter den spottenden Rufen der Männer ging sie vorsichtig tastend tiefer hinein, bis ihr die stinkende Brühe an den Bauch reichte.
Die eisige Temperatur ließ sie erschauern, unwillkürlich stöhnte sie auf. Einen Moment stand sie regungslos da. Dann holte sie Luft und glitt ins Tiefe. Als sie wieder auftauchte, war ihr Kopf von einem schmierigen Schleier überzogen. Theresa spuckte aus und wischte sich den Schleim vom Gesicht. Dann langte sie wieder in die undurchsichtige Flüssigkeit und schob die Haut- und Fettreste um sich herum zur Seite. Sie spürte, wie der Kalk auf der Haut brannte und sie von der entsetzlichen Kälte ganz starr wurde. Die stinkende Brühe schwappte ihr bis übers Kinn, doch Aufgeben kam nicht in Frage. Sie nahm sich zusammen und versuchte sich zu konzentrieren. Inzwischen hatte ein Schneesturm eingesetzt, der ihr wie mit Nadeln ins Gesicht schlug, während sie mit zitternden Armen unter der Oberfläche hin und her ruderte wie ein Blinder, der verzweifelt nach Halt sucht. An den bloßen Füßen spürte sie eine glitschige Schicht aus Schlamm und fauligen Häuten. Doch plötzlich stieß sie gegen etwas Festes. Sie erstarrte, das Herz schlug ihr bis zum Hals, sie wagte sich kaum zu rühren. Sie betastete den Gegenstand mit dem Fuß – was konnte das sein? Unmöglich zu sagen, sie hatte kaum noch Gefühl in den Zehen. Sollte sie der Schmach vielleicht doch ein Ende bereiten und auf den Gesellentitel verzichten? Sie musste an ihren Vater denken und an all die Menschen, die ihr Vertrauen in sie gesetzt hatten. Sie holte noch einmal tief Luft und tauchte unter. Die Kälte pochte ihr schmerzhaft in den Schläfen, als ihre Hände ein schleimiges Etwas fassten. Sie musste würgen, tastete sich jedoch tapfer weiter an dem widerlichen Klumpen entlang, bis sie eine Reihe kleiner Kiesel unter ihren Fingern zu spüren glaubte. Und plötzlich begriff Theresa, was sie da gerade befühlte: Zähne, das Gebiss eines toten Tieres! Vor Abscheu hätte sie beinahe die Augen aufgerissen, doch im letzten Moment besann sie sich: Die Kalklauge hätte sie auf der Stelle für immer blind gemacht. Wie vom Teufel gejagt schoss sie hoch an die Wasseroberfläche, das Gesicht von Ekel verzerrt. Und wie sie hustete und spuckte, tauchten neben ihr die fauligen Reste eines riesigen Rindskopfes auf.
Gleich kamen mehrere Kerle an das Becken herangelaufen, einer streckte Theresa die Hand hin, als wollte er ihr heraushelfen, dann aber ließ er sie los. Theresa plumpste zurück in die dreckige Brühe, den Tränen nahe. Da kam die Frau des Pergamentarius, die offenbar die ganze Szene mit angesehen hatte, in den Hof geeilt und drängte die Männer beiseite. Voller Verachtung blickte sie in die Runde und zog die schlotternde Theresa aus dem Becken. Rasch legte sie ihr eine Decke um und wollte sie gerade ins Haus bringen, als hinter ihnen Kornes scharfe Stimme ertönte:
»Sie soll sich gefälligst trockene Kleider anziehen und endlich an ihrem Arbeitsplatz erscheinen.«
Als Theresa in die Werkstatt zurückkehrte, lag ausgebreitet auf ihrer Werkbank die triefende, schlaffe Rindshaut; irgendjemand hatte den Kopf entfernt. Mühevoll wrang sie das glitschige Ding aus und schlug es wieder auseinander, um es zu begutachten. Die Haut konnte erst diese Woche abgezogen worden sein, denn der Kalk hatte kaum das Fell gelöst, und auf der Innenseite hafteten noch Fleisch- und Fettreste. Zahlreiche Bissspuren deuteten darauf hin, dass die Kuh von Wölfen gerissen worden war. Daneben verunstalteten Dutzende Narben, die von Geschwüren und älteren Wunden herrühren mussten, die Haut und machten sie praktisch unbrauchbar für die Herstellung von Pergament. Diesen Fetzen kann man ja nicht mal mehr den Ratten zum Fraß vorwerfen, dachte Theresa.
»Wolltest du nicht eine große Pergamentmacherin werden?«, höhnte Korne. »Dann setz dich an die Arbeit, damit Wilfred sich bald von deinem Geschick überzeugen kann.«
Er verlangte Unmögliches von ihr, und keine Gerechtigkeit bot ihm Einhalt. Doch Theresa unterdrückte ihre Empörung und erhob keinen Widerspruch. Schon eine gute Haut zu säubern, erforderte eigentlich mehrere Tage Arbeit, und damit der Kalk und die Spülungen ihre Wirkung entfalteten, musste das Stück zwischen den einzelnen Arbeitsschritten eine ordentliche Weile liegenbleiben. Sie hatte indes keine Wahl, niemals würde sie Korne den Triumph gönnen, dass sie sich geschlagen gab. Entschlossen krempelte sie die Ärmel des Kittels hoch, den Kornes Frau ihr geliehen hatte, griff nach einer Borstenbürste und schrubbte damit energisch die Fleischreste ab, die den Würmern entgangen waren. Als sie mit der Fleischseite fertig war, drehte sie den Lappen um und machte sich an die Haarseite. Mit aller Kraft schabte sie das übriggebliebene Fell von der Haut, spülte sie immer wieder durch, wrang sie gründlich aus und faltete sie auf der Werkbank auseinander, um sich den Stellen noch einmal zu widmen, an denen die Haare nicht vollständig entfernt waren. Schließlich suchte sie die Kiste mit dem Ginster, um die Säure aufzutragen. Sie war verschwunden. Korne verfolgte jeden ihrer Handgriffe mit hämischem Grinsen, hin und wieder wandte er sich betont ungeduldig ab, als hätte er Wichtigeres zu tun, doch schon bald kehrte er zurück, um zu sehen, wie sie vorankam. Theresa bemühte sich eisern, ihn nicht zu beachten. Sie wusste, dass das Verschwinden des Ginsters kein Zufall war, und verschwendete keine Zeit damit, danach zu suchen. Stattdessen nahm sie eine Kelle Asche, mischte sie mit etwas von dem Mist, den die Maulesel vor dem Eingang hinterlassen hatten, und strich diese Paste auf die Poren der Rinderhaut. Dann kratzte sie mit einem halbrunden, stumpfen Messer sorgsam die letzten Fellreste ab, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war.
Der erste Schritt war geschafft. Nun hieß es, die Haut auf einen Rahmen zu spannen, so dass eine Art riesiges Tamburin entstand. Dabei musste sie sehr behutsam vorgehen, denn an den stark beschädigten Stellen konnte die Haut leicht einreißen. Theresa legte einige Kiesel auf den Rand und wickelte sie geschickt ein, indem sie den Lappen darüber schlug. So entstanden kleine Beutel, die sie mit einer Schnur zuband. Vorsichtig legte sie den Fetzen dann über den Rahmen und zog ihn mit Hilfe der Schnüre an den Beutelchen behutsam straff. Die Anspannung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Es durften bloß keine Risse entstehen! Endlich atmete Theresa erleichtert auf, die schwierigste Etappe hatte sie hinter sich gebracht. Nun musste sie die Haut nur noch vor dem Feuer trocknen lassen und abwarten, bis sie so fest war, dass man sie mit dem schärferen Messer glatt schaben konnte. Sie trug den bespannten Rahmen zum Feuer, das in der Mitte des Arbeitsraums knisterte. Dort war es nicht nur am wärmsten, sondern auch am hellsten; daher gruppierten sich um die Feuerstelle auch die Tische, auf denen die wertvollsten Codices ihrer Instandsetzung harrten.
Theresas Blick verlor sich in den Flammen, sie stellte sich zum ersten Mal die Frage, woher diese Rindshaut wohl stammen mochte. Die meisten Kühe waren während des schlimmen Unwetters elendiglich verendet; soweit sie wusste, besaß nur Wilfred noch welche, also musste Korne die Kuh über einen der Verwalter des Grafen beschafft haben. Und ihrem Zustand nach zu urteilen wohl allein in der Absicht, ihr eine unmöglich zu bewältigende Aufgabe zu stellen.
Der Pergamentermeister trat zu Theresa an das Feuer. Er fuhr mit dem Finger über die Trommel, auf der Wasser perlte, und sah Theresa verächtlich an.
»Ich sehe, du bemühst dich. Vielleicht kommt zuletzt ja sogar etwas dabei heraus«, sagte er, auf den Rahmen deutend.
»Ich tue mein Bestes, Herr«, erwiderte Theresa und hielt seinem Blick stand.
»Dieser Dreck hier ist also das Beste, was du zustande bringst?«, zischte Korne, zog sein Messer aus der Scheide und näherte es der aufgespannten Haut. »Hast du diese Stellen hier gesehen? Da wird es reißen.«
»Nein, das wird es nicht. Ich habe die Stellen genau geprüft und die Haut so gespannt, das nichts passieren kann«, erwiderte sie prompt.
Da begann der Meister, ganz langsam und genüsslich mit der Messerspitze über das fast fertige Pergament zu fahren, als kitzelte er mit dem Dolch die Kehle eines Opfers. Die Schneide ratschte über die Haut und warf einen feinen Grat auf. Theresa beobachtete entgeistert, wie Korne mit tückisch glitzernden Augen und halb geöffneten Lippen, die seine beiden hässlichen Zähne entblößten, sein teuflisches Werk verfolgte.
»Tut das bitte nicht!«, flehte Theresa.
Korne sah sie triumphierend an, dann stieß er statt einer Antwort mit dem Messer zu. Die Haut zersprang in tausend kleine Fetzchen, die über ihre Köpfe wirbelten und sich langsam ins Feuer senkten.
»Oh!«, machte der Pergamentarius bedauernd. »Da hast du wohl die Spannung doch nicht richtig berechnet. Tja, ich fürchte, du bist einfach nicht so weit, manchen sind Talent und Glück nun einmal nicht in die Wiege gelegt. Du wirst es nie zum Gesellen bringen, hörst du, niemals!«
Theresas Züge verkrampften sich, sie ballte die Fäuste. Sie hatte Kälte und Erniedrigung ertragen, und sie hatte unter widrigsten Umständen aus diesem vollkommen unbrauchbaren Kadaverrest ein annehmbares Pergament hergestellt; und nun wollte Korne sie, allein, weil sie eine Frau war, für alle Ewigkeit zur Hilfsarbeit verdammen!
Nur mühsam beherrscht stand sie da, als Korne sie unvermittelt am Arm packte und zu sich heranzog.
»Du kannst dir ja immer noch dein Geld damit verdienen, irgendwelchen Säufern den Wanst zu kneten«, spuckte er ihr gehässig ins Ohr.
Da packte Theresa blinde Wut. Mit einem Ruck entwand sie sich dem Griff dieses widerlichen Mannes, stieß ihn von sich und wollte aus der Werkstatt laufen. Korne stellte sich ihr breitbeinig in den Weg.
»Du glaubst doch wohl nicht, dass ich mich von einer Hure wie dir so behandeln lasse!«, geiferte er und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht.
Theresa glitt aus und fiel gegen den Rahmen, auf dem eben noch ihr Pergament aufgespannt gewesen war, ehe es mitsamt all ihren Träumen unter Kornes Messer in tausend Fetzen zerplatzt war. Das Gestell geriet ins Wanken und krachte schließlich auf die brennenden Holzscheite. Eine Glutwolke stob durch die Werkstatt, die für einen Augenblick rot erleuchtet war wie eine Schmiede. Die Funken sprühten bis auf die nahe beim Feuer stehenden Bänke, die glimmende Asche setzte die noch nicht gebundenen Codices in Brand, den Leim und die Chemikalien, und im Nu hatten aufzüngelnde Flammen auf die Regale übergegriffen.