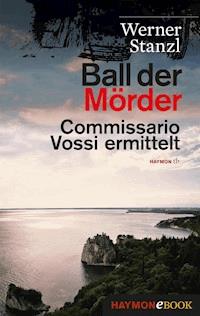Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
WIE ENTKOMMST DU JEMANDEM, DESSEN GESICHT DU NICHT KENNST? TRAUMHAFT SCHÖNES BADEN ... Baden: DIE ROMANTISCH-RUHIGE BIEDERMEIERSTADT AN DEN GRÜNEN HÄNGEN DES WIENERWALDS. Der Ort, an dem seit Jahrhunderten ENTSPANNTE KURGÄSTE GENUSSWANDELN und sich in die Beschaulichkeit des Römerbades zurückziehen. Darunter PROMINENZ AUS KUNST UND KULTUR: hier komponierte LUDWIG VAN BEETHOVEN seine Neunte, und auch FRANZ II., DER LETZTE KAISER des Heiligen Römischen Reiches, hinterließ seine Spuren in Baden. Doch neuerdings STÖRT ETWAS DIE ÄRZTLICH VERORDNETE RUHE DER HEILSUCHENDEN AM GESUNDBRUNNEN … etwas, das für SEHR REALE ALBTRÄUME sorgt. WER IST DER MASKIERTE MÖRDER, DER DAS IMAGE DER RENOMMIERTEN KURSTADT BESCHMUTZT? KONTROLLINSPEKTORIN ILSE STRASSER steht vor einem Rätsel - und es heißt ALFRED EDER: VERSICHERUNGSVERTRETER UND MUTTERSÖHNCHEN. Der harmlos scheinende Kauz wird GLEICH IN ZWEI TODESFÄLLE VERWICKELT: Seine Mutter ist kaum begraben, da wird EINE IHM BEKANNTE PROSTITUIERTE ERMORDET UND BESTOHLEN. Ilse Strasser ist unschlüssig. ALFRED HAT KEIN ALIBI, MÖCHTE ABER BEI DER AUFKLÄRUNG BEHILFLICH SEIN. Kann sie es riskieren, ihm zu vertrauen? Als es ZUM DRITTEN MORD IN DER BESCHAULICHEN KURSTADT kommt, gerät die Ermittlerin zunehmend unter Druck. Allerorts WARNEN DIE MEDIEN VOR DEM "WIENERWALDPHANTOM". Den Blut- und Geldadeligen wird der Schlaf geraubt - denn ZUHAUSE IST ES NICHT MEHR SICHER ... ***************************************************************************** "Atmosphäre: check. Spannung: check. Coole Ermittlerin: check. Bin hellauf begeistert." "Sehr ungewöhnliche Figuren, die Werner Stanzl da in die Verbrechensbekämpfung schickt: Ilse Strasser ist eine Ermittlerin ganz nach meinem Geschmack!" "Diese ganz eigene Kombination aus Spannung und Gemächlichkeit mag ich bei Werner Stanzls Krimis sehr." "Werner Stanzl schafft es einfach, viel interessantes Lokalwissen in eine spannende Geschichte zu verpacken - Hut ab!" *****************************************************************************
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Stanzl
Das Phantom von Baden
Ein Wienerwald-Krimi
1
Der Andrang vor der Leichenhalle überraschte. Nie hätte Alfred angenommen, dass sich so viele Menschen zum Begräbnis seiner Mutter einfinden würden. Der Auflauf passte genauso wenig zu ihrer schroffen, abweisenden Art wie das Wetter zum unvermeidlichen Gang ans offene Grab. Begräbnisse waren nun mal auch Freilufttermine. Da blieb man doch angesichts der dunklen Wolken über den Dächern der Stadt lieber weg. Gleich würde es schütten. Die Ersten spannten schon vorbeugend ihre Schirme auf.
Wieso wussten überhaupt all die vielen von dem Termin? Er hatte ihn doch gegenüber keinem Dritten erwähnt. Frau Stöger ausgenommen, der besten, weil einzigen Freundin der Mutter. Deren Wissen über die notwendigen Behördenwege und das Verabschiedungsritual waren übrigens ganz nützlich gewesen. Doch Trauergäste waren in ihren Ausführungen nicht vorgekommen. Offensichtlich hatte auch sie keine erwartet.
Alfreds Schritte wurden kürzer. Ob er etwas verwechselt hatte? Nein. Der Friedhofsbedienstete hatte ihm doch den Weg gewiesen und gemeint: „Nur zu, nur zu, es gibt nur die eine Leichenhalle.“
Folglich musste ihn seine Uhr im Stich gelassen haben. Er war doch eine gute Stunde vor der Zeit von zu Hause aufgebrochen, um sich nur ja rechtzeitig neben der Bahre postieren zu können. Befallen von Schuldgefühlen rechnete Alfred nach: Kurz vor sieben war er bei der Hundesitterin, um Rauhaardackel Adolf loszuwerden. Der Gang durch den Doblhoffpark, vorbei am Weilburgpark zum Helenenfriedhof hatte vielleicht eine halbe Stunde gedauert und das Schlendern zwischen den Gräbern vom Friedhofstor hier herauf zur Aufbahrungshalle höchstens eine weitere. Oder hatte ihn dabei trotz des unfreundlichen Wetters das Zeitgefühl verlassen? Möglich. Er wusste nur zu gut, wie leicht er sich bei der Lektüre von Grabsteininschriften verlor. Sie gemahnten an die Ordner mit den Versicherungsfällen, deren Belege er in seinen ersten Arbeitsjahren nachzurechnen und nach Daten zu ordnen hatte, bevor sie als erledigt dem Zentralarchiv anheimfielen. Einmal hatte er einen davon selbst hinuntergetragen. Er wollte den Aktenfriedhof einfach mal sehen und staunte über kilometerlange Regale, bis unter die Decke gefüllt mit Schwarten. Eine letzte Ruhestätte dort wie hier. Dort im Zentralarchiv warteten Protokolle, Schimpforgien von Kunden, Gutachten und Quittungen auf eine jederzeit mögliche Nachkontrolle, hier die Toten auf das Letzte Gericht. Alfred fürchtete weder das eine noch das andere. Die von ihm bearbeiteten Schadensfälle wusste er gewissenhaft abgerechnet, und an das Endgericht eines allmächtigen und allwissenden Abrechners glaubte er nicht. Dafür waren die Terra-X-Sendungen über die Evolution und Universum zu überzeugend.
Leicht gebeugt, wie es für den Anlass geboten schien, ging er an den aufgefädelten Trauergästen vorbei in Richtung Sarg. Dabei spürte er das Brennen ihrer Blicke auf seinem Rücken. Er fühlte förmlich den hellen Punkt zwischen seinen Schultern, der in den Fernsehkrimis den vermummten Beamten der Sokos vor dem Kommando „Zugriff“ das Ziel wies.
Aufatmend erreichte er die Stätte mit den Kerzen und Kränzen am Ende des Saals. Als nächster Angehöriger war dies sein Platz. So viel wusste er über die Spielregeln von Bestattungen. Und darüber hinaus auch noch, dass dunkle Kleidung für den Trauerfall als angebracht galt.
Sehen konnte er wenig, erkennen keinen. Nach den Anstrengungen des im letzten Teilstück relativ steilen Weges war ihm die Brille angelaufen. Als sich der Beschlag auflöste, stellte er fest, dass sich der allgemeine Schlendrian über die Kleiderordnung für Trauerfälle hinwegsetzte. Selbst die Erwachsenen von über vierzig standen in Jeans und Lederjacken herum. Lediglich die sehr betagte Dame, die ihm zögernd und mit einem Blick zwischen Staunen und Missbilligung die Poleposition neben dem Sarg überlassen hatte, trug Schwarz mit einem Ansatz von Trauerschleier vor dem Gesicht.
Sie musste wohl Tante Hermine sein, die Schwester seines Vaters. Er kannte sie fast nur aus Erzählungen und hatte sie bloß ein einziges Mal gesehen. Das war nach dem Fall der Berliner Mauer. Sie war unangemeldet aus einem brandenburgischen Dorf zu Besuch gekommen und überstürzt wieder abgereist. Die drei Stunden dazwischen gab es Streit über ein Foto im Familienalbum. Ursprünglich hatten darauf Tante Hermine und Mutter in die Kamera eines jener Fotografen geblickt, die seinerzeit im Kurpark ihre Dienste anboten. Etliche Jahre nach der Aufnahme war Mutter um ein Passfoto verlegen. Also trennte sie ihr Konterfei von dem der Tante und schnitt es passend zurecht. Die Tante vermutete böse Absicht hinter den Schnitten und fauchte. Es endete damit, dass sie die Wohnungstür zuknallte. Von außen.
Offensichtlich hatte Tante Hermine inzwischen die Banalität des Streits eingesehen und der Mutter verziehen. Es war also doch richtig gewesen, sie brieflich vom Todesfall zu benachrichtigen.
Tante Hermines Adresse war Teil des Inhalts einer blechernen Keksdose gewesen. Diese hatte alles enthalten, was Mutter als bewahrenswert erschien oder was schlicht notwendig war: Reisepass, Staatsbürgerschaftsnachweis, Geburtsurkunde und das Büchlein zum Aufkleben der Beitragsmarken des Sterbevereins. Dazwischen ein nie abgeschickter Brief mit der Adresse der Tante. Alfred hatte den Inhalt studiert und war zu dem Schluss gekommen: Alles, was seine Mutter ausgemacht hatte, lag in der kleinen Keksbüchse verwahrt. Mehr war da wohl nicht. Auch er würde sich beizeiten nach einem Behälter für sein Leben und Sterben umsehen müssen. Jemand würde die enthaltenen Utensilien sichten, Maßnahmen setzen und alles entsorgen. Den Gedanken, am Ende nicht mehr als ein paar persönliche Daten auf Formularen mit Amtssiegel zu sein, empfand er als beklemmend.
Mit ihren letzten Worten war seine Mutter über das Wetter hergezogen. Danach hatte sie sich zum Mittagsschlaf in ihr Zimmer zurückgezogen. Weil sie zu vorgerückter Stunde nicht zum Kochen des Abendmahls erschienen war, hatte Alfred nach ihr gesehen. Sie lag friedlich auf ihrem Bett und atmete nicht. Daraufhin war er mechanisch in das Vorzimmer gegangen, hatte nach der Nummer des Hausarztes gesucht, sie auf dem Wandzettel über dem Telefon gefunden, die Nummer gewählt und den Doktor gebeten zu kommen. Das Telefonat hatte den Rauhaardackel Adolf geweckt. Nach einem langen Gähnen hopste er aus seinem Korb, um auf sich und seinen Hunger aufmerksam zu machen. Am Bett von Frauchen angelangt, stellte er sich auf seine Hinterpfoten, schnüffelte aufgeregt an dem leblosen Körper und machte, ohne ein Kommando erhalten zu haben, „Sitz“. Alfred kannte den darauffolgenden Blick des Hundes, den ein verhaltenes Knurren unterstrich. Es war die Körpersprache, mit der Adolf draußen auf der Jagd totgeschossenes Wild bewachte.
„Herzversagen“, hatte der Arzt konstatiert und ein Formular aus seiner Tasche geholt. Alfred reagierte darauf wie auf einen Befehl. Mit den mechanischen Schritten eines Golem war er in die Küche gegangen, hatte die Keksdose aus der Kredenz hervorgeholt und dem Arzt die Geburtsurkunde der Mutter gereicht. Wortlos hatte sie der Arzt entgegengenommen, Namen und Daten auf das Formular übertragen, während Alfred darüber nachdachte, wie das Problem Hund für die Zeit des Begräbnisses zu lösen sei. Er war sich nämlich sicher, dass Hunde bei einem Begräbnis nicht vorgelassen wurden. Bei dem Gedanken an Adolfs Marotte, Alleingelassenwerden schon nach Minuten als grobe Vernachlässigung zu empfinden und wutentbrannt alles zu zerbeißen, was er irgendwie erreichen konnte, war Alfred ein Schauer über den Rücken gelaufen.
„Das hat sie aber gut hingekriegt“, hatte der Arzt neben der toten Mutter gemurmelt. Alfred wusste, was der Mediziner damit sagen wollte. Die Mutter hatte einen Graus davor gehabt, dereinst als Pflegefall anderen zur Last zu fallen. Ein zeitgerechter Tod war ihr letzter großer Wunsch, dessen Erfüllung sie hartnäckig vom Schicksal eingemahnt hatte. Als billig und gerecht, weil es ihr in allen anderen Dingen die kalte Schulter gezeigt hatte. Die guten Blutwerte bei den diversen Kontrolluntersuchungen hatte sie stets jammernd zur Kenntnis genommen. Dem Hausarzt hatte sie bei solcher Gelegenheit mehr als einmal vorgehalten: „Ihr verlängert nicht das Leben, sondern die Jahre der Gebrechlichkeit. Belastet Sie das nicht?“
„Ist das Ihr Ernst?“
„Und ob!“, hatte sie gefaucht und nicht die Spur von Empathie für die Betroffenheit des Medicus gezeigt.
In der Aufbahrungshalle roch es wie in dem Blumengeschäft am Ende der Fußgängerzone, stellte Alfred nüchtern fest. Er nahm die Brille ab, putzte sie, und anstatt sie wieder aufzusetzen, steckte er sie in seine Rocktasche. Das tat er immer in Momenten, in denen er sich unsicher fühlte. Und das tat er oft. Er gab sich der Illusion hin, wenn er als stark Kurzsichtiger nicht klar sehen und Details nicht ausmachen konnte, könnten die anderen auch ihn nicht erkennen. Diese naive Gleichung aus dem Versteckspiel früher Kindheitstage hielt er sich auf Abruf, um ganz banale, ihm aber brenzlich erscheinende Situationen auszuhalten. Sein Getriebe stellte er dabei auf Leerlauf.
Dass jetzt unangemeldet ein Priester, gefolgt von einem Ministranten mit Wuschelkopf die Szene betrat und zu einem Gebet anstimmte, widersprach grob der Übereinkunft mit dem Bestattungsunternehmen. Die Verstorbene wollte bei der Verabschiedung keine Geistlichkeit, und Alfred hatte dies pflichtschuldig weitergegeben. Zudem erinnerte ihn jetzt das Erscheinen des Priesters daran, dass die Mutter keine Blumen zu ihrem Begräbnis geopfert sehen wollte. „Nur ein Mistelzweig auf meinem Sargdeckel, sonst nichts. Kümmere dich darum“, hatte sie mehrmals reglementiert. Dabei war sie bis zuletzt geblieben. Doch der Mistelzweig fehlte. Und wie um Alfreds Ärger darüber zu steigern, hob der Priester jetzt auch noch an: „Oh Herr, gib ihr und allen Christgläubigen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen.“
Wie immer, wenn Alfreds Widerspruch oder Protest gefordert gewesen wäre, duckte er sich ganz einfach weg, verschloss sich. In der gegebenen Situation mochte das aus Rücksicht auf die versammelte Trauergemeinde durchaus angemessen erscheinen. Aber genauso verhielt er sich beispielsweise beim Fleischer. „Hundert Gramm Extrawurst, bitte sehr, bitte gleich. Oh, darf es etwas mehr sein?“ Diese Draufgabe ganz einfach abzulehnen, dazu wäre Alfred nie fähig gewesen. Und schon waren seine beiden Semmeln mit Wurst vollgepappt und das Verhältnis Fleisch-Backware zu fleischlastig, was er verabscheute.
Deshalb war die Meinung, dass so ein Mensch der letzte wäre, der Versicherungspolizzen eines Konzerns wie der Länderversicherung erfolgreich anbieten könnte, eine relativ einhellige. Alfreds Abteilungsleiterin, die ihn auf Weisung von oben in ihr Team nehmen musste, teilte diese Einschätzung nicht nur, sondern trug sie offen zur Schau. Der Weisung von oben hatte sie sich zu fügen, ganz geschlagen geben wollte sie sich aber nicht, und so versuchte sie, Alfred ohne weiteres Zutun rasch wieder loszuwerden. Damit war klar: Alfred musste in den Außendienst. Im direkten Kontakt mit den Kunden würde sich der unerwünschte Neuling sein Grab schaufeln. Danach brauchte es nur noch einen kleinen Schubs und schon würde er ohne Aufsehen in die Grube fallen. Nur dank solcher und ähnlicher Tücken im mittleren Managementbereich waren die Bilanzen der Länderversicherung trotz ebenso ständiger wie statutenwidriger Einmischungen von Landespolitikern und Parteifunktionären im grünen Bereich. Dass Alfred den Job seiner Mutter, die Kontakte zu einem hochrangigen Landespolitiker hatte, verdankte, war ihm klar geworden. Aber welcher Qualität diese Beziehungen zu dem Landespolitiker waren, blieb im Dunkeln. Er wusste nur vage, es hatte mit dem tödlichen Verkehrsunfall seines Großvaters zu tun.
Während der Priester seine Totengebete abspulte, dachte Alfred darüber nach, ob der Tod der Mutter Auswirkungen auf seine Position in der Versicherungsgesellschaft haben könnte und wenn ja, welche. Inmitten dieser Überlegungen wichen die Trauergäste zur Seite, um einer Kohorte Pompfinebrer aufgetakelter Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens, den Weg freizumachen. Deren Schuhe hinterließen nasse Abdrücke auf dem Steinboden, die schwarz aufgedonnerten Uniformmäntel tropften. Offensichtlich hatte es draußen zu regnen begonnen. Mit einem Ruck hoben sie den Sarg an und bewegten sich in Richtung Grabzeilen. Gefolgt vom Priester, Alfred und der angereisten Tante. Keiner von ihnen trug geeignetes Schuhwerk. Bloß der Ministrant. Er schlürfte in Gummistiefeln neben dem Priester her und rasselte dazu mit dem Weihrauchkessel.
Draußen hatte es tatsächlich zu regnen begonnen. Nicht wie ursprünglich befürchtet aus Kübeln, aber heftig genug, um nach wenigen Schritten durchnässt zu sein. Dagegen halfen auch keine Schirme. Heftige Sturmböen vom Wienerwald herab sorgten dafür, dass das Wasser nicht von oben, sondern beinahe horizontal auf sie niederprasselte. Jetzt galt es Krägen aufzustellen, Köpfe einzuziehen und durchzuhalten. Ein Seitenblick verriet Alfred, dass das Mäntelchen der Tante als Schutz vor dem Unwetter völlig ungeeignet war, weshalb er ihr seinen Burberry umhing.
„Du bist Gerhard, gelt?“, fragte sie mit brüchiger Stimme und setzte, wie um Entschuldigung bittend, nach: „Man sieht sich ja nur noch zu Begräbnissen. Das letzte Mal, als wir deinen Vater begraben haben. Oder war es bei Rudis Begräbnis?“
Offensichtlich war Tante Hermine in den letzten Jahren rasch gealtert und leicht verwirrt. Sein Vater war seit Ewigkeiten tot, einen Gerhard oder Rudi gab es nicht in der Familie. Als sie ihn für „danach“ zu sich nach Mödling einlud, war er sich einer beginnenden Demenz ihrerseits sicher. In Mödling hatte sie einmal gewohnt, ja. Alfred wusste das aus Erzählungen. Aber da war sie ein schulpflichtiges Mädel und nicht eine gealterte Ostdeutsche. Oder war sie inzwischen zurückgekehrt, ohne sich bei Mutter zu melden? Aber wie hatte sie dann seinen Brief, den er ihr nach Brandenburg gesendet hatte, erreicht? Per Nachsendeauftrag, das war natürlich möglich.
Gleich nach der nochmaligen Bitte des Priesters um ewige Ruhe und ewiges Licht für alle Christgläubigen löste sich ein älterer Herr aus der Trauergemeinde, hakte sich etwas resolut bei Tante Hermine unter und entschwebte mit ihr und Alfreds Burberry, bevor der noch nach der Mödlinger Adresse fragen konnte. Zum Glück hatte er prinzipiell nie Wertsachen in Manteltaschen gesteckt. Die Mutter hatte ihm diese Regel als Vorsichtsmaßnahme gegen Taschendiebe eingebläut.
Alfred sah noch etwas wehmütig, aber felsenfest unentschlossen seinem Burberry nach, bevor er entlang der Grabzeile dem Ausgang zustrebte – im Regen, von dem er annahm, er würde mit jener Beständigkeit andauern, die typisch war für den Herbst. Der kannte nicht die Sprunghaftigkeit und Kapriolen des Frühlings. Was war eigentlich die Jahreszeit seines Lebens? Den Übergang von der Jugend zum Erwachsenensein gab eine Zahl vor: 18, nach dem Gesetz volljährig. Wie aber erkannte man den Wechsel vom Frühling des Lebens in den Sommer und vom Sommer in den Herbst, wenn man nicht verheiratet war, keine Kinder hatte und zeitlebens im Hotel Mama gewohnt hatte? Da gab es zwischen achtzehn und fünfzig keine einschneidenden Erlebnisse als Orientierungshilfe. War der Tod der Mutter eine solche, vielleicht eine Mahnung gar, sinnierte er vor sich hin.
Alfred versuchte sich zu orientieren. Eine Gräbergasse sah wie die andere aus. Da drang von rechts kommend eine weitere Gruppe Pompfinebrer in sein Blickfeld. Auf einem Radgestell schoben sie einen Sarg vor sich her. Dahinter eine Frau, in Schieflage gegen den Wind ankämpfend, unter einem jener ausladenden Regenschirme, die Hotelportiere nur bei extremem Bedarf herausrückten. Mit hochgehobenen Armen kämpfte sie, um den Schirm nicht an den Sturm zu verlieren, sodass ihr der leichte Übermantel und Rock nur noch bis über das Knie reichte. Diese Schwachstelle weiblicher Kleidung nutzte die nächste Böe und zeigte fauchend alles, was gutgebaute Weiblichkeit hüftabwärts ausmachte. Für Alfred blieb nicht unbemerkt, dass die Farbe der Reizwäsche dem Trauerfall angepasst war. Plötzlich wechselte der Wind von der Reizwäsche der Frau auf das Sargtuch. Er entriss ihm den darauf gehefteten Mistelzweig und ballesterte damit zwischen den Gräbern.
Dieses Treiben löste bei Alfred einen Denkprozess aus. Eine dunkle Ahnung stieg in ihm hoch. Er griff nach der Brille und erkannte in der wohlgebauten Frau Elvira Stöger. Er überlegte kurz. Nein, am Sarg der Mutter hatte er sie nicht gesehen. War sie in den hinteren Reihen gewesen? Sich vornehm zurückzuhalten war nicht ihre Art, oder doch? Wozu aber ging sie hinter einem fremden Sarg her? Noch dazu bei diesem Wetter. War sie etwa beruflich hier? Gab es neuerdings auch Frauen in dem makabren Berufsstand der Totengräber? War die Stögerin überhaupt berufstätig? Obwohl sie seit Jahren in dem Mutter-Sohn-Haushalt ein und aus ging und es immer wieder meisterlich verstand, die meist griesgrämige Mutter mit ein paar Zoten und eindeutigen Witzen aufzuheitern, wusste er von ihr bloß, dass sie die Männer wechselte wie der Kalender die Jahreszeiten und dass sie nackt mehr als ansehnlich war. Oh ja, Alfred hatte sie nackt gesehen. Na gut, genau genommen nur halbnackt, aber für den damals noch sehr jungen Alfred trugen die Frauen ihre Reize oberhalb der Taille. Von jenen unterhalb der Gürtellinie hatte er noch keine konkrete Vorstellung gehabt.
Damals war sie mit einem neuen Kleid zur Mutter gekommen, um es vor ihr anzuprobieren. „Glaubst du, ich kann es ohne BH tragen?“, hatte sie die Mutter gefragt, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass die Tür zu Alfreds Zimmer offenstand. „Geht das so, was meinst du?“, fragte sie die Mutter wieder und wieder. Dabei drehte sie sich einmal nach rechts, einmal nach links, strich sich über die nackten Brüste und lockte: „Nicht schauen, Herr Alfred, Sie werden als junger Gentleman doch nicht schauen, gelt?“ Still hatte er die Impulse genossen, die das optische Erlebnis in ihm auslöste. Doch fortan war er dieser Frau ausgewichen. Meist entschuldigte er sich in sein Zimmer oder ging mit dem Hund Gassi, wenn sie zu Besuch kam und die Unterröcke rascheln ließ. Gleichzeitig versuchte die Mutter zu kuppeln. Wollte sie für Sohn eine Partnerin finden, so wie sie seinerzeit den ersten passenden Anzug für ihn gefunden hatte und die Anstellung bei der Versicherung?
Eine Windböe riss die Schleife vom einzigen Kranz auf dem Karren. Alfred sah ihr hinterher und setzte die Inschrift aus den Puzzleteilen, die der Wind erkennen ließ, zusammen: „Letzte Grüße, in Liebe Dein Alfred“.
Allmählich begriff er: Er war bei der falschen Trauerfeier gewesen. Seine Uhr hatte ihn nicht im Stich gelassen, er war einfach zu früh vor Ort. Er hatte nicht damit gerechnet, dass an einem so wichtigen Tag wie dem Begräbnistag seiner Mutter auch noch anderen erlaubt wäre, begraben zu werden. Also war die alte Dame gar nicht seine Tante, und seinen Burberry würde er nie wiedersehen. Frau Stöger aber ließ ihm keine Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen. Mit der überflüssigen Frage: „Hast du keinen Schirm?“, nahm sie ihn unter ihr Großkaliber und konstatierte: „Wo bist du gewesen?“
Das Du in ihrer Rede und der Vorwurf im Tonfall ähnlich dem der Mutter alarmierten. Vor allem das Du. Wie um es von sich zu weisen, suchte er nach einem Satz, der mit einem Sie begann. Dabei war nicht mehr herausgekommen als: „Sie?“ Und danach ein: „Sie hier?“
„Wo sonst? So war wenigstens ein Mensch bei der Verabschiedung deiner Mutter.“
Wieder suchte Alfred nach einem Satz mit einem Sie vorneweg. Doch Frau Stöger ließ ihn nicht zu Wort kommen, plapperte von einem Mann, der sich im vollen Bus an sie herangedrängt hätte, dass sie seinen Atem hinter ihrem Ohr spürte, von Friedhofsgärtnereien, die viel teurer seien als solche an weniger absatzträchtigen Adressen, von den undankbaren Hausparteien in dem Mietshaus der Eders, von denen kein Mensch es der Mühe wert gefunden habe, Alfreds Mutter auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Wo sie doch so gut zu allen gewesen sei.
Alfred fiel beim besten Willen keiner ein, zu dem seine Mutter „so gut“ gewesen wäre. Im Gegenteil. Schon im Umgang mit den Nachbarn von früher war sie auf Distanz bedacht gewesen. Als ein Gutteil von ihnen wegstarb und Türken, Kurden und Afrikaner die Vakanz füllten, hatte sie von Distanz auf pure Verachtung umgeschaltet, auch gegenüber den verbliebenen Alteingesessenen, weil diese aus den Gegebenheiten das Beste zu machen versuchten und um ein gutnachbarliches Einvernehmen mit den Neuankömmlingen aus Entwicklungsländern bemüht waren. Weshalb also sollte das Lager der Verachteten Notiz von dem Begräbnis nehmen, noch dazu, wo Alfred keinen im Haus von dem Todesfall informiert hatte.
Endlich hatte der Sturm das Sargtuch an sich reißen können. Einer der Pompfinebrer grapschte danach und klemmte es sich unter den Arm. Diese schienen nur noch wegkommen zu wollen ins Trockene, und Alfred erkannte eine Gelegenheit, um durch einen Haken nach rechts die Stögerin loszuwerden. Allerdings verlor er nach ein paar weiteren Haken neuerlich die Orientierung. Endlich sah er ein Schild mit der Aufschrift Ausgang. Es führte zum anderen Ende des Friedhofs. Dort stand abfahrtsbereit ein Taxi mit laufendem Motor. Alfred atmete auf. Er war durch und durch nass. Deshalb schnellstmöglich nach Hause, Heizung auf höchste Stufe und ein warmes Bad einlassen.
Nur mit Mühe konnte er sich aus den nassen Kleidern schälen. Trotzig wie ein kleiner Junge betrachtete er von der Wanne aus die Markierungen der gewollten Unordnung: Nasse Hose, Unterwäsche, Socken, alles verstreut auf den Badezimmerfliesen. Und keine Mutter weit und breit, die deshalb keifen würde. Er hatte die Badezimmertür hinter sich abgeschlossen, bevor er sich eines Besseren besann. Wozu abschließen? Die Wohnung gehörte ja nun einzig und allein ihm. Na gut, ihm und dem Hund Adolf, den er gleich nach dem Bad von der Hundesitterin abholen musste.
Er hatte den Dackel Adolf genannt, weil er irgendwann irgendwo gelesen hatte, dass Hitler ein anderer Mensch geworden wäre, hätte er statt der Schäferhündin Blondi so einen kleinen Terroristen besessen. Alfreds Hund übertraf sich in all den negativen Eigenschaften, die man Dackeln nachsagte. Er war lauter als der Dackeldurchschnitt, noch leichter reizbar, noch anmaßender und dazu hinterlistig und bissig. So war Alfred auf den Namen Adolf gekommen. Und um seine Mutter zu ärgern, die vehement für einen „Lumpi“ gekämpft hatte.
Mit geschlossenen Augen erinnerte er sich der Wortgefechte darüber. Danach döste er in der Wanne vor sich hin. Plötzlich hörte er, wie jemand einen Schlüssel im Schloss der Wohnungstür zweimal umdrehte, die Tür öffnete und wieder schloss. War es ein Spuk, mit dem sich die von ihm nicht verabschiedete Mutter rächte? Hatte sie vor, hier heute und in Zukunft herumzugeistern, oder war er des Wahnsinns? Alfred erinnerte sich, wie wehrlos er war, nackt in seinem Bade.
Just als er „Mutter, bist du’s?“ fragen wollte, rief eine Frauenstimme durch die Tür: „Ich komme!“
Er war nicht des Wahnsinns und es war nicht die Stimme der Mutter – sondern die der Stögerin. Seit Jahren schon war sie bemüht, Alfred anzufüttern. Mit ihren Reizen als Köder. Nicht, dass sie sich Großes dabei erwartet hätte. Der Sturkopf Alfred hatte ja doch nur seine Börsenberichte im Kopf. Und doch: Seine schnöde Ignoranz war ihr Ansporn und Ärgernis zugleich. Wär doch gelacht! Der Trotz war sozusagen der ideelle Teil ihres Vorhabens. Der materielle hatte den exklusiven Zirkel der Jägerschaft im Visier, für die Alfred als Versicherungsmakler und Anlageberater fungierte. Alles Männer von Stand, die mit beneidenswerter Regelmäßigkeit in den Seitenblicken des ORF Austern oder Champagner schlürften. Es klang wie ein Widerspruch, und doch war es Tatsache: Zu diesem exklusiven Zirkel hatte Alfred Zutritt. Der illustre Kreis der Austernschlürfer hielt ihn für eine Art Autisten mit der Sonderbegabung, ihr Anlagevermögen erfolgreicher zu vermehren, als Banken oder irgendwelche plakatierten Wachstumsversprecher das konnten. Über bessere Margen war er ihr Maskottchen in Geldsachen geworden.
Und Elvira Stöger hatte erkannt: Falls überhaupt, würde sie nur über Alfred einem aus der betuchten Jagdgesellschaft auffallen. Also musste sie ihn so weit bringen, sie zu einem der Halalis mitzunehmen. Sozusagen als Frau an seiner Seite. Sie kannte die Männer und wusste, dass ihre Vorzüge in Begleitung einer Null nur noch mehr auffallen würden. Wetten würden die Jäger darauf abschließen, wer sie als Erster abschießen könnte.
Und so stand sie jetzt vor Alfred, nackt, wie Gott sie schuf, und drall, wie der dosierte, aber doch regelmäßige Genuss von Likörbonbons sie über die Jahre hatte werden lassen. Er verkutzte sich vor Schreck am Badewasser, weshalb er nichts Rechtes herausbrachte. Sie aber sagte mit echtem oder gespieltem Ärger: „Willst du mich hier erfrieren lassen?“
Bevor er noch richtig begriff, war sie auf ihm. Da zwei Körper eine weitaus größere Wasserverdrängung hatten als einer, kam es rundum zu einer hässlichen Überschwemmung. Er besah das Durcheinander aus seinen Kleidern im übergeschwappten Badewasser und dachte: „Dieser Saustall wär das Ende der Mutter.“ Die Stögerin aber zeigte Routine. Mit beiden Händen griff sie nach der Stange des Handtuchhalters über ihrem Kopf. Sie fand Halt, hob ihren Schoss leicht an und nahm ihn mit kumpelhaftem Augenzwinkern in sich auf. Just in diesem Augenblick polterte jemand gegen die Tür und rief: „Aufmachen, Polizei!“
Er fühlte, wie sie erstarrte. Sie ließ den Handtuchhalter los, um ihn von sich zu stoßen. Darüber verlor sie den Halt und soff ab. Pustend kam sie wieder hoch, rang nach Luft und keuchte: „Was hast du angestellt?“
Indigniert stieg er aus der Wanne, schwang sich das Badetuch um die Lenden und stellte mit leichter Verärgerung fest, dass sie ihn noch immer oder schon wieder duzte. Dazu noch die Unterstellung, dass er etwas angestellt habe. Wie konnte sie nur? Zwei Ungereimtheiten, die der Klärung bedurften. Rechnete man das polternde Erscheinen der Polizei hinzu, waren es drei.
Mit dem Ruf: „Ich komme!“, schlüpfte er in seine Badeschlappen und ging ab, um die Wohnungstür zu öffnen.
2
Eine Frau, sportlicher Typ, irgendwo zwischen dreißig und fünfzig – wer konnte das Alter gepflegter Damen im Bereich dieser Jahresringe schon annähernd genau einschätzen? – hielt Alfred flüchtig eine Ausweiskarte unter die Nase, fixierte das Brustgeschirr der Stögerin an der Garderobenwand und sagte mit spöttischem Unterton: „Oh, Sie haben Besuch.“ Und zu dem Uniformierten hinter ihr gewandt meinte sie in sachkundigem Tonfall: „Die Dame trägt Schwarz.“
Alfred errötete.
„Sind Sie Alfred Eder?“, fragte sie weiter.
Der so Angesprochene sah völlig überfordert aus dem kleinen Stück Wäsche, das er sich um die Lenden gewickelt hatte.
Die Polizistin wertete sein Schweigen als ein Ja und fuhr fort: „Am besten Sie ziehen sich an und kommen mit. Wir haben nämlich ein paar Fragen.“
„Ja, aber …“, stotterte Alfred verständnislos.
„Machen Sie schon, wir warten einstweilen hier im Stiegenhaus. Sie werden uns doch nicht aus dem Fenster springen wollen? Falls doch, bedenken Sie: vierter Stock.“
Alfred lehnte die Wohnungstür halb zu und öffnete die in das Bad. Die Stögerin hatte sich von dem Schrecken erholt, stand unter dem Brausekopf und duschte, als ob nichts geschehen wäre.
Alfred sagte nur: „Sie verzeihen“, nahm Kamm und Bürste von der Ablage und eilte in sein Zimmer, um sich anzukleiden.
„Ich gehe jetzt“, sagte er dann in Richtung Bad und ließ sich von der wortführenden Polizistin und deren Kollegen in die Mitte nehmen.
Im Polizeikommando stellte sie sich vor: „Kontrollinspektorin Ilse Strasser. Bitte nehmen Sie Platz, ich mache uns erst mal einen Kaffee.“
Alfred musterte den Schreibtisch der Frau und nahm innerlich Anstoß an dem Durcheinander darauf. Auf Ordnung und Organisation ließ das wenig schließen. Das alles passte ganz und gar nicht zum gestrafften Aussehen und dem schnörkellosen Auftreten der Frau Kontrollinspektorin. Er fand sie beachtlich. Umso mehr schämte er sich, beim Öffnen der Wohnungstür beinahe nackt vor ihr gestanden zu haben. Mit der Reizwäsche der Stögerin an der Garderobenwand hinter ihm.
Während die Polizistin in einer Ecke ihres Büros an der Melitta mit Schalen, Filter, Milchkanne und Kaffeedose hantierte, gab sie per Handy im Stakkatoton Anweisungen an die Adresse eines Untergebenen weiter. Schließlich kam sie mit einer dampfenden Tasse und einem länglichen Glas zu ihm zurück. Das Glas stellte sie vor ihm ab und meinte: „Tut mir leid, Sie müssen damit vorliebnehmen, die Tassen sind alle schmutzig. Doch keine Angst, das Glas ist dickwandig, Sie werden sich nicht die Finger verbrennen.“
Noch nie hatte Alfred so schöne Hände gesehen. Erst nachdem sie ihre Frage, ob er Zucker nehme, wiederholt hatte, lehnte er ab und trank von der schwarzen Brühe.
„Geht’s?“, fragte sie interessiert.
„Mhm.“
„Woher kennen Sie Agnes Brunner?“, fragte sie wie beiläufig weiter.
Alfreds Wangen liefen rot an.
„Schämen Sie sich etwa? Was ist schon dabei, Agnes zu kennen. Bloß weil sie Geld dafür nimmt, dass sie Männer an sich ranlässt?“
Alfred war erleichtert, dass sie nicht das hässliche Wort Nutte oder gar Hure gebrauchte, sondern die Zusammenhänge rein merkantilistisch beschrieb. Zu einer Antwort war er dennoch nicht fähig.
„Oder war es mehr als ein Kennen? Waren Sie vielleicht ihr Zuhälter?“
Alfred konnte sich auf Zuhälter keinen Reim machen.
„Oder sind Sie bloß ihr Mörder!“
Das war keine Frage mehr. Das kam wie ein Peitschenhieb, verfehlte aber sein Ziel. Denn Alfred war im Augenblick nicht bei der Sache. Ihm fiel ein, dass er bei seinem hastigen Abgang aus der Wohnung vergessen hatte, die Schlüssel einzustecken. Die Stögerin würde doch auf ihn warten und ihn nicht gar etwa aussperren?
Die Kontrollinspektorin konnte scheinbar Gedanken lesen und wurde ungehalten: „Sagen Sie, hören Sie mir überhaupt zu?“
„Bitte?“
„Schmeckt Ihnen mein Kaffee nicht?“
Da er wieder nichts sagte, nahm sie sein Glas und kippte den Rest Kaffee in die Spüle neben der Melitta-Maschine. Danach wählte sie eine Nummer und sagte in ihr Handy: „Komm herüber. Ich habe etwas für die Spurensicherung.“
Der Uniformierte aus dem Abholkommando kam, nahm das Glas und entschwand. Da meldete sich bei Alfred wieder dieses Zittern. Es begann mit einem Tremor in beiden Händen. Alfred versuchte ihm Herr zu werden, das Übergreifen auf den ganzen Körper zu unterdrücken. Umsonst.
Ilse Strasser beobachtete Alfreds Probleme, fragte sich besorgt, ob sie es mit einem Epileptiker zu tun habe, und wünschte, sie hätte Pfeiffer nicht weggeschickt. Das Sichern der Fingerabdrücke auf dem Glas hätte noch Zeit gehabt. Besorgt fragte sie: „Ist Ihnen nicht gut?“
„Nein, geht schon“, brummte Alfred, und tatsächlich hatte das Zittern nachgelassen.
„Sie fragen sich vielleicht, was jetzt mit dem Glas geschieht, das da eben durch die Tür in den Kriminaltechnischen Dienst abging. Also: Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Und die beschäftigen jetzt unseren Computer, und danach werden wir ja sehen. Ich will nämlich ganz genau wissen, mit wem ich es zu tun habe. Inzwischen plaudern wir ein wenig. Einverstanden? Also, woher kennen Sie Agnes Brunner?“ Die Strenge im Ton klang nicht nach einer beginnenden Plauderstunde.
„Ich habe sie durch meine Mutter kennengelernt.“
„Lauter.“
„Ich habe sie durch meine Mutter kennengelernt.“
„Durch Ihre Mutter?“ Ilse Strasser setzte sich wieder hin. Nach einer kurzen Pause bohrte sie weiter: „Ist ja interessant. Erzählen Sie.“
Und Alfred bemühte sich, einen roten Faden für seine Geschichte zu finden. Es sei vor zwei Jahren gewesen, stotterte er. Seine Mutter habe ihm einen Zettel mit einer Adresse gegeben. Mit der Bitte, einer Dame drei Flaschen Holunderlikör zu bringen, die diese bestellt habe.
„Holunderlikör?“
„Ja, Mutter sammelt immer im Sommer Holunder und macht daraus Likör, den sie dann verkauft. Angeblich bekommt man keine Grippe, wenn man rechtzeitig vor dem Winter regelmäßig davon trinkt. Sie hat eine ganze Menge begeisterter Kunden.“
„Also Holunderlikör. Und weiter?“
„Das habe ich gemacht.“
„Was haben Sie gemacht? Und etwas genauer, wenn ich bitten darf.“
Alfred lief rot an und sah zu Boden.
„Hören Sie zu, Herr Eder. Wir sind hier nicht zum Spaß. Sie sagen mir jetzt genau, was Sie bei dieser Agnes oder mit ihr gemacht haben und wann das war, kapiert?“
„Ich bin mit dem Holunderlikör zu ihr gegangen und habe ihn mit einem schönen Gruß von meiner Mutter übergeben.“
„Und dann?“
„Die Dame, also Agnes war sehr freundlich, hat mich in die Wohnung gebeten und mich gefragt, ob ich sie nicht lieben wolle.“
„Lieben, tatsächlich?“ In der Stimme der Polizistin lag Spott.
„Aber so war’s.“
„Und?“
„Ich dachte, sie wollte sich über mich lustig machen, aber sie begann, sich auszuziehen.“
„Und da haben Sie sich auf sie gestürzt?“
„Aber wo. Doch Agnes sagte: ‚Komm doch, mein Kleiner. Mach deiner Mutti die Freude.‘“
„Das hat sie gesagt?“
„Ja, hat sie. Und sie hat mir gesagt, ich solle sie Agnes nennen. Erst danach hat sie mir erklärt, meine Mutter mache sich Sorgen, weil ich kein Interesse für Frauen zeige.“
„Das hat sie danach gesagt.“
„Ja, danach.“
„Wonach?“
Alfred wurde wieder rot im Gesicht und sagte ergeben: „Sie wissen schon.“
Ilse Strasser konnte es kaum glauben. Ein ausgewachsenes Mannsbild, vielleicht etwas fett um die Mitte herum, beruflich vielleicht sogar recht erfolgreich, sprach wie ein Vierzehnjähriger, der beim Pornoschauen überrascht worden war. Oder hielt er sie bloß zum Narren?
„Wann genau war das?“
„Vor nicht ganz zwei Jahren.“
Die Kontrollinspektorin schien aus irgendeinem Grund enttäuscht zu sein, bohrte aber nach einer Art Verlegenheitssekunde weiter: „Und wer war die Frau, die bei Ihnen war, als wir Sie abholten?“
„Die Stögerin.“
„Aha, die Stögerin.“
„Ja, Frau Stöger, eine Freundin meiner Mutter.“
„Ach, schon wieder Ihre Mutter. War sie von der Nummer mit Agnes Brunner nicht überzeugt gewesen?“
„Meine Mutter ist tot“, sagte Alfred traurig.
„Das tut mir leid. Wann ist sie gestorben?“
„Vorige Woche. Heute Vormittag war das Begräbnis.“
„Und danach war Leichenschmaus, und da haben Sie sich gedacht, jetzt nehme ich mir noch schnell die Stögerin vor, oder wie?“
Alfred war dem Weinen nah. „Nein, sie kam einfach in mein Bad.“
„Haben Sie aber ein Glück bei den Frauen. Geht das schon länger so?“
„Nein. Agnes nannte mich ‚meine Jungfrau‘.“
Pfeiffer kam herein, wechselte einen Blick mit seiner Vorgesetzten und sagte: „Auf den ersten Blick sauber“, und setzte sich dazu.
Ilse Strasser nahm den Faden wieder auf: „Also, wo waren Sie heute Vormittag zwischen acht und zehn Uhr?“
„Da war ich bei meiner Hundesitterin, um ihr Adolf zu bringen.“
„Adolf?“
„Ja, mein Dackel. Ich bin nämlich Jäger.“
„Ach, Sie sind Jäger. Sie ballern also gerne in der Gegend herum.“
„Ich hasse das Ballern.“
„Warum dann Jagen?“
„Beruflich, nur beruflich.“
„Ach, Sie sind hauptberuflicher Jäger?“
„Nicht ganz. Ich gehe als Versicherungsangestellter sozusagen beruflich jagen.“
„Gehört Jagen neuerdings zum Hauptgeschäft von Versicherungskonzernen?“
„Aber nein. Ich war damals als Außendienstmitarbeiter ziemlich unter Druck, weil ich zu wenig brachte.“
„Das ist das Erste, was ich Ihnen vorbehaltslos glaube, Herr Eder“, sagte die Polizistin und lehnte sich entspannt zurück.
„Ja, und mein Kollege, Herr Semmelweis, der damals auf Altersteilzeit umstieg, wollte mir aus der Patsche helfen. Nicht um mir einen Gefallen zu tun, wie er sagte, sondern um der Greilinger eins auszuwischen. Denn die hatte mich in den Außendienst abkommandiert. Sie hatte gemeint, dort könne ich nur versagen, und so würde sie mich über kurz oder lang loswerden. Das hat sie mir auch so ins Gesicht gesagt.“
„Wer ist die Greilinger?“
„Grete Greilinger, meine Abteilungsleiterin.“
„Gut, weiter.“
„So kam ich zum Klientel des Kollegen Semmelweis. Beste Adressen. Alles Jäger, aber gute Kunden. Versichert werden müssen Jagdhütten, Waffen, Hunde, Jagdfahrzeuge und jede Menge Haftpflicht. Darüber hinaus ist ja die Länderversicherung über die Hypo im Investmentgeschäft aktiv geworden. Und vermögend sind meine Jäger auch. Sehr sogar. Also komme ich auch als Anlageberater ins Geschäft. Das Verfolgen von Aktienkursen war schon immer mein Steckenpferd. Meine Kunden haben im Schnitt zuletzt 13,8 Prozent an den von mir empfohlenen Transaktionen verdient. Im Jahr davor waren es 19. Wohlgemerkt, im Schnitt, also alle Gewinne addiert, Verluste abgezogen und geteilt durch die Kopfzahl. Damit war ich Viertbester von einhundertzweiundsechzig Anlageberatern bundesweit.“
Ilse Strasser registrierte, dass er über seine Geschäfte in einem veränderten, viel trittfesteren Ton sprach, sich beinahe ereiferte, als ob er von seinem Lieblingsspielzeug spreche. Dennoch hatte sie Zweifel: „Wie haben Sie das hingekriegt?“
„Dank meiner Mutter.“
„Aha. Schon wieder Ihre Mutter.“
Alfred merkte nicht den Spott in Ilse Strassers Worten, fand im Gegenteil, dass es sich mit der Frau mit den wunderschönen Händen gut plaudern ließ: „Da haben Sie recht. Um sich Zugang zu verschaffen, musste die Jagdprüfung bestanden werden. Sie hat mich dafür angemeldet, mit mir gebüffelt, mich abgehört, Adolf besorgt und mich grün eingekleidet. So wurde ich Weidmann. In dieser Beziehung war Mutter schon gut“, sagte er bar jeder Trauer, ja sogar mit leichtem Vorwurf im Unterton, den Ilse Strasser herauszuhören glaubte.
„Aber für den großen Weidmann reichte es nicht, oder?“
„Nein. Mir wird schlecht, wenn ich Blut sehe. Das merkt auch Adolf. Deshalb verachtet er mich.“
„Ein Kollege?“
„Aber nein, mein Dackel. Eine bösartige Kreatur, bissig und laut.“
„Adolf mag Sie also nicht?“
„Gott, ein Dackel eben. Die sind angeblich alle so. Die Jägerschaft aber meint, Adolf sei ein Prachtexemplar, mutig beim Aufspüren von Wild und flink wie ein Wiesel im Unterholz. Ich werde manchmal richtig beneidet.“
„Warum verkaufen Sie ihn dann nicht einfach?“
„Kollege Semmelweis meinte und meint heute noch, den Dackel brauche ich vor der Jagdgesellschaft als Statussymbol.“
„Und heute früh haben Sie den Dackel Ihrer Hundesitterin übergeben. Wann genau?“
„So gegen acht.“
„Und die Hundesitterin kann das bezeugen?“
„Natürlich.“
Das Telefon läutete. Ilse Strasser hob ab und unterhielt sich mit dem Anrufer über irgendwelche Vorgänge. Alfred hörte nicht hin. Vielmehr wunderte er sich über seine Gesprächigkeit. So viel wie in den letzten Minuten sprach er sonst in Tagen nicht. Wie hatte es diese Frau geschafft, diesen Redeschwall in ihm loszutreten? Er musterte sie genau. Das schwarzglänzende Haar, straff zurückgekämmt, der markante Schnitt ihres Gesichts, der kluge Blick aus zwei grüngrauen Augen. Sie hätte ein besseres Modell für das Shampoo auf dem Plakat zwischen den Spiegeln seines Friseurs abgegeben als jenes, das dafür posierte. Und dazu ihre feingliedrigen Hände. Die farblos lackierten Fingernägel reflektierten das Licht der Deckenlampen, während sie in das Telefonkabel Locken drehte. Er sah nur die bewundernswerte Erscheinung vor sich und ahnte nicht, wie durchtrainiert und angriffslustig sie war.
Ilse Strasser legte auf und wandte sich wieder ihm zu: „Also, dann schreiben Sie uns mal Ihren vollen Namen, geboren wann und wo, Namen von Vater und Mutter, den Geburtsnamen der Mutter und Ihre genaue Adresse auf dieses Blatt Papier hier.“
Er tat, wie geheißen, sie nahm den Zettel entgegen, reichte ihn dem Kollegen weiter, worauf sich dieser erhob und abging. Danach lehnte sie sich zurück und musterte Alfred aus halbgeöffneten Augen.
„Wollen Sie nicht wissen, was mit Agnes Brunner geschehen ist?“
„Wieso, was ist mit ihr geschehen?“
„Sie wurde vergiftet. Vielleicht mit Holunderlikör. Genaues wissen wir erst, wenn unser Gerichtsmediziner ihren Mageninhalt analysiert hat.“
Jetzt zitterte Alfred von oben bis unten und wurde blass. Was sie erstaunte. Vom Ableben seiner Mutter hatte er gesprochen, als ob er den Wetterbericht verlesen würde, doch die Nachricht vom Tod dieser Liebesdienerin schien ihn zu erschüttern. Vielleicht, weil er der Täter und sie dabei war, ihm das zu beweisen? Spielte er ihr etwas vor? War alles an ihm, jedes seiner Worte nur Maskerade?
„Kann ich jetzt gehen?“, sagte der Erblasste unvermittelt und schien mit Atemproblemen zu kämpfen.
Ilse Strasser hatte dafür nur ein „Wo denken Sie hin!“ über und entschied: „Gehen Sie doch mal ans Fenster. Ein wenig frische Luft wird Ihnen guttun.“
Schwer seufzend stand Alfred auf, tat, wie geheißen und atmete tief durch. Der Regen hatte aufgehört. Es roch ein wenig nach faulem Ei, wie in so vielen Teilen des Zentrums von Baden. Doch von der Waldandacht wehte es nadelgrün herab und Alfreds Wangen nahmen wieder Farbe an.
Inzwischen war der Polizist mit dem Zettel zu Alfreds Personalien wieder auf seinem Platz und redete auf die Kontrollinspektorin ein. Als Alfred nähertrat, verstummte er vielsagend und lehnte sich weit zurück. Seine Körpersprache schrie die Verachtung für Alfred geradezu heraus. Ilse Strasser aber meinte: „Ok, ein Tapetenwechsel und ein wenig frische Luft wird uns allen guttun. Kommen Sie, Herr Eder, auf geht’s in die Wohnung von Agnes Brunner. Sie werden sich dort für uns umschauen und uns sagen, ob etwas fehlt und ob sich etwas seit Ihrem letzten Besuch dort verändert hat.“
Alfred musste das erst einmal verdauen. Wenn er sie richtig verstanden hatte, wollte sie, dass er sie zu Agnes begleitete.
„Sie meinen, ich soll …?“
„Keine Sorge, das Opfer ist schon in der Gerichtsmedizin. Also handelt es sich bloß um einen kleinen Gefallen, und den werden Sie mir doch sicherlich gerne machen, Herr Eder. Sie wollen doch auch, dass wir den Täter zu fassen kriegen, bevor er noch einmal zuschlägt.“
Alfred registrierte, dass ihr Blick etwas hatte, das Neinsagen unmöglich machte. Offensichtlich kannte sie die Wirkung ihres Blicks aus unzähligen Erfahrungen und hatte schon nach ihrer Lederjacke gegriffen.
„Komm, Pfeiffer“, sagte sie zu ihrem Kollegen und ergänzte für Alfred: „Übrigens, Abteilungsinspektor Leo Pfeiffer, mein Mitarbeiter.“
„Sehr erfreut“, log Alfred und deutete eine Verbeugung in dessen Richtung an. Der hatte sich aber schon abgewendet, um seine Uniformjacke zu holen.
Im Auto suchte die Kontrollinspektorin Blickkontakt mit Alfred durch den Rückspiegel: „Wissen Sie, Kollege Pfeiffer ist im Kriminaldienst, wie ich. Für gewöhnlich trägt er also keine Uniform. Nur wenn wir Adressen abklappern. Das verschafft uns bei unseren Klienten mit islamischem Migrationshintergrund wenigstens etwas Respekt. Gegenüber einer Frau erlauben sich die ja alles, egal ob Polizistin oder nicht.“
Ihr Handy läutete. Obwohl sie den Wagen lenkte, hob sie ab, horchte hinein, sagte: „Aha“, und danach: „Nicht jetzt“, und legte auf.