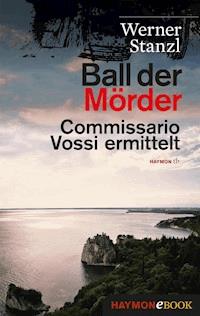Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sie ließen Superjachten auf den Weltmeeren verschwinden und die österreichische Montana-Maritim-Bank dafür bezahlen. Sie kassierten bei dem Geldinstitut 40 Millionen für Baugenehmigungen auf Inseln, die es gar nicht gab, und überließen der Bank Immobilien als Sicherstellung, die ihnen nicht gehörten. Der Politiker aus Wien sprach kryptisch von montenegrinischen Piraten. Kein Wunder, dass Commissario Bruno Vossi ihn nicht gleich beim Wort nahm. Denn keine Bank würde sich so einfach um Millionen prellen lassen. Doch jetzt liegt der Wiener in seinem Kingsize-Bett in der Edelabsteige von Grado - erdrosselt mit einer Seidenschnur. Neben ihm die Karte eines renommierten Londoner Detektivbüros, dessen wichtigstes Zugpferd steifgefroren an einem Fleischerhaken im Kühlhaus des Marktamtes hängt. Commissario Bruno Vossi steht am Anfang komplizierter Ermittlungen und schon spürt er den Flügelschlag der Geier, die sich beim Kehraus der Montana-Maritim um das millionenschwere Aas der Bank zerfleischen ... Erstmals erschienen unter dem Titel "Hintermänner"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Werner Stanzl
Mord mit fünf Sternen
Commissario Vossi ermittelt
Generaldirektor Doktor Wolfram Kummer von der Montana-Maritim-Bank saß im Executive-Room des Luxushotels über dem Wörthersee und sah der Realität ins Auge. Alle Zeichen standen auf Niederlage und Schmach. Sein Abrutschen könnte in einen freien Fall übergehen – hinein in ein Loch mit schwedischen Gardinen. Nach oben war es nicht ganz so schnell gegangen: Vom Benjamin zum Generaldirektor war ein steiler und korrumpierender Weg gewesen mit teils fragwürdigen Seilschaften. Aber er hatte ihn mit Bravour und unter allgemeinem Beifall geschafft. Doch jetzt, da die Zeichen auf Sturm standen, mutierten die, die eben noch applaudiert hatten, zu Besserwissern. Sogar die Bosse der Konkurrenz lachten über ihn. Dabei wusste er, wussten sie, wie schlecht es auch um ihre Banken stand. Hatten nicht sie alle im Ende des Kalten Krieges und im Zerfall des Ostblocks die Chance gesehen, Big Business zu machen? Eine solche politische und ökonomische Weichenstellung zugunsten der Österreicher würde es nie wieder geben, da war man sich einig gewesen. Ein plötzlich offener Markt von Millionen ausgehungerten Konsumenten des Sowjetlagers, die kaum mehr besaßen als Deutsche und Österreicher seinerzeit nach dem Weltkrieg, und eine Industrie, die darniederlag, schrien doch förmlich nach Banken. Wenn das nicht eine Chance auf eine Wiederholung des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit war, was dann? Mit Österreich in der Poleposition. Die Deutschen hatten sich doch mit den Kosten der Wiedervereinigung beinah übernommen. Also würden sie bei dem Rennen gar nicht antreten können. Und so öffnete sich ein Markt vor der Haustüre Österreichs, ohne dass der große Bruder mit breiter Brust alles an sich riss. Einmalig! „Also immer nur rein, Wolfram“, hatte sich Kummer gesagt. Und immer nur rein, Wolfram, hatten alle gesagt, die etwas zu sagen hatten. Seine Bank war bloß die erste, der die Luft ausging. Denn mit den deutschen Banken waren auch die deutschen Konzerne zu Hause geblieben. Warum sollten sie in Dalmatien, in Serbien oder sonst wo zwischen Tatra, Balkan und Karpaten investieren, wenn jede Mark in den neuen Bundesländern gute Rendite bei besseren Sicherheiten versprach? Damit war klar: Doktor Kummer hatte sich verrechnet – und zwar schwer.
Und da saß er nun. Wenn der Aufbau von Filialen in Slowenien, Kroatien und die Gründung von Montana-Maritim-Töchtern in den Zentren des ehemaligen Ostblocks kein Flop sein sollte, hieß es durchstarten und Einheimische, sogenannte Natives, mit Krediten und Leasingangeboten bedienen. Dazu brauchte er Fremdkapital zu günstigsten Bedingungen. An das kam er aber nur, wenn der Eigentümer, also das Land, Haftungen übernehmen würde. So wartete er nun auf den Landeshauptmann. Von seinem Ja oder Nein hing Kummers Zukunft ab. Denn die Bank gehörte dem Land.
Der Landeshauptmann betrat ohne Begleitung den Raum. Ein positives Zeichen. Der Landesvater – eigentlich war er für dieses Etikett zu sehr „Burschi“ – lehnte sich, wie das seine Art war, in schlampig blasierter Haltung zurück und musterte Doktor Kummer mit halb offenen Augen. Den Bericht zur misslichen Lage schien er zu genießen. Auch beim Wort Landeshaftung zuckte es nicht in dem zerknitterten Gesicht über jugendlich durchtrainiertem Körper. Nach dem misslichen Vortrag war es eine Weile vollkommen still im Raum. Danach richtete er sich im Sessel auf und resümierte:
„Sie sind also dabei, die Bank gegen die Wand zu fahren. Rettung ist nur möglich, wenn ich eingreife. Habe ich das richtig verstanden?“
Doktor Kummer versuchte das übliche Blabla: „Die politischen Entwicklungen entsprachen nicht ganz unseren Erwartungen und …“
„Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen aus der Patsche helfen. Die Maßnahmen dafür brauchen etwa acht Wochen. Haben wir so viel Zeit?“
„Auch mehr. Noch brennt es nicht.“
„Gut. Also, zuerst brauche ich von Ihnen eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache. Ich werde jedenfalls keinen Ihrer Posten hinterfragen.“
„Verstehe.“
Der Landespolitiker wiederholte sich: „Dennoch, ich betone nochmals: Ich werde keine Posten hinterfragen. Sie haben also Gestaltungsspielraum.“
„Alles klar.“
„Gut. Was also das Zahlenwerk betrifft, verlasse ich mich auf Ihre Kreativität. Schließlich waren Sie ja auf den besten Schulen für Bilanzgestaltung. Eine kleine Warnung nur: Übertreiben Sie es nicht! Meine Abgeordneten mögen ihre intellektuellen Grenzen haben, aber ausgesprochen blöd sind sie auch wieder nicht. Leider habe ich einen hellwachen Landesrat für Finanzen. Den werde ich ersetzen. Ich weiß auch schon, durch wen, durch mich. Ich werde das Ressort an mich ziehen. Unter uns, ich habe für diese Regierungsperiode und für die nächste nämlich noch viel vor. Manches davon wird Finanzierung brauchen. Ich bin sicher, wir verstehen uns.“
Damit reichte ihm der Landeshauptmann die Hand: „Für die Zukunft, Kummer, beachten Sie bitte: im persönlichen Gespräch und vor Dritten nur Erfolgsmeldungen. Schlechte Nachrichten und Hilferufe ausschließlich über meinen speziellen Adlaten. Er wird sich bei Ihnen unter Nennung des heutigen Datums als Losungswort einführen. Noch etwas: Es gibt bei mir in der Landesregierung einen abhörsicheren Raum. Fakten und Zahlen vertraulicher Natur nur dort. Ich werde nämlich beschattet und abgehört und muss mich deshalb dieser lästigen James-Bond-Spielereien bedienen. Nochmals, ich werde im Landtag für die Haftungen sorgen. Wie gesagt: Zeitfenster acht Wochen – und eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Schaffen wir das?“
Doktor Kummer meinte erleichtert: „Jawohl, schaffe ich.“ Damit war das durchgestanden. Der Bankchef überdachte die fälligen Maßnahmen. Erster Schritt für eine bessere Bilanzfrisur: 80 Prozent der faulen Kredite raus aus den Miesen, so aufstellen, als ob sie von den Kreditnehmern noch bedient würden. Zweiter Schritt: detto mit den Leasingposten. Dritter Schritt: Ausdehnung der Geschäfte durch Kreditvergabe an die eingeborenen Habenichtse der Ostblockstaaten. Sie würden Kredite bekommen und sie würden kaufen wie die Wilden. Sie würden Leasingangebote bekommen und zuschlagen wie die Verrückten. Damit würden Händler investieren und ebenfalls bei ihm um Kredite Schlange stehen. Und seine Bilanzsumme würde sich aufblähen wie ein Buchtelteig. Doch Doktor Kummer war auch klar: Damit ließ sich nur Zeit gewinnen.
In Grado tauchte die erste wirklich kräftige Frühlingssonne hinter dem Schilfgürtel ins Meer. Spektakulär. Und ja, es war ein ungewöhnlich warmer, beinahe heißer Tag gewesen, aber noch lange kein Badetag. Zudem kühlte es bereits ab. Für die Einheimischen älteren Semesters Zeit, sich Pullover oder Blousons für die Flaniermeile am Strand überzuziehen. Die etwas zu laute Gruppe hellhäutiger Twens männlichen und weiblichen Geschlechts scherte die fallende Temperaturkurve jedoch scheinbar wenig. Sie schälten sich aus ihren Kleidern, spornten sich in lauten Zurufen an und liefen in großen Schritten über den Sand in Richtung Wellen. Die meisten Strandbummler ärgerte das Gejohle und Geschrei, doch der eine wie der andere männliche Spaziergänger putzte seine Brillen. Nach dem langen Winter und dicken Pullovern waren die jungen Schönheiten – fast durchwegs oben ohne – ein echter Hingucker.
Die ersten Twens hatten inzwischen die Wasserlinie im Sand erreicht. Empört spritzte und schäumte die eben noch ruhig daliegende Adria unter ihren Tritten auf.
Hannelore aus dem bayerischen Piding fand das Wasser arg kalt. Sie war aber Schlimmeres gewohnt. Etwa, wenn nach dem letzten Rüscherl auf der Terrasse des Seewirts von Bad Reichenhall Abkühlung angesagt war, um den Blutalkohol abzusenken. Denn vor der Einfahrt in die Salinenstadt lauerten abends die Bullen.
Um Verkehrskontrollen brauchte sich Hannelore hier nicht zu kümmern. Ihr Hotel war gleich hinterm Strand. Das Einzige, was bei diesem Bad störte, war der Sand. Die Strandduschen waren ja im März noch nicht in Betrieb. Und Sand in der Hose, zwischen den Beinen, zwischen den Zehen, war für Lore ein „Igitt“. Da aber alle dem Vorschlag gefolgt waren, die neue Badesaison zu eröffnen, wollte sie nicht ausscheren. Zumal sie am Nachmittag ohnehin schon blöde Sprüche hatte hören müssen, weil sie sich nach dem fünften oder sechsten Prosecco weigerte, weiterhin Alkoholisches in sich hineinzuschütten.
Endlich hatte sie eine Tiefe erreicht, die es ihr ermöglichte, abzutauchen. Sie hielt dabei wie immer die Augen offen. Die Blindheit geschlossener Augen unter Wasser fand sie irgendwie beängstigend. Zu sehen indes gab es hier wenig. Etwas Graszeugs und Wolken von Sandkörnern, die in den Gezeiten schaukelten. Einer der Gruppe musste sie überholt haben. In der trüben Suppe nahm sie nur einen Schatten wahr und eine leichte Berührung. Sie tauchte auf und spürte eine Last auf ihrem Scheitel. Sie schüttelte ihren Kopf in hysterischen Linksrechtsdrehungen, worauf eine fremde Hand auf ihre Schulter patschte. Sie gehörte zum aufgequollenen Gesicht eines Mannes, der sie mit dem Blick eines toten Fisches anstarrte. Hannelore wollte schreien, verschluckte sich und konnte nur wild um sich schlagen.
Die Spaziergänger auf der Flaniermeile waren inzwischen von Nachrückenden abgelöst worden. Einer von ihnen erklärte seiner Frau die Leuchtfeuer der Hafeneinfahrt, deren Blinken man in der Abenddämmerung bereits deutlich erkennen konnte. Plötzlich rannte er los in Richtung Wasser und rief den Schwimmern zu, zu helfen. Sein Tonfall und seine Gesten ließen keinen Zweifel am Ernst der Lage. Eine Passantin hob ihr Fernglas. Sie sah die junge Frau draußen im Meer. Neben ihr schwappte irgendein Bündel mit dem Gang der Wellen auf und nieder.
„Da ist Treibgut“, sagte sie zu sich selbst. Und dann: „Ein Ertrunkener.“
Commissario Bruno Vossi saß auf seiner Terrasse auf dem Hügel über Gorizia und las Texte, die er aus dem Internet herausgesucht hatte. Für den Sommer hatte er eine Kulturreise durch Deutschland angesagt. Er wollte mehr erfahren über die Zeit der historischen Einheit der deutschen Länder mit Italien unter Ottonen und Staufern. Er interessierte sich für Geschichte so wie andere für Inter Mailand, den FC Roma oder Juventus Turin. Jetzt las er: „Otto I., ostfränkischer König, heiratete Adelheid von Burgund 951 in der lombardischen Königsstadt Pavia und übernahm die langobardisch-italienische Königswürde …“
Vossi nahm seine Reisenotizen zur Hand und schrieb. „1. Stopp, Pavia, Dom.“
Da meldete sich sein Assistent Roberto Vialli und keuchte ins Telefonino: „Wir haben einen Toten am Strand von Grado. Könnte Opfer eines Verbrechens sein, sagt der Forensiker.“
„Gut, hol mich ab.“
Die beiden ernteten böse Blicke der Spaziergänger, weil sie das Fahrverbot auf dem Uferweg missachteten. Ein Absperrposten der Polizia winkte sie durch einen Ring Neugieriger, dann sahen Vossi und Roberto die Bescherung. Im Sand lag die Leiche eines jungen Mannes, irgendwo zwischen ausgezehrt und halb verhungert, mit zerfetztem Unterleib. Offensichtlich hatte ihn eine Schiffsschraube aufgerissen, als er im Wasser trieb. Auffällig die extreme Hagerkeit des Toten. Drogensucht?
Dottore Stefano Lamberti von der Forensik, für Bruno Vossi aufgrund ihrer gemeinsamen Herkunft aus Istrien stets nur Stipe, slowenisch für Stefan, nahm seine Brille ab und begrüßte den Commissario: „Trieb wohl schon seit Tagen im Wasser. Vielleicht beim Schwimmen ertrunken.“
Vossi schüttelte sich: „Schwimmen, jetzt? Zu dieser Jahreszeit? Und in Jacke und Hose?“
„Warum nicht. Vielleicht ein Tourist, der volltrunken das Nasse suchte, um wieder klar zu werden.“
„Stipe, ich bitte dich!“
„Oder vom Boot gefallen.“
„Wie ein Seemann oder Freizeitkapitän ist er aber nicht gekleidet. Also müssten andere an Bord gewesen sein, die Alarm geschlagen hätten.“
„Vielleicht von einer Fähre.“
„Vielleicht. Warten wir’s ab. Fremdeinwirkung?“
„Nicht vor morgen früh, Bruno.“
„Und bitte schau nach, ob du Einstiche siehst. Er schaut mir aus, als ob er zuletzt nur von Drogen gelebt hätte.“
„Willst du mir meinen Job beibringen?“
„Stipe, du weißt, dass es so nicht gemeint war. Mich schüttelt es nur immer aufs Neue, wenn ich einen Suchtl im Endstadium sehe.“
Zwei Stunden später, Vossi war schon wieder zu Hause beim Abendessen, meldete sich Alberto Bettini, der Chef der Spurensicherung. Er teilte mit, dass der Tote nichts in den Taschen gehabt hatte.
„Wie viel ist nichts, Alberto?“
„Nichts bedeutet so viel wie gar nichts, absolut nichts, totale Fehlanzeige.“
„Das ist aber komisch. Denk mal nach, Alberto, wie oft hast du nichts, also absolut gar nichts in deinem Hosenbund und deinen Rocktaschen?“
„Das kann schon vorkommen, denn meist bin ich pleite. So long, Bruno.“
Und Alberto hatte aufgelegt. Noch wusste Vossi nicht viel, eigentlich gar nichts, aber er war sich sicher: Es handelte sich um Mord.
„Erwürgt“, triumphierte Dottor Lamberti am nächsten Morgen.
„Ich wundere mich immer, welche Freude dir so eine menschliche Tragik machen kann“, brummte Vossi.
„Ich freue mich nicht über das Schicksal des Opfers, Bruno, sondern darüber, dass ich dich auf Trab halten kann. Du vergräbst dich sonst zu sehr in deinen Geschichtsbüchern. Wie weit bist du denn?“
„Deutsches Mittelalter“, antwortete Vossi ungewollt.
„Na, da hast du ja noch eine schöne Strecke bis zur Gegenwart. Gratuliere.“
„Stipe, zur Sache bitte.“
„Ja, da haben wir etwas ganz Besonderes, mein lieber Bruno. Erwürgt, aber nicht einfach so. Nein, mein Lieber. Die Würgespur war so dünn, dass wir sie gestern im Dämmerlicht am Strand nicht gleich bemerkten. Zum Glück aber wiederum so tief, dass die ganze Zeit kleinste Fasern haften blieben.“
Lamberti zeigte auf einen tiefen Ring um den Hals des Toten. Es hätte eine Hautfalte sein können, wäre er nicht so unnatürlich gerade verlaufen.
„Wie ein Schnitt.“
„Ja, wie ein Schnitt und absolut clean.“
„Warum ist er dann so hager?“
„Vielleicht ein Albaner. Doch nun zu etwas ganz Besonderem: Die Fasern von der Würgeschlinge sind reine Seide, alles hundert Prozent organisch, wie du und ich. Äußerst ungewöhnliches Material für ein Mordwerkzeug.“
„Ja und nein“, hielt Vossi dagegen.
„Wieso, was weißt du, was ich nicht weiß?“
„Die Osmanen exekutierten ihre glücklosen Heerführer und hochgestellte Persönlichkeiten mit reiner Seide. Kara Mustapha zum Beispiel. Der erfolglose Belagerer Wiens wurde für seine Niederlage vor den Stadtmauern mit einer Seidenschnur stranguliert. Was den Osmanen allerdings nicht genug war: Dem Glücklosen wurde nach der Exekution auch noch der Kopf abgetrennt, in eine Schatulle gepackt und dem Sultan am Bosporus präsentiert. Ob zum Beweis der Vollstreckung oder zur Genugtuung des Sultans, darüber streiten die Gelehrten.“
„Wann war das?“, wollte Dottor Lamberti wissen.
„Das Erwürgen im Dezember 1683, die Niederlage in der Schlacht um Wien im September davor.“
„17. Jahrhundert also. Ich dachte, du bist in Geschichte erst beim Mittelalter?“
„Ob dem Toten hier auch der Kopf abgetrennt werden sollte, zur Genugtuung eines sehr mächtigen Auftraggebers vielleicht?“
„Du wirst es nie erfahren, Bruno. Ich sage dir, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun, das irgendwo da draußen auf See passiert ist, womöglich in internationalen Gewässern, vielleicht vor der Küste Sloweniens, Kroatiens, Korfus oder des Veneto. Jedenfalls außerhalb deines Bereichs. Leg ihn ab in deinem Aktenfriedhof der Namenlosen und vergiss.“
Vossi mochte seinen Freund Stipe Lamberti und schätzte ihn als Forensiker, aber manchmal fragte er sich, warum. Doch Stipe sollte recht behalten. Es war unmöglich, die Wasserleiche zu identifizieren, es gab keine Vermisstenanzeigen, die Bildsendung an Interpol erbrachte keine Meldung, der Akt verschwand in jenem Regal, das hausintern als „Friedhof der Namenlosen“ alle fünf Jahre mal durchforstet wurde, wenn Mörder vor Ort gerade eine größere Pause einlegten.
Der Bürgermeister und seine besorgtesten Lobbyisten, die Hotelbesitzer, atmeten auf, als sie hörten, dass der Fall ruhte. Mord war nicht gut fürs Geschäft.
Der grobschlächtige Typ mit dem gebügelten Gesicht des Bösewichts aus einem pixeligen Computerspiel wartete an einem der Glastische des Restaurants am Fischereihafen auf die Rechnung. Er hatte sich mit einem Callgirl verabredet, dessen Nummer er vom Hotelportier gegen ein fürstliches Trinkgeld erhalten hatte. Die junge Frau saß ihm jetzt gegenüber. Der Portier hatte sie zutreffend beschrieben, als er sich seine beiden Hände beziehungsvoll vor die Brust hielt, um ihre Oberweite anzudeuten, und mit „blond“ komplettierte.
Glatko zahlte die Restaurantrechnung. Es war schon still geworden in dem Lokal, das einen Hinterausgang in einen Hof hatte, wo ihn die Puppe als Vorschuss für die Nacht schon einmal bedienen könnte. So sein Plan. Vielleicht würde sie dabei jemand überraschen. Für ihn ein zusätzlicher Reiz. Er brauchte das geradezu. Ob als Anlass, den Entdecker dafür spitalsreif schlagen zu können, darüber hatte er noch nie nachgedacht. Bevor er aber mit der Blondine zur Sache kommen konnte, schlug sein Handy an. Es war der Oberst. Die Frau des Ministerpräsidenten, die blöde Kuh, hätte wegen irgendeiner Weibergeschichte durchgedreht und stünde nun als Patin für die morgige Schiffstaufe nicht zur Verfügung. Er möge für Ersatz sorgen, egal wie.
Glatko, der Frauen nur nach jung, alt, schön, hässlich, sexy oder mau einzuschätzen wusste, musterte das Callgirl und sagte: „Kein Problem, ich habe schon einen Ersatz.“
Er stand seinem Chef gerne zu Diensten. Schon im Durcheinander des jugoslawischen Bürgerkriegs waren sie ein Team gewesen. Er als Mann fürs Grobe seines Obersten, eines Kommandoführers der alten Volksarmee. Mit dem Ende des Krieges galt es für beide, der Sinnlosigkeit des Tötens Sinn zu geben. Die Jagd nach dem Mammon bot sich dabei quasi an. Jede abgepresste Liegenschaft, jede durch Arglist, Lug, Trug und Einschüchterung gewonnene Million bot Befriedigung, Herren über die Opfer zu sein und über dem Gesetz zu stehen. Das war ihr neuer Krieg. Er wurde anders geführt, aber die Hemmungslosigkeit des Tötens, das Zuschlagen aus dem Hinterhalt und nicht zuletzt die Seilschaften mit den Veteranen, daran hatte sich nichts geändert. So blieben die beiden ein Team. Aus dem Genossen Oberst wurde der Chef, zuständig für Planen, Mehren und Wahren, Glatko oblag die Beseitigung von Hindernissen.
Hin und wieder überraschte er seinen Oberst durch Anfälle von Intelligenz. Etwa mit seiner Beschreibung des Unterschieds zwischen Krieg und Frieden: „Im Krieg laufen dir die Opfer davon, im Frieden laufen sie dir nach.“ Der Oberst verstand, was er meinte. Auch er war manchmal verblüfft von der Gier von Bankern, den Opfern seiner kriminellen Energie. Die in Klagenfurt waren allerdings eine für seine Absichten selten entgegenkommende Mischung aus Gier und Blödheit. Bedenkenlos hurten sie mit den zugetriebenen Edelnutten herum und ließen sich in allen möglichen Stellungen fotografieren. Kosten und Mühen, die er sich wahrscheinlich hätte sparen können. Sie lieferten ihm auch so bereitwillig Millionen in Form von Großkrediten und Leasinggeschäften, dass sie ihn bisweilen sogar damit verunsichern konnten. Hatte er es wirklich und tatsächlich mit Bankern zu tun, oder waren die auch nur Betrüger? Vielleicht solche, die, noch um eine Nummer größer als er, und die ihn legen wollten? Und wer trieb eigentlich zu den Deals? Die Banker oder die oft mit am Tisch sitzenden Provinzpolitiker, deren Häuptling er bis dato nicht so richtig einschätzen konnte? Unglaublich, wie der von den Seinen hofiert wurde, wie sie ihm nach dem Mund redeten und auf jeden Wink gehorchten. Von diesem Mann konnte er jedenfalls noch lernen.
Im Fischrestaurant von Grado begann man Tische abzuwischen und die Theke zu polieren. Diese Aktivitäten sollten den Gästen die Sperrstunde signalisieren. Glatko beendete das Telefongespräch mit seinem Chef. Auf die Idee, dass ein Callgirl als Patin bei einer Schiffstaufe nicht unbedingt die Idealbesetzung sein könnte, kam er erst gar nicht. Eine Frau wurde gebraucht. Da war seiner Einschätzung nach etwas Dekoratives in Blond und mit beachtlicher Oberweite immer noch besser als die dicke Nudel des Regierungschefs.
„Hol dir schnell von zu Hause was Tolles zum Anziehen, ich brauch dich morgen als Taufpatin“, sagte er zu ihr von oben herab.
„Als Taufpatin? Muss ich da katholisch sein?“
„Weiß ich nicht. Bist du’s?“
„War es mal. Ist es ein Junge oder ein Mädel?“
„Blöde Gans, ein Schiff, mit Champagner und Kapitän und Ehrengästen und dem ganzen Trallala.“
„Ach so … Was muss ich denn da anziehen?“
„Das musst du doch wissen. Irgendeinen tollen Fummel halt. Und komm dann für den Rest der Nacht ins Hotel.“
Nachdem sie gegangen war, zahlte er und ging über den dunklen Hof in Richtung Toiletten. Und da stand diese Frau. Irgendein Licht strahlte sie an. Er sah ihr Entsetzen. Er wusste zunächst nur, dass er ihr schon einmal begegnet war. Dann erinnerte er sich schlagartig, sogar das Datum wusste er: Potocari, 12. Juli 1995. Er hatte getrunken, so wie alle seine Kameraden auch. Dann hieß es ausschwärmen, Bosniaken töten. Davon hatten sich ungefähr 20.000, zumeist Frauen und Kinder, auf dem Gelände der UN-Blauhelme zusammengerottet, um vor Übergriffen der Serben sicher zu sein. Es war ein heißer Abend. Er hatte Durst und es gab weit und breit kein Wasser, nur Rotwein. Benebelt schlitzte er mit seinem Bajonett eine Zeltwand auf. Da stand sie hinter einem alten Mann und versteckte sich, so gut sie konnte. Der Alte spuckte ihm ins Gesicht. Da rammte er ihm sein Bajonett in den Bauch. Röchelnd fiel er zu Boden. Dann riss er der Frau die Kleider vom Leib. Er wollte sie mit Gewalt nehmen, war aber zu betrunken. Wofür sie ihn in ihrer Verzweiflung mit Schimpftiraden und Spott übergoss. Da spreizte er ihre Beine, im wilden Gerangel. Unter der Gewaltanwendung wurde sein Glied steif und er drang in sie ein. Seither brauchte er solche Handgreiflichkeiten, gespielt oder echt, um zum Orgasmus zu kommen.
Und jetzt stand sie plötzlich wieder vor ihm. Sie öffnete den Mund. Ob um zu schreien oder um ihn wie damals in Potocari zu verspotten, würde er nie erfahren. Denn bevor er wusste, was geschah, lag sie auf dem Boden. Er wunderte sich kurz, dass sie kaum blutete. Da hatte er schon anderes gesehen, wenn er mit seinem Messer zustach. Er blickte sich um. Kein Mensch weit und breit.
Im Hof standen mehrere Kühlwägen. Aus einem Raum nebenan mit schwachem Licht hinter dem Fenster drangen Laute in einer fremden Sprache. Schnell griff er sich die Tote, schleifte sie die paar Meter zu einem der Fahrzeuge, öffnete eine Tür, durch die sofort Kühlwolken nach außen drangen. Er zog seinen Hosengürtel aus den Schlaufen, schlang ihn um den Hals der Leiche und hängte sie damit an einem der Haken auf. Dann schloss er die Tür.
Erst jetzt registrierte er, dass eine Blutspur zu dem Wagen führte. Zum Glück gab es mehrere Wasserhähne, von denen Schläuche hingen. Er öffnete einen und ließ den Wasserstrahl in ganz flachem Winkel über den Boden sprudeln. Die Blutspur verwischte und wenig später hatte sie sich fast ganz aufgelöst. Gerade rechtzeitig. Denn eine Tür ging auf und die fremden Wortfetzen kamen näher. Von seinem Versteck aus sah er, wie sich eine Schar Dunkelhäutiger an den Fahrzeugen zu schaffen machte. Und er erblickte die Handtasche seines Opfers. Die zog er rasch aus dem Blickfeld der Saubermacher und nahm sie an sich. Er sah an sich herab. Sein Hemd war blutverschmiert. Nicht übermäßig stark, aber genug, um fragende Blicke anzuziehen. Er schlich in den Raum, aus dem die Dunkelhäutigen gekommen waren, und stellte fest, dass es ihr Umkleideraum war. Er besah sich einige Jacken und nahm sich die größte. Sie war ihm viel zu klein, aber groß genug, um sie über seinen Arm zu hängen und die blutige Stelle und die Damenhandtasche zu verdecken. Doch wohin mit dem Messer, so auf die Schnelle? Er holte aus und es landete auf einem der Spinde der Putzbrigade. Und jetzt nichts wie weg. Nicht einmal den wohligen Schauer, der bei Szenen von Blut und Tod durch ihn rieselte, gönnte er sich. Er würde ihn im Rest der Nacht mit der Blondine ausleben.
Am nächsten Morgen brauchte sie reichlich Schminke, um sich das blaue Auge aus dem Gesicht zu pinseln. Ein Hämatom im Gesicht der Schiffspatin könnte negativ auffallen.
Während sie pinselte, versuchte er erneut, ihn zu erreichen. Er musste ihn warnen. Kaum anzunehmen, dass die Bosnierin vom Hinterhof ohne Familie in Grado gelandet war. Vermutlich gab es mehrere ihrer Sorte. Und er war nun mal darauf programmiert, alle Zeugen von damals als gefährlich einzuschätzen. Immer wieder hatte ihm der Oberst eingeschärft: „Das ist dein Hauptgeschäft.“ Sollte dabei jemand im Weg stehen, hieß es „weg mit ihm“. So wie gestern, als es hieß „weg mit ihr“.
Der Oberst war schon an Bord der Dunja. Er hatte ihm aufmerksam zugehört und dann klare Anweisung gegeben. „Schick mir sofort den Hubschrauber, damit ich mich dünnmachen kann. Sonst alles nach Plan.“
Das bedeutete, gleich nach der Schiffstaufe Kurs Süd-Süd-Ost in Richtung Sveti Stokan, dem erlesenen montenegrinischen Ferienparadies. Auf der kleinen Klosterinsel, seit den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ein Hotel, hatten sich schon so illustre Gäste wie Jacqueline Kennedy, Sophia Loren und Sylvester Stallone in die Sonne gelegt. Allerdings lag noch immer der Schatten des jugoslawischen Bürgerkriegs auf dem Gemäuer. Vom Anschluss an die Top-100-Hotels Europas konnte man allenfalls träumen. Und solche Träume verkaufte der Oberst seines Wissens gerade irgendeiner Bank. Details interessierten Glatko nicht, hatten ihn auch nicht zu interessieren. Er war bei solchen Gelegenheiten für den Personenschutz seines Partners und Brotgebers verantwortlich, wurde bei Verhandlungen als Sekretär vorgestellt und hatte meist bloß vor dem jeweiligen Besprechungszimmer zu wachen.
Jetzt hieß der Befehl: „Schiffstaufe wie geplant. Hast du eine Taufpatin aufgetrieben?“
„Ja, Herr Oberst. Sie pinselt sich gerade die Augen.“
Der wusste genau, was damit gemeint war, sagte noch: „Übertreib’s nicht, wir sind nicht in Montenegro“, und legte auf.
Die Uhr vom Glockenturm der Klagenfurter Pfarrkirche schlug acht. Nicht acht Uhr abends, sondern acht Uhr früh. Generaldirektor Kummer sah sich in der Runde um. Die Nacht hatte bei allen Spuren hinterlassen, doch jetzt lag eine Rohbilanz auf dem Tisch, die herzeigbar war und mit der alle leben konnten. Es war nicht schwer gewesen, seinen Stellvertreter Schneider und die wichtigsten Führungskräfte in seiner Mannschaft von der Notwendigkeit gewisser kosmetischer Maßnahmen bei der Bilanzerstellung zu überzeugen. Sie alle wussten, es ging um die Existenz der Bank und damit um ihre. Der Häuptling der Buchhaltung hatte es zwar gewagt, das Wort „Einspruch“ zu gebrauchen. Aber er hatte ihm klargemacht, dass er, Doktor Wolfram Kummer, über seine jetzige Position hinaus dafür sorgen könnte, dass er keinen Job in einer Bank mehr bekäme und bestenfalls mit der Pension Normalsterblicher grau und tatterig werden würde. Darauf war auch dieser Bleistiftspitzer stumpf geworden und hatte mit einem Sprühregen von Ideen und einem gehörigen Maß krimineller Energie das Zahlenwerk im wahrsten Sinne des Wortes bereichert.
Doktor Kummer schwor noch einmal die Runde auf das gemeinsame Wohl und Wehe ein. Immerhin, der Landeshauptmann hatte Wort gehalten, die Landeshaftung war in schier magischem Tempo im Landesparlament von den Abgeordneten abgenickt worden. Damit standen die Millionen zu günstigsten Bedingungen zur Verfügung. Jetzt ging es darum, sie unter die Leute zu bringen. Zu den für die Kreditkunden ungünstigsten Bedingungen, versteht sich. Der Unterschied zwischen günstigst und ungünstigst wäre der Gewinn.
„Beim Kapitel Sicherheiten nicht zu strenge Maßstäbe anlegen“, mahnte Doktor Kummer. Er selbst habe seinerzeit als Krisenmanager bei der Agrarbank feststellen können: Wären seine damaligen Arbeitgeber nicht so beckmesserisch bei der Risikoeinschätzung gewesen, die Agrarbank hätte üppig verdienen können, nicht bloß bürgerlich.
„Und denken Sie daran, meine Herren: Wir müssen üppig verdienen, nicht bloß bürgerlich – und sei es nur auf dem Papier. Denn die, die dafür gesorgt haben, dass die Landeshaftung für unsere Kapitalisierung abgenickt wird, haben sich nicht nur aus Liebe zur Bank aus ihren Fenstern gelehnt. Sie erwarten sich Gefälligkeiten. Gefälligkeiten, für die wir uns etwas einfallen lassen müssen. Und jetzt, meine Herren, Schiff ahoi, auf nach Grado zur Schiffstaufe.“
Das Sesselrücken war auch durch die gepolsterten Türen deutlich vernehmbar. Die Vorzimmerdamen staunten nicht wenig, dass ihre Bosse nicht, wie sonst um diese Zeit üblich, frisch rasiert von zu Hause oder sonst woher eintrudelten, sondern unrasiert aus dem Allerheiligsten trotteten, ihre Glieder streckten und nach den Chauffeuren verlangten.
In Grado herrschte schon großer Bahnhof. Das bedeutete heute wie vor hundert Jahren Trubel in der Lagune, Hektik am Landungssteg. Denn einen wirklichen Bahnhof hatte es zu keiner Zeit in Grado gegeben, nicht einmal einen kleinen. Hatte die Badeinsel inmitten der blaublitzenden Lagune auf halbem Weg zwischen Triest und Venedig auch nie nötig gehabt. Denn seit der Flecken dank der Bahnverbindung mit Wien von Kaiser Franz Joseph zum kaiserlich-königlichen Kurbad dekretiert werden konnte, kamen die Gäste auch so in Massen. Bis zum Einsetzen der Motorisierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts per Dampf über den Semmering nach Triest und von dort weiter mit dem Boot. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, in Blechlawinen. Das Fischerdorf, das einst als Badewanne der Monarchie Furore gemacht hatte, mutierte zum Parkplatz mit Strand. Nur an der segensreichen Lage am Meer hatte sich nichts geändert. Die Ehrengäste der Schiffstaufe vor dem Palast-Hotel am Jachthafen gehörten zu den ganz wenigen, die keine Parkplatzprobleme hatten. Sie waren per Limousine der Montana-Maritim-Bank vorgefahren worden. Die meisten vom nahen Flughafen Ronchi, etliche aus Kärnten, Dalmatien und Montenegro. Unter dem Knattern der Europafahne, des montenegrinischen Doppeladlers auf rotem Tuch und der Fahne der Bank griffen sie nach den herumgereichten Kanapees. Sie waren beladen mit Hummer, eingeflogen aus Kanada, mit Austern, per Eiltransport aus Frankreich, angelgefangenem Thunfisch in rohen Häppchen und Beluga-Kaviar, gereicht zu eiskaltem Bier. Noch kälter, fast steifgefroren der dazu gereichte Wodka und die toskanische Zwiebelmousse. Für die Damen stand reichlich Jahrgangs-Champagner der Marke Krug bereit, den das ungeschulte Personal allerdings so kalt servierte, dass sie auch Massensekt hätten einschenken können.
Die Bewirteten waren sehr damit beschäftigt, den Eindruck gehobener Wichtigkeit zu hinterlassen. Geschäftig scharten sie sich um einen hageren Dürren, den sie mit „Herr Ministerpräsident“ anredeten und der jeden zweiten seiner Sätze mit den Worten „bei uns in Montenegro“ begann. Lautstark schwadronierte er in gebrochenem Deutsch vor einer Gruppe in alpinem Trachtenanzug, Farbe kastanienbraun, und einigen Herren im Nadelstreif. Die wiederum betitelten einander mit Herr Landeshauptmann, Herr Generaldirektor, Herr Hofrat, Herr Doktor, Herr Präsident oder Herr Kommerzialrat. Das ganze Hin und Her des Geredes schien sich nur aus Titeln zusammenzusetzen.
Etwas abseits stand einer dieser Gorillas, wie sie den amerikanischen Präsidenten flankieren, wenn er im Rosengarten des Weißen Hauses Gäste willkommen heißt. Seine muskulöse Gestalt passte ganz gut zu seiner verkrampften Haltung. Stoisch blickte er in Richtung Gästeschar durch eine rabenschwarze Sonnenbrille. Vom Personal wurde er mit „Herr Sekretär“ angesprochen, von den Gästen überhaupt nicht. Und doch folgte ihm das Personal auf den kleinsten Wink und sorgte so dafür, dass keinem der Honorablen etwas abging.
„Da kommt sie ja“, sagte der etwas schmächtige Trachtenträger, der mit „Herr Landeshauptmann“ angesprochen worden war, und legte seine Hand als Schutz gegen die blendende Sonne an die Stirn. „Sakra, ein schönes Schiff, ganz in Weiß.“
Tatsächlich glitt ein Superlativ maritimer Eleganz wie von unsichtbarer Hand gezogen in Richtung Pier. Das Bild, so schön es auch war, erinnerte gewaltig an den Kitsch von Heimatfilmen der Marke Weißes Rössl und Wolfgangsee, Fischer und Capri. Eine der Damen fühlte sich an Lohengrins Schwan erinnert und blieb dafür unbestraft. Die versammelten Herren beschäftigte ohnedies mehr die Frage, was so ein „Kahn“ wohl pro hundert Kilometer an Treibstoff nuckeln würde.
„Seemeilen, Herr Landeshauptmann. Seemeilen, wenn ich anmerken darf.“
Worauf ein umständliches Konvertieren von Kilometern in Seemeilen einsetzte. Champagner, Hummer, Austern und Kaviar im Gegenwert von rund 10.000 Euro verloren derweil in der direkten Sonneneinstrahlung rapide an Wert.
„Was kostet sowas?“, fragte einer der Trachtenträger, der sich in greifbarer Nähe zum Büffet aufgehalten hatte, seinen Nebenmann, einen Doktor Schaden, Leiter der Risikoabteilung der Montana-Maritim.
„Was jetzt?“
„Na das Schiff.“
„Knapp über 15 Millionen.“
„15 Millionen! Und das kann sich jemand leisten, der vor knapp zwei Jahrzehnten noch als Vulkanizer an der montenegrinischen Küste Reifen flickte?“
„Nicht so laut, die Herren vom Balkan werden nicht gerne an das erinnert, was sie gestern noch waren.“
„Aber wie verdient ein Vulkanizer von heute auf morgen das Geld für solch einen Luxus?“
„Na ja, der Ministerpräsident und die halbe Regierung Montenegros fressen ihm angeblich aus der Hand. Abgesehen davon, er hat die Jacht ja nicht gekauft. Bloß geleast.“
„Und was macht da so eine Leasingrate aus?“
„Etwa 350.000 Euro im Monat.“
„Das müsste sich dann schon rechnen für Ihre Bank.“
„Davon dürfen Sie ausgehen.“
„Aber das Risiko. Was ist, wenn mit dem Schiff etwas passiert?“
„Alles versichert bei der Albion. Und bedenken Sie: Wo sonst bekommen Sie heute noch 16 bis 20 Prozent fürs Verborgen?“
„Und wer von den Herren ist der Glückliche, der sich eine Leasingrate von 350.000 im Monat leisten kann?“
„Keiner von ihnen. Ich gehe davon aus, dass er an Bord ist.“
„Sie kennen ihn nicht persönlich?“
„Kaum jemand von uns kennt ihn persönlich. Er ist einer von den Scheuen und macht sich gern rar.“
In diesem Augenblick übertönte das Rotorengeräusch eines Hubschraubers jede weitere Unterhaltung. Das Luftvehikel umkreiste die Jacht, landete auf Deck und entschwand kurz darauf hinter den Hausdächern.
„Und was war das?“, wollte der Trachtenträger wissen.
„Keine Ahnung …“
Die Antwort ging im zigfachen Tuten der Schiffsirenen aus der Marina unter. Dazu nahmen zwei Löschkähne der Hafenverwaltung Triest die gleitende Diva in die Mitte und ließen Fontänen hochgehen, die im Gegenlicht der Sonnenstrahlen das Farbenspiel zweier Regenbögen herbeizauberten.
Wenig später galt das Interesse einer braungebrannten Blondine mit ostentativem Dekolletee, langen Beinen und botox-geschwulsteten Lippen, die in ein Mikrofon hineinkicherte und zu ein paar Sätzen in unbeholfenem Englisch eine Leine losließ, an deren Ende eine Champagnerflasche hing. Die Flasche beschrieb einen eleganten Bogen und erfüllte alle Erwartungen, indem sie am Rumpf der Dunja zerschellte. Damit war das Schiff nach allen Regeln der christlichen Seefahrt getauft und die Ehrengäste wurden an Bord gebeten.
Zwischen edelstem Holz und spitzfindigem Design erklärte eine Art Dressman ein wenig über die Geschichte Ferrettis, des Erbauers der Jacht. Das Unternehmen sei 1968 von Norberto Ferretti, dem Powerboat-Weltmeister von 1994, gegründet worden. Im Frühjahr 2009 hätte das Unternehmen mehrfach umgeschuldet werden müssen, bevor im Jonglieren mit den Millionen in Rot die Chinesen zuschlugen. Eine Wendung, an die auch der Herr Landeshauptmann als letzten Ausweg dachte, sollte die Montana-Bank aus der Spur laufen und nicht mehr als sein Esel-streck-dich herhalten können. Nach seinem persönlichen Leitspruch: Alles hat ein gutes Ende, und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende.
Der Dressman hatte ausgeredet und wandte sich an den Ministerpräsidenten aus Montenegro: „Ich darf Sie nun bitten, in Vertretung des verhinderten Bootseigners nach gutem Seemannsbrauch dieses reine Stück Gold in die Luke hier unter dem Führerstand zu legen, wo es für immer bleiben soll.“ Damit wies er auf eine ringartige Ausnehmung im Teakholzdeck und reichte dem Ministerpräsidenten einen Krugerrand. Mit leicht zittriger Hand legte dieser die Münze an die zugewiesene Stelle. Worauf ein Matrose im Blaumann mit der Aufschrift „Dunja“ wortlos vortrat und mit schwerem Gerät den Deckel des Ringes vierfach vernietete. Ein anderer Matrose brachte den Hals der zerbrochenen Champagnerflasche. Der Kapitän, der sich bis dato im Hintergrund gehalten hatte, hob ihn wie eine Trophäe hoch und zeigte ihn herum. Die Bordgäste musterten das Stück zerbrochenes Glas mit dem sinnlos gewordenen Korken verständnislos.
Stunden später, auf der Rückfahrt in Richtung Villach, erklärte Doktor Schaden seinem Gesprächspartner vom Büffet die Bedeutung der Vorgänge bei einer Schiffstaufe.
„Ein Glück, dass die Flasche zerbrach und der Korken im Hals stecken blieb.“
Er erntete dafür einen fragenden Blick seines Fahrgastes.
„So eine Schiffstaufe ist ein Ritual, so heilig und ernst wie eine Krönung. Taufpate eines Schiffes ist stets eine Frau. Ein Mann als Taufpate wäre ein böses Omen. Nach dem Zerschellen der Flasche an der Bordwand wird der Korken untersucht, der zum Beweis der Wirksamkeit der Taufe noch fest im oberen Rest des Flaschenhalses sitzen muss.“
„Und was hat es mit dem Goldstück auf sich?“, wollte der Trachtenträger wissen.
„Wenn auf dem Segelschiff der Großmast eingesetzt wird, legt man in die Höhlung der Mastspur ein blankes Goldstück, dort, wo danach der Fuß des Mastes ruht. Der Messingring unter dem Führerstand beim Motorschiff ersetzt die Mastspur. Das Goldstück, genannt Goldfuchs, soll vor den unbekannten Mächten des Meeres schützen.“
„Und die Seeleute nehmen das heute immer noch ernst?“
„Heute genauso wie vor Hunderten von Jahren. Zwischenfälle während der Schiffstaufe werden als böses Omen gedeutet. Sollte die Sektflasche nicht zerbrechen oder das Schiff beim Stapellauf auf der Helling hängen bleiben, heuern manche Seeleute erst gar nicht an. Auch heute erzählt man sich dann allerlei Geschichten. So wie die von der Melanie Schulte. Die kennen Sie doch, oder?“
„Nicht die Spur.“
„Sie blieb beim Stapellauf auf der Helling hängen, die schiefe Ebene, über die ein neues Schiff seinem nassen Element übergeben wird. Wenige Wochen nach der Schiffstaufe im November 1952 blieb sie im Nordatlantik spurlos verschwunden.“
„Und wie war das bei der Titanic? Ging da bei der Schiffstaufe auch etwas schief?“
„Allerdings!“ Doktor Schaden war nun endgültig in seinem Element.
„Sie fand aus Termingründen erst gar nicht statt. Das ist schon einmal äußerst ungewöhnlich. Und vor der Abfahrt am 2. April 1912 kletterte ein Heizer durch den vierten Rauchfang, der ja nur Attrappe war und zur Belüftung diente, und blickte von oben herab auf die Mole. Als die Seeleute an Land sein rußgeschwärztes Gesicht sahen, war für sie klar: Die Titanic war dem Untergang geweiht. Zwölf Tage später versank sie nach der berühmten Kollision mit dem Eisberg und nahm über 1500 Mann mit in ihr nasses Grab.“
„Aber bei unserer Schiffstaufe war alles in Ordnung. Also kein Grund zur Sorge, oder?“
„Da war schon ein gewichtiger Schönheitsfehler.“
„Und der wäre?“
„Der Eigner war nicht anwesend. Sie haben ja selbst gesehen, wie der Hubschrauber auf Deck landete und Minuten vor der Zeremonie mit ihm abschwirrte.“
„Was war eigentlich die Ursache? Haben Sie da etwas Genaueres gehört?“
„Nein. Sowohl der Kapitän wie auch der Kleiderständer von Ferretti beteuerten, sie hätten keinen Schimmer. Eigentlich hätte der Hubschrauber den Eigner nach der Schiffstaufe zum Flughafen nach Rijeka bringen sollen, doch dann sei ein Anruf gekommen und der überstürzte Abflug. Eine Schiffstaufe ohne Eigner! Meines Wissens ein noch nie da gewesener Fall. Wenn das nur kein schlechtes Omen ist …“
Noch ein Omen gab es an diesem Tag, das für Doktor Schaden Anlass genug war, sich Gedanken zu machen. Nachdem die Feierlichkeit am Hafen vorbei war, die Ehrengäste ihre Koffer gepackt hatten und sich abreisen ließen, hatte ihn der Hoteldirektor, ein watschelnder Pinguin, zur Seite genommen:
„Da wäre dann noch die Rechnung, Herr Doktor Schaden“, sagte er mit diskretem Hüsteln und präsentierte auf einem Silbertablett einen Stapel Kassenzettel mit einem hochnoblen Blatt aus Büttenpapier obendrauf.
Der Banker war bemüht, sich seine Verlegenheit nicht anmerken zu lassen. „Sollte das nicht der Sekretär des Herrn Konsul in Ordnung bringen?“, fragte er mehr sich selbst als den Pinguin.
Der fühlte sich aber angesprochen und meinte: „Von der Entourage des Herrn Konsul ward niemand mehr gesehen.“
Doktor Schaden schärfte sich auf die Summen des Büttenpapiers ein. Mehrere „Subtotals“ waren aufgelistet. Da hieß es etwa: Logis inkl. Frühstück € 9.600, Zimmerservice in den Suiten € 3.280, Blumenschmuck der Suiten € 1.280, Empfangscocktail für alle € 2.612, Restaurant individuell € 6.060, Büffet am Hafen, Speisen € 8.412, Büffet am Hafen, Getränke € 6.180, Fremdkosten Mietautos € 4.800, Geschenk für die Taufpatin € 5.000. Darunter stand, Doktor Schaden nahm seine Brille zu Hilfe: „Total € 47.224“.
Es wurde ihm schlagartig klar, dass er gar nicht das Pouvoir hatte, für solche Summen im Namen der Bank zu unterschreiben. Um sich eine Denkpause zu verschaffen, fragte er nach der Bewandtnis mit dem Geschenk für die Taufpatin.
„Der Sekretär des Konsuls hat uns Anweisung gegeben“ – leichtes Naserümpfen – „der Dame 5.000 Euro in bar auszuzahlen. Ein Wunsch, den wir ihm selbstverständlich erfüllt haben.“ Ein bisschen viel für die „Dame“, doch unmöglich konnte er die Peinlichkeit durch Verweigerung der Unterschrift zur Blamage steigern. Er nahm mit einem „Selbstverständlich“ den Griffel, den der Pinguin neben dem Konvolut aus Kassenzetteln auf dem Tablett platziert hatte, und unterschrieb. Hoffentlich im Sinne seines Generaldirektors, der schon abgereist war.
Der Hotelpinguin hatte das Silbertablett inzwischen irgendwie weggezaubert, sodass Doktor Schaden den Griffel nicht einfach darauf ablegen konnte, sondern ihn überreichen musste. So kam es zu einem Blickkontakt. Von wegen Blickkontakt. Der Hotelpinguin fixierte ihn und hatte plötzlich etwas unendlich Trauriges in seinen Augen. Etwa so, als ob er sich in die Hose gemacht hätte.
„Ach so, das Trinkgeld.“
Doch was gab man in einer solchen Situation? 32 Gäste, 18 Suiten, 18 Zimmermädchen, das Büffetpersonal, die Chauffeure der Mietwägen. Er tendierte zu 1000 Euro, erinnerte sich, dass Italiener im Umgang mit Trinkgeld eher knausrig sind, und überreichte einen Fünfhunderter. „Für die Angestellten.“
Der Pinguin ließ die Banknote verschwinden wie ein guttrainierter Taschendieb das Corpus Delicti und watschelte in Richtung Tür mit der Aufschrift „Service only“.
All das ließ Doktor Schaden Revue passieren, als er jetzt auf der Autobahn in Richtung Villach abbog. Die nicht ganz geglückte Schiffstaufe mit einer Dame des Horizontalen als Taufpatin und die Hotelrechnung, die er für die Bank wohl oder übel übernehmen musste, was hatte das wohl zu bedeuten?
Tags darauf saß Doktor Schaden mit zwei Kolleginnen in Klagenfurts Moser Verdino, um einen Happen zu essen. Die beiden warteten mit Details aus dem Kontrollbericht der Wiener Finanzmarktsaufsicht auf. Es sei alles paletti, beruhigte Schaden.
„Solange das Land dafür haftet, gibt es für die Bank kein Problem. So sieht es auch Wien.“
„Was aber, wenn irgendwann einmal die Haftung schlagend werden sollte, wenn das Land für all die Milliarden geradestehen muss?“, fragte einer.