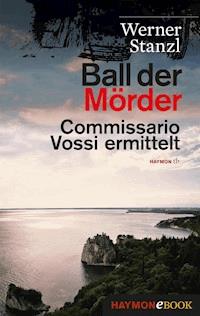Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Vossi-Krimis
- Sprache: Deutsch
EIN MÖRDER GEHT UM IN DER HAFENSTADT TRIEST Die junge Italienerin Mia bricht aus ihrer strengen Familie in Monfalcone aus, um ein neues Leben zu beginnen. Am nächsten Tag wird die junge Frau erstickt in einem Friseursalon gefunden. Bald gibt es ein weiteres Opfer: In einem Fangobad stirbt eine Physiotherapeutin. Commissario Vossi ist zunächst ratlos, der "Würger" scheint seine Opfer völlig zufällig auszuwählen. Doch dann bringt ihn seine Frau auf eine außergewöhnliche Spur: An allen Tatorten liegt ein besonderes Aroma in der Luft … und Vossi muss einmal mehr beweisen, wie fein seine Spürnase ist. Zwischen Triest, Grado und Monfalcone, zwischen nostalgischer Romantik und italienischer Lebensfreude entspinnt sich ein Kriminalfall, der trotz sengender Hitze erschauern lässt … KRIMISPANNUNG VOR PARADIESISCHER ADRIA-KULISSE Italienische Lebensfreude, Dolce Vita, prachtvolle k.u.k.-Bauten, sommerliche Hitze: Triest ist der Sehnsuchtsort schlechthin. Zwischen Gorizia, Grado und Monfalcone, an der wunderschönen Adria-Küste, schaltet und waltet Commissario Vossi. Er weiß, wo man den perfekten Espresso und das beste Gelato bekommt, wo der Wein am besten schmeckt. Er kennt die reiche Geschichte seiner Stadt, all die Verbindungen zum Hause Habsburg, er kennt aber auch die dunklen Winkel. Ohne Schirm, dafür mit Charme und Melange, klärt er seine Fälle auf. Er hört genau hin, wenn die Einheimischen ihm düstere Gerüchte erzählen, und heftet sich mit viel Gespür für menschliche Abgründe den Tätern an die Fersen. Und wenn es darum geht, einen Mörder dingfest zu machen, kann der sonst eher gemütliche Vossi plötzlich eine beeindruckende Geschwindigkeit an den Tag legen … **************************************************************************** "Die Krimis von Werner Stanzl sind die idealen Reisebegleiter. Ganz nebenbei erfährt man eine Menge über Triest und die wunderbare Gegend an der Adriaküste. Und auch, wenn mich daheim das Fernweh packt, nehme ich sie immer wieder zur Hand …" "Commissario Vossi ist ein Ermittler vom alten Schlag: Akribisch geht er allen Spuren nach, das macht seine Fälle für mich so spannend!" "Nachdem ich alle Bücher von Veit Heinichen verschlungen habe, ist Werner Stanzl meine neue Entdeckung!" ***************************************************************************** Die Krimireihe mit Commissario Vossi: Aussicht auf Mord Der Würger von Triest
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Werner Stanzl
Der Würger von Triest
Commissario Vossi ermittelt
1
Armes Monfalcone. Trotz des klingenden Namens hatte es für die Stadt auf halbem Weg von Grado nach Triest zu keiner Zeit einen Platz auf der Perlenkette der Adria gegeben. Schon im 19. Jahrhundert, als das ganze Land weit und breit noch als Österreichisches Küstenland firmierte, dröhnten hier die Hämmer für den Bau der Schiffe der k.u.k. Transatlantikrouten und des Orienthandels. Heute wurden an diesem Ort stattdessen Kreuzfahrtriesen auf Kiel gelegt. Und wie eh und je rochen die Straßen und Plätze nach dem Schweiß der Kesselklopfer. Verließ man hingegen die Stadt in Richtung Süden, ebbte der Lärm der Hämmer jählings ab. Eine leichte Brise strich vom Meer her über den Schilfgürtel eines Reservats, in dem Wasservögel in einem fort balzten, ihre Jungen aufzogen und abermals balzten. An einer Kurve des Güterwegs öffnete ein schmaler Pfad den Zugang zu einem umzäunten Grün, das von Oleanderblüten, Sonnenblumen, Zitronenbäumen und knorrigen Rosenstöcken überragt wurde. Hinter dem Zaun eine Fischerhütte aus alten Planken, durch Anbauten zu einer bescheidenen Einheit erweitert. Das Ganze in einer Statik, die nicht klar erkennen ließ, ob die Balken der Hütte die Anbauten oder umgekehrt die Anbauten die Hütte stützten.
Trotz dieser Einschränkung diente das bauliche Kuriosum als spartanisches, kleines Paradies der sechsköpfigen Familie Vaccaro, Zuwanderern aus dem italienischen Süden. Salvi hieß die kalabrische Streusiedlung, über der sie in einer gefährlich baufälligen Keusche gehaust hatten, die sie sich mit ein paar Hühnern und vier Ziegen teilten. Beim Erdbeben vor sieben Jahren hatten sie sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten können, bevor das Gebälk in sich zusammenbrach. Die angebundenen Ziegen und die in einem Schlag eingesperrten Hühner aber hatten keine Chance gehabt. Die Trümmer erschlugen sie.
Für einen Wiederaufbau hatten den Vaccaros Mut und Kraft gefehlt. Ein weitschichtiger Verwandter, der sein Glück in Köln gemacht hatte, bot erste Hilfe für einen Neuanfang in Deutschland an. Darauf, auf ihn und auf Gott wollten sie bauen. Doch die staatliche Erdbebenhilfe hatte gerademal für sechs Fahrkarten bis Udine gereicht. Aber es fügte sich. Vater Vaccaro hatte irgendwo aufgeschnappt, die Werft von Monfalcone hätte Arbeit zu vergeben. Auch an Ungelernte. Und nach drei Schichtjahren auf der Werft und dem behelfsmäßigen Hausen in einem Hinterhofloch bekamen sie hier im Schilfgürtel das Plätzchen Erde mit der alten Fischerhütte zugewiesen. Das Ersparte ging in den Anbauten auf und erblühte in Gemüsebeeten, Blumenrabatten, Rosenstöcken, Obst- und Zitrusbäumen.
Hinter dem Fenster mit den geklöppelten Vorhängen lag das Zimmer der drei Töchter. Mia, die Jüngste, blinzelte erwachend in die Morgensonne. Um nicht von ihren Strahlen geblendet zu werden, drehte sie sich von der Sonne weg. Schlaftrunken äugte sie nach dem Wecker. Das Ziffernblatt mit den mahnenden Zeigern holte sie in die Wirklichkeit, überschüttete sie mit Kummer, Sorge und Angst vor den Klippen des bevorstehenden Tages. Dies also war ihr letztes Erwachen im vertrauten Zuhause. Sie würde es für immer verlassen, Reißaus nehmen, wie man so sagte, sich befreien von dem archaischen Regime ihres Vaters, der die ganze Familie in einem bigotten Wahn terrorisierte. Das heißt, nicht alle. Nicolo, der Bruder, konnte als Einziger frei nach seiner Fasson leben.
Die beiden Schwestern, Alessia, die Älteste, und Bianca, die Mittlere, schliefen fest in ihren Betten an der Wand gegenüber. Ihr friedlicher Anblick weckte in Mia die Versuchung, sich einfach die Decke über den Kopf zu ziehen und ihren Abgang ein weiteres Mal hinauszuschieben. Schließlich raffte sie sich in einem Gegeneinander von Nichtwollen und Müssen hoch und stellte betroffen fest, auch die Knospen des Rosenstrauchs vor dem Fenster hatten sich gegen sie verschworen. Wie auf ein geheimes Zeichen waren die Knospen über Nacht erblüht und lockten in unschuldiger Schönheit zu bleiben. Sie begann sie abzuzählen wie die Blütenblätter der Margerite: „Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich.“ Sie seufzte. Was für ein Paradies, in das Gott sie geführt hatte. Aber eines, das der Vater mit seiner unerbittlichen Glaubensstrenge in eine Hölle verwandelte.
Just an Mias zehntem Geburtstag waren sie aufgebrochen und hatten in Catanzaro den Zug in das neue Leben bestiegen. Mit allem, was sie tragen konnten, wie man so schön sagt. Wahr ist, sie hätten noch einiges schultern können, besaßen aber nicht mehr. Mia erinnerte sich noch aus einem anderen Grund an jenen Tag ganz genau. Von diesem Tag an musste sie auf des Vaters Geheiß hin lange Röcke und Kopftuch tragen. Denn der Vater lebte streng nach den Regeln der Gebräuche der entlegenen Dörfer seiner Herkunft. Nach der Ankunft hier wurden sie noch strenger ausgelegt und befolgt. Denn für den Zuwanderer aus dem Süden lauerte im Glitzer des italienischen Nordens der Fluch der Versuchung, dem junge Mädchen nicht widerstehen konnten. So kam es, dass Mia, wenn sie zur Arbeit fuhr, und die beiden Schwestern, wenn sie sich in der Stadt ihr Arbeitslosengeld abholten, von Ortsfremden im Bus für Moslems gehalten wurden. Auch von den Nachbarn wurden sie anfangs abweisend beäugt und bestaunt. Islamische Migranten waren hier ebenso selten wie unerwünscht.
Zum Glück gab es im Stadtzentrum eine öffentliche Toilette mit Waschraum. Er war Mias direkte Anlaufstelle nach der Busfahrt. Zuallererst schaltete sie ihr Handy ein, das sie gar nicht besitzen dürfte, ginge es nach ihrem Vater. Beglückt und mit roten Wangen hörte sie die Liebesschwüre ihres teuren und einzigen Paolos ab. Dann hieß es: Adé Mittelalter. Mit Kopftuch, Rock und Umhängetuch verschwand das Mittelalter in einer Plastiktüte. Sie schlüpfte in enge Jeans und eine lockere Bluse, und schon war aus dem hässlichen Entlein ein Hingucker geworden. Rank und schlank, ausgestattet mit ansehnlichen Rundungen oberhalb der schmalen Taille. Die schüchterne Natürlichkeit, mit der sie ihre Vorzüge trug, unterstrich die optische Wirkung beträchtlich.
Mit den Maskeraden sollte jetzt Schluss sein. Sie würde das Elternhaus für immer verlassen und zu ihrem Paolo ziehen. Es war ein endgültiger Abschied, wusste sie doch, der Vater würde sie danach nicht wiedersehen wollen und die Mutter sie nicht wiedersehen dürfen. Bei jedem Gedanken daran spürte sie die Last dieses Bannes. Wie ein Fluch drückte er gegen ihre Brust.
Mit einem letzten Blick auf die Rosen erhob sie sich aus dem Bett, um einmal noch den Bus vom Schilfgürtel zur Arbeit zu nehmen und dann nie wieder. Auch wenn ihr zum Heulen war, das Morgenritual musste ablaufen wie immer, um nicht durchschaut zu werden. Alles hatte sie bestens geplant. Was sie von ihrer Habe für ein neues Leben an der Seite Paolos brauchen würde, hatte sie bereits in den Friseursalon Brioli, ihren Arbeitsplatz, gebracht. Jeden Tag ein Stück, um sich nur ja nicht zu verraten. Viel war es ja nicht und wirklich wichtig davon war eigentlich nur das Foto, aufgenommen zu ihrer Firmung, mit Vater, Mutter, den Schwestern und Bruder Nicolo. Sie im weißen Kleid mit Blumenkranz im Haar. Sie wusste, sie würde es in Zukunft oft betrachten.
Aufgeschoben konnte das Vorhaben nicht mehr werden. Ihr Bruder Nicolo musste zur Montage nach Udine. Damit fiel der Wachhund aus. Nicolo hatte vom Vater den Auftrag, sie täglich mit seinem Motorrad vom Salon Brioli abzuholen und auf direktem Weg nach Hause zu bringen. Abends lauerten ja für den bigotten Vater überall junge Männer, die nichts anderes im Kopf hatten, als Mia die Jungfernschaft zu nehmen. So spukte es in seinem Kopf herum. Da Nicolo sie heute nicht abholen konnte, sollte die älteste Schwester den Tugendwächter spielen. Ihr würde Mia ganz einfach sagen, dass sie nicht mitkäme. Alessia würde danach nichts anderes übrigbleiben, als unverrichteter Dinge mit dem Bus heimzufahren. Dort würde es wahrscheinlich Dresche geben, aber Alessia würde weder im Salon Brioli noch auf der Straße davor eine Szene machen. Da man jedoch nie wissen konnte, hatte sie ihrem lieben, einzigen Paolo eingeschärft, sie nicht abzuholen, sondern in seiner Wohnung auf sie zu warten. Keinesfalls sollte er Zeuge einer nicht auszuschließenden Auseinandersetzung mit Alessia werden.
Arme Alessia. Vor wenigen Tagen erst hatte Mia gehört, wie die Mutter den Vater fragte: „Unsere Töchter sind alle drei im heiratsfähigen Alter. Wie soll das werden?“
„Ein Ehrenmann wird kommen und nach Glauben und Sitte werben“, brummte der Vater abweisend.
„Wo soll der herkommen, wenn sie keiner kennt?“
„Ich habe mit Barbarino gesprochen. Ich werde zu Maria Himmelfahrt nach Salvi fahren, Alessia mitnehmen und sie verheiraten.“
„Über Barbarino, den Kuppler?“
„Weißt du etwas Besseres?“
„Und Bianca und Mia?“
„Wenn Alessia erst einmal verheiratet ist, werden wir sie mit den beiden besuchen. Und da wird dann auch kein Mangel mehr sein an geeigneten Hochzeitern.“
„Sie werden da unten im Süden nicht glücklich werden“, schluchzte die Mutter.
„Und hier ist ihr Seelenheil in Gefahr. Gott prüft uns, indem er uns Töchter gab. Deshalb müssen wir darauf achten, dass sie von diesem gottlosen Pack hier nicht verdorben werden. Zum Glück haben wir Nicolo. Er und ich, wir beide passen schon auf unsere Täubchen auf. Keine Sorge. Er ist wachsam wie ich und schließlich sind die Mädchen brav und gehorsam.“
„Und was wird mit unserem Sohn Nicolo?“
„Zum Bauern eignet er sich nicht. Aber er macht sich gut in seinem Beruf, hat sich hier gut eingelebt und wird einmal auf uns schauen, wenn wir alt und gebrechlich sind. Als Mann hat er hier alles und eine sittsame Braut aus dem Süden wird sich für ihn finden.“
„Und wenn es eine von hier ist?“
„Da sei Gott vor. Aber Nicolo ist seines Glückes Schmied, nicht ich.“
Mia würde Alessia später warnen, nahm sie sich vor. Jetzt galt es, aus dem Haus zu kommen.
Ein festes Frühstücksritual gab es bei den Vaccaros nicht. Jeder ging nach einem kurzen Morgengruß seinen Beschäftigungen nach. So auch diesmal. Nicolo trank hastig eine Schale Kaffee, startete sein Motorrad und ratschte davon in Richtung Udine. Birko, der Hund, sah ihm fassungslos nach. Vater war schon bei seinen Bienenstöcken, Mutter kniete vor ihrem Salatbeet und klaubte Schnecken, Alessia holte Holz, weil sie Brot backen sollte und Bianca, die Mittlere der Schwestern, brauchte wieder einmal zu lange im Bad. Mia zappelte davor und erinnerte durch die geschlossene Tür daran, dass der Bus nicht zu warten pflegte. Somit war tatsächlich alles wie sonst.
Zwei Stunden später betrat Mia den Friseursalon Brioli. Die Signora, ihre Chefin, sah ihr in die wässrigen Augen und sagte nur: „Heute ist es also soweit.“ Die kluge und liebevolle Frau stellte keine weiteren Fragen, sondern begann, die Vorzüge eines neuen, biologischen Haarfärbemittels zu verlesen. Es berücksichtige die besondere Struktur des Haares von Männern im fortgeschrittenen Lebensalter. Für Signora Brioli war das von Relevanz, da ihr Betrieb ein Salon ausschließlich für Herren war. Erwägungen, ihn auf Frauen zu erweitern, hatte sie bisher noch immer beiseitegeschoben: „Nicht, so lange sich jeden Morgen an die 50 alte Männer zur Rasur anstellen.“ Und zu Mias besserem Verständnis setzte sie nach: „Natürlich könnten die sich auch selbst rasieren. Aber uns ranzulassen, ist guter alter Brauch. Und wegen der Rasur kommen sie ja gar nicht. Die kommen, um miteinander zu tratschen. Über den Sport, die Weiber und die Politik. In der Reihenfolge. Hör ich doch jeden Tag.“
Mia, die die dreistündige Mittagspause immer mit ihrem Paolo verbrachte, würde ihn heute eine halbe Stunde im Park warten lassen und sich bei Don Filippo zur Beichte anmelden. Der war ein guter Hirte, der ein Herz für seine Schafe hatte. Ganz besonders für die Lämmer unter den Schafen. Einmal hatte er vor allen Leuten den Vater für die Strenge gegenüber seinen Töchtern gescholten: „Übertreibung ist eine Spielart des Teufels, Signore Vaccaro. Seien Sie nicht so streng zu den Ihren. So viel Strenge könnte die Liebe zum Vater ersticken.“
Und ein andermal scherzte Don Filippo: „Wäre nicht übel, wenn mehr so hübsche Mädchen zur Messe kämen. Das würde die Buben meiner Pfarre anlocken.“ Was allerdings den Vater nur zu noch mehr Strenge veranlasste. Seit dieser scherzhaften Bemerkung des Pfarrers musste ihr Bruder Nicolo Mia jeden Tag von ihrer Lehrstelle abholen und schnurstracks nach Hause bringen. Und weil er maulte, bekam er das Motorrad. Hätte Don Filippo auch nur geahnt, was seine Bemerkung auslöste, er hätte dem Vater ordentlich die Leviten gelesen. Ja, Don Filippo würde sie verstehen, trösten und von der Last der Sünde lossprechen.
Die Mittagsglocken hatten kaum ausgeläutet, da kniete Mia schon im Beichtstuhl von Santa Maria Assunta in Cielo. Doch es stellte sich heraus, so einfach war das mit der Lossprechung gar nicht.
„Ist der Mann, dem du dich hingibst, verheiratet?“, fragte Don Filippo besorgt aus der Zelle seines Beichtstuhls.
„Gott bewahre, nein. Wir wollen doch heiraten und zwar so bald wie möglich.“
„Willst du bis dahin in Keuschheit von ihm lassen?“
„Kann ich nicht. Die Beziehung, die bedingungslose, ist mir heilig.“
Der Pfarrer räusperte sich. Nach einer Pause sagte er in einem Ton, zu dem Mias Vater nie fähig gewesen wäre: „Es tut mir sehr leid, Mia. Dann kann ich dich nicht lossprechen. Es fehlt die Reue und der ehrliche Wille, nicht mehr sündigen zu wollen. Mir ist die Macht gegeben, dich unter Erfüllung dieser Voraussetzungen loszusprechen. Ich bin aber nicht befugt, Ausnahmen zu machen. Für Ausnahmen ist nur der liebe Gott zuständig. Glaube fest an ihn und sei getrost. Er schaut nicht nur auf deine Sünden, er schaut auch in dein Herz.“
Als Mia aus dem Beichtstuhl hervorkroch, war ihr, als setze die Orgel zum Jubel ein, so stark war das Gefühl der Erleichterung und ihre Zuversicht. Gott schaute in ihr Herz. Und das war rein. Deshalb würde Gott nichts finden, worüber er böse sein könnte. Konnte Gott überhaupt böse sein? Dem Taufscheinkatholiken Paolo, der sich wenig später beim Treffen im Park über ihr Hochgefühl wunderte, sagte sie nur, sie sei eben glücklich, weil er sie glücklich mache. Alles andere war viel zu kompliziert, um in schönen Stunden erklärt zu werden.
Auch Signora Brioli, ihrer Chefin und mütterlichen Freundin, fiel nach der Mittagspause Mias Stimmungshoch auf. Sie brabbelte etwas von der wundersamen Wirkung von Liebe am Nachmittag, was Mia mit einem bestimmten „Gott sieht nicht nur auf meine Sünden, er sieht auch mein reines Herz“ quittierte.
„Woher hast du denn diese Weisheit?“
„Von Don Filippo, Pfarrer von Santa Maria Assunta in Cielo.“
„Sag bloß, du warst beichten.“
„Ja, war ich. Und bei Gott, es hat gutgetan.“
„Und wie viele ‚Gegrüßet seist du Maria‘ gab es zur Buße?“
„Drei.“
„Alle Achtung, Mia. Drei ‚Gegrüßet seist du Maria‘ für guten Sex, kein schlechter Tausch.“
„Signora, wie können Sie nur! Schämen Sie sich, so etwas zu sagen.“
„Ok, ich schäme mich. Aber ein guter Tausch bleibt es dennoch.“
Da läutete das Telefon und Signora Brioli hob ab. Offensichtlich ein Kunde, der wegen eines Termins anfragte. Mia hörte, wie die Signora bedauerte. Dann schrieb sie mit dem Eyeliner eine Telefonnummer auf den Spiegel über dem Telefon und sagte, sie werde zurückrufen.
„Mia, könntest du heute eine Stunde länger bleiben? Dem Herrn in der Leitung scheint es sehr an einem Haarschnitt gelegen zu sein.“
Mia zögerte. Ausgerechnet heute, an diesem für sie und Paolo so wichtigen Tag. Aber es ging ja nur um eine Stunde und die Signora war die beste Chefin, die man sich nur denken konnte. Deshalb sagte sie dienstbeflissen: „Sicher, Signora Brioli.“ Worauf die Signora zurückrief und sagte: „Ich selbst bin leider verhindert. Aber meine Mitarbeiterin wird Sie erwarten.“ Und gleich darauf: „Ich versichere Ihnen, meine Mia ist eine Könnerin im Umgang mit Kamm und Schere. Sie werden zufrieden sein.“ Danach meinte sie mit einem vielsagenden Lächeln: „Ein Mann mit einer tollen Stimme. Wäre vielleicht was für mich, aber ich muss unbedingt zum Zahnarzt. Und es macht dir bestimmt nichts aus, Mia?“
„Bestimmt nicht, Signora.“
„Lass aber um Punkt sieben den Rollbalken runter, damit nicht noch ein Nachzügler kommt.“
„Sicher, Signora.“
Mia rief ihren Paolo an. Er sagte: „Kein Problem. Bei mir wird es heute auch etwas später. Ausgerechnet heute. Die Zentrale hat eine Stichkontrolle der Bücher angesagt. Da kann ich unmöglich weg. Aber du hast ja die Schlüssel. Weiß deine Schwester Alessia Bescheid?“
„Nein. Sie wird an der Bushaltestelle warten und warten und dann mit dem letzten Bus nach Hause fahren. Sie weiß nichts von meiner Entscheidung, mit dir leben zu wollen. Sie ist immer lieb und gut zu mir gewesen, und doch hätte sie es Vater verraten. Hätte sie es jedoch nicht verraten und er würde irgendwann dahinterkommen, würde er sie halb totprügeln.“
„Ich werde versuchen, mich zwischendurch vom Geschäft loszureißen, um auf einen Sprung nach Hause zu kommen. Wenn nicht, haben wir ja das Handy. Du weißt, du brauchst es nie wieder auszuschalten.“
„Und wenn mein Bruder anruft?“
„Wie sollte er, er hat ja deine Nummer nicht.“
„Ich meinte, im Salon anruft.“
„Dann ist Signora Brioli am Apparat und die wird ihm sagen, dass er nie wieder anrufen soll, sonst wird sie die Polizei rufen.“
„Und wenn er mir nachgeht?“
„Heute wird er dir nicht nachgehen können, weil er in Udine ist. Und ab morgen hole ich dich immer von der Arbeit ab und ich bringe dich auch hin. Öffne aber keinem die Wohnungstür, bis ich nach Hause komme. Wie gesagt, das kann spät sein, aber wir haben ja das Handy. Ruf an, sooft du willst. Damit müssen sich die Buchprüfer abfinden.“
Paolo war Filialleiter einer Brillenkette. Die Firma hatte ein bizarres Kontrollsystem, bei dem sich Prüfer anmeldeten und ein paar Stunden später schon vor der Tür standen. Geprüft wurde immer über Nacht, um den Geschäftsfluss nicht zu stören. Das alles war nicht sehr angenehm, wurde aber durch guten Lohn und Boni für den Filialleiter ausgeglichen.
Um 17 Uhr sagte Signora Brioli, sie müsse jetzt zu ihrem Zahnarzt und ging. So ein Weisheitszahn habe es in sich. Kurz vor sechs klingelte die Ladentür, ein großgewachsener Mann trat ein, grüßte freundlich und sagte: „Sie sind also Mia. Nun gut, wir haben einen Termin, mein Fräulein.“
Am nächsten Morgen bog Signora Brioli wie immer in die Via Vecchio, in der ihr Salon lag. Die Via Vecchio gehörte zu den wenigen Gassen, die in der Industriestadt Monfalcone von den Verwüstungen der Industrialisierung verschont geblieben waren und sich die Etikette schmuck verdienten. Man musste sie also kennen, um ein vollends gerechtes Urteil über Monfalcone abgeben zu können. Und Signora Brioli kannte sie. Hier in der Via Vecchio hatte sie als Kind gespielt, hatte sich in der Kapelle Santa Clara am oberen Ende zur Erstkommunion vor den Altar gekniet. Vor dem „Pergolato“, dem Restaurant an der unteren Ecke, hatte sie zehn Jahre danach ihr erstes Rendezvous gehabt und sich im Schutz des Torbogens von Haus 11 erstmals von einem Jungen betasten und küssen lassen. Und seit nunmehr 30 Jahren ging sie jeden Morgen an Haus 11 vorbei zum Herrensalon Brioli, den ihr Urgroßvater vor Jahrzehnten gegründet hatte.
Nachbarinnen wiederholten sich gerne in der Feststellung, dass sie noch keinen Tag pünktlich den Salon geöffnet hätte. Was diese aber herzlich wenig anging. Schließlich war Brioli ein Herrensalon. Aber der Tratsch hatte Wahrheitsgehalt. Denn tatsächlich standen die Zeiger meist auf zwanzig nach acht, wenn sie, an ihrer bereits wartenden Kundschaft vorbei, in das Wohnhaus huschte, um von hinten in den Salon zu gelangen. Sie machte dann das Licht an, zog sich ihren weißen Arbeitsmantel über und prüfte kurz ihre Frisur in einem der drei Spiegel. Danach schob sie den Rollbalken des Portals hoch und empfing die Herren mit einem strahlenden „Guten Morgen allesamt, meine Herren“ zur Rasur.
Diesmal aber stutzte Signora Brioli, als sie die ersten Meter der Via Vecchio hochging. Wohl hatte Mia den Rollbalken nach unten gezogen, aber die zwei Kugeln der Abendbeleuchtung über dem Portal brannten. Es wird doch hoffentlich nichts passiert sein? Bei Mias verrücktem Familienanhang konnte man ja nicht wissen.
Wie gewohnt brachte ihr Näherkommen Bewegung in die Herrenrunde. Die Raucher dämpften ihre Zigaretten aus, andere strichen sich ihr Jackett glatt oder fummelten an ihrem Hemdkragen herum, während sie darauf warteten, dass der Rollbalken hochging. Doch stattdessen drang ein dumpfes Poltern und gleich danach ein gellender Schrei aus dem Salon.
Mit einem besorgten „Signora?“ drückte einer aus der Runde sein Gesicht gegen die Auslage, um etwas erkennen zu können. Andere rannten kurzum in das Haus, um, wie die Signora, von hinten in den Salon zu gelangen. Im spärlichen Licht durch die Verdunkelung des Rollbalkens ließen sich nur Silhouetten ausmachen. Die Signora stand da, leicht gebeugt und hielt sich an einem der schweren Stühle fest. Sie rang hörbar nach Luft. „Sie ist über etwas gestolpert“, sagte einer der Männer zur allgemeinen Beruhigung. Ein anderer suchte und fand den Lichtschalter.
Nach etlichen Zuckungen verschafften die Neonröhren Klarheit. Die Signora war tatsächlich über etwas gestolpert, und zwar über eine Leiche. Die weit geöffneten Augen der Angestellten starrten ziellos ins Leere.
Erst jetzt erkannte auch die Signora die Tote. „Mia“, schrie sie und verlor endgültig den Halt. Einer der Männer keuchte ein „dieser verfluchte Vaccaro“, ein anderer stützte sie und half ihr in den Frisiersessel. „Sie zitterte am ganzen Körper und begann herzzerreißend zu weinen“, würde er später zu Protokoll geben.
2
Commissario Bruno Vossi saß grübelnd hinter seinem Schreibtisch. Sein Chef, der Questore, sonst eher überschwänglich, hatte es letzthin auffällig eilig und der Polizeipräsident übersah ihn bei den Feiern zum Tag der Republik. In normalen Kreisen nicht der Rede wert. Im bizarren Getriebe des Sicherheitsapparats aber kam normal nicht vor, hatte alles Bedeutung, geschah nichts aus Zufall oder ungewollt.
Sein Dienstbereich, dieses geschichtsträchtige Dreieck mit den Eckpunkten Triest, Gorizia und Grado, war erst seit 1918 italienisch. Hundert Jahre also. Und hundert Jahre konnten in der Geschichte eine sehr kurze Zeitspanne sein, wenn sich der neue Besitzer seiner Pfründe nicht sicher wähnt und zu Gleichschaltungsmaßnahmen neigt. Etwa, weil er an alten Gepflogenheiten aus der k.u.k.-Zeit Anstoß nimmt und hinter Banalstem Verrat wittert. Etwa, hinter der Tatsache, dass in den Läden des Umlandes die Gewichtsangaben altösterreichisch in Dekagramm statt in Gramm erfolgen. Einfach lächerlich, gewiss. Beamte des Sicherheitsapparats aber nahmen diese lächerlichen Blößen Roms besser ernst. Nach Vossis Überzeugung wurden diese Staatsneurosen weniger von den latenten Nostalgien in Richtung Habsburger Doppeladler provoziert, als vielmehr durch das anmaßende Auftreten der Lega und die um sich greifende Spaltung der Bevölkerung. Vorgänge zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatten tiefere Spuren hinterlassen als 500 Jahre Doppeladler. Damals, 1945, drängte sich Jugoslawien in die Reihen der Siegermächte und Italien als ewigen Seitenwechsler in das Lager der faschistischen Verlierer. In diesem Gemenge hatte Jugoslawiens Partisanenführer und neuer Präsident Josip Broz Tito die Italiener aus Istrien und Dalmatien vertreiben können. Sie, die seit Jahrhunderten zwischen Triest und Ragusa, heute Dubrovnik, zu Hause waren, mussten über Nacht weg und zurücklassen, was sie nicht tragen konnten. Ihre endlosen Kolonnen passierten ausgerechnet in den Hungerjahren der Nachkriegszeit die Grenzen. Sie waren in Triest und dem Umland ungefähr so willkommen wie der zerstörerische Fallwind, die Bora.
Unter den Vertriebenen waren auch die Eltern von Commissario Vossi. Einige Kilometer nach dem Überqueren der Grenze wurden sie, völlig erschöpft, in Baracken eingewiesen. Dort war Vossi mit unzähligen anderen Flüchtlingskindern aufgewachsen. Wer von ihnen den Aufstieg aus der Tristesse in höhere Schulen schaffte, galt als aus besonderem Holz geschnitzt. Vossi war einer von wenigen. Er hielt sich aber deshalb noch lange nicht für besonderes Holz, allenfalls für härteerprobt. Und die Grundhaltung, als ehemaliges Flüchtlingskind stets ein wenig mehr leisten zu müssen, war geblieben. Dass er dennoch nicht in den Ruf kam, ein Streber zu sein, lag an seiner warmen Herzlichkeit und an seinem ganzen Habitus, der weit entfernt war von Mailänder Schnittvorgaben. Bei seinem Dienstantritt vor nunmehr bald 25 Jahren versuchten die Kollegen, Vossis Abstammung zu orten. In dem hier ansässigen Völkergemisch war das geradezu ein Volkssport. „Italiener ist er keiner“, meinten die einen, „Slowene aber auch keiner“, die anderen. Jemand kam auf Abstammung Deutsch, womit dieser nicht ganz unrecht hatte. Denn auf dem k.u.k.-Geburtsschein von Vossis Urgroßvater stand ‚Voss‘. Doch der Steinmetz des Friedhofs von Jagodje auf der slowenischen Seite der Grenze musste den Namenszug unter der Diktatur Mussolinis um ein ‚i‘ verlängern. So entstand Vossi. Fünfzehn Jahre später überpinselten Titopartisanen grölend das Kreuz auf dem Stein des Familiengrabes mit einem fünfzackigen Sowjetstern und warnten: „Wenn du ihn abwäschst, endest du in der Foiba.“
Foiba bedeutete im Glücksfall Genickbruch, im Regelfall Verrecken. Durch die Wende im Kriegsglück vogelfrei geworden, jagten die Angehörigen des slawischen Teils der Bevölkerung ihre italienischen Nachbarn aus ihren Häusern und Verstecken. Es genügte ihnen nicht immer, sich an deren Häusern und Feldern zu bereichern. Um sich ihrer Beute sicher zu sein, formierten sie sich zu Banden und trieben ihre wehrlosen Opfer den Foiben zu. Dort stürzten sie sie in diese senkrechten Erdlöcher im Karst, manche bis zu 200 Meter tief. An die Zehntausend fielen diesem Genozid zum Opfer. Zwei volle Jahre dauerten die Pogrome an. Sie ebbten ab und flammten wegen Nichtigkeiten wieder auf. 1943 begannen sie und erreichten ihren grässlichen Höhepunkt zwischen April und Juni 1945.
In seiner Jugend weigerte sich Vossi, solche Gräuelgeschichten zu glauben. Umso mehr, als er mit einer Slowenin verheiratet war und am Oberlauf der Soča Schwiegereltern hatte, die man einfach nur gernhaben und respektieren konnte. Erst als er im jugoslawischen Bürgerkrieg erfahren musste, wozu Menschen fähig waren, akzeptierte er die italienischen Vorhaltungen als historisch gesichert. Alles in allem ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Zusammenlebens, aber eines, das, gottlob, überwunden erschien.
Umso mehr nervte ihn die Ahnenforschung der Kollegenrunde zur vorgerückten Stunde. Er versuchte einen Themenwechsel. Doch eine Runde von Mannsbildern ist nach dem dritten, vierten Glas Wein für einen solchen nicht leicht zu haben. Schließlich platzte es aus einem heraus: „Ich hab’s. Bruno Vossi ist kein Italiener. Er ist auch kein Slowene und schon gar kein Deutscher. Ich sage euch, was er ist. Er hat von allem etwas und ist schlicht und einfach ein Epocano.“ Die Runde zollte grölend Beifall.
Epocano? Damit konnte Vossi leben. Das klang nach Gediegenheit, nach Palazzi mit zierlichen Fassaden und üppigen Portalen, hinter denen man unter Stuck und Kristall auf Sternparketten parlierte. Diese Assoziationen waren allerdings relativ neu und Folge der umfassenden Stadtrenovierung, die 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs einsetzte und Triest das aristokratische Flair alten Glanzes zurückgab. ‚Epocano‘ war also eher ein verbaler Ritterschlag und sicherlich gut gemeint. Wie aber würde sich ‚Epocano‘ in Vossis Personalakt des Ministeriums für Inneres in Rom lesen? Würde man dort Epocano nicht ungeprüft als habsburgtreu oder österreichverbunden bewerten? Wahrscheinlich fragten sich die Zentralisten schon längst, ob er nicht doch zum Lager der Vorgestrigen gehörte, die an jedem 18. August im benachbarten Cormòns auf den Geburtstag des Kaisers von Schönbrunn anstießen und zum „Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land“ den Hut zogen. Dass er bei dem jährlichen Festzug erst ein einziges Mal gesichtet worden war, machte ihn für die Observanten womöglich noch verdächtiger. „Alle von der Questura pilgern dort hin“, wunderten sie sich vielleicht. „Warum nicht auch Commissario Vossi? Was will er uns damit vormachen?“
Möglich war auch, dass sein Eintreten für Giuseppe, den Türmer der Festung Görz, Eingang in seinen Personalakt fand. Dieser Giuseppe hatte seinen Vorgesetzten, den ausgewiesen rom-orientierten Burghauptmann, wieder einmal mit einer Fahne in Habsburgs Schwarzgelb auf dem Burgturm zum Schäumen gebracht. Wahrscheinlich hatte er sich den Lappen im Lager des Vereins „Altösterreich“ gegriffen. Besoffen wie er war, hatte er dem Burghauptmann dann auch noch Paroli geboten: „Görz ist eine alte Kaiserstadt und die Farben des Kaisers sind nun mal schwarzgelb.“ Weshalb ihn der Burghauptmann hinauswarf und ihm eine Anzeige wegen Hochverrats hinterherrief. So der Kantinentratsch. Sicher war nur: Giuseppe war gefeuert worden und untergetaucht.
Über all das hatte sich Vossi vor Kollegen lustig gemacht. Er könnte sich dabei etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Umgeben von einem Vielvölkergemisch aus Slowenen, k.u.k.-Deutschen, Kroaten, Juden und Griechen – alle im Laufe von fünf Jahrhunderten unter Habsburg waschechte Friulaner geworden – fühlten sich die Rom-Zentralisten immer wieder mal bemüßigt, den Okkupanten hervorzukehren.
All das hatte sich Vossi in Erinnerung gerufen, als sein Handy anschlug. Capitano Giuseppe Scappo von den Carabinieri nervte wieder einmal. Es ging um eine Verkehrstote und Fahrerflucht auf der Staatsstraße von Monfalcone nach Gorizia.
„Was haben wir mit einem Verkehrsopfer zu tun?“, fragte Vossi etwas ungnädig.
„Naja, ich dachte, ihr solltet euch das ansehen. Fahrerflucht. Ein Wagen mit ausländischer Nummer wurde dabei gesichtet. Also vielleicht ein grenzüberschreitender Fall und damit deine Zuständigkeit. Zudem handelt es sich bei dem betreffenden Fahrzeughalter um einen Diplomaten.“
„Wo steht ihr?“
„Auf dem Parkplatz des Castellos di Spessa. Das auffällige Fahrzeug hat am rechten vorderen Kotflügel eine Delle und ein paar Kratzer. Ein Wiener Kennzeichen. Vielleicht könntest du den Besitzer befragen, Bruno. Du sprichst ja Deutsch.“
„Ein Diplomat, sagst du?“
„Ja.“
Vossi hatte nur schlechte Erfahrungen mit Diplomaten. Zumindest die, mit denen er bisher zu tun gehabt hatte, waren aufgeblasen, Profis im Finden von Ausflüchten und hatten bei Bedarf immer irgendeine Staatskanzlei in der Hinterhand. Die ganze Wiener Konvention mit ihren Immunitätsklauseln für diese besondere Klientel konnte ihm einfach gestohlen bleiben. Er stöhnte: „Ok, wir kommen. Wo steht der Wagen?“
„Vor dem Castello.“
„Und der Wagen wurde im Bereich der Unfallstelle gesichtet?“
„Ein Wagen mit ausländischem Kennzeichen. Und der Wagen hier hat eines und dazu noch einen verdächtigen Blechschaden.“
„Gut. Halte die Stellung, wir kommen.“
„Es gibt Arbeit“, rief Vossi seinem Assistenten Roberto Vialli zu und beide machten sich auf den Weg.
Roberto stammte aus dem sonnigen Sizilien. Er war abkommandiert worden, um sich unter Vossis Fittichen Sporen zu verdienen und später einmal eine Dienststelle in seiner Heimat zu übernehmen. Roberto war in mehrfacher Hinsicht ein Zauberer. Noch nicht mal richtig angekommen, wusste er schon, wo er sich zu Preisen, die zu seiner niedrigen Gehaltsstufe passten, einkleiden konnte. Und sah darin aus wie ein Dressman für Armani oder Versace. Zur Verwunderung Vossis machten die jungen Damen der Truppe vom ersten Tag seines Erscheinens an einen weiten Bogen um Roberto. Bis Rita Jurinec, die Grande Dame in seinem Team, aus dem Nähkästchen plauderte: „Er sieht den Gören zu sehr nach Herzensbrecher aus. Da sehen sie sich vor. Und jede von ihnen weiß: Ein freundliches Wort für Roberto, ein direkter Blick in seine Augen, und schon hast du die Meute der weiblichen Belegschaft unter fünfunddreißig zum Feind.“
„Ach, deshalb sind alle Damen so nett zu mir. Weil ich als Fang uninteressant wäre.“
„Du sagst es. Es ist wie bei den Fischern. Der Beifang zählt nicht.“
„Ist Roberto damit verurteilt, lebenslang ein Eremit zu bleiben?“
„Kaum. Irgendeine Mutige oder Übermütige wird sich schon finden. Und lebenslang einsam sowieso nicht. Schönheit vergeht, wie wir wissen. Auch bei Männern. Sie lassen Haare, setzen einen leichten Bauch an und bekommen Falten.“
„Ich auch?“, fragte Vossi scheinheilig.
„Falten nein, dafür kocht deine Jelena wohl zu gut.“
Nach Vossis Schätzung konnte Roberto die Zurückhaltung der jungen Kolleginnen locker verschmerzen. Die aufmerksame Zuwendung der Reiferen entschädigte reichlich. Deren Herzen flogen ihm ungebremst zu. Sein Gesang rührte sie bei Betriebsfeiern regelmäßig zu Tränen und entlockte Lobeshymnen: „Wie ein Pavarotti der frühen Jahre.“ Vossi war sich ziemlich sicher, dass die Seufzer nicht nur mit Robertos Stimme zu tun hatten. Sei’s wie’s sei: Bei ihm jedenfalls hielt sich die Begeisterung für den Pavarotti der frühen Jahre in Grenzen. Bei Dienstfahrten zu Leichen, Zeugen oder Tätern irritierten Robertos Arien.
„Andere atmen, Roberto singt“, hatte er sich einmal bei Rita beklagt.
„Versuch es zu genießen“, war Rita wie immer auf Robertos Seite. „Gesang ist doch etwas Schönes, Befreiendes.“
„Befreiend ist gut. Diese südlichen Lieder werden mit jedem Takt schneller und Roberto pflegt seinen Fahrstil den Tarantellas anzupassen. Dann entscheiden nicht Straßenzustand oder Verkehrsaufkommen unser Tempo, sondern die jeweilige Nummer aus Robertos Musikladen.“
„Dann sag ihm doch, er soll mal etwas Langsames singen.“
Auf der Fahrt zu einer Leiche nach einer Messerstecherei hatte Vossi es versucht: „Roberto, sing mal etwas in Moderato, etwas Trauriges.“
„Trauriges?“, fragte Roberto, als ob er das Wort noch nie gehört hätte.
Vossi probierte es mit einem Beispiel. Da ihm nichts Besseres einfiel, mit Rudolfos Jammern über Mimis Verfall in Puccinis La Bohème:
„Schrecklich klingt dieser Husten,
der die Brust ihr erschüttert …“
Mimis so besungenes, unaufhaltsames Verwelken schien Roberto sehr zuzusetzen. Tieftraurigen Blicks wandte er sich Vossi zu und sagte seufzend: „Sie mögen Musik nicht, stimmt’s Commissario?“
Worauf sich beide biegen mussten vor Lachen.
Das Castello di Spessa wurde 1359 erstmals urkundlich erwähnt und musste seit seiner Grundsteinlegung allerlei Renovierungen über sich ergehen lassen. Auch die eines gewissen Rudolf Völkl, Gewürzhändler aus Wien, im 19. Jahrhundert. Und so grüßte der Komplex als Bauteil einer Walt-Disney-World. Zwar in Kupfer, Nippes und Sandstein statt in Plastik, aber unverkennbar frei nach Walt Disney.
Capitano Scappo von den Carabinieri hatte sie längst erwartet. Alles verhielt sich so, wie er gesagt hatte. Die Delle am rechten vorderen Kotflügel war beachtlich, das Blech laienhaft zurechtgebogen. Gerade genug, um den Wagen lenken zu können, ohne die Reifen aufzuschlitzen. Reste von Schlieren verrieten, dass Blut verwischt worden war. Vossi wandte sich an Roberto: „Ruf die Spurensicherung. Ich vermute ja, dass die kurzen braunen Haare von einem Reh stammen und somit auch das Blut. Aber ich kann mich täuschen. Und wir alle wissen: Lorenzo Bettini, unser Chef der Spusi, täuscht sich nie. Also, her mit dem Meister im Nanobereich.“
Die Zulassungsnummer des Wagens war die eines Honorarkonsuls. Betuchte konnten sich diesen Titel erkaufen, meistens von irgendeiner Bananenrepublik. Damit war ihnen erlaubt, mit einem CC-Aufkleber für Corps Consulaire herumzufahren. Diplomatenstatus, also diplomatische Immunität, gab es aber nicht dazu. Vossi klärte Scappo darüber auf. Der lachte: „Also CC wie Cash and Carry!“
In diesem Moment traf Lorenzo Bettini mit seinem Helfer ein. Mit einer Pinzette sammelte er die kurzen braunen Haare auf dem Blech der Karosserie, während sein Assistent an dem verbeulten Kotflügel herumschabte. Vossi wollte abwarten, ob Lorenzo mit Soforterkenntnissen dienen konnte und genoss etwas abseits die Brise vom Meer her. Der Wind spielte mit den Blättern der Sträucher, sodass deren Rückseite zwischendurch silbern aufblitzte. Die Äste hielten dagegen, was Vossi an Mädchen und Frauen erinnerte, die verbissen ihre Röcke vor plötzlichen Windböen niederhielten.
„Und wie findest du das Stück Disney-Florida inmitten dieser herrlichen Landschaft?“
Roberto gab sich beeindruckt.
„Mich stößt es ab“, gestand Vossi. „Der Kitsch inmitten dieser herrlichen Landschaft kommt mir vor wie eines dieser Plastikpärchen auf Hochzeitstorten. Die reinste Schmähung für die Kunst der Konditormeister. Da mischen sie mühevoll Cremen, Marzipan und Biskuit in kulinarischer Perfektion zu optischer Vollendung. Und dann setzt irgendein Banause diese grässlichen Püppchen oben drauf.“
Ein schlaksiger Mann von etwa 40, in zu großem Anzug und zu weitem Hemd, näherte sich dem verbeulten BMW. Vossi hörte, wie er Lorenzo fragte, was ihn an seinem Wagen so fasziniere. Er konnte die Antwort nicht genau verstehen, aber im Näherkommen hörte er den Schlaksigen sagen: „Ich konnte es nicht verhindern. Der Rehbock ist rechts aus dem Gebüsch direkt in meinen Kotflügel gelaufen. Und das bei helllichtem Tag.“
Vossi und Roberto traten hinzu und stellten sich vor. „Und, hat der Rehbock überlebt?“, wollte Vossi wissen.
Der Schlaksige verfiel in Begräbnisstimmung und bedauerte: „Eben nicht. Ich musste reversieren und nochmals über ihn hinwegfahren. Gezielt über seinen Kopf. Jetzt noch höre ich das Geräusch, schrecklich.“ Der Mann war tatsächlich dem Weinen nahe.
„Haben Sie Anzeige erstattet?“
„Ja. Drüben in Slowenien, wo es passierte. Wollen Sie die Bestätigung sehen?“
„Wenn es keine Umstände macht. Sie wissen ja, Polizisten sind von Natur aus neugierig.“
Der Schlaksige holte einen Zettel aus der Innentasche seines Jacketts und reichte ihn Vossi. Seine Hand hatte einen leichten Tremor. „Scheint krank zu sein“, dachte Vossi und musterte ihn genauer: Die gelblichen Augen standen mit hoher Wahrscheinlichkeit für schlechte Leberwerte.
Lorenzo von der Spusi hatte inzwischen begonnen, seine Gerätschaften in seinem Hexenkoffer zu verstauen und konstatierte: „Das wär’s Bruno. Ich bin hier nicht mehr von Nöten. Alles Tierblut und Rotwildhaare, kein Zweifel.“
Vossi gab dem Mann das Stück Papier zurück: „Dann kann ich nur einen schönen Nachmittag wünschen. Also, alles Gute.“
Der Schlaksige nahm die Anzeigebestätigung entgegen und machte kehrt.
Vossi wollte ihn noch etwas fragen, aber das Handy schlug an. Nach konzentriertem Hineinhören und einem „Via Vecchio, kenne ich“ rief er Lorenzo von der Spusi zu: „Es gibt Arbeit, diesmal echte Arbeit. In Monfalcone. Roberto du fährst, die anderen fahren uns einfach nach. Details klären wir über Funk.“
Auf dem Beifahrersitz des Lancia bemühte Vossi die Straßenkarte, denn das Navi streikte seit Wochen. Laut Fahrbereitschaft waren alle Updateversuche vergeblich gewesen und die Anlieferung eines Tauschgeräts ließ auf sich warten. Nachdem er den Bestimmungsort auf der Karte ausgemacht hatte, zitierte er den Forensiker, Dottore Stefano Lamberti, zum Tatort und beschrieb ihm den Weg.
Dottore Stefano Lamberti, für seine Freunde auf Slowenisch Stipe, war ein wacher Geist mit dem Gesicht eines Draufgängers und einem Faible für Eleganz und Luxus. Er war nicht besonders beliebt. Schon gar nicht bei den Kolleginnen. Bei den Älteren von ihnen, weil sie sich seinetwegen um das Herzenswohl ihrer Töchter sorgten, bei den Jüngeren, weil sie entweder mit ihm auf Tuchfühlung gegangen waren oder er ihre auffordernden Blicke, auf Tuchfühlung zu gehen, absichtlich übersah. Wie immer hatte Stipe eine lustige Begebenheit auf Lager und setzte zum Erzählen an. Doch Vossi wehrte ab: „Später, Stipe. Später.“
Die bevorstehende Bekanntschaft mit einer Leiche hatte seine Stimmung gedämpft, zumal Vossi den Frisiersalon kannte. Eine Signora Brioli, hatte der anrufende Carabinieri gesagt. Das musste wohl das junge Ding von seinerzeit sein, als er ab und an beim alten Brioli eine Stoppelglatze verpasst bekam.
Die Via Vecchio war kaum breiter als ihr Dienstwagen. Sie war sorgfältig gepflastert. Vor den Fenstern hingen Sonnensegel in Orange und Bordeauxrot. Eine leichte Brise vom Meer her setzte sie in Bewegung und fächerte den Passanten südliches Flair zu. Die Spusi mit Lorenzo am Steuer hatte offenbar eine bessere Route genommen und war schon vor Ort. Ihr Wagen blockierte die Fahrbahn. Vossi und Roberto mussten deshalb die letzten 50 Meter zu Fuß zurücklegen.
Dabei passierten sie einen der für Italien so typischen dreirädrigen Piaggios, die überall durchkamen und deshalb gern für Zulieferungen und Abtransporte in den Windungen der Altstädte eingesetzt wurden. Mit diesem wurde Hausmüll abgeholt. Allerlei unangenehme Gerüche stiegen aus ihm auf. Jener nach totem Fisch und sonstigem Küchenabfall vom Restaurant Pergolato an der unteren Ecke der Gasse dominierte.
Vossi traf sogleich eine Vorkehrung: „Sorge dafür, dass der Müllkutscher nicht einfach weiterfährt. Vielleicht hat er den Abfall des Friseursalons schon geladen. Und wir wollen doch nicht eine ganze Deponie von oben nach unten durchwühlen, bloß, weil uns ein paar Haare zwecks DNA-Abgleich fehlen.“
Vor dem Geschäft hatten sich Schaulustige zusammengerottet. Zwei Carabinieri hielten sie in Zaum. Der eine als Good Cop, mit freundlichem Zureden, der andere als Bad Cop, mit herrischem Gehabe. Vossi stellte mit stillem Bedauern fest, dass der in der Rolle des Bad Cop mehr bewirkte.
Im Frisiersalon lag ein Frauenkörper, halb abgedeckt von einem Tuch in Zuckerlrosa, an normalen Tagen das Umhängetuch für Kunden. Vossi stellte erleichtert fest, die ihm bekannte Besitzerin des Ladens war es nicht. Die Lehne des Frisierstuhls war dem Spiegel zugewandt, so als ob sich gerade jemand daraus erhoben hätte. Er registrierte: Zwei Armstützen des Stuhls waren lederbespannt. Für Lorenzo also eine Kleinigkeit, darauf die Fingerabdrücke des Kunden zu isolieren, der zuletzt in dem Sessel saß und sich auf den Lehnen abstützte, um sich zu erheben. Vielleicht auch, um zu töten, wer weiß?
Lorenzo flüsterte, über das Opfer gebeugt, Tatortdetails in sein Diktaphon. Vossi gesellte sich zu ihm und nahm eine ähnliche Haltung ein. Wie zwei Trauernde standen die beiden da, während Roberto im Hintergrund die Personalien einer Frau von etwa 50 abfragte. Nach einer Weile wandte sich Vossi ihnen zu: „Ich bedaure die tragischen Umstände an einem sonst so schönen Tag, Signora …?“
„Brioli, Dorotea Brioli.“
„Ach Signora Brioli. Ich kannte noch Ihren Vater. Vossi mein Name. Sie haben in den Salon investiert. Gute Arbeit. Ein wahres Aushängeschild für Ihr Handwerk. Respekt, alteingesessen und doch ganz im Schwung der Gegenwart. Bravo.“
„Kannten Sie auch meinen Großvater? Der hat das Geschäft 1936 gegründet“, schluchzte sie, als ob der Vorfahre ihr damit schweres Leid zugefügt hätte.
„Nein, ich hatte nicht das Vergnügen. Ich bin wohl etwas jünger als ich aussehe, Signora.“
„Scusi, Commissario. Ich bin heute völlig durcheinander.“
„Kein Problem. So etwas Tragisches passiert ja auch, Gott sei Dank, nicht alle Tage.“
Ein Schatten im Rahmen der Eingangstür und der Klang schneller Schritte unterbrachen sie. Der Duft nach abgestandenem Haarspray vermischte sich umgehend mit dem süßlichen von Formaldehyd. Der Forensiker Dottore Lamberti war da. Mit einem indifferenten „Buongiorno“ ging er an Roberto, Vossi und Signora Brioli vorbei und kniete sich vor der Toten hin, ohne auf die Haarschnipsel um den Frisiersessel zu achten. Weshalb Lorenzo fauchte: „Pass doch auf die Haare auf. Es könnten ja die des Mörders darunter sein.“
„Ist es überhaupt Mord?“
„Das fragst du mich! Du bist doch dafür der Experte.“
Stipe hatte sich Latexhandschuhe übergezogen und tastete die Tote ab. Er öffnete den Kragen ihrer Bluse, suchte ihren Nacken nach Würgespuren ab und roch an dem Glas, das die Tote in ihrer Rechten hielt. Er ließ die letzten Tropfen daraus auf seine hohle linke Hand tröpfeln, benetzte den Zeigefinger der Rechten damit und rieb ihn gegen den Daumen. Danach roch er daran und überreichte Lorenzo das leere Glas.