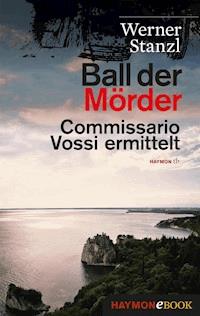Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
KRIMISCHAUPLATZ TRIEST STADT DER KAFFEEHÄUSER, Legenden und Dichter, Stadt an der goldenen Adriaküste, einstiger kaiserlicher Hafen, Tor zur Welt und Schmelztiegel der Kulturen. In den verwinkelten Gassen ITALIENISCHE LEBENSFREUDE, Dolce Vita und südländisches Temperament - dann wieder prachtvolle Gebäude aus der k.u.k.-Zeit, nostalgische Melancholie und die drohende, eisige Bora aus dem Karst. - Vielfältiges, vielbesungenes, bewundertes, sehnsuchtsvolles TRIEST! Was könnte diese Idylle stören? Ein Mord natürlich! Verhängnisvoller Fund: Sind es DIE LEGENDENUMRANKTEN GOLDMÜNZEN AUS SCHLOSS MIRAMARE? In einem Marmorsteinbruch werden Goldmünzen gefunden. Viele vermuten dahinter die Münzen, die Kaiser MAXIMILIAN I. VON MEXIKO der Legende nach im 19. Jahrhundert kurz vor seinem Tod noch prägen und ins SCHLOSS MIRAMARE bringen ließ. Wenn das stimmt, sind die Münzen ein Vermögen wert! Ganz Triest und Umgebung befindet sich im GODLRAUSCH und schon bald gibt es Arbeit für COMMISSARIO VOSSI VON DER MORDKOMMISSION GORIZIA: Denn der erste Tote lässt nicht lange auf sich warten, ein weiterer folgt. Die Zusammenhänge sind verworren. Fest steht: Der zwielichtige Casinoangestellte Claudio Casari hat seine Finger im Spiel. Ein Sumpf aus Korruption und Verbrechen tut sich auf und die Ermittlungen für das Team des Feinschmeckerkommissars Vossi gestalten sich schwierig … MIT COMMISSARIO VOSSI DURCH TRIEST WANDELN Von den sanften Weinbergen um GORIZIA, die Küstenstraßen von GRADO und MONFALCONE hinab, am märchenhaften CASTELLO DI MIRAMARE vorbei bis hinein ins altehrwürdige TRIEST führt dieser spannende Krimi. Zwischen Kaffeehäusern aus der Kaiserzeit, der Hafenpromenade und der Piazza Unitá, sanften Weinbergen, kulinarischen Genüssen und der aufziehenden Bora kämpft das Friaul-Julische Ermittler-Original Commissario Vossi gegen das Verbrechen. Autor Werner Stanzl hat selbst jahrelang in Triest gelebt. Ein REISE- UND GENUSS-KRIMI mit AUTHENTISCHEM LOKALKOLORIT!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Stanzl
Aussicht auf Mord
Commissario Vossi ermittelt in Triest
1
Er war schon angekleidet, als sich die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne vorsichtig in die Kammer unter dem Glockenberg wagten. Da war schon wieder eines dieser widerlichen Biester, die ihn auch in dieser wohl letzten Nacht seines Lebens nicht verschont hatten. Seit seiner Ankunft in diesem Land verfolgten ihn die Bettwanzen beharrlich. Schon am Abend hatte er ihre Witterung aufgenommen, diesen süßlichen Duft nach Koriander. Der Melissengeist hatte gegen den Juckreiz nicht wirklich geholfen. Doch bald würde er auch das überstanden haben.
Auf der Treppe hörte er ihre schweren Schritte. Sie hatten also nicht auf ihn vergessen. Natürlich nicht, dachte er mit einem säuerlichen Lächeln. Mehr unbewusst als bewusst vergewisserte er sich, dass die sechs Goldstücke an ihrem Platz in der Rocktasche waren. Dann führten sie ihn hinaus. Die sechs Soldaten des Exekutionskommandos waren beinahe noch Kinder, so jung waren sie. Er registrierte ihre Unruhe und sprach beruhigend auf sie ein: „Nur ruhig, ihr tut nur eure Pflicht.“ Dann überreichte er jedem eines der Goldstücke mit der Bitte, sein Gesicht zu schonen. Der Mutter wegen, die wohl sein Antlitz noch einmal sehen wollte, bevor sich der Sargdeckel über dem schloss, was Staub werden musste.
Eine Augenbinde lehnte er ab. Die Sonne blendete ihn dermaßen, dass er ohnedies nichts erkennen konnte. Er hörte die Stimme des Pfaffen, dann das Kommando „Feuer“, gefolgt von dem Hammerschlag der Kugeln, die seine Brust zerfetzten. Dass der kommandierende Offizier sich danach begutachtend über ihn beugte, missmutig das Zucken seiner Hand feststellte, die Pistole zog und ihm einen Genickschuss verpasste, war genauso Angelegenheit der Nachwelt wie das Ritual des Pfaffen, der Weihwasser über den Leichnam sprengte und dazu ein Gebet murmelte.
2
Commissario Bruno Vossi legte sein Buch zur Seite. Es war heiß geworden über den Hügeln von Gorizia. Er blickte nach Norden über die Landsenke Friauls hinweg auf die karnischen Alpen. Der Anblick des ewigen Schnees auf den Gipfeln der Gebirgskette kühlte nicht wirklich ab. Schlimmer noch, er warf die Frage auf, ob angesichts der Klimaerwärmung von ewigem Schnee überhaupt noch die Rede sein konnte. Vossi nahm einen Eimer, stellte darin eine Flasche Prosecco kalt und öffnete die dunkle Bespannung des Sonnenschirms. Wie er doch diese dienstrechtlich verordneten Ruhepausen hasste, diese lächerliche Ultima Ratio Roms, das horrende Staatsdefizit durch Überstundenabbau zu reduzieren. Natürlich hätte er trotzdem in die Questura fahren und dort Dinge aufarbeiten können. Aber dann würde der Kollege von der Beamtengewerkschaft wieder etwas von Solidarität daherfaseln. „Wir merken uns das, Vossi“, hatte er das letzte Mal im Stiegenhaus blöd geunkt. Als ob das Hickhack zwischen Gewerkschaft und Rom etwas mit Solidarität zu tun hätte. Anzunehmen, dass liegengebliebene Arbeit neue Stellen schaffen würde, war reichlich naiv. Zumal die überwiegende Mehrheit der Kollegen sie mit nach Hause nahm. Wenn die Solidarität der Personalvertretung nichts Ergiebigeres erreichte als Verwerfungen, konnte er gut darauf verzichten.
Anfangs nahm Vossi diese Intermezzi gelassen. Wenn die Zwangspausen aber dann in die dritte Woche gingen, begann er zu granteln. Da half nicht einmal die Gewissheit, dass schon bald alles im alten Trott weitergehen würde, denn die römische Bürokratie war ausufernd, aber vergesslich. Einige widersprachen dem und verbesserten auf inkonsequent. Jedenfalls unterschied sich das weltliche Machtwort „Roma locuta – causa finita“ sehr vom kirchlichen Original. Das weltliche bedeutete ein Zwischenspiel, das päpstliche bei Zuwiderhandeln ewige Verdammnis, wenn nicht gar Flammentod im Diesseits. Auch ein Grund, warum Vossi mit dem Staat besser zurechtkam als mit Dogmen.
Der Commissario registrierte das Rumoren seiner Frau Jelena zwischen den Rosenstöcken und fand es ausgesprochen beruhigend. Nichts beruhige faule Männer mehr als eine fleißige Frau, schimpfte seine Schwiegermutter über die Mannsbilder. Wie klug sie doch war, sagte sich Vossi schmunzelnd und fühlte sich tatsächlich ruhiger.
Jelena hatte vor geraumer Zeit eine Stelle in einem Weingut auf der anderen Seite des Hügels angenommen. Von der Terrasse aus konnte man es beinahe sehen. Es war ein Weingut von Renommee. Vossi hatte bald feststellen müssen, dass sie genau diesen Job brauchte: betraut mit der Werbung für Wein, umgeben von herrlicher Natur.
„Ich könnte kein Förster sein“, hatte sie einmal gesagt. „Die sehen nur Bäume. Ich aber richte mich auf, schaue über einen ganzen Hang von Rebstöcken hinweg in das Isonzotal und fühle mich wie Gott.“ Da hatte Vossi etwas von Blasphemie gemurmelt, und Jelena zitierte: „Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte bringen mit ihrem Samen darin, und Gott sah, dass es gut war. Genesis 1, 12“.
Er wusste es, er wusste es, er wusste es: Die wie eine Seuche um sich greifende religiöse Rückbesinnung auf mittelalterliche Urstände würde noch dazu führen, dass seine Jelena, dieses herrliche Produkt marxistisch-leninistischer Jugenderziehung, die Bibel zitierte.
„Selbstverständlich“, hatte sie erwidert, „wenn Menschen angesichts des sicheren Todes auf der Titanic ‚Näher, mein Gott, zu dir‘ anstimmen, warum nicht auch ich angesichts so viel Schönheit da draußen in der Natur der Weinberge.“
Vossi wollte bei Gelegenheit darüber nachdenken, was das eine mit dem anderen zu tun hatte, fand aber, dass die von Rom verordnete Zwangspause nicht die nötige geistige Indifferenz für emotionsloses Denken biete. Wichtig war nur: Jelena war glücklich, und überzeugender hätte sie dieses Glücksgefühl nicht zum Ausdruck bringen können. Damit war er natürlich dem Zwang ausgesetzt, gute Miene zum schlechten Spiel zu machen. Was ihm nicht immer leichtfiel, denn manchmal arbeitete jetzt auch sie länger. Dann wartete er auf sie. Allein mit dem notorisch anödenden Fernsehprogramm. „Du kannst doch lesen“, hatte sie einmal vorwurfsvoll gemeint. Doch komisch: Ein Buch genießen konnte er nur, wenn sie im Haus war. „Hier lebt es sich am schönsten zu zweit“, hatte sie gesagt. Jetzt verstand er auch den tieferen Sinn ihrer Worte.
Schön, dass sie jetzt einige Tage Urlaub hatte. Sie waren ihr als Ruhe vor dem Sturm gewährt worden. Vor jenem Sturm, den sie bei der bevorstehenden Weinmesse für die Region entfachen sollte. Die meisten Anreisenden dachten ja, dass der Weinbau hier auf die Römer zurückginge. Es war kein Schaden, sie in diesem Glauben zu lassen. Die Wahrheit aber sah anders aus: Alles Land hier war bis zum Ende der K.-u.-k.-Monarchie als Kirschgarten des Kaisers bekannt. Ab Ende März wären die Hügel weiß gewesen von der Blütenpracht der Kulturen. Es hätte jedes Mal ausgesehen, als wäre der Winter zurückgekehrt. Die Kirschen waren damals die ersten der Saison auf den Märkten Wiens, Budapests, Prags und gar Sankt Petersburgs. Mit dem Ende der Monarchie 1918 gehörte dann alles plötzlich zu Italien. Die Italiener aber hatten ihre eigenen Kirschgärten. Die Bauern von Cormòns mussten sich etwas einfallen lassen. So waren sie auf Wein gekommen.
Optisch passte Vossi ja nicht ganz zu den Weinbergen. Zu viel an ihm löste Assoziationen mit Bier aus. Er glich bis ins Detail der Galionsfigur, die seit Generationen die Flaschen von Birra Moretti zierte. Der Schnauzer und der Hut eines Bauern aus dem Steirisch-Slowenischen, die Lachfalten um die blauen Augen mit dem freundlichen Blick eines Wiener Hofzuckerbäckers, dazu der dunkelgraue Lodenanzug mit Knöpfen aus Hirschgeweih und die Schnürschuhe bis über die Knöchel. In den üblichen Halbschuhen schmerzten Vossi schon nach wenigen Schritten die Knöchel. Sagte er immer. Für Jelena eine Marotte. Wie auch immer: Mit den Schnittmustern der Mailänder Modeschöpfer hatte Commissario Vossi jedenfalls nichts gemein. Vielleicht genoss er gerade deshalb das Vertrauen der Menschen diesseits und jenseits der Trennlinien des Gesetzes.
Kollegen aus artfremden Teilen des italienischen Stiefels taten sich schwer, Vossi einzuordnen. „Wie sein Kaiser, dieser Weihnachtsmann in Uniform“, hatte einer mal resümiert.
Dem Aussehen nach ergab der Vergleich keinen Sinn. Nichts an Vossi erinnerte an Kaiser Franz Joseph und dessen Rauschebart. Deshalb wollte er wissen, wie das gemeint sei. In der Ecke Italiens, in der Bruno Vossi zu Hause war, tat man immer noch gut daran, solche Äußerungen auf die Goldwaage zu legen – vor allem als Staatsbeamter. Sie hätten als Vorwurf mangelnder Treue zur Republik Italien ausgelegt werden können. Und manchmal gebärdete sich Rom wie eine Besatzungsmacht.
Doch der Kollege hatte mit einer plausiblen Erklärung abgewunken: Er hätte Vossis Supranationalität gemeint. „König Emanuel durfte Italiener sein, Kaiser Wilhelm ein Preuße, aber mit dem Habsburger mussten sich alle seine Völker identifizieren können, egal ob Deutsche, Ungarn oder Italiener. Und auch Sie scheinen alles in sich zu verbinden, Commissario Vossi.“
Damit konnte er leben.
Die Vorfahren Vossis waren weiter südöstlich zu Hause gewesen, in der verlorenen Heimat Istrien, das die italienischen Faschisten an Jugoslawien verspielt hatten. Und so waren die Eltern des Commissario unter dem Diktat der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und Marschall Titos als Italienischstämmige dazu gezwungen gewesen, die Heimat zu verlassen. Bruno war da noch nicht geboren. Umso weiter hatten sich die Erinnerungen an das alte Zuhause von der bescheidenen, ja kargen Wirklichkeit entfernt. Dazu hatte auch die unfreundliche Aufnahme durch die italienischen Landsleute beigetragen, als man mittellos hier in Gorizia angekommen war. In Triest, wo der Vater eigentlich hinwollte, waren die Flüchtlingslager hoffnungslos überfüllt gewesen.
Andächtig hatte Bruno seiner Mutter zugehört, wenn sie von den Schönheiten des istrischen Heimatdorfes schwärmte. Und als er es das erste Mal besuchte, stellte er enttäuscht fest, dass es de facto ein Vorort Muggias, des südlichen Vorortes von Triest war, vielleicht fünf Kilometer vom Schlagbaum der italienisch-jugoslawischen Grenze entfernt. Streng genommen noch gar nicht istrischer Boden.
Auf dem Platz, auf dem das Haus der Großeltern und die Nachbarshäuser standen, erhob sich frech ein schmieriger Plattenbau mit einer schmutzigen Kneipe im Erdgeschoß, die nie Besseres als Betontristesse gesehen hatte. Statt Coca-Cola gab es Jugo-Cola nicht bei Agip, sondern bei einer schmutzstarrenden Tankstelle mit der Aufschrift Jugopetrol.
Damals war Bruno zum ersten Mal stolz darauf, ein Italiener zu sein. Glaubte er zumindest. In Wahrheit war er bloß froh, dass er nicht in diesem Kaff aufwachsen musste. Stolz war er auf sein Zuhause, das Land zwischen Triest, Gorizia, Palmanova und Cividale, mit den Alpen im Norden, der Küste im Süden, den Ufern des Isonzo und der Lagune von Grado. Oft blieb er auf der Straße vor den Weinorten dieses Fleckens Heimat stehen, um sich am Anblick der Rebstöcke zu erfreuen. In Reih und Glied verharrten sie auf den Hängen, als ob ihnen der Himmel „Hab acht!“ kommandiert hätte.
Vossi wollte möglichst viel davon seinem Assistenten Roberto vermitteln: „Hier bist du in so viel Europa gleichzeitig!“ Es lag ihm sehr daran, dass der junge Sizilianer dereinst möglichst viel davon mit nach Hause nehmen konnte. Obwohl, Skepsis war angebracht, denn für alles, was nicht sizilianisch war, hatte Roberto nur ein „Outside Africa“ übrig. Sicher war also nur: Wenn es so weit war, dass Roberto Abschied nahm, würde Vossi ihn vermissen. Er mochte den Jungen, diesen noch nicht gereiften Marcello-Mastroianni-Typen. Nichts genoss der Commissario mehr, als von seinem Blick die Prozesse des Begreifens abzulesen. Und wenn er von Begebenheiten erzählte, in denen seine sizilianische Mamma die Hauptrolle spielte.
Vossi griff nach der Repubblica, seiner Meinung nach die einzige Zeitung Italiens, die es verdiente, gelesen zu werden. Er blieb an einem Artikel hängen, den er Jelena nicht vorenthalten wollte. Laut las er in Richtung Rosenrabatte:
Bei einer Versteigerung in London fiel für ein Goldstück von 6,8 Gramm mit der Prägung „Maximilian Emperador“ beim spektakulären Preis von knapp einer Million Euro der Hammer. Zwei Exilmexikaner, in den USA zu Multimillionären geworden, hatten sich gegenseitig überboten, bis bei 920.000 Euro der Hammer fiel. Die Prägung zeigt das Portrait Kaiser Maximilians von Mexiko, den mexikanischen Adler und das Prägejahr 1867. Kaiser Maximilian von Mexiko, jüngerer Bruder von Kaiser Franz Joseph, hat die Prägung ein Jahr vor seiner Hinrichtung in Auftrag gegeben. Das Besondere an dem seltenen Stück ist der Zusatz „In Memoriam“ auf der Kopfseite. Die Fachwelt ging ursprünglich davon aus, dass alle diese Münzen nach der Machtübernahme von Benito Juárez eingeschmolzen wurden und keine erhalten wäre. Das Goldstück, nunmehr gelistet als „Memoriam Maximiliano“, führt die Zahl 100 und keine Währungsangabe.
„Was sagst du dazu?“, wollte Vossi von Jelena wissen.
„Dass deine Repubblica mit dem Piccolo nicht mithalten kann. Der hat die Meldung schon gestern gebracht.“
Il Piccolo war ein Mittelding zwischen Boulevard und Zeitung. Er war schlimm, aber bei Weitem nicht das Schlimmste, was der Medienmarkt zu bieten hatte.
„Tatsächlich?“
„Tatsächlich“, echote es aus den Rosen, und Jelena kam in Bikini, Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen aus den Sträuchern hervor.
„Ist es nicht ein Wahnsinn, wenn jemand für ein Stück mit einem Goldwert von vielleicht dreihundert Euro knapp eine Million hinlegt?“, meinte Vossi mehr als Feststellung denn als Frage.
„Würdest du den Piccolo statt der alten Tante Repubblica lesen, würdest du es verstehen. Die Münze soll im Steinbruch von Jamiano gefunden worden sein und aus dem Schatz stammen, den Maximilian von einem Getreuen in den letzten Stunden seines Lebens nach Triest hinausschmuggeln lassen konnte. Für seine Frau Charlotte. So sorgen sich wahre Gentlemen, wenn es um den Verbleib ihrer Frauen geht.“
„Tu ich ja auch, du bekommst einmal meine Pension.“
„Vorausgesetzt, Italien geht nicht pleite.“
Vossi überhörte die budgetpolitischen Einlassungen seiner Frau. „Und? Hat der Schatz diese Charlotte je erreicht?“
„Nein. Der Überbringer soll ihn in einem der Steinbrüche hier vergraben haben. Leider hatte Commissario Vossi damals dienstfrei. Sonst würden wir mehr wissen.“
„Aber Vossi weiß, was das Geschwätz im Piccolo auslösen wird. Die Leute werden jeden Stein in Jamiano umdrehen.“
„Auch in diesem Punkt hinkst du den Abläufen hinterher: Im Radio wird stündlich darauf hingewiesen, dass alle Zufahrtsstraßen abgesperrt sind und das Betreten des Steinbruchgeländes von Jamiano strengstens verboten ist.“
„Was? Und keiner ruft an?“
„Du hast doch dein Handy im Büro vergessen und wolltest ohnedies deine Ruhe haben. Da habe ich auch meines abgestellt.“
Vossi sagte irgendetwas Unverständliches und stürmte in Richtung Haus. Jelena hörte ihn aufgeregt telefonieren. Minuten später erschien er wieder auf der Terrasse, volladjustiert: „Ich muss los.“
„Das nennst du Zeitausgleich? Worin besteht da der Ausgleich?“
„Ich fahr ja nicht dienstlich hin. Ich will mir das nur ansehen. Privat sozusagen.“
„Und dich hat nicht Capitano Scappo von der Polizia um Hilfe gebeten?“
„Schon. Aber ich helfe ja nicht dienstlich, sondern nur aus Kollegialität. Von Freund zu Freund sozusagen.“
„Ich habe gar nicht gewusst, dass Scappo dein Freund ist.“
„In bestimmten Situationen schon. Bis später, mein Liebes.“
Schon zweihundert Meter vor dem Schlagbaum war an der schmalen Gemeindestraße keine Parklücke mehr frei. Männer und Frauen machten sich seitlich im Gebüsch zu schaffen. Wie Erdmännchen kratzten sie im Boden zwischen größeren und kleineren Steinen und behielten argwöhnisch das Geschehen rechts und links von ihnen im Auge.
Die eigentliche Zufahrt zum Steinbruch war ab dem Schlagbaum gesperrt. Allerlei Volk vom Kinde bis zum Großpapa drängte gegen ein Sonderkommando aus Polizeikadetten. Kinder plärrten, ein Wirrwarr tiefer und schriller Stimmen machte jede Form zivilisierter Kommunikation unmöglich.
„Was geht hier eigentlich vor?“, wollte Vossi von dem Carabiniere wissen.
„Es war in den Frühnachrichten: Hier soll es einen Schatz geben. Inzwischen wird kolportiert, dass schon etwas Gold und ein paar Edelsteine gefunden worden seien. Angeblich der Schatz des Maximilian.“
„Und ist was dran?“
„Ich habe noch kein strahlendes Gesicht weggehen sehen. Aber Sie wissen ja, wie die Leute sind, Commissario.“
Vossi meinte, zumindest eine Ahnung davon zu haben, aber so etwas hätte er nicht erwartet. Nichts ging mehr. Der Commissario wies sich aus und sagte schweißgebadet: „Bahnen Sie mir den Weg.“
Auf der Bank vor seiner Hütte saß der Platzwächter. Vossi kannte den Mann, wusste, dass er beinamputiert war. Jemand musste ihn da abgesetzt haben. Sein Rollstuhl war umgeworfen worden und lag hinter dem Schlagbaum. Mit hasserfülltem Blick sah er hinauf auf die Wand, auf der sich Männer, Frauen und Kinder um die besten Plätze stritten.
Vossi erkannte Capitano Giuseppe Scappo, der mit hochrotem Gesicht in ein Megafon Richtung Wand brüllte: „Das ist Hausfriedensbruch. Kommen Sie herunter und verlassen Sie das Terrain!“ Die meisten in der Wand ließen sich davon nicht stören, einige aber richteten sich auf, drehten sich um und zeigten Scappo den Stinkefinger. Der kommandierte für seine Männer: „Personalien aufnehmen, von allen.“ Dummerweise hatte er den Lautsprecher noch an, sodass der Befehl mit mehrfachem Echo von der Wand zurückkam. Das reichte für ein Gejohle und Pfeifkonzert aus allen Richtungen. Scappo bebte vor Zorn oder Verzweiflung, als er zu Vossi sagte: „Am liebsten würde ich die Armee anfordern und sie runterknallen.“ Zum Glück hatte ihm da sein Adjutant das Megafon schon abgenommen.
„Du brauchst unbedingt Verstärkung. Sollte nur einer hier ein Körnchen Gold finden, gibt es im Kampf darum Mord und Totschlag.“
„Meinst du?“, fragte Scappo, jetzt sichtlich verunsichert.
„Ganz entschieden meine ich das.“
„Aber wir hatten das doch schon öfter, wenn der angebliche Schatz des Maximilian von den Gazetten erwähnt wird“, beschwichtigte Scappo vor allem seine eigenen Bedenken und Ängste.
„So schlimm wie diesmal war es aber noch nie. Das hat mit der Versteigerung in London zu tun. 920.000 Euro sind ja auch kein Pappenstiel.“
Capitano Scappo meinte, er wolle noch abwarten. Und tatsächlich, nach etwa zwei Stunden gaben die ersten Schatzgräber auf und zogen sich zurück in ihr Wochenende. Vossi sah sich noch ein wenig um und scherzte mit einem Nachbarn, der ihn mit „Na Commissario, auch auf der Suche?“ begrüßt hatte. Er beobachtete noch, wie sich eine Menschentraube um einen Wünschelrutengänger scharte und die ersten Stufen hinauf in die Wand nahm. Er eilte ihm nach und überzeugte ihn, besser im Felsengarten unweit des Parkplatzes zu suchen. Der Mann nahm ihn tatsächlich ernst, zog ab, und fast alle trippelten hinter ihm her. Damit waren die Polizeikräfte diesseits der Schranke numerisch überlegen.
„Jetzt aber schnell“, rief Vossi dem leicht überforderten Scappo zu, und ein Kordon der Polizeikadetten riegelte alles hermetisch ab. Dennoch versuchten sich an die hundert Schatzsucher unbeirrt in der Wand als Reinhold Messner.
Scappo kam mit dem Megafon und bat Vossi: „Mach du das, Bruno. Du sprichst ihre Sprache.“ Der Capitano stammte aus der Gegend um Bologna und war des friulanischen Italienisch, also des Furlanischen, nicht mächtig. Italienisch wurde ja nur im Schriftlichen und bei formalen Anlässen verwendet, den Alltag hingegen beherrschten die jeweiligen Dialekte der Regionen.
„Bürgerinnen und Bürger, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie fündig werden, müssen Sie wissen, dass Sie jedes Fundstück von Wert vor Verlassen des Grundstücks bei der Polizia abliefern müssen. Sie dürfen nichts davon behalten. Ich wiederhole: Nichts davon dürfen Sie behalten, alles muss abgeliefert werden!“, eröffnete Vossi den Schatzsuchenden mit Grabesstimme. In der Wand verstummten die Klopfgeräusche und das Kratzen. Fast alle drehten ihre Köpfe in Richtung Megafon und schenkten dem Commissario böse Blicke. „So will es das Gesetz. Zuwiderhandeln wird mit aller Strenge bestraft. Eigentümer etwaiger Fundstücke sind zu gleichen Teilen die Grundstücksbesitzer und die Republik Italien. Es gibt auch keinen Finderlohn, denn Ihre Klettertour hat den Zweck, sich fremden Eigentums zu bemächtigen. Also lassen Sie von dem Unsinn ab. Die Straftat der Besitzstörung haben Sie mit Ihrem unbefugten Betreten des Grundstückes schon begangen. Kehren Sie um und kommen Sie von der Wand herunter. Wenn Sie diesem Aufruf zur Vernunft durch sofortigen Abzug Folge leisten, tun Sie das mit der Zusicherung auf freies Geleit und Straffreiheit.“
„Dann sollen sie ihren Scheiß gefälligst selber suchen! Wir sind doch nicht deren Trottel!“, rief einer von der Wand herunter und begann mit dem Abstieg. Für den Rest der Meute war das das Signal für den Rückzug. Mit hängenden Köpfen machten sie sich aus dem Staub.
Vossi wusste, dass er damit seine Kompetenzen überschritt, und war sich auch nicht sicher, ob das mit der Eigentumsregelung von Fundsachen genau stimmte, aber seine Worte wirkten – und das war entscheidend. Die Gefahr, dass sich jemand schwerwiegend verletzte oder gar zu Tode stürzte, war zu groß, ein gutes Ende des Geschehens vorrangig.
Letztlich war Jelena die Einzige, die etwas zu meckern hatte. Mit süffisantem Lächeln und einer halbleeren Flasche Prosecco in der Hand musterte sie den heimkehrenden Vossi in seiner verstaubten Kluft. „Und? Wo bleibt der Schatz?“
3
Badewetter und das lange Wochenende mit dem Donnerstag als Fronleichnamsfeiertag würden in der Bucht von Sistiana ein Gedränge auslösen. Die Strandbetreuer und Eisverkäufer erhofften tausende Badegäste. Per Auto, Motorrad oder Bus würden sie aus dem nahen Triest, aus Monfalcone und Udine anreisen. Der feine Kies zwischen Schloss Miramare und der Burg von Duino war ja längst kein Geheimtipp mehr. Noch aber hatten die Frühaufsteher das azurblaue Meer vor der senkrecht aufsteigenden Steilküste für sich. Die Kleinen tummelten sich im kühlenden Nass, die Männer blinzelten vom Schatten der Strandbar aus auf die eine oder andere Nixe, die zwischen Taschen, Sonnenhüten und Strandschuhen die ersten Schweißperlen in der prallen Sonne ausdünstete. Gelegentlich strich ein Hauch vom Meer her über die nackte Haut und erleichterte das Stillhalten. In den Steinbrüchen hinter der Steilküste aber war von diesem Hauch nichts zu spüren. Erbarmungslos brannte die Sonne auf die Felswände, auf deren Vorsprüngen die Disteln welkten. Alles Leben schien in sich versunken, wie bei einem Gedenken. Selbst das sonst so hartnäckige Liebeswerben der männlichen Zikaden zersägte nur sporadisch die flimmernde Luft.
Die absolute Nullsumme erträumter Funde hatte die epidemisch um sich greifende Schatzsuche kuriert, Polizeikontrollen fanden nur noch statt, wenn dem Platzmeister hinter der Zufahrtsschranke etwas verdächtig vorkam.
Unter einem Überhang auf halber Höhe der Wand kauerten zwei Männer. Vom Aufstieg erschöpft, lehnten sie kraftlos gegen ihre Rucksäcke auf einer Terrasse über der gleißenden Schlucht, die vor Generationen in den Berg gesprengt worden war. Sie war gerade einmal breit genug, um sich darauf ausstrecken zu können. Ingenieur Carlo Bennuti, der ältere der beiden, hatte den Auftrag, den Rest des Berges nach einer möglichen Marmorsträhne zu durchsuchen. Der Regungslose neben ihm war Dragan Jurić, sein Helfer.
Carlo arbeitete nun schon seit zweiunddreißig Jahren als Montaningenieur und Sprengmeister im Abbau. Acht Jahre noch bis zur Rente. Ob er die noch erleben würde? Immerhin gab sich der Onkologe im Krankenhaus von Monfalcone zuversichtlich. Sie würden den Krebs schon beim Schwanz packen, versuchte er Zuversicht zu verbreiten. Carlo hatte sich inzwischen von der Strapaze des Aufstiegs in der prallen Sonne erholt. Mit einem Seitenblick vergewisserte er sich, dass die Sprengstäbe nur ja im Schatten lagen. Zwar war das neue Sprengmaterial angeblich so gut wie hitzeunempfindlich. Man konnte es sogar in die Taschen stecken und mit sich herumtragen, sich daraufsetzen, ja sogar mit dem Hammer darauf einschlagen, ohne dass es zu einer Explosion kam. Aber Dinge, die buchstäblich Berge versetzen konnten, behandelte Bennuti prinzipiell wie rohe Eier. Und beim Thema Sicherheit ging es ja nicht nur um seine eigene Haut. Er war auch für Dragan verantwortlich. „Alte Schule“ nannten das etliche der jungen Kollegen und machten sich lustig. Sein Helfer aber wusste Carlo als Mentor zu schätzen. Wie ein Vorzugsschüler schien er alles ernst zu nehmen, was sein Vorarbeiter zur Arbeit oder aus seiner Lebenserfahrung von sich gab.
Eigentlich war Dragan Steinmetz und Bildhauer. Ein Künstler also, sogar ein ziemlich begabter. Parklandschaften deutscher und italienischer Anwesen zierten Plastiken, die er als junger Spund im Auftrag Belgrads aus Granit und Marmor herausgeklopft hatte. Für Vorhöfe von Wohnblöcken, Kasernen und Partisanendenkmäler aus der Tito-Ära. Dann unterbrach der jugoslawische Bürgerkrieg jäh sein künstlerisches Werden. Statt Hammer und Meißel musste er eine Kalaschnikow schwingen. Am Höhepunkt der Kampfhandlungen verschwand er dann für Jahre in einem kroatischen Gefängnis. Dragan war nie bereit gewesen, darüber zu reden. Das Wichtigste dazu hatte Carlo erst über Umwege erfahren.
Unter Tito war Dragans Vater Brigadegeneral in Belgrad gewesen. Bei Ausbruch des Bürgerkriegs hatte er – obwohl gebürtiger Kroate – als Armeekommandant auf serbischer Seite gekämpft. Der Sohn war daraufhin von der kroatischen Führung in Zagreb in Sippenhaft genommen und festgesetzt worden und erst mit Ende des Krieges wieder freigekommen. Dies hatte er exzessiv mit reichlich Alkohol gefeiert und war in Triest straffällig geworden. Ein Raufhandel mit schwerer Körperverletzung im Suff. Zwei Jahre hatte er dafür ausgefasst. Sie waren unter Auflage einer Entziehungskur auf bedingt herabgestuft worden. Irgendeine Macht des Schicksals oder Zufall hatte danach Dragan als Carlos Helfer angespült. Alkoholrückfällig war er in all den Jahren nur ein einziges Mal geworden: Er hatte Carlo zum Fünfzigsten eine Plastik schenken wollen, einen Sankt Christophorus, wie sich später herausstellte. Doch das künstlerische Wollen und das verbissene Ziel, seine bisherigen Arbeiten zu krönen, hatten ihn überfordert. Er war aus der Übung oder hatte eine Blockade. Nichts half: kein dem Stein gut Zureden, damit er herausgab, was in ihm steckte, kein Drohen, kein Fluchen. Bis Dragan aus Verzweiflung zur Flasche griff und das beinahe fertige Stück verzweifelt in Stücke schlug. Mit dem Erfolg, dass er wieder süchtig war und die bedingte Haftstrafe als unbedingt absitzen musste.
Auch diese Zusammenhänge hatte Carlo nur durch Zufall erfahren. Aus Dragan war ja wieder nichts herauszubringen gewesen. Besucher im Gefängnis ließ er nicht vor. Und als Carlo für den Einsitzenden in dessen Wohnung nach dem Rechten sehen wollte, entdeckte er im Kellerabteil die Bruchstücke der unfertigen Skulptur. Das Gesicht des Christophorus hatte eindeutig seine, Carlos ureigene Züge. Was für ein beeindruckender Freundschaftsbeweis. Auch wenn der in die Brüche gegangen war.
Nach dem Tod seiner Frau hatte Carlo deutlich empfunden: Es waren die paar Menschen, die einem etwas bedeuteten, die einen am Diesseits klammern ließen wie ein Gecko an einer Senkrechten. Ihretwegen zog man die Mühen des Seins der großen Unbekannten des Nichtseins vor. Welchen Sinn hätte es, hundertfünfzig Jahre alt zu werden, wenn niemand da wäre, um die Erinnerungen an Schule, Jugend, die ersten Jahrzehnte des Lebens teilen zu können? Die Welt wäre eine Öde, das Dasein ein Vegetieren. Was bedeuteten schon Robinson Crusoe die üppige Flora, die Luft, das Meer, die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Freitag bedeutete ihm mehr als das und die ganze Insel. Und Carlo sah ein: Nach dem Tod seiner Frau war Dragan so etwas wie sein Freitag geworden. Unerfahren und ängstlich bewegte er sich in seiner, Carlos Welt.
Natürlich hätte er am liebsten die Bruchstücke der Skulptur an sich genommen. Doch Dragan wäre das sicherlich peinlich gewesen. Schließlich gehörten unvollendete Werke irgendwie zum Privatbereich eines Künstlers. Besonders dann, wenn der sie zerstören wollte. Am besten, Dragan würde nie erfahren, dass Carlo je in seiner Wohnung gewesen war. Ein einziger Jammer, das Ganze.
Beim Gedanken daran zog Carlo an der Wasserflasche. Die Sonne stand jetzt im Zenit, doch man musste. Er erhob sich in einem der Hitze angepassten Tempo. „Dann wollen wir mal. Am besten, wir beginnen gleich hier mit dem Überhang.“
Dragan steckte je einen zigarrendicken Stab Betonit in die Löcher, die sie am frühen Morgen gebohrt hatten. Danach gingen beide in Deckung. Auch wenn das Gebiet abgesperrt und mit Sicherheit menschenleer war, wollte es die Vorschrift, dass Carlo zur Warnung in sein Horn blies. Die Schlucht antwortete mit einem dreifachen Echo. Danach zogen sie sich den Schallschutz über die Ohren und Carlo zündete die Ladung.
Das Echo steigerte den Knall der Explosion in ein akustisches Inferno. Eine Staubwolke nahm den beiden die Sicht, der Atem durch die Schutzmaske schmeckte nach Kalk. Minutenlang war noch das Rieseln der tausend Teile zu hören, in welchen der geborstene Fels in die Schlucht prasselte.
Als sich der Staub endlich gelegt hatte, prüfte Carlo mit seinem Fernglas den Ort des Geschehens. Wo zuvor der Fels überhing, erweiterte sich die Terrasse einige Meter in eine Ausbuchtung. Die Sprengstäbe hatten also ganze Arbeit geleistet. Dragan und Carlo kamen aus ihrer Deckung hervor und näherten sich langsam dem Werk des Betonits. Dabei galt als ungeschriebenes Gesetz, dass der Sprengmeister vorauszugehen hatte. Vorsichtig setzte Carlo einen Fuß vor den anderen.
Nach ein paar Schritten inspizierte er nochmals die herausgesprengte Vertiefung in der Wand mit seinem Fernglas. Schon vorhin hatte er etwas blitzen sehen. Und jetzt wieder. Mit einem Wink bedeutete er Dragan zurückzubleiben. Im Ersten Weltkrieg war die Gegend hier Kampfgebiet gewesen. Vereinzelt wurden auch heute noch Blindgänger und andere hochexplosive Relikte des tausendfachen Tötens gefunden. Doch das, was da blitzte, waren allem Anschein nach harmlose Uniformknöpfe aus Messingblech. Die Offiziere der Österreicher hatten solche an den Uniformen gehabt. Bennuti hob eines der Stücke auf. Für Knöpfe aus Messingblech war das Rund viel zu schwer. Er setzte seine Brille auf. Für einen Knopf fehlte zudem die Öse für den Zwirn. Kein Zweifel: Es handelte sich um eine Münze. Auf der einen Seite sah er deutlich das Konterfei eines Bärtigen. Vermutlich Kaiser Franz Joseph. Carlo las „Maximilian Emperador“. Erstaunt drehte er die Münze um. Ein Wappen füllte fast gänzlich die Rückseite mit der Inschrift „Imperio Mexicano“.
Dragan schaute ihm von hinten neugierig über die Schulter. „Was ist das?“
Der Sprengmeister kratzte mit dem Fingernagel auf der Oberfläche des Fundstückes und schob es sich in Goldgräbermanier zwischen die Zähne. Der Biss tat weh. Seine Zähne waren längst nicht mehr die besten, die Chemotherapie tat ihr Übriges. Spuren auf den Prägeseiten hinterließen sie jedenfalls keine. Dennoch war er sich sicher, dass das, was da um ihn herum vielfach in der Sonne glitzerte, mit Knöpfen von Offiziersuniformen nichts zu tun hatte. Er wandte sich um und sagte gelassen: „Für mich ist das Gold.“
„Kein Scherz?“
„Kein Scherz.“
Dragan fiel wortlos auf seine Knie, blickte verzückt um sich und begann auf allen Vieren, die Münzen einzusammeln. „Der Schatz Maximilians. Wir haben ihn, wir haben ihn“, stammelte er dazu. Fehlte nur noch, dass er es hinunterbrüllte in Richtung Platzmeister und all der anderen. Nachdem Dragan siebzehn Stück in seiner Linken gesammelt hatte, hielt er inne, faltete beide Hände wie eine Köchin beim Formen von Knödeln und schüttelte sie. Das Klimpern quittierte er mit hysterischem Lachen. Er steckte sie in seine Hosentasche und plötzlich wechselte sein Gesichtsausdruck von Entzücken in Entsetzen: „Hoffentlich sind keine in die Schlucht gefallen.“ Dazu beugte der Gehilfe sich auf der schmalen Terrasse derart weit über den Abgrund, dass er glatt abgestürzt wäre, hätte ihn Carlo nicht gehalten. Dragan war nicht wiederzuerkennen. Ungeachtet der Gefahr, abzustürzen, hatte er die Hände nicht geöffnet, um sich festzuhalten. War ihm das Gold wichtiger als sein Leben?
„Setz dich“, kommandierte Carlo barsch. Die Worte zeigten keinerlei Wirkung. „Setz dich und benimm dich wie ein normaler Mensch.“
Dragan quittierte die barsche Aufforderung mit einem feindseligen Blick. Carlo kam aus dem Wundern nicht heraus. Dragan ihm gegenüber feindselig? Er wusste sich nicht anders zu helfen, als ihm eine runterzuhauen. Um den Schlag abzuwehren, öffnete Dragan endlich die Hände, und die Münzen fielen klimpernd zu Boden.
Carlo registrierte, dass es größere und kleinere gab, und fuhr Dragan an: „Was ist denn los? Bist du übergeschnappt?“ Und da Dragan nicht reagierte, sondern gleich wieder wie ein Trüffelschwein nach Münzen suchte, gab ihm Bennuti einen Tritt. „Bist du übergeschnappt!“ Und da all dies nichts half, blies er mit aller Kraft in das Sprenghorn. Egal, was sich die Kollegen da unten denken mochten, hier oben, auf dieser kaum einen Meter breiten Terrasse musste wieder Vernunft einkehren.
Das Horn zeigte Wirkung. Dragan reagierte wie einer von Pawlows Hunden. Er hockte sich hin, Blick auf Carlo.
„Beruhige dich doch, das Gold gehört nicht uns, sondern entweder dem Grundbesitzer, also der Werksgesellschaft, oder der Republik. So genau weiß ich das nicht. Aber uns gehört es nicht, dir nicht und mir nicht“, dozierte der Sprengmeister.
„Aber die Hälfte gehört mir“, beharrte Dragan, als ob er nichts von dem, was Carlo sagte, verstanden hätte.
„Ach, du willst das Gold behalten, ja? Willst du das?“
„Nur meine Hälfte. Die andere Hälfte gehört dir.“
„Wie stellst du dir das vor, Dragan? Nehmen wir an, wir sammeln die Münzen ein und stecken sie in unsere Taschen. Und nach uns kommt der Trupp vom Abbau und findet auch welche. Da kommen wir doch sofort in Verdacht, ebenfalls etwas gefunden und behalten zu haben. Möchtest du, dass wir wie Diebe dastehen?“
Dragan dachte nach. Carlo atmete auf. Immerhin, der Mann dachte nach. Der Gehilfe hatte sogar eine Idee: „Dann musst du dafür sorgen, dass keiner hier abbaut.“
„Und wie soll ich das?“, fragte Carlo, enttäuscht über die negative Wendung der Unterhaltung.
„Ganz einfach: Du erklärst, dass hier nichts zu holen ist. Kein Marmor, Schluss, aus, fertig.“
„Du willst, dass ich das Vertrauen meines Arbeitgebers missbrauche und meine Kompetenz Lügen strafe?“
„Ich will das Gold, alles andere ist mir egal.“
„Ich sag dir, was zu tun ist, Dragan. Sammle erst einmal alle Münzen ein. Lass uns sehen, was da zusammenkommt. Dann reden wir weiter. Aber pass auf, dass du nicht vor lauter Gier in die Schlucht stürzt. Das fehlte noch.“
Bennuti überlegte. Die kleineren Münzen mochten je etwa zweihundertfünfzig Euro wert sein, die größeren rund tausend Euro das Stück. Man müsste also zumindest tausend Münzen finden, um von einem Schatz sprechen zu können. Was Dragan finden konnte, belief sich auf vielleicht zehntausend Euro. Das Ergebnis würde Dragan ernüchtern und zur Vernunft bringen.
Der Sprengmeister sollte sich täuschen. Der Fund brachte eine Seite seines Helfers ans Tageslicht, deren Existenz Carlo niemals vermutet hätte. Bei keiner Gelegenheit noch hatte sich sein Helfer je geldgierig gezeigt, nie gejammert, dass seine Lotterielose immer nur Nieten waren.
Endlich hatte er aufgehört, auf den Knien herumzurutschen. „Es sind siebzehn Münzen. Aber ich bin sicher, es ist eine ganze Menge davon da runtergefallen in die Schlucht.“
Carlo rechnete: „Das sind keine zehntausend Euro. Und deshalb willst du, dass ich zum Betrüger werde?“
„Aber Carlo, eine davon ist in London für neunhundertzwanzigtausend Euro versteigert worden. Wir sind reich.“
„Du irrst, Dragan. Die Münze in London hat diesen Preis erzielt, weil man der Meinung war, dass es nur diese eine gibt. Wenn du jetzt siebzehn Münzen auf den Tisch legst und nicht ausschließen kannst, dass es noch irgendwo auf der Welt oder hier im Tal einige hundert davon gibt, bist du beim Goldwert. Und der liegt bei den kleinen irgendwo zwischen zweihundert und dreihundert Euro und bei den großen bei tausend, tausendzweihundert. Als Montanist kenne ich die Metallpreise.“
„Aber da sind doch sicher noch viel mehr irgendwo zwischen den Steinen. Lass uns doch suchen.“
„Ich habe den Auftrag, nach Marmor zu suchen und nicht nach irgendwelchen Münzen.“
„Ja, aber gib uns doch nur einen oder zwei Tage.“
Carlo dachte nach. Wie konnte ihm sein Gehilfe zumuten, zum Betrüger zu werden? Was hatte er getan, dass Dragan dies annehmen konnte? War er nie von ihm ernst genommen worden, wenn er Gift und Galle spuckte über all die Schieber in Politik und Wirtschaft, die ruchlos das Ansehen seines Italiens in den Dreck zogen, Existenzen vernichteten und, wenn überführt, die Justiz auszutricksen wussten? War er dabei nicht glaubwürdig, überzeugend gewesen? Die Frage, was tun mit Millionen, hatte er gelegentlich am Kiosk mit der freundlichen Alten besprochen, wenn sie ihn zum Kauf eines Loses überreden wollte. „Was sollte ich mit dem Geld? Na ja, eine dieser sündteuren Uhren vielleicht. Aber ich brächte es nicht übers Herz, dafür so viel Geld auszugeben.“
„Aber Sie hätten es ja. Was würden Sie denn sonst damit machen?“, wunderte sich die Alte.
„Eben. Genau das ist ja die Frage.“
Sie hatte über seine Antwort gelacht, aber nicht über ihn. Denn er sah ihr an, dass sie ihn sehr wohl verstand. Wenn er also sie überzeugen konnte, in einem Gespräch von vielleicht einer Minute, warum nicht Dragan in all den Jahren?
Bennuti war schon bewusst, dass er anders reden und handeln würde, wenn er Kinder hätte oder seine Frau noch am Leben wäre. Aber würde er für sie zum Betrüger werden? In Zwangslagen vielleicht. Für Dragan? Vielleicht. Aber Dragan war in keiner Zwangslage. Er wollte nur Geld, reagierte wie ein Kind, das an der Kassa des Supermarkts ein Überraschungsei sieht und losplärrt. Andererseits: Musste Gold immer Unglück bedeuten, könnte es nicht eine positive Wendung in Dragans Leben auslösen? Verdient hätte der es, weiß Gott. Das Schicksal hatte ihn genug gebeutelt.
„Pass auf, Dragan. Meinetwegen kannst du in deiner Freizeit hier weitersuchen. Ich will aber nichts davon hören und sehen, und lass dich nur ja von keinem dabei beobachten.“
„Und die Münzen?“
„Ich will nichts davon wissen.“
„Willst du denn nicht die Hälfte davon haben?“
„Nicht ein Stück. Also kein Wort mehr über Gold und Münzen, verstehst du? Begreife doch: Ich will nichts davon wissen.“
„Okay, okay, du bist der Boss.“
„Und das will ich auch bleiben. Nur eines noch: Komm ja nicht auf die Idee, die Münzen hier irgendwo in Euro umzutauschen. Sie würden dich fragen, woher du sie hast, und würden nicht aufhören, Fragen zu stellen, bis wir beide hinter Schloss und Riegel sind. Hast du das verstanden?“
Dragans „Ja doch“ kam zu schnell, um Carlo beruhigen zu können.
Als sie sich eine Stunde später in der Minenverwaltung abmeldeten, sagte der Bergmeister: „Ihr habt zweimal Sprengalarm gegeben. War was?“
„Ich wollte noch eine Nachsprengung zünden, hatte sich aber erübrigt“, log Bennuti und war sich sofort bewusst, dass er erstmals in dienstlichen Angelegenheiten die Unwahrheit sagte. Er fühlte Ärger in sich hochsteigen.
„Und wie schaut’s aus? Wird der Berg noch etwas hergeben?“
Mit unangebrachter Schärfe bellte er: „Mein Gott, viel zu früh, dazu irgendetwas zu sagen.“
„Ich frage ja nur. Der Vorstand erscheint mir ziemlich ungeduldig. Scheinbar wollen die ihre Ertragsvorschau schönen. Du weißt ja, Shareholder Value.“
„Ich kenn nur eins: meine Arbeit. Und ich weiß, wie ich sie zu tun habe“, entgegnete der sonst allseits freundliche Carlo barsch und ging ab in die Dusche.
„Is ja gut, is ja gut.“
Nach seinem Abgang fragte die Assistentin des Bergmeisters verwundert: „Was ist denn in Carlo gefahren? Verträgt er auf einmal die Hitze in der Wand nicht mehr?“
„Nun ja, alte Hunde knurren gern.“
Die zwei Tage des nun beginnenden Wochenendes waren für Carlo Bennuti die reinste Tortur. Er fürchtete, dass Dragan in die Wand steigen und nach weiteren Münzen schnüffeln würde und ihn jemand dabei beobachten könnte. Er fühlte Unheil nahen, spürte es in jedem Knochen. Oder war es bloß das schlechte Gewissen, weil er den Fund nicht sogleich gemeldet hatte? Oder der Krebs? Jedenfalls würde er gleich Montagmorgen den Goldfund mitteilen.
4
Auch Dragans Wochenende war keines der Erholung und Erbauung. Nach der Arbeit hatte er lange kalt geduscht, um sich einigermaßen zu beruhigen. Dann war er mit seinem Wagen die paar Kilometer nach Monfalcone gefahren. Was mochte eine Münze wohl wert sein? Sicher, Carlo hatte schon recht. Von einem Einzelstück konnte keine Rede mehr sein. Und nur ja nichts tun, was irgendwie auffallen könnte. Der Gehilfe trug seinen Schatz in einem Lederbeutel unter der Schulter. In der Wohnung zurücklassen wollte er ihn keinesfalls. Man las ja dauernd davon, dass die Zahl der Einbrüche ständig stieg. Und weil der Lederbeutel durch das Hemd schien, hatte er seine Jacke aus dem Kofferraum des Wagens geholt und – Hitze her oder hin – übergezogen.
Aufregend war sein Leben plötzlich geworden. Dragan begann fürchterlich zu schwitzen, gleichzeitig schepperten seine Zähne wie im Schüttelfrost. Er brauchte einen Kaffee und ein Glas Wasser. Nachdem er seinen Wagen im Hafenviertel geparkt hatte, ging er in eine Espressobar und bestellte einen doppelten Grappa. Den Schnaps nahm er erst wahr, als er vor ihm stand. Hatte er einen Grappa bestellt? Er wollte doch nur einen Espresso und ein Minerale. Nach dem ersten Grappa bestellte er gleich noch einen.
Wenig später landete Dragan – er hätte selbst nicht sagen können, wie – vor einem der einarmigen Banditen des Spielsalons auf der anderen Straßenseite. Ein-, zweimal hatte er sich hier schon blicken lassen. Er warf dann jeweils Euros ein, solange der Vorrat reichte. Ab und zu gewann er eine größere Summe, um sie danach in vielen kleineren wieder zu verlieren. Den Jackpot hatte er natürlich noch nie geknackt. Er hatte auch nie erlebt, dass einer der anderen Spieler ihn geknackt hätte. Sei’s drum, der Pot stand auf knapp dreißigtausend Euro.
Nach einer Stunde hatte er gerade noch genug Münzen für ein Bier. Dass ein Tropfen genügen würde, um ihn rückfällig werden zu lassen, daran verschwendete er in dem Moment keinen Gedanken. Vielmehr schwang er sich mit gefährlicher Routine auf den Hocker an der Bar und überlegte. Sollte er nicht eine der Goldmünzen wechseln? Wäre es nicht ein schneller Test, festzustellen, was die Münzen wirklich wert waren? In der Erregung über das Wissen um das kleine Vermögen unter seiner Schulter trank er das Bier gierig in einem Zug aus und bestellte gleich noch eins. Danach ging er zur Kassa, nahm ein Goldstück aus dem Lederbeutel und legte es auf das Wechselpult. Dabei fiel ihm ein weiteres aus dem Beutel. Taumelnd bückte er sich danach, legte es auf die Wechseltasse und fragte mit deutlichem Zungenschlag: „Was bekomme ich dafür?“
Der Kassier hinter dem Panzerglas wusste ganz offensichtlich mit Gold umzugehen. Um den einarmigen Banditen weiter füttern zu können, hatten Spieler schon alles Mögliche bis hin zum Ehering umgetauscht. Er strich mit einem kleinen Pinsel eine Flüssigkeit über die Münze, fixierte sie eine Weile, kratzte mit einer Art Nagelfeile darauf herum und legte sie auf die Waage. Danach tippte er Ziffern in seinen Tischrechner. „Hundertsechsundfünfzig Euro.“
„Was? In Triest bekomme ich zweihundertfünfzig“, gab Dragan sich wissend.
„Wir haben unseren festen Kurs. Hundertsechsundfünfzig Euro.“
„Na gut, gib schon her.“
Mit diesen paar Worten war Dragans Schicksal entschieden. Das Geld war im Nu verspielt. Zweimal hätte er beinahe den Jackpot geknackt. Es fehlte nur die fünfte goldene Glocke in den rotumrandeten Feldern. Was blieb ihm also anderes übrig, als wieder zur Kassa zu gehen. Der Kassier schien schon auf ihn gewartet zu haben, wiederholte den Prüfvorgang und zahlte weitere hundertsechsundfünfzig Euro aus, die Dragan nach einer weiteren Viertelstunde verplempert hatte. Er legte ein weiteres Goldstück auf den Tresen und verlangte nach einem weiteren Bier.
Die Blondine an der Bar beäugte das runde Ding geringschätzig und schob es von sich. „Tut mir leid, mein Herr, wir dürfen nur gegen Bargeld ausschenken.“