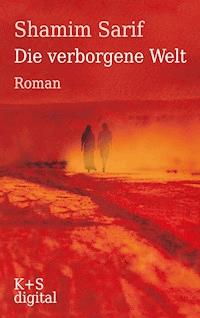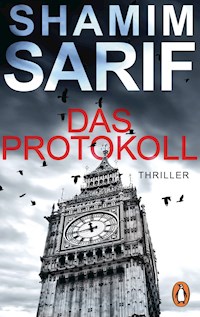
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie ist tough. Sie ist furchtlos. Sie ist verdammt gut in ihrem Job. Doch dann bricht sie die wichtigste Regel …
Wo der Kampf gegen das Verbrechen selbst dem Staat zu brenzlig wird, sorgt Geheimagentin Jessie Archer für Gerechtigkeit. Sie arbeitet für Athena, eine internationale Organisation, deren oberste Regel lautet: Rette Leben, ohne zu töten. Als Jessie dagegen verstößt, ist sie ihren Job los. In dem Wissen, dass ihre Kolleginnen bei ihrem nächsten Auftrag ohne sie keine Chance haben, begibt sie sich auf die gefährlichste Mission ihres Lebens. Ihre Zielperson ist der Anführer eines Menschenhändlerrings, dessen Vertrauen sie sich ohne Rückendeckung erschleicht. Doch noch während sie sich in seinen engsten Kreis einschleust, gerät sie in das Visier ihrer Kolleginnen, die schon längst Jagd auf sie machen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Shamim Sharif wurde 1969 in London geboren. Sie arbeitet als Autorin, Drehbuchautorin und Regisseurin und ist Inhaberin einer britischen sowie einer kanadischen Filmproduktionsgesellschaft. Ihre Filme wurden vielfach ausgezeichnet. Shamim Sharif lebt zusammen mit ihrer Partnerin und ihren zwei Söhnen in London.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
SHAMIM SARIF
DAS PROTOKOLL
THRILLER
Aus dem Englischen von Simone Schroth
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem TitelThe Athena Protocol bei HarperCollins, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Shamim Sarif
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Penguin Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: Shutterstock / ©gyn9037; Lina Mo; SumanBhaumik
Redaktion: Sabine Thiele
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-23607-6V001
www.penguin-verlag.de
Für Hanan, meine ganz persönliche Göttin der Gerechtigkeit und der Weisheit
Und für Ethan und Luca – stille Krieger und geborene Mystiker
1. Kapitel
Manchmal frage ich mich, ob die Welt durch ein Zielfernrohr nicht besser aussehen würde. Klarer, deutlicher, aufs Wesentliche konzentriert. Weniger chaotisch.
In meinem Fadenkreuz schläft ein Soldat, kaum ein junger Mann, nicht viel jünger als ich. Sein Mund ist leicht geöffnet, und mit der Hand bedeckt er die Augen, um das Glitzern des Morgengrauens auszusperren, das sich langsam über den Himmel ausbreitet. Ich kann sogar die einzelnen abgenutzten Fäden am ausgefransten Kragen seiner fleckigen Tarnjacke erkennen. Ich verlagere mein Gewehr nach links, wo ein Stück weiter hinten einige Gebäude hinter ein paar dornigen Bäumen stehen. Dort schläft Ahmed, der Anführer der Miliz. Dann wende ich mich nach rechts, zu dem eingezäunten Areal, in dem die ungefähr fünfzig Mädchen, die sie vor drei Monaten entführt haben, gefangen gehalten werden. Alle schlafen: die Soldaten, ihre Geiseln, der Anführer. Während ich warte, lausche ich den Geräuschen der Frau an meiner Seite.
Hala liegt so dicht neben mir, dass sich unsere Körper fast berühren. Ich spüre, wie sie sich bewegt, und hinter uns hustet Caitlin leise. Sie unterdrückt das Geräusch, obwohl wir viel zu weit oben hinter dem Camp sind, als dass es irgendjemand hören könnte. Ich muss auch husten. Die Luft ist trocken; so trocken, dass jeder Atemzug die Kehle reizt. Der Geruch nach versengter Erde steigt mir wieder in die Nase: der Duft Westafrikas. Einen Augenblick lang denke ich an den dumpfen metallischen Geruch verregneter Straßen in London, zu Hause. Aber die Erinnerung verflüchtigt sich rasch, und ich huste wieder.
»Minimale Verspätung der eintreffenden Trucks«, meldet Caitlin leise. »Drei, vier Minuten.«
Hala und ich lassen die Gewehrläufe sinken, und ich schaue über die Schulter zu Caitlin, während ich mit der Wasserflasche eine tote Kakerlake neben mir wegschlage. Caitlin lauscht einer Meldung über ihren Ohrempfänger.
»Ich habe Hunger«, sagt Hala. Hala isst ständig, oder sie denkt ans Essen.
Caitlin greift in ihren kleinen Rucksack und wirft jeder von uns einen Eiweißriegel zu. Besonders begeistert bin ich nicht, aber sie hat ja wohl kaum frische Croissants dabei, deswegen sage ich nichts und schnappe mir den Riegel. Hala isst ihren schnell auf, ohne jeden Kommentar. Sie braucht Energie. Ich schlucke meinen mit weniger Begeisterung runter. Der kalte süße Block in meinem Mund ist einfach widerlich. Ich rufe mir in Erinnerung, dass in Afrika Millionen von Kindern verhungern und dass ich nicht das Recht habe, mich zu beschweren. Vor allem, weil wir morgen schon zu Hause sein werden.
»Wir sollten uns wieder bereitmachen«, ordnet Caitlin freundlich an. Etwas an ihrem amerikanischen Akzent, den lang gezogenen Silben, wie aus einem Cowboyfilm, verstärkt in mir das Gefühl, Britin zu sein.
Hala und ich folgen dem Befehl, schauen durch unsere Zielfernrohre, nehmen das Milizcamp unter uns wieder ins Visier. Wir haben dieselbe Position eingenommen wie in unserer ersten Nacht hier, als wir nur alles beobachtet und an unserer Strategie gefeilt haben. Himmel, war diese Nacht furchtbar. Als ich endlich schlafen konnte, war ich richtiggehend froh darüber, von etwas anderem zu träumen.
Mit unseren Spezialkontaktlinsen können wir mittels Blinzeln Dinge ran- und wegzoomen, deswegen hatten wir sogar von hier oben die Soldaten perfekt im Blick. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so jung sein würden. Man kennt ja diese Videos von Kindersoldaten in Afrika, aber das hier waren keine Kinder – Männer allerdings auch noch nicht. Wahrscheinlich haben sie sich nur zu gern von Ahmed und seiner Terroristenmiliz rekrutieren lassen. Wenn man in einem Dorf festsitzt und dort den ganzen Tag auf dem Feld arbeitet, um Erde zu bewirtschaften, aus der womöglich nie etwas wächst, gibt einem Ahmed vielleicht etwas, woran man glauben kann, und Gewehre zum Rumspielen noch dazu. Wir beobachteten sie in dieser Nacht, wie sie lachten, einander auf typische Jungenart neckten, sich auf kleine Kämpfe einließen, die wie kochendes Wasser aufsprudelten und sich genauso schnell wieder beruhigten. Die blutigen Nasen, das Schreien und Schubsen – damit käme ich schon klar.
Aber was sie den Mädchen angetan hatten … Diesen fünfzig Mädchen, die sie irgendwo in einem weit entfernten Dorf gefangen genommen hatten, um bei der Regierung Inhaftierte freizupressen … Was sie da taten, konnte sich keine von uns ansehen, und einander konnten wir auch nicht anschauen. Als ich aus Versehen Caitlins Blick begegnete, sah ich die Tränen in ihren Augen, und dass sie so litt, machte mich noch wütender. Ich wollte sofort etwas unternehmen, runtergehen und mit meiner Waffe alles beenden. Ich glaube, ich hatte mich sogar leicht aufgerichtet, denn Caitlin hatte mir eine Hand auf den Arm gelegt und ließ sie auch eine ganze Weile da, damit ich mich beruhigte. Um zwei Uhr morgens hatte das Ganze von selbst geendet. Das menschliche Bedürfnis nach Schlaf war stärker als alles andere. Und im Camp war es still geworden, genau wie jetzt.
Auf dem Bauch auf der harten, von der Hitze festgebackenen Erde zu liegen, ist nicht leicht. Wir halten uns schon seit fast einer Stunde hier auf, weil Caitlin bei allem gern früh dran ist; sie mag es nicht, wenn man unter Stress gerät, weil die Zeit knapp wird. Mir werden langsam die Beine steif. Ich bewege sie ein wenig und wische mir Schweiß von der Nase. Das Sonnenlicht hat das Tintenblau des Himmels unter der unregelmäßigen Linie der Bäume ein Stück weit entfernt heller werden lassen, und die Hitze ist schon wieder erdrückend. Ich bin angespannt, nervös: Wenn dieser Überfall erst einmal losgeht, dürfen wir uns keinen Fehler erlauben. Ich werde unruhig und merke, wie sich Hala mir gereizt zuwendet.
»Was ist?«, frage ich.
Aber Hala konzentriert sich wieder auf ihr eigenes Gewehr, schaut durchs Zielfernrohr. Sie redet nicht viel, und darüber hinaus spricht sie auch nicht gern Englisch. Dabei kann sie es gut – sogar sehr gut, wenn man sich überlegt, dass sie es erst seit ungefähr zwei Jahren richtig lernt. Aber sie bleibt gern für sich, und ich vermute, dass sie auch auf Arabisch nie viel von sich gegeben hat. Normalerweise schätze ich das an ihr, weil man so nicht dauernd Small Talk machen muss, aber jetzt ärgere ich mich über ihre unerschütterliche Ruhe.
»Verdammt, was für eine Hitze«, sage ich, nur um die Spannung ein wenig zu lösen.
Caitlins sanfter Südstaatenakzent wirkt beruhigend, wie Öl auf Wasser.
»Es ist doch nicht heiß. Irak im August, wenn man fünfzig Kilo Kampfausrüstung mit sich herumschleppt. Dann ist es heiß.«
»Du bist hier nicht die Einzige, die ein militärisches Training hinter sich hat«, gebe ich zurück.
»Und mit dem, was du schon geschafft hast, kann ich sowieso nicht mithalten, Jessica«, erwidert Caitlin lächelnd. »Ich war nur bei der Infanterie. Nichts Besonderes.«
Auf die Gefühle anderer einzugehen, ist Caitlins Lieblingsreaktion auf alles. Das müssen sie ihr im Offizierstraining mal beigebracht haben, und es ist hängen geblieben. Ich habe es in einem Führungskurs in England vor ein paar Jahren gelernt, in einer speziellen Trainingsschule, aber damals war ich sechzehn, und normalerweise konfrontierte ich andere lieber direkt, statt mir Sorgen über die Gefühle meines Gegenübers zu machen.
Aber hier sind wir nicht in der Armee oder in einem Regierungsprogramm, und in unserem kleinen Dreierteam gibt Caitlin den Ton an und erteilt die Befehle. Deshalb belasse ich es dabei. Ich bewege mich ein wenig unruhig hin und her, weil sie immer ganz genau weiß, was in mir vorgeht, weil sie mein Bedürfnis kennt anzugeben, aber jetzt erlischt ihr Lächeln. Sie sieht zum Horizont, wo zwei Trucks erscheinen und auf uns zukommen. Im Camp unter uns ist es immer noch ruhig, und man kann die Silhouetten der auf dem Boden ausgestreckt schlafenden Jungen erkennen, die überall herumliegen.
»Sieben Minuten.« Über ihre Kontaktlinse kann Caitlin die Geschwindigkeit der Trucks einschätzen, ihre Entfernung und wie lange sie noch bis zu uns brauchen werden.
»Bereit?«, fragt sie.
Adrenalin pumpt durch meine Adern.
»Ich war noch nie bereiter.«
Ich höre das Prahlen in meiner Stimme und weiß, dass Hala die Augen verdreht, aber ich kann nicht anders. Hala nickt natürlich einfach nur.
»In Position für den ersten Schuss.«
Wir beugen die Köpfe über unsere Zielfernrohre. Hala nimmt die schlafenden Soldaten rechts ins Visier, ich die links. Wir warten auf Caitlins Befehl. Die Zeit scheint sich zu dehnen, und wir liegen völlig reglos, atmen kaum noch.
»Jetzt«, befiehlt Caitlin.
Das erste Abdrücken ist für meine Finger eine Überraschung, als würde ich immer vergessen, wie viel Druck ich genau ausüben muss. Vielleicht liegt es daran, dass er sich wegen der Anpassungen an diese Gewehre ein wenig verändert hat, sie schießen nämlich Betäubungspfeile ab, keine Kugeln. Trotzdem fällt es mir leicht, Ziele zu treffen. Eins, zwei, drei, vier … Ich erwische die arglosen Soldaten in einem stetigen Rhythmus. Diese Gleichmäßigkeit ist wichtig. So beeilt man sich nicht zu sehr, denn dann könnte einer von uns ein Fehler unterlaufen, der uns alle Kopf und Kragen kostet.
Ein Auge habe ich am Zielfernrohr, mit dem anderen zoome ich durch meine Kontaktlinse heran, wie die Soldaten den Stich der Pfeile spüren. Sie erheben sich kurz, bevor sie bewusstlos zusammenbrechen. Einer nach dem anderen wird getroffen. Zwanzig, dreißig … meine Seite ist erledigt. Hala ist noch an ihrer dran. Sie ist langsamer als ich, aber sehr treffsicher. Jetzt herrscht völlige Ruhe. Die Bäume rauschen unter einem kurzen Windstoß, und im Käfig bewegen sich die Mädchen ein wenig, aber im Hauptteil des Lagers regt sich noch nichts.
Hala wirft mir einen fast zufriedenen Blick zu. Wir haben unsere Aufgabe gut erledigt. Aber dann werden wir von Caitlins Stimme unterbrochen.
»Auf zwei Uhr.«
Hala und ich fahren herum. Ein Soldat ist aufgesprungen und rennt auf Ahmeds Hütte zu. Dürre Beine und eine zerrissene Jacke, die ihm um den ausgezehrten Körper flattert. Er stellt sich geschickt an – läuft im Zickzack, um uns das Zielen auf ihn zu erschweren.
Mir jedoch nicht. Noch in der Bewegung fällt der Junge flach aufs Gesicht, Arme und Beine im roten Staub ausgestreckt. Und dann ist wieder alles still.
Caitlin seufzt erleichtert auf und lächelt mich an. Hala schüttelt den Kopf, als könnte sie gar nicht glauben, was für einen Schuss ich da gerade hingelegt habe.
»Los«, sagt Caitlin. »Die Trucks sind gleich hier.«
Ich höre das entfernte, dumpfe Brummen ihrer Motoren, als sie sich von Westen nähern, ganz genau nach Zeitplan. Diese Trucks sind die einzige Unterstützung, die uns die Regierung dieses Landes zubilligt, und das, nachdem wir die Drecksarbeit erledigt haben. Ich stehe auf, verstaue mein Gewehr, nehme unsere Waffen und folge den anderen runter ins Camp.
Wir gehen vorsichtig zwischen den Soldaten hindurch. Ihre Münder sind schlaff im erzwungenen Schlaf, sie liegen wehrlos da. Hala kontrolliert mit der Waffe im Anschlag, dass keiner von ihnen unseren Pfeilen entkommen ist. Dann wendet sie sich dem Käfig zu, in dem die Mädchen stehen und uns schweigend und mit offenen Mündern anstarren. Wir alle tragen maßgeschneiderte sandfarbene Kampfausrüstung, mit Holstern, Waffen und Stiefeln. Um die Köpfe haben wir Tücher gewunden, die wir uns über die Gesichter gezogen haben. Nur unsere Augen sind zu erkennen. Smartphones gibt es überall, sogar hier draußen, und wir dürfen nicht riskieren, dass uns irgendjemand identifiziert.
Während Hala die Käfigtür gewaltsam öffnet, um die Mädchen zu befreien, rennen Caitlin und ich weiter, auf Ahmeds Hütte zu. Aber die Mädchen zögern. Hala will sie davon überzeugen, dass sie ihnen helfen möchte.
»Versuch’s mal mit Lächeln«, murmele ich, und ich weiß, dass sie mich über ihren Knopf im Ohr gehört hat, denn sie wirft mir einen wütenden Blick zu. Lächeln ist nicht gerade eine ihrer leichtesten Übungen, aber sie versucht es, und es funktioniert. Jetzt kommen die Mädchen langsam und vorsichtig aus dem Käfig, bewegen sich auf die sich nähernden Rettungstrucks zu.
Die beiden Soldaten, die Ahmeds Hütte bewacht haben, sind ausgeschaltet, schlafen durch unsere Betäubungspfeile, und mit ein bisschen Glück liegt Ahmed da drinnen und schnarcht, dann können wir ihn auch unter Drogen setzen. Jede von uns hat ein Betäubungsgewehr in der Hand sowie eine Handfeuerwaffe, nur für den Fall. Unser Befehl lautet, Ahmed lebendig gefangen zu nehmen und den Regierungsstreitkräften zu übergeben, die dann auch das Lob für seine Ergreifung einheimsen werden. Diesen Preis haben wir ausgehandelt, damit man die entführten Mädchen in Sicherheit bringt.
Aber als wir uns gerade darauf vorbereiten, Ahmed zu überfallen, hupt einer der Trucks mehrmals, während er sich dem Camp nähert. Gestresst sehe ich in die Richtung. Die entkommenen Mädchen sind auf den Truck zugerannt und dabei fast unter die Räder geraten – der Fahrer hat also wahrscheinlich instinktiv die Hupe betätigt, doch die bloße Lautstärke seiner Warnung ist für unsere Mission eine Katastrophe. Ahmed muss den Lärm gehört haben.
Caitlin nickt nervös, und wir nähern uns rasch der Hütte – jede Sekunde des Zögerns gibt Ahmed Zeit, die Situation zum Nachteil für uns zu verändern.
Die Tür ist nicht verschlossen, und Caitlin öffnet sie, sodass ich die Hütte betreten kann, die Handfeuerwaffe vor mir. Ich spüre, wie Caitlin direkt hinter mir hereinkommt und mir Deckung gibt. Sie behält die andere Seite des Raumes im Auge. Ich stehe mit der Waffe im Anschlag da und komme mir wie eine Idiotin vor. Wie lange haben wir alles geplant, wie gründlich – stundenlang haben wir auf dem Bauch gelegen, damit wir sicher sein konnten, dass uns niemand kommen sieht, aber damit haben wir nicht gerechnet: dass Ahmed vielleicht Mädchen bei sich festhält. Genau die Mädchen, zu deren Rettung man uns hergeschickt hat.
Zwei sind es, und sie können nicht älter sein als fünfzehn Jahre. Wenn Ahmed noch geschlafen hätte, wäre das sogar egal gewesen. Aber der ganze Lärm von draußen hat ihn eindeutig aufgeweckt. Und diese zusätzlichen drei Sekunden haben uns den Überraschungseffekt verdorben. Wir sind einfach nicht schnell genug, um die Mädchen aus dem Weg bekommen, bevor Ahmed sie vor sich zieht und sie als nützliche menschliche Schutzschilde gebraucht. Jetzt ist meine Pistole auf die Mädchen gerichtet statt auf ihn, und gleichzeitig berührt Ahmeds eigene Pistole von hinten ihre Köpfe.
»Behalt ihn im Visier«, murmelt Caitlin.
Wir richten weiter unsere Waffen auf ihn. Gleichstand. Aber ich spüre, dass er glaubt, in der besseren Position zu sein, mehr Kontrolle zu haben, jetzt, wo er etwas zum Verhandeln in der Hand hat. Unter dem wild wuchernden Bart sieht er attraktiv aus. Irgendwie habe ich damit nicht gerechnet, als müsste das Böse seiner Taten sich in seinem Gesicht widerspiegeln. Seine Stirn ist schweißüberströmt, und er erwidert aus seinen eng zusammenstehenden Augen meinen Blick. Die Mädchen schwitzen auch, ein Film überzieht die Verletzungen auf ihren Gesichtern, und eines von ihnen fängt an zu weinen.
»Ruhe!«, befiehlt Ahmed. Aber sie ist außer sich vor Angst, fast hysterisch. Das andere Mädchen flüstert ihr zu, sie soll still sein, aber sie schluchzt weiter. Das macht Ahmed nervös. Er stößt sie von sich, und erleichtert rennt das Mädchen in eine Zimmerecke, wo es weiterweint.
»Gib sie uns«, sagt Caitlin, die wenigstens eine der beiden hier rausbekommen will.
Doch Ahmeds Pistole bewegt sich von der einen Geisel weg zu der anderen hin. Bevor ich mich rühren kann, ertönt ein Schuss, das Echo prallt von den Wänden ab wie Donner. Erschrocken zucke ich zusammen. Das Mädchen in der Ecke fällt hin. Ich starre auf die Wand hinter ihr, sehe die Blutspritzer. Einen Augenblick lang ist es völlig still. Dann gibt Caitlin ein ersticktes Geräusch von sich, und in mir steigt ein blutiges Rot auf, so tiefrot, dass ich sonst nichts mehr erkennen kann.
Caitlins Stimme holt mich gerade so in die Wirklichkeit zurück. Ihr Arm berührt meinen, während sie mit Ahmed spricht, und das fühlt sich richtig an – Caitlins Arm und ihre Stimme –, als gäbe es in diesem grausamen Zimmer doch noch etwas Gutes.
»Immer langsam. Wir sind nicht gekommen, um dich zu töten«, sagt Caitlin.
Mein Blick wird von dem toten Mädchen auf dem Boden angezogen. Die andere Geisel keucht vor Angst. Sie hat die Augen fest zusammengekniffen und schüttelt unter Ahmeds Pistole den Kopf. Ahmed sieht aus dem Fenster, wo noch weitere Trucks mit Regierungssoldaten eintreffen.
Über uns höre ich plötzlich ein schwaches Knacken, und plötzlich erklingt Halas Stimme in meinem und in Caitlins Ohr.
»Ich bin auf dem Dach«, sagt sie.
Ich kann wieder atmen. Ein kleines bisschen Hoffnung. Sie muss den Schuss und unseren Austausch mit Ahmed gehört und das getan haben, was sie am besten kann: klettern. Das Dach ist nur schlecht gedeckt, die Mauer darunter braun und glatt. Dass da jemand raufkäme, scheint ganz unmöglich, aber Hala hat es geschafft. Zu Hause hat man sie il bisseh genannt, »die Katze«. Das war eines der ersten Dinge, die sie mir erzählt hat, als sie zum ersten Mal mit mir sprach, in diesem deprimierenden Zimmer in dem Untersuchungszentrum für Flüchtlinge.
Hala bekommt sicher kaum ein freies Schussfeld auf Ahmed, aber gleichzeitig weiß ich, dass wir durch eine Kugel von ihr am besten aus dieser Sache rauskommen. Ich will nicht in ihr Schussfeld geraten, deswegen trete ich unauffällig zwei Schritte zurück und habe dabei den Blick weiter auf ihn und das Mädchen gerichtet. Wenn es wirklich einen Gott gibt, bezweifle ich stark, dass er die Existenz von so jemandem wie Ahmed zulassen würde. Deswegen bete ich jetzt darum, dass Hala das Ganze in Ordnung bringt.
»Sorg dafür, dass er auf dich zukommt«, flüstert mir Halas angespannte Stimme ins Ohr.
Ich beobachte Ahmed, sehe, wie es ihm förmlich in den Fingern juckt, den Abzug zu betätigen. Das Mädchen wimmert leise. Mit der linken Hand hole ich eine kleine Granate aus der Tasche. Ahmed ist misstrauisch, er hat Augen wie ein Luchs. Er sieht, dass ich etwas in der Hand halte.
»Das Ding ist scharf«, sage ich und werfe es ihm mit wenig Schwung zu. Instinktiv lässt er das Mädchen los und bewegt sich nach vorn, um die Granate aufzufangen. Dann sieht er, dass sie noch nicht entsichert ist – und im selben Moment wird ihm die Pistole aus der Hand geschossen. Halas Kugel reißt ihm auch gleich einen oder zwei Finger ab, und er schreit auf, hoch und so schrill, dass mir der Kopf davon dröhnt, und irgendwie fühle ich mich dadurch besser. Ich schnappe mir das Mädchen, gleichzeitig schlägt Caitlin Ahmed mit dem Pistolenlauf zu Boden, holt sich die Granate und legt Ahmed an Händen und Füßen Handschellen an.
Jetzt nehme ich auch wieder Geräusche wahr. Manchmal geht mir das so, wenn ich mich sehr stark konzentriere: Einer meiner Sinne fällt völlig aus, der andere stellt sich übermäßig scharf. Aber jetzt wird der Raum geradezu überflutet: mit dem Geräusch sich drehender Rotorblätter, das von unserem eigenen Hubschrauber stammen muss, der uns abholen soll, und dem Dieseltuckern weiterer Trucks, die draußen eintreffen. Ahmed hört es auch, denn er dreht den Kopf zum einzigen Fenster hin. Durch die Scheibe sehe ich, wie Regierungssoldaten aus den Lastwagen springen und die betäubten Soldaten in den Käfig zerren, in dem vorher die Geiseln festgehalten wurden.
Unter meinen Händen zittern die dünnen Schultern des Mädchens. In ihrem Blick erkenne ich Angst und Misstrauen. Ich schaue ihr kurz in die Augen und lege ihr den Arm um die Schultern, versuche ihr klarzumachen, dass sie in Sicherheit ist. Sanft führe ich sie in Richtung der Tür und übergebe sie Hala, die vom Dach heruntergeklettert ist. Hala sieht die Leiche des anderen Mädchens und zuckt zusammen. Sie wirft mir einen gequälten Blick zu. Ich verstehe sie. Noch ein verschwendetes Leben. Noch ein Bild, das uns verfolgen wird. Ich lege Hala eine Hand auf die Schulter. Sie akzeptiert die Berührung, wendet sich dann ab.
Während Hala das zweite Mädchen nach draußen bringt, ziehe ich ein fleckiges Laken vom Bett und bedecke sanft den Leichnam der anderen Geisel. Das Gesicht ist völlig zerstört, und mir wird übel. Aber ich werde mich nicht übergeben – das käme mir respektlos vor –, deswegen schaue ich weg und atme ein paarmal tief ein und aus. Dann knie ich mich neben sie, berühre ihre Stirn.
Sie ist noch warm, immer noch real, und ich suche am Hals nach einem Puls, obwohl ich weiß, dass da keiner ist. Die Augen sind in eingefrorener Angst weit aufgerissen, und ich lasse die Finger über die Lider gleiten, um sie zu schließen. Blut, ihr Blut, klebt jetzt an meinen Fingern. Ich betrachte die roten Spuren auf meiner Hand und wische sie mir behutsam an der Kleidung ab.
Währenddessen spricht Caitlin mit Ahmed.
»Man wird dich festnehmen und dir einen fairen Prozess zugestehen.«
Ahmed unterbricht sie mit einem verächtlichen Grunzen.
»Sie mussten also Frauen schicken, um mich zu kriegen.« Er zieht eine spöttische Grimasse. »In einem Jahr bin ich wieder da. Und dann übernehme ich die Gegend hier, Schritt für Schritt.«
Seine Worte verursachen mir Schmerzen, aber keine körperlichen – so fühlt es sich an, wenn einem das Herz schwer wird. Wenn man weiß, dass jemand recht hat, es aber nicht glauben will. Zum ersten Mal seit unserer Ankunft kann ich die Dinge deutlich einschätzen. Weil uns diese entführten Kinder am Herzen liegen, sind wir einer Regierung zu Hilfe gekommen, die zu schwach ist, um selbst mit terroristischen Splittergruppen fertigzuwerden, in einem zu sehr entzweiten Land. Auf lange Sicht können sie einen Mann wie Ahmed nicht bekämpfen: Er ist hartnäckig, rücksichtslos, arrogant. Und vielleicht können wir es auch nicht. Jedenfalls nicht, solange wir uns an Regeln halten, die Verbrecher wie er ganz einfach ignorieren.
Dieses tiefe Rot steigt wieder hinter meinen Augen auf, und gleichzeitig spüre ich einen scharfen Schmerz im Kopf. Es fühlt sich an, als würde mir der Schädel platzen.
Langsam stehe ich auf, wende mich von dem toten Mädchen ab und ziehe die Pistole aus dem Holster. Ich richte sie auf Ahmed. Ganz langsam, jede Bewegung ist voller Bedacht und zielgerichtet, wird von etwas angetrieben, das sich ein Stück außerhalb von mir selbst befindet. Caitlin starrt mich an und schüttelt kaum merklich den Kopf.
»So lautet unsere Order nicht.«
Aber die Geräusche um mich herum werden undeutlich, unzusammenhängend. In Ahmeds Blick liegt Spott, und ich nehme nur noch das weiße Rauschen pulsierenden Blutes in meinen Ohren wahr. Ich sehe Ahmed an – in Handschellen, wehrlos – und zögere abzudrücken. Und dieses Zögern lässt ihn lächeln, weil er sich sicher fühlt. Ein arrogantes Lächeln ist es, das leuchtend weiße Zähne entblößt. Dann denke ich nur noch daran, wie einfach es ist, meinen Zeigefinger um den Abzug zu krümmen, wie weich sich der Rückstoß der Pistole anfühlt und wie rasch Ahmed in sich zusammensinkt, wie ihm das Kinn auf die Brust fällt.
Plötzlich schreit Caitlin auf, Hala steht in der Tür, nimmt das Chaos mit einem Blick in sich auf, und man reißt mir die Pistole aus der Hand. Dann werde ich gegen die Wand gestoßen.
»Entwaffnen«, kommandiert Caitlin.
Ich wehre mich nicht, kann nicht denken, gehorche einfach nur. Ich hebe beide Hände neben meinen Kopf und stütze mich an der Wand ab, während Hala meine Beine mit ihrem Stiefel weiter auseinanderschiebt. Methodisch lässt sie die Hände über meine Hüften, meinen Rücken und meine Beine gleiten. Sie atmet rasch und abgehackt. Ein Teil von ihr kann nicht glauben, was ich da gerade getan habe. Ich werfe einen Blick über die Schulter auf Ahmed. Es war ein sauberer Schuss, natürlich war es das, genau in seine Stirn. Ich starre ihn an. Er hat gelebt, und jetzt ist er tot. Wie einfach es war, ein Leben auszulöschen – wie schnell es ging. So etwas habe ich noch nie vorher getan, und ohne jede Vorwarnung wird mir übel. Die Galle steigt mir in der Kehle hoch, aber ich würge kurz und schlucke sie runter. Dann hole ich tief Atem, drehe mich wieder zur Wand und straffe die Schultern. Er hat diese Mädchen vergewaltigt, und ich habe gerade mit angesehen, wie er eines von ihnen umgebracht hat. Warum sollte es mir also etwas ausmachen? Und trotzdem tut es das, irgendwie.
»Vollständig entwaffnet«, meldet Hala und zeigt Caitlin einige Waffen. Meine Waffen.
Halas Blick begegnet meinem, und ich lese Missbilligung darin. Ich ziehe ein winziges Taschenmesser aus dem Stiefelfutter und reiche es ihr, um zu zeigen, dass ihr etwas entgangen ist. Dieser unbedeutende wortlose Austausch mit ihr hilft mir, für einige Sekunden an etwas anderes zu denken. Aber dann wird das winzige Stück Folie in meinem Gehörgang lebendig, und eine körperlose Stimme wendet sich Tausende von Meilen entfernt in strengem Ton an mich:
»Was ist da gerade passiert?«
Ich beiße mir so fest auf die Unterlippe, dass ich Blut schmecke. Caitlin berührt die Kamera am Revers ihrer Uniform.
»Peggy, das lässt sich nicht so einfach erklären …«
»Wir sehen, was durch unsere Kameras reinkommt«, unterbricht sie Peggy, und ich habe das Echo im Ohr. »Wir können erkennen, dass er tot ist. Warum?«
Caitlin zögert. Sie will nicht diejenige sein, die das Offensichtliche in Worte fasst. Die mich damit in die Scheiße reitet.
»Ich habe ihn erledigt, Peggy«, sage ich, damit Caitlin die Entscheidung erspart bleibt.
»Hat er eine Bedrohung dargestellt?«, fragt eine andere Stimme, die ich als Kits erkenne. Obwohl sie meine Mutter ist – oder vielleicht genau darum –, verspüre ich sofort das Bedürfnis, sie zu ärgern.
»Genau, eine Bedrohung für die Menschheit.«
Die Stimmen in London verstummen, und ich weiß, dass ich jetzt richtigen Ärger bekommen werde.
»Macht sauber«, ertönt Peggys Befehl direkt in unseren Ohren, und Caitlin nickt Hala zu, die ihren Rucksack absetzt und eine Packung weißer Gelblöcke herausholt, die aussehen wie Geschirrspülertabs. Schnell, aber ohne offensichtliche Eile verteilt Hala sie im Raum, überall in den Ecken und unter Ahmeds Körper. Dann nimmt sie eine Tube aus dem Rucksack und verbindet die Tabletten mit Linien aus Gel.
»Sei vorsichtig«, sagt Caitlin zu ihr.
Dann verpasst sie mir einen leichten Schlag gegen die Schulter, und ich setze mich rasch in Bewegung. Draußen wartet unser Helikopter, ohne Kennzeichnung, mit sich drehenden Rotorblättern, der Metallrumpf hebt sich klein und schwarz von der roten, hitzetrockenen Erde ab. Caitlin folgt mir nach draußen, und im Laufschritt eilen wir auf die geöffnete Tür des Helis zu. Wir klettern hinein und warten angespannt auf Hala. Da ist sie, und sie rennt so schnell, dass sie im gleißenden Sonnenlicht zu verschwimmen scheint.
»Los, los, los!«, ruft Caitlin dem Piloten zu.
Als sie uns erreicht, ignoriert Hala die Hand, die ich ihr hinstrecke, und nimmt stattdessen Caitlins; die zieht sie in den Helikopter, der sofort sanft aufsteigt. Unter uns geht Ahmeds Hütte in lodernden, reinigenden Flammen auf.
2. Kapitel
Aus dem Hubschrauber steigen wir auf einem kleinen Flughafen irgendwo am Rand der Hauptstadt in ein Privatflugzeug um. Trotz der langen Heimreise bekomme ich nicht viel Schlaf. Ich fühle mich ganz dumpf vor Erschöpfung, aber jedes Mal, wenn ich einnicke, träume ich von Ahmed, deswegen beschließe ich nach einer Weile, lieber wach zu bleiben. Hala ist sofort eingeschlafen, Caitlin dagegen unruhig, zumindest bis sie ein paar Pillen schluckt. Ich spüre ihren Blick auf mir, aber ich halte die Augen meistens geschlossen. Ich tue so, als würde ich schlafen, damit sie nicht das Gefühl hat, sie müsste mit mir über Ahmeds Tötung reden und mein Verhalten kaputtanalysieren. Trotzdem drückt sie umständlich ein paar Pillen aus der Tablettenpackung im Rucksack und verschwindet schließlich auf die Toilette, um sie einzunehmen. Während ihrer Zeit im Irak hat sie viel gesehen, nicht nur die üblichen Kriegsgräuel, sondern auch, wie US-Soldaten irakische Gefangene misshandelt haben. Sie hat versucht, ihre Vorgesetzten zu alarmieren, aber man hat ihr mit unehrenhafter Entlassung gedroht, deswegen hat sie nachgegeben. Ich denke, dass sie darum Pillen schluckt. Nicht weil sie nicht aushält, was passiert ist, sondern weil es ihr zu schaffen macht, dass sie nichts daran ändern konnte. Außerdem waren ihre ersten Lebensjahre in Kentucky wie ein schlechter Countrysong. Wenn sie Hilfe braucht, um mit alldem fertigzuwerden, ist das eben so. Aber sie will es nicht zugeben. Es ist komisch, wenn Leute vor sich selbst so tun müssen, als hätten sie alles unter Kontrolle. In dieser Beziehung erinnert mich Caitlin an die Leiterinnen von Athena. Sie ist älter als Hala und ich – Ende zwanzig –, und manchmal wirkt sie mehr wie eine von ihnen als wie eine von uns.
Jetzt muss ich an sie denken, an die Frauen, die unsere Vorgesetzten sind, die Frauen, die Athena gegründet haben. Die uns rekrutiert, unser Training organisiert haben und die uns dafür bezahlen, Befehle auszuführen. Nirgendwo sonst gibt es eine bessere Gruppe von Überfliegern, und ich bin ziemlich sicher, dass einige von ihnen schon in ähnlichen Situationen waren wie wir gerade, obwohl sie nie darüber sprechen und man auch in ihren Lebensläufen oder in ihren Wikipedia-Einträgen nichts darüber findet. Alle sind sie erfolgreich, ehrgeizig und auf ihre eigene Art diszipliniert (sogar Kit). Sie haben es nicht dorthin geschafft, wo sie jetzt sind, weil sie Ungehorsam zulassen, und ich weiß, dass ich ganz großen Ärger bekommen werde, wenn wir landen.
Deswegen schleiche ich mich um zwei Uhr morgens ins Haus, und zwar noch geräuschloser als sonst. Ich will auf keinen Fall, dass Kit mich hört. Meistens stört es mich nicht, mit meiner Mutter zusammenzuleben, aber in solchen Augenblicken wünschte ich, ich hätte eine eigene Wohnung. Das Haus ist groß genug – eine dieser alten, weißen Stuckvillen in Notting Hill. Kit hat sie vor fünfzehn Jahren gekauft, als sie noch eine ziemlich bekannte Sängerin war, und wahrscheinlich ist das die beste Investition, die sie jemals getätigt hat. Ich benutze nicht die Haustür, weil die immer quietscht und man sie nicht schließen kann, ohne dass das ganze Haus in seinen Grundfesten erzittert. Stattdessen klettere ich über die Regenrinne und einen Ast in mein Zimmer. Wenn man eine dünne Messerklinge unter den Rahmen schiebt, lässt sich das Fenster aufhebeln. Ich werfe meinen Rucksack auf den Holzfußboden und gleite in den Raum.
Es riecht wie zu Hause. Wie Möbelpolitur und dieses teure Zitronenraumspray, das Kit mag, und wie Nudelsoße oder irgendwas mit Tomaten. Mir knurrt vor Hunger der Magen, aber wenn ich jetzt nach unten gehe, hört das meine Mutter vielleicht, und dann wird sie mich wegen Ahmeds Tod in die Mangel nehmen. Eine Dusche will ich aber riskieren, weil ich den Geruch nach Staub und Schweiß nicht länger ertrage. Und gerade rechtzeitig liege ich im Bett. Etwa fünf Minuten nachdem ich mich im Dunkeln hingelegt habe, öffnet sich die Zimmertür. Zum Glück habe ich mich auf die Seite gedreht, mit dem Blick zur Wand. Ich lasse die Augen geschlossen und atme leise und gleichmäßig. Kit steht eine Ewigkeit neben mir, und ich frage mich, ob sie jemals so lange an meinem Bett gestanden hat, als ich jünger war. Ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht hätte ich es auch sowieso verschlafen. Aber Kit war während meiner Kindheit auch nicht oft zu Hause. Ihre Karriere hatte Vorrang, und deswegen musste sie viel reisen.
Endlich schließt sich die Tür. Den Schlaf vorzutäuschen, hat mich benommen gemacht. Innerhalb weniger Minuten schlafe ich ein und wache am nächsten Morgen um sieben Uhr auf. Erleichtert stelle ich fest, dass ich gar nichts geträumt habe.
Ich drehe mich auf den Rücken und schaue an die Decke, wo sich ein Streifen Sonnenlicht auf der weißen Farbe ausbreitet. In der Magengrube verspüre ich Anspannung, weil heute Morgen ein Meeting im Hauptquartier von Athena ansteht, und ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass man mich zur Rechenschaft ziehen wird. Oder was auch immer man mit Leuten macht, die für eine private Organisation arbeiten, von deren Existenz niemand sonst weiß. Ich überlege, wo sie jetzt wohl alle sind. Hala und Caitlin wahrscheinlich jeweils in ihrer Wohnung. Sie ziehen sich an, trinken Kaffee. Oder Pfefferminztee, was Hala angeht. Li, zusammen mit Kit und Peggy eine der drei Gründerinnen, meditiert zweifelsohne gerade in ihrem tadellosen weißen Wohnzimmer, oder sie spricht über eine Telefonschaltung mit ihrer Technologiefirma in Shanghai.
Ich höre Schritte auf dem Flur. Kit klopft leise und steckt den Kopf zur Tür herein.
»Ich habe dich gar nicht kommen hören«, sagt sie.
»Ich wollte dich nicht wecken.«
Dass sie bei mir war, erwähnt Kit nicht. Jetzt kommt sie rein, und ich setze mich halb im Bett auf. Sie ist schon fertig angezogen, in engen schwarzen Jeans und Cowboystiefeln, und in einer Hand hält sie eine Tasse grünen Tee. Kit hat immer etwas Glamouröses an sich, und ihr Arbeiterklasseakzent ändert daran nichts. Bei ihr sieht alles ganz einfach aus, und sie bewegt sich immer anmutig. Auch wenn sie nicht berühmt wäre oder man noch nie von ihr gehört hätte, würde man sich immer noch nach ihr umdrehen, wenn sie ein Zimmer betritt. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob man das lernt, wenn man ein Star wird, oder ob man überhaupt nur deswegen einer wird. Sie setzt sich auf die Bettkante und mustert mich gründlich. Schaut sie mich an, ihre Tochter, und sieht eine Killerin vor sich? Ich senke den Blick und schlucke. Das bringt sie zum Sprechen.
»Ich weiß, du wirst wahrscheinlich reden wollen«, fängt sie an.
Ja, alles klar.
»Aber ich glaube, es ist besser zu warten, bis ich Peggy und Li getroffen habe.«
Ich nicke.
»Ich mache mir einen Kaffee«, redet Kit weiter. »Kommst du runter?«
Ich schüttele den Kopf und fühle mich elend dabei. Sollen wir uns in die Küche setzen und Small Talk über das Wetter halten, während ich warte, wie das Athena-Beil auf mich herabfällt? Darauf kann ich verzichten.
»Na ja, unten ist Brot. Und du solltest ein Ei essen. Wegen des Proteins.«
Ich begreife noch immer nicht richtig, wie sich Kit plötzlich in die Mutter des Jahres verwandeln konnte, wobei das erst angefangen hat, als ich Teil des Programms wurde, also mit fünfzehn. Und so ist das weitergegangen, seit sie mich zurückgeholt hat, damit ich Athena beitrete. Sie will ständig, dass ich Eier esse, kein Gemüse liegen lasse und warme Kleidung trage. Wo hat sie denn gesteckt, als ich sechs war und diese Fürsorge gebraucht hätte?
Obwohl ich kein einziges Wort gesagt habe, scheint sie meinen trotzigen Widerwillen zu spüren. Sie steht auf und verlässt das Zimmer, und sobald die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen ist, nehme ich die Fernbedienung und schalte die Nachrichten ein. Ich lasse mich ins Kissen zurücksinken und schaue mir das Ende eines Berichts über eine Schießerei in Los Angeles an. Im nächsten Beitrag sieht man einen Reporter vor dem Parlament, der uns alle über die neuesten Entwicklungen zu einer langweiligen Gesetzesänderung informiert. Mir fallen die Augen zu; der typische Sprachfluss, den wohl alle Nachrichtensprecher draufhaben, lullt mich ein. Und dann höre ich das Wort »Kamerun«. Aus diesem afrikanischen Land sind wir gerade zurückgekehrt. Ich springe auf und stelle die Lautstärke hoch. Der Sprecher wendet sich an Jake Graham, der seinen Bericht vor dem Hochkommissariat von Kamerun in London abgibt. Jake Graham kennt jeder. Schlank und ein bisschen nachlässig gekleidet, mit Haaren, die immer aussehen, als könnten sie schon länger einen ordentlichen Schnitt vertragen. Ein guter Journalist, einer von den ernsthaften, ein richtiger erfahrener Held da draußen in den Schützengräben. Ich bin nicht gerade begeistert, dass man ausgerechnet ihm diese Story zugeteilt hat.
»Das Martyrium der jungen Frauen, die vor drei Monaten von einer religiösen Miliz entführt wurden, ist vorbei«, erklärt Jake jetzt live. »Die gewagte Rettungsoperation endete mit der Tötung des Anführers Ahmed Dawud.«
Mit trockenem Mund schaue ich zu, wie Jake in die Kamera und in die Sonne blinzelt.
»Die Vereinigten Staaten und führende europäische Regierungen haben erklärt, nicht in die Operation involviert gewesen zu sein, die sauber und wie von einer unabhängigen Spezialeinheit durchgeführt wirkt. Deswegen bleibt die Frage offen: Was ist hier geschehen?«
Vom Bildschirm sieht mir Jake direkt in die Augen.
Ich bin angespannt. Das habe ich nicht erwartet – und ich kann mir vorstellen, dass Li, die immer sofort merkt, wenn etwas auf irgendeinem Nachrichtensender läuft, gerade ausflippt, vor allem über diesen »Spezialeinheit«-Kommentar. Ich hoffe nur, dass bald Gras über alles wächst. Niemand hier hat jemals von den Entführungen in Kamerun gehört, und bis heute Morgen hatte man diese gefangenen Mädchen völlig vergessen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze die Leute morgen noch interessiert.
Verstimmt gehe ich ins Badezimmer, um mich fertig zu machen. Aber ich vermeide es, mich im Spiegel anzusehen. Ich kann es einfach nicht. Es ist, als wäre ich nicht mehr diejenige, die ich gestern war. Vor Ahmed. Das ist eines der aufschlussreichen psychologischen Details, die die Athena-Therapeutin geradezu lieben würde. Vielleicht hebe ich es für sie auf und verschaffe ihr damit einen richtig guten Tag, denn diese Sitzungen finde ich meistens unerträglich langweilig. Schnell ziehe ich mich an. Bei Tageslicht, nicht mehr im Chaos der Mission, fühle ich mich schuldig, weil ich ohne Bedrohung ein Leben beendet habe. Aber dann rufe ich mir ins Gedächtnis, um wessen Leben es sich handelt. Ahmed hat diese Mädchen entführt und missbraucht, also hat er es doch verdient? Der Gedanke ist nicht so beruhigend, wie ich das gern hätte. Ich schnappe mir meinen Rucksack und ziehe los.
Die U-Bahn ist überfüllt. Kaum zu glauben, dass ich erst gestern früh Meilen um Meilen von menschenleerer Landschaft um mich hatte. Ich bewege mich vor Unruhe ein bisschen, drehe den Kopf von dem Geruch nach Shampoo mit Morgenschweiß weg, der in der U-Bahn im Sommer immer vorherrscht. Meine Station liegt genau am Rand der City of London – dem Stadtteil, in dem die meisten Finanzkonzerne und einige der großen Technologiefirmen untergebracht sind.
Ich arbeite mich in der Flut der Pendler nach draußen vor und halte mich auf der endlos langen Rolltreppe links, steige immer zwei Stufen gleichzeitig hoch und lasse die Unterwelt aus überfüllten Tunneln und warmen, stickigen Windstößen hinter mir. Ich ziehe meine Oystercard über das Lesegerät, verlasse die Station und atme innerhalb weniger Sekunden die Morgenluft. Eine Brise vom Fluss bringt den schwachen Geruch von Auspuffgasen mit sich. Auf dem Fußweg ins Büro schaue ich auf das graue Wasser, das in der mir fremd erscheinenden Sonne glänzt, außerdem sehe ich die Brücken und die Gebäude, die leuchtend über mir aufragen. Nicht in einer Million Jahre hätte ich mir vorstellen können, jemals dort ein Büro aufzusuchen. Diese Gebäude, die Leute, die zur Arbeit rennen – das Ganze kam mir immer so karrieremäßig vor. Aber jetzt bin ich hier, auch wenn ich nicht gerade einen typischen Achtstundenjob habe.
Ich gehe an meinem Arbeitsplatz vorbei und halte mich auf der anderen Straßenseite. Es handelt sich um einen schlanken, hoch in den Himmel aufragenden Turm mit CHENTECHNOLOGIES in fast zwei Meter großen Chrombuchstaben darauf. CT ist eine richtige Firma – oder besser gesagt eine Firmengruppe – und führend in der Welt der Technologie. Gegründet hat sie Li, und inzwischen breitet sie sich global aus. Wie sich herausgestellt hat, ist sie auch die perfekte legitime Firma, um unsere viel kleinere, weniger dem Gesetz entsprechende Organisation zu verstecken. Als ich durch die riesigen Eingangstüren des Gebäudes gehe, erscheint Li persönlich in einem schwarzen Tesla. Der ist cool genug, dass der vorüberfahrende Verkehr sich ein wenig verlangsamt, weil die Leute schauen wollen. Ihr Fahrer stoppt genau vor dem Eingang, und die Türen klappen auf. Li hält nichts davon, die Minuten zwischen ihrer Ankunft am Gebäude und der an ihrem Schreibtisch zu verschwenden, deswegen steht ihr Assistent Thomas immer schon da, wenn der Wagen bremst, und informiert sie über ihren Terminkalender. Thomas ist aber auch einer der wenigen Menschen, denen sie genug vertraut, dass er über Athena Bescheid weiß. Währenddessen gehen normale CT-Angestellte an ihr vorbei ins Gebäude, wie ein breiter Strom aus ausgeblichenen Jeans, Rucksäcken und Pappkaffeebechern. Als wäre sie Moses, öffnet sich der Strom vor Li, damit sie in ihrem Maßanzug und ihren Designerschuhen vorbeikann. Ich marschiere weiter, am Bürogebäude vorbei, gehe dann über die Straße, wende mich nach links in eine kleine Gasse und dann wieder nach links in eine noch kleinere, die sich zur Gebäuderückseite schlängelt.
Wir witzeln immer, dass das der Lieferanteneingang ist. Li kann das Gebäude durch die große Tür betreten, denn es trägt ihren Namen auf der Fassade und ist der Arbeitsplatz für achthundert ihrer Angestellten. Kit und Peggy werden durch die Tiefgarage hierhergebracht; sie haben einen privaten Eingang und einen gesicherten Aufzug, der sie direkt in die Athena-Etage bringt. Aber der Rest von uns betritt das Gebäude so wie ich. Eine ruhige kleine Gasse, die zu einer einfachen Garagentür aus Metall führt. Man öffnet sie über ein verstecktes Fingerabdruckpanel ziemlich weit unten am Boden, wo es niemand vermuten würde. Als ich meinen Zeigefinger darauf platziere, bewegt sich die Tür keinen Millimeter, und einen Augenblick lang halte ich inne. Werde ich für das, was ich getan habe, ausgesperrt? Ich wische mir die verschwitzte Hand an der Jeans ab. Dann versuche ich es noch einmal – und die Tür öffnet sich.
Dahinter ist eine Garage mit einer weiteren Tür an der hinteren Wand, die nirgendwo hinführt, sowie eine Tür auf der rechten Seite, die wir benutzen. Ich tippe mit einer ganz normal aussehenden Kreditkarte auf eine unmarkierte Metallplatte und stehe in unserem Aufzug. Hier gibt es keine Knöpfe, nur einen Bildschirm. Ich trete davor und warte, bis der Irisscanner anspringt. Das Licht des Lasers gleitet über mein Auge und bestätigt, dass es sich um meins handelt. Dann erscheint auf dem Display eine Auswahl an einfachen Optionen; keine davon würde für jemand anderen einen Sinn ergeben – da steht nur Option Eins (so kommt man ins Athena-Stockwerk, wo die Einsatzzentrale ist und wo Kit, Li und Peggy ihre Büros haben) und Option Zwei, wo die Tech-Höhle untergebracht ist. Ich weiß nicht mehr, warum wir sie die Tech-Höhle nennen, denn sie liegt nicht unter der Erde. Vielleicht weil ihre Leiterin Amber sie auch bewacht wie eine Bärin ihre Höhle. Von dort aus hat man eine fantastische Aussicht über die City, aber die Fenster funktionieren nur in eine Richtung: Wir können rausschauen, aber von draußen sieht die Fassade aus wie Spiegelglas. Dort hält Amber all unsere Waffen, Ausweispapiere, Ersatzkleidungsstücke und unsere Ausrüstung hinter Schloss und Riegel, und irgendwo auf diesem Stockwerk wird auch ihre geliebte neue Technologie getestet.
Ich benutze mein Auge wie eine Maus – bewege den Cursor zur Option Eins und zwinkere zweimal für die Auswahl.
Anscheinend ist dieser Security-Level nicht korrumpierbar. Endlich bewegt sich der Lift. Dabei rutscht mir förmlich der Magen in die Kniekehlen.
Mit Ahmeds Tötung habe ich den geheimen Status von Athena gefährdet, und mir ist bewusst, dass wir ohne diese Geheimhaltung nicht weiter existieren können. Für die Außenwelt existiert Athena nicht. Wir sind kein geheimes Spezialteam des britischen Geheimdienstes oder ein Experiment der CIA. Peggy, Kit und Li haben etwas geschaffen, das keinen Weisungen von außen unterliegt. Der Vorteil ist, dass sie sich vor niemandem zu rechtfertigen haben und sich keinem offiziellen Regelwerk unterwerfen müssen, das Dinge verlangsamt oder blockiert. Der Nachteil ist offensichtlich: Wenn irgendjemand herausfindet, was wir da treiben, landen wir alle im Gefängnis. Deswegen weiß ich, dass ich richtig Scheiße gebaut habe.
Komischerweise ist das Gefühl, Peggy zu enttäuschen, das Schlimmste von allen. Vielleicht, weil sie noch das meiste Verständnis hätte. Sie gehört zu diesen freundlichen, wirklich anständigen Menschen, die einen niemals verurteilen, ohne einen vorher angehört zu haben. Peggy ist Amerikanerin. Von der Ostküste, einer richtig guten Elite-Uni, und sie ist clever wie ein Fuchs. Ich bezweifle, dass vor dreißig Jahren viele andere afroamerikanische Frauen in Harvard Jura studierten, aber sie gibt nie damit an. Sie sieht immer wie aus dem Ei gepellt aus und wirkt, als würde sie ihr halbes Leben bei Opern- oder Ballettaufführungen verbringen und die andere Hälfte bei schicken Wohltätigkeitsmittagessen. Einige Jahre war sie US-Botschafterin in London – und irgendwann war sie auch mal bei der CIA. Irgendwie scheint sie in jedem Land Kontakte zu haben. Sie hat Li kennengelernt, als sie beide Sonderbotschafterinnen der Vereinten Nationen waren.
Li ist während der Kulturrevolution in China aufgewachsen. Sie spricht nie darüber, aber als Kind hat man sie ihrer Familie weggenommen und gezwungen, für die Regierung zu arbeiten. Genau da wird die Geschichte interessant: Gerüchte besagen, dass sie ein hohes Tier beim chinesischen Geheimdienst war. Alles andere ist der Stoff für Legenden. Wie alle hier weiß ich, wie man online obskure Details ausgraben kann, aber über Li findet man abgesehen von nichtssagenden Reportagen in den schicken Magazinen kaum etwas.
Und was Kit betrifft – na ja, was tun Musikstars, wenn sie irgendwann keine Platten mehr verkaufen und in Panik geraten, weil sie älter werden? Meine Mutter jedenfalls hat sich für Frauenrechte eingesetzt. Fairerweise muss man sagen, dass Kit seit ihrer Jugend Aktivistin und Feministin war; das hat sie mir immer in allen Einzelheiten erzählt, wenn ich sie auf eine Kundgebung begleitet oder die hundertste Petition unterschrieben habe. Sie hielt mir ständig Vorträge darüber, wie es war, Teil einer verlorenen Generation auf sich selbst fixierter Kinder zu sein, die sich kein bisschen dafür interessierten, dass die Welt vor die Hunde geht. Meistens ließ sie sich darüber aus, wenn sie spätabends eine halbe Flasche Wodka getrunken hatte, was das Ganze etwas weniger beeindruckend machte. Dann reiste sie ein Jahr durch Osteuropa, Afrika und Indien; für die Vereinten Nationen ließ sie sich mit Frauen und Kindern fotografieren, die in Armut lebten oder sich daraus befreiten. Das brachte sowohl Kit als auch den Vereinten Nationen viel gute Presse ein.
Bis zu dem Vorfall in Pakistan. Niemand konnte das kommen sehen, und es veränderte alle drei. Das war der Beginn von Athena, etwas so Einzigartigem, so Außergewöhnlichem, dass ich keinen Moment zögerte, mich vom Programm abzuwenden und Teil von Athena zu werden. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde irgendwann einmal für meine Mutter arbeiten, hätte ich diesen Menschen laut ausgelacht. Aber so ist es gekommen.
Thomas wartet schon auf mich, als sich die Lifttür öffnet. Er weiß, dass ich kommen werde, weil eine App auf seinem Smartphone einen Klingelton, ein Bellen oder sonst was von sich gibt, wenn irgendjemand von uns per Fingerabdruck die Tür unten in der Gasse aktiviert. Wir gehen nach links, zum Besprechungsraum und zu den Büros der Gründerinnen. Die befinden sich hinter einer weiteren gesicherten Tür. Rechts führt ein Flur zur Einsatzzentrale, einem großen Raum voller Bildschirme, und zwar solche transparente, fließende, die immer wirken, als würde man sie irgendwohin projizieren. Zu verschiedenen Zeiten zeigen sie Gesichter, Wärmebilder, Untersuchungsergebnisse, Analysemuster. Oder jede Menge langweiligen Onlinekram. Caitlin, Hala und ich erledigen selbst ziemlich viel von den Hintergrundrecherchen für die Missionen, die Athena in Erwägung zieht. Von uns abgesehen gibt es nur ein paar Analytiker, und denen bin ich noch nie begegnet. Ich nehme an, es handelt sich um eine kleine Kerngruppe von Angestellten, denen Li vertrauen zu können glaubt – vielleicht auch welche, die aus irgendeinem Grund von ihr abhängig sind. Wer kann das schon wissen? Li achtet sehr darauf, die Leute in einer Abteilung zu behalten. Wenn man in der Technologieentwicklung arbeitet, dann auch nur da. Und wenn ich irgendetwas von dort brauche, gibt es nur eine Person, mit der ich Kontakt habe – Amber. Deswegen gehe ich davon aus, dass niemand von uns wirklich weiß, wie weit Athena ihr Netz aufspannt.
»Du bist spät dran«, meint Thomas. »Hast du verschlafen?«
Er geht neben mir her. Genau genommen ein kleines Stück vor mir, sodass ich das Gefühl bekomme, dass er mich mit Absicht eskortiert.
»Ich verschlafe nie«, gebe ich zurück.
»Also kommst du ausgerechnet heute mit Absicht zu spät?«
Ausgerechnet heute, wo ich Ärger habe, meint er.
Thomas ist etwa dreißig und arbeitet als eine Art Überassistent für Li, seit er mit der Uni fertig ist. Er teilt ihre Besessenheit in Bezug auf das perfekte Erscheinungsbild. An wild wuchernde Augenbrauen oder gelockerte Krawatten würde er nicht einmal denken, und niemand würde es wagen, ihn mit »Tom« anzusprechen. Ständig schaut er auf seine Smartwatch. Die scheint einen unablässigen Kurznachrichtenstrom von Li wiederzugeben – außer, nehme ich an, wenn sie gerade meditiert oder Yoga macht. Sie schwört auf beides und will uns alle dazu überreden.